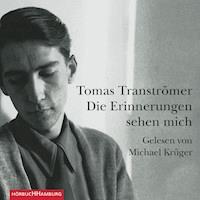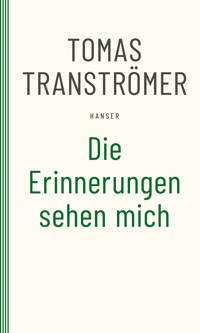
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Was macht einen Menschen aus? Ist es die Familie, die Schule, die erste Lektüre, die frühen Reisen? Tomas Tranströmer, der schwedische Dichter, versucht in diesem Buch, sich dem Kern zu nähern, seiner Existenz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 49
Ähnliche
Über das Buch
Was macht einen Menschen aus? Ist es die Familie, die Schule, die erste Lektüre, die frühen Reisen? Tomas Tranströmer, der schwedische Dichter, versucht in diesem Buch, sich dem Kern zu nähern, seiner Existenz.
Edition Akzente Herausgegeben von Michael Krüger
Tomas Tranströmer
Die Erinnerungen sehen mich
Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel
Carl Hanser Verlag
Erinnerungen
»Mein Leben«. Wenn ich diese Worte denke, sehe ich einen Lichtstreifen vor mir. Bei näherer Betrachtung hat der Lichtstreifen die Form eines Kometen, mit Kopf und Schweif. Das lichtstärkste Ende, der Kopf, sind die Kindheit und das Heranwachsen. Der Kern, sein dichtester Teil, ist die sehr frühe Kindheit, wo die wichtigsten Züge in unserem Leben festgelegt werden. Ich versuche, mich zu erinnern, versuche, dahin vorzudringen. Aber es ist schwer, sich in diesen verdichteten Bezirken zu bewegen, es ist gefährlich, ein Gefühl, als käme ich dem Tode nahe. Weiter hinten verdünnt sich der Komet — das ist der längere Teil, der Schweif. Er wird immer spärlicher, aber auch breiter. Ich bin jetzt weit im Kometenschweif drinnen, ich bin sechzig Jahre alt, da ich dies schreibe.
Die frühesten Erlebnisse sind größtenteils unerreichbar. Nacherzählungen, Erinnerungen an Erinnerungen, Rekonstruktionen auf der Grundlage plötzlich auflodernder Stimmungen.
Meine früheste datierbare Erinnerung ist ein Gefühl. Ein Gefühl von Stolz. Ich bin gerade drei Jahre alt geworden, und man hat mir gesagt, es sei sehr bedeutsam, daß ich jetzt groß geworden sei. Ich liege zu Bett in einem hellen Zimmer und klettere dann auf den Fußboden hinunter, mir unerhört dessen bewußt, daß ich dabei bin, erwachsen zu werden. Ich habe eine Puppe, der habe ich den schönsten Namen gegeben, den ich mir ausdenken konnte: KARIN SPINNA. Ich behandle sie nicht mütterlich. Eher ist sie ein Kumpan oder ein Schwarm.
Wir wohnen in Stockholm, im Stadtteil Söder; die Anschrift lautet: Swedenborgsgatan 33 (heute Grindsgatan). Papa ist noch bei der Familie, wird sie aber bald verlassen. Der Umgangston ist recht »modern« — von Anfang an sage ich zu meinen Eltern du. Die Großeltern mütterlicherseits sind in der Nähe: sie wohnen um die Ecke, in der Blekingegata.
Großvater, Carl Helmer Westerberg, wurde 1860 geboren. Er war Lotse und mein sehr enger Freund, 71 Jahre älter als ich. Seltsamerweise hatte er dasselbe Altersverhältnis zu seinem eigenen Großvater mütterlicherseits, der somit 1789 geboren war: die Bastille wurde erstürmt, der Anjala-Aufstand, Mozart schrieb das Klarinettenquintett. Zwei gleich große Schritte nach hinten, zwei lange Schritte, dennoch so lang nicht. Man kann die Geschichte anfassen.
Großvater sprach die Sprache des 19. Jahrhunderts. Viele Wendungen würden sich heute auffallend altertümlich ausnehmen. In seinem Munde und für mich klangen sie ganz natürlich. Er war ein ziemlich untersetzter Mann, mit weißem Schnurrbart und einer kräftigen, leicht gebogenen Nase — »wie bei einem Türken«, sagte er selber. An Temperament fehlte es ihm nicht, und er konnte aufbrausen. Ein solcher Ausbruch wurde nie richtig ernst genommen und ging sogleich vorüber. An ausdauernder Aggressivität fehlte es ihm gänzlich. In Wirklichkeit war er so versöhnlich, daß er Gefahr lief, als lasch zu gelten. Auch mit nicht anwesenden Personen, die in einem gewöhnlichen Gespräch angeschwärzt wurden, wollte er sich gutstellen. »Aber Papa muß doch wohl zugeben, daß X ein Schuft ist!« — »Hör mal, davon weiß ich nichts.«
Nach der Scheidung zogen Mama und ich in die Folkungagata 57; das war ein Haus für die untere Mittelklasse. Dort wohnte eine bunte Ansammlung von Menschen dicht beieinander. Die Erinnerungen an das Haus gliedern sich ungefähr wie in einem Film aus den dreißiger oder den vierziger Jahren, mit einer Personengalerie, die da hineinpassen würde. Die liebenswerte Portiersfrau, der wortkarge starke Portier, den ich unter anderem deshalb bewunderte, weil er generatorengasvergiftet war — das deutete auf eine heldenhafte Nähe zu gefährlichen Maschinen.
Ein spärlicher Verkehr von Unbefugten lief ab. Es kam vor, daß Trunkenbolde sich im Treppenhaus erholten.
Ein paarmal in der Woche klingelten Bettler an der Tür. Sie standen murmelnd im Flur. Mama strich Butterbrote für sie — sie gab Brotscheiben statt Geld.
Wir wohnten im fünften Stock. Ganz oben also. Außer der Bodentür gab es vier Türen. Auf einer davon stand der Name Örke, ein Pressefotograf. Irgendwie war es ein tolles Gefühl, neben einem Pressefotografen zu wohnen.
Unser nächster Nachbar, derjenige, den man durch die Wand hören konnte, war ein Junggeselle höheren mittleren Alters mit bleichgelber Hautfarbe. Er übte seinen Beruf zu Hause aus, machte irgendwelche Maklergeschäfte über Telefon. Während der Telefongespräche gab er oft mitreißende Lachsalven von sich, die durch die Wand zu uns drangen. Ein anderes ständig wiederkehrendes Geräusch war das Knallen von Korken. Die Bierflaschen hatten damals keine Kapselverschlüsse. Diese dionysischen Geräusche, die Lachsalven und das Korkenknallen, wollten nicht zu dem bleichen Gesellen passen, den ich bisweilen im Aufzug traf. Mit den Jahren wurde er mißtrauisch, und die Lacher wurden seltener.
Einmal kam es zu Gewalttätigkeiten. Ich war noch klein. Ein Nachbar war von seiner Frau ausgeschlossen worden, er war betrunken und tobte, und sie hatte sich verbarrikadiert. Er versuchte, die Tür einzuschlagen, und stieß Drohungen aus. Erinnern kann ich mich, daß er folgenden sonderbaren Satz schrie:
»Es ist mir scheißegal, ob ich auf den Kungsholm komme!«
»Was meint er mit dem Kungsholm?« fragte ich Mama. Sie erklärte, auf dem Kungsholm liege die Polizeiwache. Der Stadtteil bekam etwas Heimtückisches. (Das wurde noch verstärkt, als ich das Sankt-Eriks-Krankenhaus besuchte und die Kriegsversehrten aus Finnland sah, die dort im Winter 1939/40 gepflegt wurden.)
Frühmorgens ging Mama zur Arbeit. Sie fuhr nicht, sondern ging. Während ihres ganzen Erwachsenenlebens lief sie zwischen den Stadtteilen Söder und Östermalm zu Fuß hin und her — sie arbeitete an der Hedvig-Eleonora-Volksschule und betreute Jahr für Jahr die dritte und die vierte Klasse. Sie war eine ergebene Lehrerin und Kindern sehr zugetan. Man hätte glauben sollen, daß es schwer für sie würde, sich pensionieren zu lassen. Aber so kam es durchaus nicht, sie empfand große Erleichterung.