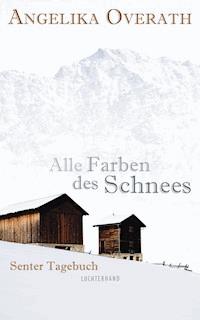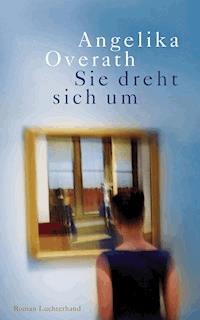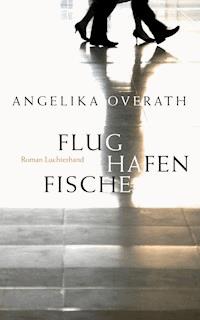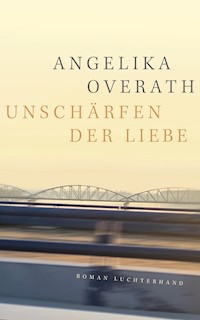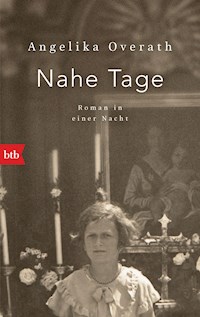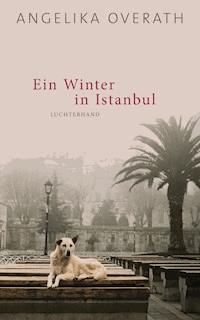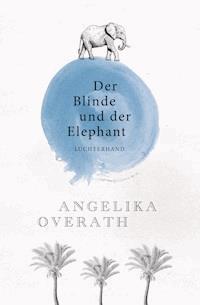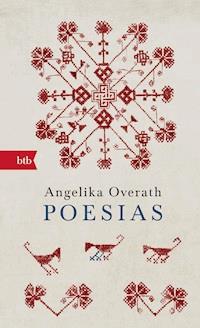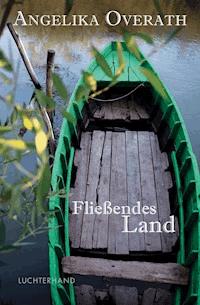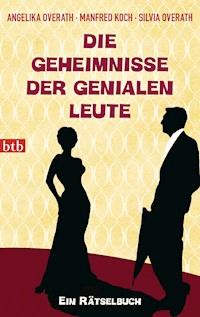
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Stimmt es, dass Schriftsteller Menschen sind, die ihre Mütter nicht mögen? Müssen begnadete Komponisten in ihrer Jungend schlechte Musikschüler gewesen sein und sich später in Rebellen ihres Fachs verwandelt haben, damit sie gut komponieren können? Und wie kommt eigentlich eine junge Frau auf die Idee, Salben mit wohlriechenden Essenzen herzustellen und unermüdlich Kunden für ihre Cremes und Badezusätze zu suchen und auch zu finden? Diesen und vielen anderen Fragen geht Angelika Overath in ihren Texten über große Maler, Musiker, Philosophen, Erfinder und Schriftsteller nach. Mit Leidenschaft entwirft sie knappe und spannend zu lesende biographische Skizzen und führt uns nahe an diese berühmten Frauen und Männer heran. Sie schreibt Rätsel über menschliche Abgründe berühmter Menschen. Die Lektüre dieser Miniaturen ist ein Vergnügen, ihre Auflösung verblüffend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Ähnliche
Stimmt es, daß Schriftsteller Menschen sind, die ihre Mütter nicht mögen? Müssen begnadete Komponisten schlechte Musikschüler gewesen sein und sich in Rebellen ihres Fachs verwandelt haben, damit sie gut komponieren können? Und wie kommt eigentlich eine junge Frau auf die Idee, Salben mit wohlriechenden Essenzen herzustellen und unermüdlich Kunden für ihre Cremes und Badezusätze zu suchen und auch zu finden? Diesen und vielen anderen Fragen gehen Angelika Overath, Manfred Koch und Silvia Overath in ihren Texten über große Maler, Musiker, Philosophen, Erfinder und Schriftsteller nach. Mit Leidenschaft entwerfen sie knappe und spannend zu lesende biographische Skizzen und führen uns nahe an berühmte Frauen und Män-ner heran. Entstanden sind unerwartete Rätsel über menschliche Abgründe. Die Lektüre dieser Miniaturen ist ein Vergnügen, ihre Auflösung verblüffend.
ANGELIKA OVERATH, geboren 1957, arbeitet als Reporterin, Kritikerin (NZZ) und Dozentin. Sie hat Reportagen und Essays und zwei Romane veröffentlicht.
MANFRED KOCH, geboren 1955, lehrt Literaturwissenschaft an der Universität Basel und ist freier Mitarbeiter im Feuilleton der NZZ. Zuletzt erschienen: »Faulheit. Eine schwierige Disziplin« (2012)
SILVIA OVERATH, geboren 1986, studiert an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Ein Roman ist in Vorbereitung.
Von den Herausgebern liegt bei Luchterhand vor: »Tafelrunde. Schriftsteller kochen für ihre Freunde« (2012)
Angelika Overath, Manfred Koch, Silvia Overath
Die Geheimnisse der genialen Leute
Ein Rätselbuch
Für Manfred Papst, ohne den es diese Rätsel nicht gäbe
Vorwort
Alles begann damit, daß Manfred Koch beim gemeinsamen Familienmittagessen über Salat und Nudeln immer wieder kuriose Details aus dem Leben von Schriftstellern erzählte. Da war die Rede etwa von Goethe, der seinen Enkelkindern regelmäßig Rheinwein zu trinken gab, weil die Kleinen dann so putzig wurden. Oder von Rilke, der klagte, er könne in Paris schwer schreiben, da gäbe es keine Wiesen. Er aber müsse zur Inspiration morgens im Frühtau mit nackten Füßen über Gras gehen.
Die Familie kaute und freute sich.
Es war die Zeit, da bei der Neuen Zürcher Zeitung eine Sonntagszeitung geplant wurde. Als Angelika Overath dem Leiter des Ressorts Kultur, Manfred Papst, von den Trouvaillen ihres Mannes erzählte, reagierte er sofort. Die Idee einer Rätsel-Kolumne, die anhand von Obsessionen, Ängsten, Süchten, Idiosynkrasien oder einfach nur Ticks nach dem Leben genialer Künstler fragte, überzeugte ihn.
Wir kennen unsere toten Helden nur in den Aureolen ihres Erfolgs. Sie strahlen als Heilige der ersten Ideen, als Erneuerer, Klassiker. Wir kennen ihre Kunst. Doch wie war ihr Alltag? Was hat sie dazu gebracht, die Werke zu schaffen, die wir bewundern?
Je mehr wir uns mit den Biographien genialer Leute von der Antike bis in die Gegenwart beschäftigten und dabei nach Absonderlichkeiten forschten, nach Umwegen, Brüchen, Skurrilem, um so deutlicher trat der bedrohlich fruchtbare Nährboden von Eigensinn, Unglück und Wahn hervor.
Mit der ersten Ausgabe der NZZ am Sonntag erschien im März 2002 auch die erste Folge der »Abgründe«. Und eine kleine Familienwerkstatt begann. Denn Silvia Overath, die Tochter von Angelika und Manfred, die gerade die Biographie über Marlene Dietrich las (mutig geschrieben von deren Tochter), steuerte sofort Rätselstoff bei und zeigte sich entschieden, bei der Kolumne mitzumachen. Eine produktive Arbeitsteilung kristallisierte sich heraus: in der Regel recherchierten Manfred und Silvia (sie lasen Briefe, Tagebücher, Biographien) und Angelika schrieb. Die Grenzen der Zusammenarbeit waren fließend. Immer wieder gingen die Ideen und pointierten Kommentare der Vorbereitenden direkt in die Texte ein.
Seit zwölf Jahren erscheinen die rätselhaften »Abgründe« nun wöchentlich in der NZZ am Sonntag; sie haben viele treue Ratende gefunden.
Nach den Auswahlbänden »Genies und ihre Geheimnisse. 100 biographische Rätsel« (2005) und »Genies und ihre Geheimnisse. 100 neue biographische Rätsel« (2008) sind nun mit »Die Geheimnisse der genialen Leute« 150 der schönsten neu entstandenen Rätsel versammelt.
Ein solches Projekt braucht Freunde!
Wir sind froh über alle, die mit Nachfragen und Vorschlägen die Entstehung unserer Rätsel begleitet haben. Namentlich danken möchten wir Nana Badenberg, Basel; Marc Eberhardt, Karlsruhe; Ute Oelmann, Stuttgart; Barbara Spengler-Axiopoulos, Heidelberg.
Unser Dank gilt auch der Fachbereichsbibliothek des Deutschen Seminars der Universität Basel und der Universitätsbibliothek Basel. Und der wunderbaren Buchhandlung Chantunet da Cudeschs, Scuol.
Sent und Ludwigsburg, Sommer 2013
Angelika Overath, Manfred Koch, Silvia Overath
1
Also gut, die Dichter lügen. In der Wirklichkeit ist auf sie kein Verlaß. Aber Chronisten, Ethnologen, Historiker? Und gerade er! Wie formulierte er so schön: »Doch ist meine Pflicht, alles was ich höre, zu berichten, freilich nicht, alles Berichtete zu glauben. Dies gilt für mein ganzes Geschichtswerk.« Er stellt sich uns vor als ein besonders kritischer Kopf. Und was tischt er uns dann auf: »Eine Stadt in Arabien gibt es, in der Nähe einer Stadt Buto gelegen, dahin bin ich gefahren. Um Kunde einzuziehen. Es soll dort nämlich geflügelte Schlangen geben. Da sah ich denn Knochen und Gräten von Schlangen, mehr als ich beschreiben kann.« Knochen und Gräten von Schlangen! Und um das zu sehen, will er eigens hingereist sein! Doch unerschütterlich, weil er es so genau betrachtet hat, mit eigenen Augen, fährt er fort: »Ganze Haufen von Rückenknochen lagen dort, große, kleinere und noch kleinere, in großer Zahl. Der Platz, wo sich diese Knochenhaufen befinden, ist ein enger Paß, der aus den Bergen in eine weite Ebene hinabführt. Diese Ebene stößt an die ägyptische Ebene.« Hier spricht der Reporter. Sah er Überreste von Fischen? Ausgerechnet in der Wüste? Indische Flughunde? Hat er nicht so genau hingeschaut? Da macht er eine so weite Reise und will es dann doch nicht wissen? Seltsam. Oder seine Beschreibung von Babylon: »Die Stadt zerfällt in zwei Teile. Mitten hindurch fließt der Strom, der den Namen Euphrat trägt.« Das stimmte nun auch zu seiner Zeit nicht. Und das Schwarze Meer, wo er gewesen sein will, macht er fast doppelt so groß wie es ist. Ist er denn wirklich gereist, wie er mit Nachdruck behauptete, oder hat er nur die sonnengebleichten Matrosen im Hafen von Athen gefragt, wenn sie von großer Fahrt zurückkamen? Zugegeben, er war geschickt. In seinem Werk – in dem er über tausendmal »ich« sagt – erzählt er immerhin (man hat das nachgerechnet) einundvierzigmal Dinge, von denen er sagt, daß er sie nicht glaubt. Dreiundsechzigmal gibt er von derselben Sache verschiedene, sich widersprechende Berichte und neunundneunzigmal führt er etwas aus, das er zumindest bezweifelt. Warum erzählt er es dann? Vermutlich weil er zunächst mündlich erzählte, vor einer staunenden Menge. Weil er da stand, gestikulierend, und sprach und sprach und ausschmückte und mit den unglaublichsten Geschichten kam und sein Publikum bannte. Und auf skeptische Einwürfe, auf Nachfragen mußte er natürlich sofort reagieren. Ja, er hat es selbst gesehen, gehört, vor Ort an Inschriften entziffert! Aufgeschrieben hat er seine Reportagen und Recherchen erst später im italienischen Exil. Mittlerweile behaupten Forscher, daß er, gerade wenn etwas nicht stimmte, sorgfältig Quellenangaben fingierte. »Vater der Geschichtsschreibung« hat ihn Cicero genannt. Nun, gezeugt hat er vielleicht, den Samen gelegt für das, was wir heute Augenzeugenbericht, Quellenstudium nennen. Und er hatte einen guten Grund, von unerforschlichen Göttern und Welten zu erzählen. Er wollte verstehen, warum esKriege gab.
Wer war der Autor, der einmal schrieb: »Denn kein Mensch ist unverständig genug, Krieg dem Frieden vorzuziehen: begraben doch im Frieden die Kinder ihre Eltern und im Kriege die Eltern ihre Kinder«?
Lösung
Es handelt sich um den griechischen Historiker Herodot, 490/480 v. Chr. – 424 v. Chr.
2
Er wollte alles wissen. Man sah den berühmten Philosophen – er soll soberühmt gewesen sein, daß er das Öl, in dem er seinen Körper badete, nach dem Bade verkaufen konnte – durch Athen ziehen,stattlich gekleidet, gepflegtes Haar, die Finger üppig mit Ringen geschmückt, wie er die Handwerker ausfragte, die Bauern, die Fischer. Alles interessierte ihn, alles sog er auf. Noch die Wahrnehmung selbst war Gegenstand seiner Aufmerksamkeit: »Daß das Gesicht dem Gehör vorauseilt, erkennt man am Ruderschlag der Schiffe: wenn die Blätter schon wieder aufwärts gehen, kommt erst der Schall von ihrem Einschlag an.« Oder: »Wenn man die Finger übereinanderschlägt, nimmt der Tastsinn eben das als zwei Gegenstände wahr, was der Gesichtssinn als einen wahrnimmt.« Hingebungsvoll beobachtete er noch das einzellige Glockentierchen: »Deswegen soll man sich nicht in kindischer Weise langweilen bei der Untersuchung der unbedeutenden Lebewesen. Es liegt in jedem Geschöpf der Natur irgend etwas Wunderbares.« Er hat wohl 500 Tiere beschrieben, den Tintenfisch und den Löwen, den Hirsch und den Seeigel. Sehr am Herzen lag ihm der männliche Wels. Während nämlich das Weibchen nach dem Laichen einfach davonschwimme, bewache der sorgsame Fischvater vierzig bis fünfzig Tage die Brut, bis die Jungen ausgewachsen seien: »Die Fischer erkennen seinen Standort, wenn er wacht, da er, um die Fische zurückzuscheuchen, schnauft und schnalzt und brummt.« Der Mensch war ihm das höchste Tier; und auch bei dieser Gattung bemerkte er Verhaltensunterschiede der Geschlechter, die er durchbuchstabierte und zu bemerkenswerten Vorschlägen kam: »Wenn nämlich auch die Frau zum Samen und zur Zeugung ihren Beitrag liefert, dann muß schließlich ein Gleichlauf vorausgesetzt werden. Falls also der Mann schnell am Ziel ist, die Frau jedoch noch nicht – im allgemeinen geht es bei Frauen langsamer –, so liegt darin ein Hindernis.« Nun käme es darauf an, den »passenden Augenblick« zu finden »für die Vereinigung«, damit so ein ungleichzeitiges Paar doch Kinder bekommen könne: »Falls nämlich die Frau besonders erregt und bereit und recht aufmerksam ist, der Mann dagegen sich geärgert oder abgekühlt hat, dann muß ja schließlich einmal der Gleichlauf erreicht werden.« Er glaubte über alles an die Vernunft, an das Helle, an den dem Menschen erkennbaren Grund, der all die verschiedenen Erscheinungen verband. Schlaf und Traum hingegen waren ihm nichtgeheuer. »Denn Schlafen und Wachen unterscheidet sich lediglich dadurch, daß die Seele im Wachen wenigstens oft das Wahre trifft, im Schlafe aber stets in einer Täuschung befangen ist.« Wer einmal »das vernünftige Denken verschmeckt« habe, der ertrage das Dunkle und Unklare nicht mehr: »Dies ist der Grund, daß niemand von uns zeitlebens betrunken oder ein Kind bleiben möchte. Dies ist ferner der Grund, weshalb der Schlaf zwar etwas höchst Angenehmes, aber dennoch nicht wünschenswert ist.« Sein antiker Biograph berichtet, er habe sich mit einer ehernen Kugel zur Ruhe gelegt, die, sollte ihn der Schlaf völlig überwältigen, seiner Hand entfallen und auf einen Teller schlagen würde. Von diesem Geräusch wäre er sogleich wieder aufgeweckt worden.
Wer war der »Fürst der Philosophie« (Maimonides), der für den in Gott ergebenen Luther nur ein »verdammter, hochmütiger, arglistiger Heide« war?
Lösung
Es handelt sich um den griechischen Philosophen Aristoteles, 384 v. Chr. – 322 v. Chr.
3
Sex war sein Leben. Oder war es die Sprache? War Sprache Sex? Saß hier der Glutkern der Erregung? Jedenfalls, davon war er überzeugt, wurde der Geschlechtsverkehr besser durch Texte, die von ihm handelten. Er nannte den Vorgang vornehmlich »Ficken« und kreierte harte Neologismen um das harte Wort. Im Kreis einer verwöhnten Jeunesse dorée wollte er unterhalten und aufgeilen. So einfach war das. So schwer. Denn wie soll man dauernd wieder neue Verse finden für die eine Sache! Er strengte sich an und suchte, ja erfand ein immer schärferes Lustpotential um Vagina, Anus, Mund. So evozierte er in lautmalerischen Wortfolgen die Bewegungen, mit der die Lippen bei der Fellatio die Vorhaut zurückschieben. Das sollte ihm einer nachmachen! Wenn wir ihm glauben wollen, stand keiner so unter Hochspannung wie er, war keiner so wütend, so gewissenhaft im Bett wie im Text. Er liebte und haßte. Und war berühmt für seine klangstarken, rhythmisch kalkulierten, laut vorgetragenen Beschimpfungen von Konkurrenten. Da wurde von einem gesagt, ihm »wohne unten im Tal der Achseln ein schrecklicher Bock. / Den fürchten alle. Kein Wunder! Denn er ist ein sehr übles / Tier, mit dem kein schönes Mädchen schlafen will«. Ein anderer war gleich eine »Schwuchtel, weicher als Kaninchenfell / oder Gänsemark oder als ein Ohrläppchen / oder als der schlaffe Schwanz eines Greises und modrige Spinnweben«. Wenn er Angst hatte, ein Nebenbuhler wolle sich an seinem Lieblingsknaben vergreifen, drohte er mit analer Schändung: »wehe dann über dich Elenden und Mann eines üblen Geschicks, / den bei angewinkelten Beinen und offenem Tor / durchbohren werden Rettiche und Fische«.
Daß wir von ihm wissen, ist ein Zufall. Um 1300 tauchte in Verona ein Manuskript auf, eine ziemlich schlechte Abschrift mit 113 Liedern und einigen antiken Kommentaren. Sie wurden kopiert, der gefundene Papyrus ging verloren. Aus den Versen rekonstruierte man den Roman des Lebens eines Autors. Herkunft aus einer wohlhabenden Familie, finanziell abgesichert, gut vernetzt. Offensichtlich konnte er sich jede Frechheit erlauben. Und von Caesar als »Tunte« sprechen und von dessen Bettschatz als »schwanzlosem Schwuchtel«.Wir lesen, daß er, vom Vater zum Studieren nach Rom geschickt, dort der erotischen Anziehung einer hohen römischen Patrizierin verfiel (die vermutlich ein inzestuöses Verhältnis zu ihrem Bruder gepflegt hatte). Er wird erhört und betrogen, die Circe, klagt er, habe »300 Liebhabern den Unterleib zerrüttet«. Was ihre Attraktivität für ihn nicht schmälerte. (Seine Wut und seinen Schreibfuror aber anstachelte.) Bei allen Frauen und Knaben, denen er beiwohnte, blieb sie ihm doch die Einzige, die vielfach vögelnde, die den toten Sperling wohl zu erwecken wußte: »Leben, meine Lesbia, wollen wir und uns lieben, / und alles Genörgel allzu strenger alter Männer / soll uns nicht einen Pfifferling wert sein. / Sonnen können sinken und wiederkehren / doch wenn einmal erloschen ist unser kurzes Lebenslicht, / müssen wir eine einzige ewige Nacht schlafen. / Gib mir tausend Küsse, dann noch hundert …«. Er soll, nach biblischem Muster, nur dreißig Jahre alt geworden sein. Ein enfant terrible, ein Prophet der Jugendsprache, ein Klassiker.
Wer war der Dichter radikaler Obszönitäten, der als erster Römer ein Ich über seine Liebe zu einer Frau sprechen ließ?
Lösung
Es handelt sich um den römischen Dichter Catull, etwa 84 v. Chr. – 54 v. Chr.
4
Seine Mutter soll geträumt haben, sie habe einen Lorbeerzweig zur Welt gebracht, aus dem ein Baum entstand, mit Blüten und Früchten bedeckt. Als sie am nächsten Tag übers Land ging, gebar sie ihr Kind auf freiem Feld. So wurde die Erde seine erste Wiege. Der Jüngling wuchs heran, groß, schön, von dunklem Teint, aber körperlich nicht belastbar. Sein Vater, ein Bauer, Töpfer und Bienenzüchter, schickte den sensiblen Sohn zur Ausbildung in die Stadt. Er sollte Jurist werden. Doch die Rhetorik, die ihm Phrasen und kalkulierte Emotionen abverlangte, blieb dem Naturkind fremd. Als er das erste Mal in Rom öffentlich als Anwalt auftrat, war er »äußerst stockend und langsam beim Reden und wirkte wie einer, der nicht bis drei zählen kann«, so ein Augenzeuge. Der junge Mann fiel unter die Dichter. Aber auch im Kreis der »Neutöner«, einer bunten Weltstadt-Bohème, hielt er sich nicht lange. Er dankte den holden Musen. Sie sollten weiterhin nach seinen »Blättern schauen, doch zuchtvoll und selten«. Es zog ihn nach Neapel. In einer Villa am Meer hatte ein Philosoph Jünglinge um sich geschart, die zur »Meeresstille der Seele« finden wollten. Und das in der Zeit größter politischer Umstürze! In den blutigen Parteikämpfen war ein junger Aristokrat durch besondere Skrupellosigkeit aufgefallen. Und er, der zarte, besonnene Dichter, fing nun an, ausgerechnet diesen gewissenlosen, hochbegabten Aufsteiger als Heilsbringer poetisch zu verherrlichen. War er korrupt? Um die im Bürgerkrieg angeheuerten Söldner abzufinden, waren in seiner Heimat die Bauern enteignet und vertrieben worden. Wollte er jetzt durch die Gunst des Machthabers seine väterlichen Ländereien zurück? Oder sah er sich tatsächlich als Erzieher des jungen Tyrannen? In liebevollen Versen feierte er ihn als Stifter einer goldenen Friedenszeit. Das Volk jubelte. Aber der Dichter lebte weiter zurückgezogen unter den Philosophen am Meer. Wenn ihn jemandin Neapel erkannte, flüchtete er schnell in den nächsten Hauseingang. Man nannte ihn »das schüchterne Jüngferlein«. Seine Texte arbeitete er wieder und wieder um. Er verglich sich mit einer Bärin, die ihr Junges so lange leckt, bis sein Fell endlich ganz und gar glatt und glänzend scheint. Er ließ sich nicht drängen. Sein zweites Werk besteht aus 2.200 Versen; dafür brauchte er acht Jahre. Es handelt von der unscheinbaren Arbeit, dem Leben der Bauern, dem Dasein der Bienen. Eigentlich wollte er danach nichts mehr schreiben. Doch dann fing er etwas an, das, kaum begonnen, unter der Aura des Ruhmes stand. Er wiegelte ab: »ich muß verrückt gewesen sein, ein solches Werk in Angriff zu nehmen.« Die Erwartungen drückten ihn nieder, doch das war wenig gegen das Joch der Sorgfalt, unter das er sich selbst stellte. Er recherchierte bis ins Kleinste. Er wußte, bei welchem archaischen Opferritual man Pappellaubkränze trug (und nicht etwa Lorbeer, wie eine Quelle behauptete).
51jährig erkrankt er auf einer Reise. Er spürt, daß er sterben wird, und verlangt nach seinem Manuskript. Da waren doch noch ein paar unfertige Stellen. Unmöglich, das Werk so zu veröffentlichen! Er befiehlt, das Ganze zu verbrennen. Schon zuvor hatte er testamentarisch festgelegt, alles sei zu vernichten, was er nicht selbst freigegeben habe. Man hält sich nicht daran.
Wer war der folgenreiche, große römische Dichter?
Lösung
Es handelt sich um den römischen Dichter Vergil, 15. Okt. 70 v. Chr. – 21. Sept. 19 v. Chr.
5
Nichts gegen Bildung für junge Frauen, aber was er da anzettelte, das ging den meisten Männern doch zu weit! Ein kluges Mädchen, eine römische Tochter aus gutem Haus, las und musizierte, aber sie vernachlässigte dabei den Haushalt nicht. Und sie wurde eine verläßliche Gattin und Mutter. Doch zu einer Zeit, da der Kaiser Erlasse verabschiedete wie »Gesetz zur Bestrafung von Ehebruch« und »Gesetz über die Verheiratung der oberen Stände« (es herrschte Kindermangel),hatte unser Held (aus dem Stand der Ritter) nichts besseres zu tun, als über die freie Liebe nachzudenken. Und wenn es nur beim Denken geblieben wäre oder eben, so nötig, beim diskreten Praktizieren! Aber nein, er mußte darüber schreiben, ja mitmissionarischem Eifer eine regelrechte Grammatik der geschlechtlichen Konjugationenformulieren. »Erfahrung brachte dieses Werk hervor«, rühmte er sich. Wir glauben es ihm.
Er wollte die zweckfreie Erotik.Das Gegenbild sah so aus: »Die will ich nicht, die sich gibt, nur weil sie eben verpflichtet / Trocken dabei, und denkt gar noch an Wolle und Garn.« Er glaubte an die selbstbewußte, an die heitere Liebende. Seine lebenden Vorbilder waren die anmutigen Freigelassenen aus den griechischen Provinzen, kultiviert, gebildet, die sich eher ihrer Scham schämten, nicht ihres Genusses.
Sein Grundidee war klar: So wie es eine erlernbare Kunst gibt, Schiffe zu steuern, so wie man wilde Pferde und Stiere bändigen kann, so gibt es auch Techniken, Amor zu befehlen. Dem liebesfähigen Menschen angemessen war weder eine schnöde Ehe (er war übrigens dreimal glücklich verheiratet) noch ein die Liebenden zerstörender Liebeswahn. Nein, es käme darauf an, daß eine kultivierte Leichtigkeit die körperliche Liebe zwischen Mann und Frau bestimme. Dabei seien Geduld und Rücksicht vonnöten und immerKlugheit. Wie solle man sonst Amor, den Geflügelten, auch auf Dauer halten? Vermutlich war er der erste, der hochemotionale Frauenmonologe schrieb. Er gab weiblichen Nebenfiguren der Sagengeschichte das Wort, und sehnend und leidenschaftlich sprechen sie nun zu ihren Männern: daß sie nicht fortgehen mögen, daß sie doch zurückkommen sollten, daß sie blieben. Der Gedanke, daß nichts so war wie es ist und nichts so bleiben würde, faszinierte ihn. Als wunderbare Verwandlung erschien ihm der Mensch, »sei es, daß ihn aus göttlichem Samen jener Weltschöpfer formte, der Begründer einer besseren Welt, sei es, daß die Erde, jugendfrisch, erst kürzlich vom hohen Äther geschieden, noch Samen des verwandten Himmels bewahrte.« Seine Gegner warfen ihm ungehemmte Erotisierung vor.Vermutlich hatten sie recht. Aber was hieß das für einen, der nicht zwischen Dichten und Lieben trennte?
Für ihn ging es am Ende nicht gut aus. Das hing allerdings weniger mit der freien Liebe als mit der restriktiven Politik des Kaisers zusammen. Irgendwie muß er in eine staatsgefährdende Familienintrige hineingeraten sein, bei der seine amourös-dichterischen Seitensprünge mehr als Vorwand dienten. Sicherheitshalber entfernte man ihn aus Rom. Nun wurde sein Heimweh, seine Trauer sein Thema: »Und zu meinem Gedicht liefere ich selbst den Stoff.«
Wer war der großzügige Dichter der Frauen, der jedem liebenden Mann zum Rat gab: »Ertrage einen Rivalen mit Geduld, Größeres als dies hat meine Kunst nicht zu bieten«?
Lösung
Es handelt sich um den römischen Dichter Ovid, 20. März 43 v. Chr. – ~ 17 n. Chr.
6
Monnica weinte. Sie vergoß Ströme von Tränen um ihn. In seinen Lebenserinnerungen schluchzt die Mutter dahin für seine Seele. Kein Wunder, daß er sich immer schämen mußte. Seine größte Schuld lag in seinem sündigen Fleisch. Er begehrte, also war er schlecht. Einmal, als er mit seinem Vater in einer Badeanstalt war, konnte der eine Erektion an ihm beobachten. Der Vater lachte, und lachend erzählteer zu Hause davon der Mutter. Sie solle sich bald auf Enkelkinder einstellen. Immerhin war der Knabe 16. Die Mutter erstarrte. Und weinte. Der Vater hatte so Unrecht nicht. Mit 19 kehrte der Junge vom Studium zurück und brachte mit: eine Geliebte und einen Sohn. Als er nun aber eine Professur in Mailand erhielt, war die Mutter auf der Hut. Sie kam mit und übernahm den Haushalt. Zunächst schmiß sie die Geliebte raus. Sie war nicht gut für die Karriere und ein Hindernis, eine standesgemäßere Frau zu finden.Kurzerhand schickte Monnica die junge Frau nach Afrika zurück. Ihr Kind aber nahm sie ihr weg, es blieb in Mailand. Er litt: »Es zerriß mir das Herz, das an ihr hing.« Wie es seiner Geliebten dabei ging, reflektierte er nicht. Als ihm die Mutter nun die künftige Gattin vorstellte, akzeptierte er brav. Er müsse aber, sagt sie ihm, noch zwei Jahre warten, das Mädchen sei noch nicht geschlechtsreif.Das empfindet erals »unerträglich« und beschafft sich »eine andere, natürlich nicht als Gattin«, sondern für die Zeit der Überbrückung. (Es sollte nicht zur Heirat kommen.)
Im Nachhinein bezeichnet er sich als Sklave seiner Begierden.Spricht von den »tödlichen Wonnen«, von dem »Leim der Lust«. Undseine Schuld wuchs, je mehr Monnica sie mit ihren Tränen begoß. Monnica duldete stolz, daß ihr Gatte sie betrog. Er war ja ein Heide und nicht relevant. Denn der eigentliche Vater ihres Sohnes war doch Gott. Jetzt lag es an ihr, die spirituelle Zeugung auch auszutragen. Mit gut 30 Jahren begriff der Junge das endlich. »Ich kann ja gar nicht angemessen genug sagen, was sie für mich empfand und wieviel größer die Unruhe war, mit der sie mich geistig gebar, als die einst bei meiner leiblichen Geburt.« Jedenfalls wurde nun schlagartig alles einfacher: Er liebte Gott in seiner tränenden Mutter und entsagte dem bösen Fleisch. Keine Onanie mehr, wo er doch früher »täglich« in sich »selbst zu sterben« gewohnt war, keine Geliebte, keine Ehefrau. Nur noch Monnica und die Unio Mystica. »Ihr Leben und mein Leben waren zu einem Leben geworden.« Die Mutter war am Ziel.Sie hatte ihren Jungen für sich alleinund in ihm einen Sohn des Allmächtigen. Monnica war hart. Sie züchtigte mit »heiliger Strenge« und konnte durstigen Kindern das Wasser verweigern, damit sie später nicht zu viel Wein tränken. So war für ihn auch Gott nur ohne Gnade zu denken. Tief hockte im Menschen das Böse, dessen er sich in seiner Schlechtigkeit nicht erwehren konnte. Schon die Säuglinge waren schuldig. Schrieen sie nicht aus schierer Begierde?
Wer war der große Philosoph und Fundamentalist von Schuld und Scham, der es auf den Begriff brachte: »Der Mensch ist in sich selbst ein gewaltiger Abgrund«?
Lösung
Es handelt sich um den Kirchenvater Augustinus, 13. Nov. 354 – 28. Aug. 430.
7
Wer war sie? Die elfte Muse (wenn Sappho die zehnte war)? Eine im weiblichen Bildungswesen engagierte Frauenrechtlerin? Tochter des Königs von Northumbria? War sie eine niedersächsische Kanonissin, gar Äbtissin? Oder doch eine byzantinische Prinzessin? Da man wenig wußte, konnte man viel über sie vermuten; erst im 20. Jahrhundert klärte sich ihr Bild. Zwischenzeitlich galt sie gar als Fälschung! Eine Frau, die so ein perfektes Latein schrieb, könne es so früh überhaupt nicht gegeben haben, zischte im 19. Jahrhundert ein angesehener Wissenschaftler. Er wurde dann doch schnell widerlegt. Entdeckt hat ihr Werk (Verslegenden, Legendendramen, eine Geschichte Ottos I.) ein Dichter und Humanist Mitte des 15. Jahrhunderts. Eine Abschrift (von um 1000) war im Kloster St. Emmeram in Regensburg aufgetaucht. Er ließ das Manuskript veröffentlichen und mit Phantasiedarstellungen ihrer Person von Albrecht Dürer zieren. Ein anderer Gelehrter dichtete sofort: »Lobet, o lobt, die Jungfrau, / die deutsche Poetin, / hätte Athen sie gezeugt, / gäbe es eine Göttin mehr«, und umstandslos nahm er sie auf in seinen »Katalog berühmter Deutscher Männer«.
Das wenige, das wir über sie wissen, müssen wir aus den kurzen Bemerkungen erschließen, die sie ihren Texten voranschickte. So wird sie um 935 geboren sein und mindestens bis 973 gelebt haben. Ihre dichterische Kraft habe sie von Gott, eine Gabe, mit der sie arbeiten wolle. Egal, ob man diese schätze oder nicht. Selbstbewußt erklärte sie: »Wenn einem meine fromme Hingabe gefällt, freue ich mich; wenn sie aber wegen meiner Verächtlichkeit oder der mangelhaften, unkultivierten Sprache niemandem gefällt, so freut doch mich selbst, was ich geschaffen habe.« Eins ihrer zentralen Themen war Jungfräulichkeit; also Sex. Sie nahm sich Terenz, den berühmtesten und zu ihrer Zeit sehr beliebten Komödiendichter der römischen Antike, zum Vorbild.Seine erotischen Liebesverwicklungen wollte sie poetisch wirksam umdrehen in Bekenntnisse zum keuschen Glauben. Das hatte stoffliche Zwänge zur Folge. Wie sollte sie überzeugend die »preiswerte Keuschheit gottseliger Jungfrauen singen«, ohne zugleich konkret zu zeigen, wogegen diese Siegreichen widerstanden? »Freilich ergriff mich oft Scheu vor meiner Arbeit, brennendes Rot übergoß mein Gesicht, denn ich mußt’ ja im Geiste gestalten, mit dem Griffel festhalten verbuhlter Knaben abscheuliche Torheit und ihr unerquicklich Geschwätz, vor dem wir uns sonst die Ohren zuhalten.« Sie tauchte ein in das ABC der Verführungen, in die Höllen der Leidenschaft (einmal wirft sich ein Liebestoller kopulationsbereit auf die Leiche seiner toten Geliebten). Sie schrieb auch Bordellszenen. Immer siegt die Keuschheit. Ihre Heldinnen gehen, der Lüsternheit spottend, heiter in den Tod. (Da verlachen etwa drei verurteilte Jungfrauen einen Lüstling, der in seinem Wahn nachts die rußigen runden Töpfe in der Küche umarmte, in der Annahme, es seien füllige Frauenleiber.) In ihrem Legendendrama »Pelagius« werden einem schönen Christenknaben in Cordoba Arme und Beine abgehackt, zuletzt wird er noch geköpft, weil er sich weigerte, auf die Liebesavancen des Kalifen einzugehen. Es ist dies eine der frühesten Verurteilungen der Homosexualität in einem christlichen Text.
Wer war die fromme Autorin, die ihrem Erröten trotzte und in Gottes Namen die Darstellung der Fleischeslust auf sich nahm?
Lösung
Es handelt sich um die deutsche Dichterin Roswitha von Gandersheim, ~ 935 – 973.
8
Ein empfindsames Mädchen aus gutem Hause, kein hoher Adel, aber es muß doch selbstverständlich gewesen sein, der Tochter ein überdurchschnittliches Maß an Bildung und Herzensschulung mitzugeben. Vermutlich hat die Kleine mit dem Psalter Lesen und Schreiben gelernt. Ging sie jeden Morgen in die Heilige Messe, auf dem Gut ihrer Eltern oder in der Stadtkirche? War sie dabei, wenn die fahrenden Sänger in der Volkssprache von der Liebe sangen? Hörte sie an den Festtagen der Heiligen Mutter Gottes Passagen des Hohen Lieds auf Lateinisch? Sie muß stark auf Sprache reagiert haben, auf das Psalmodieren, das Singen. Später bekannte sie, sie habe es als erwachsene Frau gehalten wie in ihrer Kindheit: »Wann immer man mir Kummer bereitete, mußte ich stets beten.«
Was aber war das, dieses Beten? Sie war 12 Jahre alt, als ihr Gott begegnete. Und seither kam er täglich zu ihr. Das Phänomen der »Pubertät« hätte ihr, in welcher Umschreibung auch immer, kaum ein Achselzucken entlockt. Sie war selbstbewußt und reif. Hochbegabt. Nur, wohin zielten ihre Fähigkeiten? Kaum etwas wissen wir von ihr. Wir haben Lebensspuren in ihren Aufzeichnungen, die sievielstimmig als Tagebuch, Konvolut von Liebesbriefen und Dialogen, Stoffsammlungen aus dem Alltagje nach Lust und Nöten heraussprudelte. So etwas hatte es vor ihr nicht gegeben. Auch fromme Klosterfrauen schrieben. Aber hinter den Mauern machte man den Novizinnen früh klar, wie sie ihre Gedanken zu formen und zu bändigen hatten in korrektem Latein. Sie aberschrieb in ihrer Muttersprache. Und sie ging hinaus in die Welt. Unverheiratet machte sie sich auf zu einer Gemeinschaft von geistlichen Frauen, die karitativ oder kontemplativ in Wohngemeinschaften zusammen lebten. Diese Frauen durchbrachen die mittelalterliche Ständegesellschaft, sie nahmen adlige Fräuleins ebenso auf wie Handwerkstöchter. Sie unterstanden keinem Orden und lebten in selbstverantworteter Freiheit. Unter ihnen war sie eineSeelen-Radikale. Es ging nicht einfach um das Glauben. Es ging um Liebesgewißheit und Vollzug. Sie fühlte Gott körperlich. Sie durchlebte mit ihm unerhörte Vereinigungen. »O weh, mein Vielgeliebter, ich bin heiser in der Kehle meiner Keuschheit, aber der Zucker deiner liebevollen Großmut hat meine Kehle zum Klingen gebracht, daß ich nun also singen kann: ›Herr, dein Blut und meines ist eines, unverdorben - / dein Kleid und meines ist eines, unbefleckt – / dein Mund und meiner ist einer, ungeküßt – etc.‹ Dies sind die Worte des Liedes. Die Melodie der Liebe und der süße Herzensklang können nicht ausgedrückt werden, denn das kann keine irdische Hand aufschreiben.« Und doch versuchte sie immer wieder genau das. Schreiben war Liebesakt. Bis sich die Seele nackt vor Gott entkleidet und er sie seine Königin nennt. So körperintensiv sie schrieb, war sie doch körperscheu. Im Paradies, erklärte sie, fand die Befruchtung sostatt, wie die Sonne im Wasser spielt »und doch das Wasser unzerbrochen blibet«. Denn Adam und Eva hatten keine Geschlechtsteile, »schemeliche lide«. Erst nachdem sie (beide willig, keiner vom andern verführt) von der falschen Frucht gegessen hatten, stülpten sich jene Organe notwendig heraus (»grulich gestalt« und »egesclich«, also häßlich,abscheulich). Von nun an mußten die Menschen sich schämen.
Wer war die lebensbunte Mystikerin mit dem sexualisierten Reinheitskonzept?
Lösung
Es handelt sich um die deutsche Mystikerin Mechthild von Magdeburg, ~ 1207 – 1282.
9
Schon als Baby ist er aufgefallen. Da griff er in der Badeanstalt ein Stück Pergament auf und stopfte es sich in den Mund. Als das Kindermädchen es ihm wegnehmen wollte, brüllte er unbändig. Und die Mutter sah, daß auf dem Pergament der Gruß des Engels, Ave Maria, notiert war. Gut, das läßt sich als Heiligenlegende interpretieren, aber auch schlicht entwicklungspsychologisch. Auch für spätere Auffälligkeiten könnte einem nüchternen Interpreten das Wort Autismus einfallen. Dieser Mann kippte einfach immer wieder aus Situationen heraus. Er war anwesend, ohne da zu sein. Fromme Biographen sprechen von »Entrücktsein«. Da sitzt er also zum Beispiel an der festlichen Tafel mit König Ludwig IX. und soll Konversation machen. Aber er schweigt, stiert vor sich hin, reagiert nicht, und auf einmal, mitten im Essen, schlägt er mit der Faust auf den Tisch und ruft: »Das erledigt die Manichäer!« Als der Prior ihn zur Besinnung bringt, entschuldigt er sich kleinlaut beim König: er habe gemeint, er sei in seiner Zelle, »wo ich über die Irrlehre nachzudenken begonnen hatte«. Daß er, als jüngster Sohn, eine kirchliche Laufbahn einschlagen möge, war ganz im Sinne der Familie gewesen, die zwar nur zum niederen Adel gehörte, aber sehr wohlhabend war. Man hatte ihn nach seinem fünften Geburtstag als »Oblatus« Gott dargebracht und den Benediktinern in die Ausbildung gegeben. Karriereziel: Abt von Monte Cassino! Nach dem Klosterinternat also ein Studium in Neapel. Der Knabe aber muß so zwischen 16 und 18 Jahren alt gewesen sein, als er sich entschloß, den Dominikanern beizutreten. Die Familie war entsetzt von der Aussicht, ihr Oblatus werde Mönch in einem Bettelorden. Etwas mußte geschehen. Die älteren Brüder entführten ihn, verschleppten ihn auf ein entlegenes Gut und kerkerten ihn dort in den »Familienturm« ein. Als alles gute Zureden nichts nützte, habe man ihm eine liebliche Kurtisane zugeführt, die ihn bekehren sollte. Er aber habe nur nach einem Holzscheit gegriffen, die Brüder samt der Schönen hinausgejagt, mit der glühenden Kohle ein Kreuz an die Wand gemalt und sich dann von einem Engel trösten lassen. En détail ist das nicht verbürgt. Immerhin hat er mindestens ein Jahr unter Arrest verbracht. Groß, massig, ja fett, mit früh kahlem Schädel und einer Gesichtsfarbe »dem reifen Weizen ähnlich«, lebte er in äußerster Zurückhaltung. Seine Klosterbrüder nannten ihn den »stummen Ochsen«. Seine Konzentrationsfähigkeit war monströs. In seiner Zelle diktierte er gleichzeitig bis zu vier Sekretären, fiel dabei in den Schlaf und sprach schlafend weiter. Und die Schreiber schrieben. Seine Handschrift selbst war unleserlich (»littera inintelligibilis«). Manchmal erschienen ihm Petrus und Paulus. Und sein Ende? Vision, Herzinfarkt? Jedenfallsist ihm während der Messe an Nikolaus 1273 etwas zugestoßen. Seinem vertrautesten Sekretär gestand er: »Alles, was ich geschrieben habe, kommt mir vor wie Stroh im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe.« Im Frühling des nächsten Jahres stirbt er und hinterläßt als Frucht von knapp dreißig Arbeitsjahren 40 Bände eines folgenreichen philosophisch-theologischen Werkes.
Wer war der Kirchenlehrer, der als die fünf wichtigsten Heilmittel gegen »Schmerzen und Traurigkeit« nannte: »Tränen, das Mitleid der Freunde, der Wahrheit ins Auge sehen, schlafen, baden«?
Lösung
Es handelt sich um den italienischen Philosophen und Theologe Thomas von Aquin, ~ 1225 – 7. März 1274.
10
Daß er der Sohn eines armen Hirten gewesen sein soll, ist eine Legende. Sein Vater hatte ein Schiff auf der Mosel und handelte als erfolgreicher Kaufmann. Und doch blieb erstaunlich, wie er als Bürgerlicher in die höchsten Ränge der Kurie aufstieg. In Rom galt er, ein Deutscher, als weißer Rabe. Schon während des Jurastudiums in Heidelberg und Padua hatte er wichtige Kontakte geknüpft. Zwei seiner Studienkollegen wurden später Kardinäle, ein dritter sollte als Kartograph und Astronom Geschichte schreiben. Mit 23 Jahren also promoviert, mit 24 im Dienst eines deutschen Erzbischofs, der ihn in diplomatischer Mission auf Reisen schickte. Früh zeigte sich sein ökonomisches Geschick, kaum einer verkaufte so erfolgreich Ablässe und war so unerbittlich bei der Beschaffung von Pfründen. Er muß alle in Grund und Boden argumentiert haben. Noch die gegensätzlichsten Positionen konnte er miteinander vereinbaren. Auch in Glaubensdingen. Als Christ sah er einen gewissen Wahrheitsgehalt im Islam, im Judentum, sogar in der antiken Götterlehre. Es käme eben nur darauf an, daß die verschiedenen Religionen ihre »Religionsgewohnheiten« (etwa die Beschneidung) als mögliche Varianten des Christentums erkannten. Warum etwa solle man nicht mehrere Götter verehren, wie Heilige, solange nur die zentrale Figur des Gottessohnes unangetastet blieb? Er wußte, daß er Dinge sagte, die zuvor nie gehört worden waren (prius inaudita): »Die Erde ist ein Stern wie jeder andere.« Oder er sprach von seiner »negativen Theologie«, in der »die unendliche Einheit weder Vater noch Sohn noch Heiliger Geist« sei.In seiner Jugend argumentierte er mit der Macht, die vom Kirchenvolk auszugehen habe; dann schlug er sich auf die Seite des Papstes. Opportunistischer Schachzug, oder sah er, daß sich die Kurie nur von oben erneuern konnte? Jetzt ging es steil bergauf: der Papst machte ihn zum Kardinal und beauftragte ihn, mit nachlässiger Religionsausübung kurzen Prozeß zu machen. Er überwachte Klöster und Gemeinden. Alles ging gut, bis er auf eine Äbtissin traf, die einem befestigten Kloster in Tirol vorstand. Hier führten adelige Fräuleins ein sorgenfreies, von Pagen umsorgtes Leben. Klausur der Nonnen? Fasten? Die Äbtissin lächelte und schickte seinen Kontrolleur an der Klosterpforte zurück. Er setzte ihr nach bis zur Exkommunikation. In der Dorfkirche mußte allsonntäglich unter Wiederholung des Bannes eine Kerze ausgeblasen werden (gemeint war ihre Person). Die Äbtissin zuckte mit den Schultern. Als er schließlich den Bauern verbot, das Kloster weiterhin mit Nahrungsmitteln zu versorgen, heuerte sie 70 Söldner an, die im Dorf stahlen, brandschatzten, vergewaltigten. Es kam zu einem Gemetzel, bei dem 52 Männer starben. Der weiße Rabe mußte um sein Leben fürchten. Er floh, wurde gefangengesetzt. Versprach, die Nonnen in Ruhe zu lassen, und widerrief, kaum war er wieder frei. Er starb, bevor sich der Streit klären ließ. Die kühne Nonne wurde zwar nicht wieder Äbtissin, aber sie durfte den Lebensabend in ihrem Kloster verbringen. (Ihre »Sonnenburg« ist heute ein Wellnesshotel.)
Wer war der erste Denker der Unendlichkeit, der schrieb: »Der Mensch kann also ein menschlicher Gott oder wie Gott sein. Er kann als Mensch ein menschlicher Engel oder eine menschliche Bestie sein, ein menschlicher Löwe, ein Bär oder was immer sonst«?
Lösung
Es handelt sich um den deutschen Philosophen und Theologen Nikolaus von Kues, 1401 – 11. Aug. 1464.
11
Er war das uneheliche Kind eines Geistlichen, der vor der schwangeren Geliebten nach Italien geflohen war. Nicht einmal sein Geburtsjahr ist sicher. Da die Mutter früh starb, wurde er bei Augustinern erzogen. Schon früh war der empfindsame Junge mißtrauisch gegen Frömmelei und religiöse Materialschlachten. Man weihte ihn zum Priester; immerhin gehörte er also irgendwo dazu. Es war in Rom, als er einen sehr italienischen Karfreitagsgottesdienst erlebte: einen »gewaltigen Aufzug von Kardinälen und Bischöfen«; die Predigt war »vollgepackt mit Lobhudeleien« auf den abwesenden Papst, der »als Jupiter Optimus Maximus gepriesen wurde, in seiner Rechten den Dreizack schwingend und den unvermeidbaren Blitz und mit einem Wink vollbringend, was immer er wolle«. Mit solchem Paganismus in der Kirche konnte er nichts anfangen. »Was«, resümierte er, »könnte wirklich abgeschmackterund banaler sein.« Doch auch der Furor alles Reformatorischen blieb ihm fremd.Seine Idee von Gott war freundlich. »Gott«, konnte er sagen, »wird nicht durch grammatische Fehler beleidigt, aber er hat doch auch keine Freude daran.« Sein Gottesdienst war Sprachdienst, eine demütige Verbeugung im Fleiß. Er arbeitete an einer kritischen Edition des Neuen Testaments. Und er paraphrasierte Textstellen, damit sie »den Bauern, den Matrosen, den Maurern, Prostituierten, Kupplern und Türken« leichter verständlich seien. Lernen sollte das Volk, ein ordentliches, ein frisches Latein, ein schönes Griechisch! Er war kein Stubenhocker. Er reiste zwischen England und Burgund, Holland, Basel und Paris.Seine Schüler waren Prinzen; seine Tischgesellschaft die politische und geistige Elite Europas. Er korrespondierte mit Luther. Am Anfang ging das gut. Bald aber entzweiten sich die so unterschiedlichen Charaktere. Er sei ein »Aal«, wetterte der Reformator (er sagte bei weitem Schlimmeres). Der andere aber gab zu bedenken, daß man mit Höflichkeit doch weiter käme, ohne so vieles zerstören zu müssen. Insgeheim war er radikaler als der heftige Mann aus Wittenberg, aber er bestand auf der Höflichkeit, den Umgangsformen. Der Deutsche, dieses religiöse Genie, war ihm zu übertrieben. Und er fand, daß »die Ungebärdigkeit ein Wesenszug dieses Volkes sei«. Ihm gefiel das Wortspiel, das die »Germanen« an »manisch« band.
Kein Radikaler, kein Fundamentalist, verbeugte er sich hoffend vor dem Einzelnen. Luther schüttelte sich und warf ihm vor: »Menschliches gilt bei ihm mehr als Göttliches.« Er lächelte und gab der Narrheit eine Stimme. Die Torheit schien ihm ein überlebenswichtiges Moment des menschlichen Daseins. In leiser Ironie (war es Ironie?) erinnerte er an all die Weisen, die ob ihrer zu großen Weisheit Hand an sich legen mußten. Genaugenommen, das wußte er schon, war das Leben nicht auszuhalten. So fiel er durch alle Wahrheiten. Von den Männern der Reformation wurde er, der Bonvivant im Kreis seiner schönen Famuli, gehaßt. Die katholische Kirche wollte ihn zum Kardinal machen, aber er sah keinen Grund, die »Katze in Gala« zu geben, und nach seinem Tod kamen seine Schriften auf den päpstlichen Index. Seinen französischen Übersetzer hatte man wegen Ketzerei schon Jahre zuvor verbrannt.
Wer war der schillernde Menschenfreund, der einmal sagte: »Die täuschen sich sehr, die da behaupten, Christus sei von Natur ein trübsinniger Melancholiker gewesen, der uns zu einem freudlosen Leben aufgefordert hätte«?
Lösung
Es handelt sich um den niederländischen Humanisten Erasmus von Rotterdam, 27. Okt. 1466/1467/1469 – 11./12. Juli 1536.
12
Was war er für ein Mensch? Wenig wissen wir von ihm. Und von seinem so kaum deutbaren Werk! Aber vielleicht sehen wir ihn ja, wie manche Forscher ganz sicher glauben, auf seinen Bildern: alsabgerissenen, dürren Landstreicher, als guten Freund, der dem Heiligen Antonius hilft, als ein großes, knöchernes Gesicht im Baum. Melancholisch sieht er aus. Gequält? Stoisch aushaltend? Aber ist er nicht auch dort zu sehen, selbstbewußt, körperlich sicher, da, hinter dem knieenden, nackten Mann, aus dessen Anus blühende Blumen sprießen. Ja, ist er das nicht, dieser (ebenfalls) Nackte, der eine vollerblühte rote Blume mit zwei Blütenhochhält, als habe er sie gerade dort aus dem Hintern des andern gepflückt? Oder als möchte er sie ihm in diesen mit zärtlicher Geste hineinstecken? Viel Unentschiedenes ist dabei. Jedenfallshat er die Blume ruhig in der Hand und sieht dabei kühn auf den vasenhaften After. Das alles wie in Zeitlupe. Gedehnte, staunende Lust, als sei sie eine Fingerübung. Und dann, auf dem nächsten Bild, die subtilsten Qualen, die sich ebenso langsam vollziehen, an den gedehnten Körpern, die offensichtlich ein hochsensibles Instrument sind für elegante Etüden in allen Tonarten von Schmerz. Seltsam das alles. Denn es ist ja auch Kinderlust dabei, mutwilligeFreude, ein Fabulieren in Formen, Chimären, Symbolen zwischen Paradiesgärten und Höllenfeuern. Überall hockt diese unerklärliche Eule. Und was sollen die überdimensioniertenFrüchte? Himbeeren, als seien sie der Himmel der Lust. Und diese nackte schwarze Frau dort, mit der Kirsche auf dem Kopf? Eine Allegorie für Afrika und andere Kontinente, die er nie sah? Oder die Nonne ohne Kutte,rosafleischfarben, die noch den Flagellationsriemen um die wohlgeformten Oberschenkel trägt. Und das alles in farblicher Sorgfalt, subtile Striche, frohe Schatten. Wieviel künstlerische Liebe in all dieser keuschen Pornographie aus den Reichen der Sinne! Aus welchem Seelengrund kommt das?
Maler in der dritten Generation, auch zwei seiner Brüder malten. Verheiratet mit einer Tochter aus allerbestem Hause (sie bringt ein Haus, ein Gut in die Ehe; fortan ist er finanziell unabhängig), Mitglied in einer elitären Bruderschaft, die die besten Männer seiner Stadt vereinigte. Erfolgreich. Und glücklich, nehmen die Kunstkritiker an und rätseln über seine Auftraggeber. Manches hat er sicher für die Kirche gemalt. Aber anderes: unmöglich! Doch wer bezahlte, und wer stellte solche wahnsinnigen Fügelaltare aus? Geheimbünde, die vor seinen Bildern schwarze Messen feierten? Wir wissen es nicht. Hingegen lernen wir aus seinen Tafeln: Der Mensch ist begabt. Aber nicht gut. Er ist schön, aber verführbar. Er ist herrlich, daß Gott erbarm! Er ist lustgefährdet und vielleicht schmerzgeschützt. Aber sein Gott ist klein, scheu, im Vergleich zu den Dämonen, die die Artistik beherrscht. Wäre wirklich sein Gott ein erstes, modernes, in die irre Schöpfung geworfenes Ich?
Wer war der ungeheure Maler, von dem ein kluger Kunsthistoriker einmal sagte: »Er legte den Trost allein in die Meditation. Deren Inhalt war die Aussicht, die er bildhaft aussprach, daß die Überfüllung und die Übertreibung der Natur in zwar ferner Zeit auf ein unausweichliches Ende hintreiben müsse. Er malte den ersten Morgen eines Zeitalters, in dessen Abend wir noch stehen«?
Lösung
Es handelt sich um den niederländischen Maler Hieronymus Bosch, ~ 1450 – Aug. 1516.
13
Welch Ungeheuer war der Mensch? Er, Sohn eines Anwalts, hochbegabt, belesen, betrachtete diese Spezies mit äußerster Skepsis. Er war keine Dreißig, da machte er politische Karriere als rhetorisches Genie. Im Auftrag seiner Stadtrepublik Florenz verhandelte er mit den Führern ihrer Söldnerheere, die keine guten Worte, sondern Geld wollten. Da gab es den berüchtigten Paolo Vitelli, der bereits seit seinem dreizehnten Lebensjahr kämpfte und bekannt dafür war, den gefangenen Musketieren die Augen auszustechen und die Arme abzuhacken. Oder den jungen Ottaviano Riario, der, unmündig, von seiner Mutter vertreten wurde. Diese Caterina Sforza war eine rothaarige Schönheit mit Porzellanteint. Einmal, auf der Flucht vor ihren Verfolgern, die drohten, ihre kleinen Kinder zu töten, lachte sie nur hoch oben auf den Festungsmauern, zeigte mit erhobenen Röcken ihr nacktes Geschlecht und rief: »Ich habe immer noch die Möglichkeit, neue zu machen.« Sie hatte auch versucht, den Papst zu töten, indem sie ihm Briefe schickte, eingeschlagen in Tücher, die zuvor um die Köpfe von Pestkranken gewickelt worden waren. Mit dieser Dame führte er diplomatische Verhandlungen. Am meisten vielleicht hat ihn der schaurige Cesare Borgia beeindruckt, sechs Jahre jünger als er, der fünf Sprachen fließend sprach, in der Arena an einem Tag vier Stiere erledigt hatte, ein Hufeisen von Hand biegen konnte und in den Hügeln vor Florenz mit Leoparden auf die Jagd ging. Er trug Gewänder aus schwarzem Samt und eine Maske, um die Entstellungen, die die Syphilis auf seinen Zügen hinterlassen hatte, zu verbergen. Was für ein Ungeheuer war der Mensch? Angesichts des Söldnerführers Borgia jedenfalls konnte er nur schwärmen: »Dieser Fürst ist durchaus herrlich und großartig.« Als er es endlich schaffte, Florenz von Söldnerheeren unabhängig zu machen, indem er eine eigene Bürgermiliz aufstellte, beförderte er an deren Spitze Don Michelotto, der den Florentinern als »Ungeheuer der Verderbtheit« galt. Seine Spezialität war das Erdrosseln. Und da ihm der Strick so geschickt durch die Hände lief, tötete er einmal nebenbei einen Schuster, nur weil der seiner Meinung nach einen zu hohen Preis für ein Paar Stiefel berechnet hatte.
Durfte die Macht alles, solange sie alles im Griff hatte? War dem freienmenschlichen Individuum im Staat nicht zu trauen? Das Schicksal brachte ihn für drei Wochen ins Gefängnis. Er wurde gefoltert und verfaßte darüber – als Gnadengesuch – Gedichte, in denen er die Folter beschrieb. Die Hände hatte man ihm am Rücken zusammengebunden und ihn an einem Strick in die Tiefe gestürzt, so daß die Schultergelenke auskugelten. Sechsmal will er diese Tortur hinter sich gebracht haben. Nach der Entlassung schrieb er einem Freund, wie er sich erhole: »Täglich suchen wir das Haus irgendeines Mädchens auf, um wieder zu Kräften zu kommen.« Ein Menschenfreund war er vielleicht nicht gerade. Aber war er wirklich ein Zyniker oder nicht vielmehr der erste radikale Pragmatiker der Macht?
Wer war der Staatsdenker und Dichter, den man später einen »Galilei der politischen Philosophie« genannt hat und der einmal sagte: »Es gibt drei Arten von Intelligenz: die eine versteht alles von selber, die zweite vermag zu begreifen, was andere erkennen, und die dritte begreift weder von selber noch mit Hilfe anderer«?
Lösung
Es handelt sich um den italienischen Politiker und Staatsphilosophen Niccolò Machiavelli, 3. Mai 1469 – 21. Juni 1527.
14