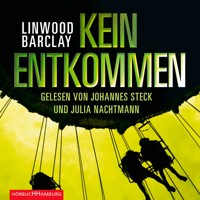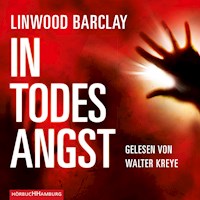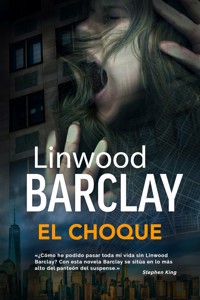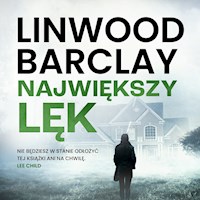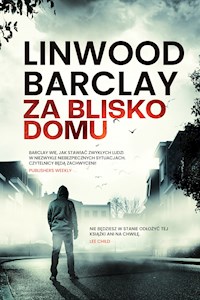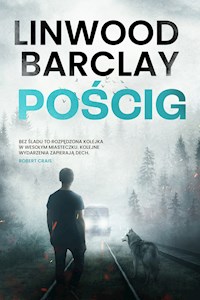12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Wahn oder Wirklichkeit? Im neuen Thriller des amerikanischen Bestseller-Autors Linwood Barclay hinterlässt eine alte Schreibmaschine nachts kryptische Nachrichten Paul Davis hat allen Grund, an seinem Verstand zu zweifeln: Seit er beinahe von seinem Freund und Kollegen Kenneth Hoffman getötet worden wäre, weil er diesen beim Entsorgen zweier Frauenleichen überrascht hat, leidet er an Gedächtnislücken und manchmal auch Wahnvorstellungen. Auch die Besuche bei seiner Psychiaterin helfen Paul nicht wirklich, also beschließt er, ein Buch über Kennethʼ Fall zu schreiben, um sein Trauma zu verarbeiten. Zur Inspiration schenkt Pauls Frau ihm eine alte Underwood-Schreibmaschine – und plötzlich meint Paul, nachts Tipp-Geräusche zu hören, obwohl niemand in der Nähe der Schreibmaschine ist. Morgens findet er kryptische Nachrichten, die von den ermordeten Frauen zu stammen scheinen. Erhält Paul tatsächlich Botschaften aus dem Jenseits – oder verliert er endgültig den Verstand? »Einer der besten Thriller-Autoren auf der Höhe seines Schaffens. ›Die Geräusche der Nacht‹ ist Linwood Barclays bisher bester Thriller.« Peter James
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Ähnliche
Linwood Barclay
Die Geräusche der Nacht
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Clewing
Knaur e-books
Über dieses Buch
Paul Davis hat allen Grund, an seinem Verstand zu zweifeln: Seit er beinahe von seinem Freund und Kollegen Kenneth Hoffman getötet worden wäre, weil er diesen beim Entsorgen zweier Frauenleichen überrascht hat, leidet er an Gedächtnislücken und manchmal auch Wahnvorstellungen. Auch die Besuche bei seiner Psychiaterin helfen Paul nicht wirklich, also beschließt er, ein Buch über Kennethʼ Fall zu schreiben, um sein Trauma zu verarbeiten.
Zur Inspiration schenkt Pauls Frau ihm eine alte Underwood-Schreibmaschine – und plötzlich meint Paul, nachts Tipp-Geräusche zu hören, obwohl niemand in der Nähe der Schreibmaschine ist. Morgens findet er kryptische Nachrichten, die von den ermordeten Frauen zu stammen scheinen. Erhält Paul tatsächlich Botschaften aus dem Jenseits – oder verliert er endgültig den Verstand?
Inhaltsübersicht
Für Neetha
Prolog
Es war schon spät, als er an jenem Abend auf der Post Road unterwegs war, doch Paul Davis hätte schwören können, dass es sich bei dem Wagen, der in diesem unberechenbaren Fahrstil vor ihm fuhr, um den seines Kollegen Kenneth Hoffman handelte. Der alte, dunkelblaue Volvo Kombi gehörte zum festen Inventar des West Haven College und bediente alle Klischees des fahrbaren Untersatzes eines typischen Professors.
Paul fragte sich, ob Kenneth – immer Kenneth, niemals Ken – eigentlich wusste, dass mit dem linken Rücklicht etwas nicht stimmte und weißes Licht durch die gesplitterte rote Plastikabdeckung nach außen drang. Hatte er nicht neulich erst davon gesprochen, dass ihm jemand ans Auto gefahren war, ohne eine Nachricht unter dem Scheibenwischer zu hinterlassen?
Ein kaputtes Rücklicht hätte Kenneth bestimmt nicht einfach hingenommen. Eine gestörte Symmetrie am Fahrzeugheck, quasi das Äquivalent zu einer Ungleichung, konnte Kenneth, Professor für Mathe und Physik, nicht ungerührt lassen.
Wie der Volvo zur Mittellinie driftete, um ruckartig wieder in die eigene Spur zurückzufinden, ließ in Paul den Verdacht aufkommen, dass mit Kenneth etwas nicht stimmte. War er am Steuer eingenickt, wieder aufgewacht und hatte bemerkt, dass er auf die andere Straßenseite zusteuerte? War er auf dem Heimweg, nachdem er irgendwo dem Alkohol zugesprochen hatte?
Wäre Paul Polizist, würde er Blaulicht und Sirene einschalten und ihn anhalten.
Paul war aber kein Polizist und Kenneth auch nicht irgendein Autofahrer. Er war ein Kollege. Nein, nicht nur das. Er war ein Freund. Sein Mentor. Pauls Auto hatte weder Blaulicht, noch war es mit einer Sirene ausgerüstet. Vielleicht konnte er Kenneth auf sich aufmerksam machen, ihn dazu bringen, rechts ranzufahren, zu einer Pause überreden, bis er wieder fit genug war, um weiterzufahren, oder ihn zur Not gleich nach Hause bringen.
Das war das Mindeste, was Paul tun konnte, auch wenn die Freundschaft zwischen ihnen nicht mehr so eng wie früher war.
Als Paul ans West Haven kam, hatte Kenneth sich fast wie ein Vater seiner angenommen. Auf einer Fakultätsversammlung hatten sie festgestellt, dass sie ein gemeinsames, wenn auch mäßig anspruchsvolles Interesse teilten. Sie hatten eine Schwäche für Science-Fiction-Filme aus den Fünfzigerjahren. Alarm im Weltall, Endstation Mond, Fliegende Untertassen greifen an, Der Tag, an dem die Erde stillstand. Der Angriff der 20-Meter-Frau, darin waren sie sich einig, war ein geniales Meisterwerk. Nachdem sie sich ausgerechnet über ein so verrücktes Thema gefunden hatten, bot Kenneth Paul eine Schnelleinführung in das West Haven College an.
Die Gepflogenheiten der akademischen Welt konnten warten. Wichtiger war es, dem Neuzugang zu erklären, wie man einen guten Parkplatz ergatterte, an wen man sich in der Buchhaltung wenden musste, wenn etwas mit der monatlichen Gehaltsabrechnung nicht stimmte, und wann man die Mensa besser mied. (Am Dienstag, wie sich herausstellte. Dienstags gab es immer Leber.)
Mit den Jahren wurde Paul klar, dass Kenneth für ihn eine Ausnahme gemacht hatte, denn diese Einführung bot er sonst eher neuen Angestellten weiblichen Geschlechts an, und zwar um einiges hingebungsvoller, wie Paul erfuhr.
Kenneth hatte verschiedene Seiten, und Paul war sich immer noch nicht sicher, ob er alle kannte.
Allen Mutmaßungen über den Kollegen zum Trotz konnte er nicht zulassen, dass der Mann seinen Kombi in den Graben fuhr und sich umbrachte. Und es wäre in diesem Fall nur er allein – soweit Paul erkennen konnte, war der Beifahrersitz neben Kenneth leer.
Fast eine Meile war der Wagen inzwischen gefahren, ohne von der Spur abzukommen, woraus Paul schloss, dass Kenneth alles im Griff hatte. Dennoch empfand er die Fahrweise als irritierend. Immer wieder gab Kenneth Gas – dann leuchteten die Bremslichter auf, auch das defekte –, um anschließend wieder vor sich hin zu schleichen. Dann gab er neuerlich Gas. Eine Viertelmeile später fuhr er wieder langsamer. Wie es schien, wandte er den Kopf immer wieder nach rechts, als hielte er Ausschau nach einer bestimmten Hausnummer.
In dieser Gegend nach Hausnummern zu suchen war sonderbar, denn Wohnhäuser fanden sich hier nicht. Auf diesem Abschnitt der Post Road gab es fast ausschließlich Gewerbebetriebe.
Was hatte Kenneth vor?
Nicht dass man etwas Bestimmtes vorhaben musste, wenn man eine halbe Stunde vor Mitternacht durch Milford fuhr, denn Paul war schließlich ebenfalls unterwegs. Und wenn er nach dem Besuch des Theaterstücks, das die Studenten im West Haven aufgeführt hatten, gleich nach Hause gefahren wäre, wäre er inzwischen auch da. Jetzt aber war er hier, weil er ziellos in der Gegend herumgefahren war und nachgedacht hatte.
Über Charlotte.
Er hatte sie gefragt, ob sie mitkommen wollte. Paul hatte mit dem Theaterstück selbst nichts zu tun, wohl aber einige seiner Studenten, sodass er sich verpflichtet gefühlt hatte, sie durch seine Anwesenheit zu unterstützen. Charlotte hatte sich entschuldigt. Sie war Immobilienmaklerin und an diesem Abend mit Kunden zu einer Hausbesichtigung unterwegs. Und natürlich war es reizvoller zu warten, bis ein möglicher Käufer sämtliche Schlafzimmer in Augenschein genommen hatte, als auf Godot.
Aber auch wenn seine Frau nicht hätte arbeiten müssen, hätte es Paul überrascht, wenn sie mitgekommen wäre. In letzter Zeit teilten sie eher nur die Wohnung als das Leben. Charlotte verhielt sich distanziert und in sich zurückgezogen. Die Arbeit, sagte sie immer, wenn er wissen wollte, was ihr Sorgen bereitete. Er fragte sich, ob Josh der Grund sein könnte. War es ihr nicht recht, wenn sein Sohn übers Wochenende kam? Nein, ausgeschlossen. Sie mochte Josh. Hatte immer alles getan, damit er sich willkommen fühlte und …
Hallo.
Kenneth hatte den Blinker gesetzt.
Er lenkte den Volvo von der Hauptstraße nach rechts in einen Gewerbepark. Eine lange Reihe von Firmen und Geschäften, die alle seit mindestens fünf Stunden geschlossen hatten.
Falls Kenneth sich nicht wohlfühlte oder müde war, war er jedenfalls klug genug, von der Straße abzufahren und ein wenig zu schlafen. Oder vielleicht wollte er mit dem Handy ein Taxi rufen. Wie auch immer, Paul hielt sein Eingreifen nicht mehr für dringend erforderlich.
Trotzdem ging er vom Gas und steuerte jenseits der Stelle, an der Kenneth abgebogen war, an den Straßenrand. Der Volvo fuhr um ein Gebäude herum auf dessen Rückseite, die Bremslichter leuchteten auf. Wenige Meter vor einem Müllcontainer blieb er stehen.
Warum fährt er hinter das Gebäude? Paul war verwundert. Er schaltete Scheinwerfer und Motor aus und beobachtete den Kollegen weiter.
Drogenhandel blitzte es in seiner überhitzten Fantasie auf, auch wenn Kenneth in dieser Hinsicht nie etwas hatte vermuten lassen.
Und es sah auch nicht danach aus, als würde Kenneth hier jemanden treffen. Weder gab es einen zweiten Wagen, noch trat der Schatten einer verdächtigen Person aus der Dunkelheit. Kenneth stieg aus, die Innenbeleuchtung im Wagen sprang an. Er schlug die Tür zu, ging ums Heck herum zur Beifahrertür und öffnete sie. Er beugte sich vor und hob etwas hoch.
Was es war, konnte Paul nicht erkennen. Der Gegenstand war dunkel – aber schließlich war hier alles ziemlich dunkel – und etwa von der Größe eines Druckers, nur unregelmäßiger in der Form. Kenneths Bemühen, das Gleichgewicht zu halten, während er den Gegenstand die wenigen Schritte zum Container schleppte, ließ darauf schließen, dass es sich um etwas Schweres handelte. Er wuchtete es auf den Rand und stieß es hinein.
»Was zum Teufel soll das alles?«, murmelte Paul.
Kenneth schloss die Beifahrertür, ging um den Wagen herum zur Fahrerseite und setzte sich wieder ans Steuer.
Paul drückte sich tief in den Sitz, als der Volvo wendete und auf die Straße zurückkehrte, dann direkt an ihm vorbeikam und in derselben Richtung wie zuvor weiterfuhr. Paul sah die Rücklichter des Volvos in die Ferne entschwinden.
Er schaute zum Container und überlegte, ob er nachsehen sollte, was Kenneth dort hineingeworfen hatte, oder seinem Freund folgen. Anfangs hatte Paul sich zunächst Sorgen um Kenneth gemacht. Aber aus seiner Sorge war Neugier geworden.
Was auch immer sich dort in dem Container befand, würde in ein paar Stunden höchstwahrscheinlich auch noch da sein.
Paul schaltete Zündung und Scheinwerfer an und legte den Gang ein.
Der Volvo bewegte sich in nördlicher Richtung. Die Häuser, Geschäfte und unzähligen Gewerbeparks hatte er hinter sich gelassen und fuhr über sich windende, schmale Sträßchen zwischen hoch aufragenden Bäumen hindurch. An einer Stelle passierten sie einen Streifenwagen, der am Straßenrand stand, ohne ihnen Beachtung zu schenken, da sie sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten.
Inzwischen fragte sich Paul, ob Kenneth überhaupt ein Ziel hatte. Das Bremslicht des Volvos leuchtete auf, als sie sich einer Abzweigung näherten. Dann beschleunigte der Wagen wieder, bis sie zur nächsten kamen. Wieder sah es so aus, als suchte Kenneth etwas.
Plötzlich schien er es gefunden zu haben.
Langsam fuhr der Wagen auf den Randstreifen. Die Lichter erloschen. Etwa zweihundert Meter hinter ihm konnte Paul keinen Grund erkennen, warum Kenneth gerade dort angehalten hatte. Weit und breit waren weder ein Weg noch ein Haus zu sehen.
Paul überlegte kurz, ob er einfach vorbeifahren sollte, dachte dann aber: Zum Teufel mit der Geheimniskrämerei. Ich muss nachsehen, ob mit ihm alles in Ordnung ist.
Er setzte den Blinker, fuhr auf den Seitenstreifen und kam hinter dem Volvo zu stehen, als Kenneth gerade ausstieg. Die Wagentür stand offen, das Wageninnere war in schwaches Licht getaucht.
Kenneth schien erschrocken. Er sah aus wie ein Häftling, der bei dem Versuch, über die Mauer zu entkommen, vom Flutlicht des Wachturms gestellt wurde.
Paul senkte rasch das Fenster ab und schob den Kopf hinaus.
»Kenneth! Ich bin’s.«
Kenneth blinzelte.
»Paul! Paul Davis!«
Kenneth brauchte offenbar einen Moment, um zu begreifen. Dann kam er in schnellem Schritt auf Pauls Wagen zu. Das Scheinwerferlicht blendete ihn. Schützend hielt er sich eine Hand vor die Augen. Paul war bereits ausgestiegen, Motor und Scheinwerfer hatte er angelassen, als Kenneth rief: »Um Himmels willen, Paul, was machst du denn hier?«
Etwas an seiner Stimme gefiel Paul nicht. Sie klang aufgeregt, nervös. Auf halbem Weg zwischen den beiden Wagen blieb er stehen.
»Dachte ich’s mir doch, dass das dein Auto war. Ich dachte, du hättest vielleicht ein Problem.«
Dass er ihm schon ein paar Meilen gefolgt war, musste er ihm ja nicht gleich sagen.
»Alles in Ordnung«, stammelte Kenneth. Er machte seltsame Zuckungen, als müsste er sich zwingen, sich nicht zu seinem Wagen umzudrehen.
»Bist du mir nachgefahren?«, fragte er.
»Nein – also, nicht richtig«, entgegnete Paul.
Das Zögern in der Antwort ließ Kenneth aufmerken. »Wie lange schon?«
»Was?«
»Wie lange folgst du mir schon?«
»Also wirklich, eigentlich …«
Paul verstummte. Im Fond des Volvos war ihm etwas aufgefallen. Die Scheinwerfer seines Wagens strahlten etwas an, das aussah wie durchsichtige Plastikfolie, die sich über dem unteren Rand des Heckfensters aufzubauschen schien.
»Das ist nichts«, sagte Kenneth schnell.
»Ich habe doch gar nicht gefragt«, sagte Paul und ging einen Schritt auf den Volvo zu.
»Paul, steig einfach in dein Auto und fahr nach Hause. Mir geht es gut, wirklich.«
Jetzt entdeckte Paul die dunklen Flecken an Kenneths Händen. Auch sein Hemd und die Jeans waren von Flecken übersät.
»Meine Güte, hast du dich verletzt?«
»Mir geht es gut.«
»Aber das sieht doch aus wie Blut.«
Als Paul weiter auf den Volvo zuging, packte Kenneth ihn am Arm, aber Paul riss sich los. Er war gute fünfzehn Jahre jünger als Kenneth und durch das regelmäßige Squashspielen auf den College-Plätzen ziemlich gut in Form.
Paul trat an die Heckklappe und sah durch die Scheibe.
»Heilige Scheiße!«, entfuhr es ihm. Er schlug sich die Hand vor den Mund und glaubte, sich übergeben zu müssen.
Kenneth, der hinter ihm stand, sagte: »Lass … es mich erklären.«
Paul wich einen Schritt zurück und sah Kenneth mit aufgerissenen Augen an. »Wie … wer ist … wer sind die?«
Kenneth rang nach Worten. »Paul …«
»Mach auf«, befahl Paul.
»Was?«
»Mach auf!«, sagte er noch einmal und zeigte auf die Heckklappe.
Kenneth trat vor ihn und griff zum Kofferraumschloss. Ein weiteres Innenlicht sprang an und erlaubte einen genaueren Blick auf die beiden Leichen, die dort, in Folie eingeschlagen, der Länge nach mit dem Kopf zur Heckklappe und den Füßen Richtung Rücklehne der vorderen Sitze lagen. Die Rücksitze waren umgelegt, als hätte es gegolten, Platz für Sperrholzplatten zu schaffen, die man gerade im Baumarkt erstanden hatte.
Durch die milchig trübe Hülle und das Blut wirkten die Gesichtszüge vollkommen entstellt. Doch dass beide weiblichen Geschlechts waren, stand außer Frage.
Zwei Frauen.
Paul starrte mit schreckgeweitetem Mund auf sie hinunter. Das anfängliche Gefühl, sich übergeben zu müssen, war blankem Entsetzen gewichen.
»Ich war auf der Suche nach einer Stelle«, erklärte Kenneth mit ruhiger Stimme.
»Wonach?«
»Ich konnte noch nichts Passendes finden. Ich dachte an den Wald dort hinten. Und dann bist du hier aufgetaucht.«
Erst jetzt bemerkte Paul die Schaufel links neben den Frauen.
»Ich stelle den Wagen ab«, sagte Kenneth. »Den Motor laufen zu lassen, schadet der Umwelt.«
Paul fürchtete, er könnte einfach einsteigen und sich aus dem Staub machen. Die Heckklappe stand noch offen. Wenn er Vollgas gab, könnten die Leichen auf die Straße rutschen. Aber Kenneth hielt Wort. Er beugte sich in den Wagen und drehte den Zündschlüssel um. Der Motor war aus.
Paul fragte sich, wer die beiden Frauen waren. Er fühlte sich wie betäubt. Als wäre das, was hier geschah, nicht real.
Ein Name kam ihm in den Sinn. Warum, das wusste er nicht so genau. Aber es war so.
Charlotte.
Kenneth kam zurück. Wirkte er jetzt ruhiger? Erleichtert vielleicht, entdeckt worden zu sein? Paul sah ihn kurz an, aber sein Blick wanderte zurück zu den Leichen.
»Wer ist das?«, fragte er mit bebender Stimme. »Sag mir, wer das ist.« Er konnte den Anblick nicht länger ertragen und wandte sich ab.
»Es tut mir leid«, brachte Kenneth hervor.
Paul drehte sich um. »Was tut dir leid …?«
Für den Bruchteil einer Sekunde sah er die Schaufel, die Kenneth wie einen Golfschläger schwang, bevor sie auf seinem Schädel niederging.
Dann wurde es dunkel um ihn herum.
Acht Monate später
Eins
Der alte Mann im Fond des SUV hätte genauso gut tot sein können. Er war tief in den Ledersitz gesunken, und der nahezu kahle, von Leberflecken übersäte Schädel lehnte an der Seitenscheibe hinter dem Fahrersitz.
Paul trat an den Lincoln heran – das Modell, das Filmstars in diesen lächerlich bombastischen Werbespots immer fuhren – und spähte hinein.
Der Mann war klein und hager, und als hätte er gespürt, dass er beobachtet wurde, bewegte er plötzlich den Kopf. Er setzte sich langsam auf, drehte sich um, blinzelte ein paarmal und sah Paul mit fragendem Blick an.
»Wie geht’s Ihnen heute?«, erkundigte sich Paul.
Der Mann nickte langsam, sank in seinen Sitz zurück und lehnte den Kopf wieder an die Scheibe.
Paul ging das letzte Stück die Auffahrt in der Carrington Avenue hinauf, zu einem Seiteneingang des zweistöckigen, mit Zedernholzschindeln verkleideten Cape-Cod-Hauses. »anna white, Dr. phil.« stand auf einer kleinen Bronzeplatte gleich neben der Tür. Er läutete, trat ein und setzte sich ins Wartezimmer, das gerade einmal zwei Polstersesseln Platz bot.
Er stöberte in einem Zeitschriftenstapel. Das hier musste er Dr. White zeigen. In den drei Monaten, die er inzwischen zu ihr kam, wurden die Zeitschriften Time, The New Yorker, Golf Digest und Golf Monthly – vermutlich war seine Therapeutin passionierte Golferin – regelmäßig durch neue ersetzt. Wenn es etwas auszusetzen gab, dann die Tatsache, dass sie den Titelblättern nicht genügend Aufmerksamkeit zu widmen schien. War es im Wartezimmer einer Psychotherapeutin wirklich geschickt, eine Zeitschrift mit dem Aufmacher Paranoia: Muss ich sie fürchten? als Lektüre auszulegen?
Trotzdem schlug er das Heft auf und wollte sich gerade dem Artikel zuwenden, als die Tür zu Dr. Whites Sprechzimmer aufging.
»Paul«, begrüßte sie ihn mit einem Lächeln. »Treten Sie ein.«
»Ihr Vater sitzt wieder draußen in Ihrem Auto.«
Sie seufzte. »Ich weiß. Er glaubt, dass wir meine Mutter im Heim besuchen. Er fühlt sich wohl da draußen. Kommen Sie rein.«
Die Zeitschrift noch in der Hand, stand er auf und folgte seiner Therapeutin ins Sprechzimmer, das natürlich kein normaler Behandlungsraum war. Es gab keine Untersuchungsliege mit Papierauflage, keine Waage, keine Sehtesttafel, und auch die anatomische Darstellung eines menschlichen Körpers fehlte. Die Ausstattung des Raums beschränkte sich auf braune Ledersessel und einen Tisch aus Glas und Holz wie aus dem Katalog mit einem aufgeklappten, silberfarbenen Laptop darauf. Ansonsten füllten den Raum eine Bücherwand, beruhigend wirkende Malereien, die das Meer, vielleicht auch den Long Island Sound zeigten, und ein Fenster mit Aussicht auf einen der städtischen Parks von Milford.
Er ließ sich in den Ledersessel fallen, in dem er immer saß, während die Therapeutin sich schräg gegenüber von ihm niederließ. Sie trug einen knielangen Rock, und Paul bemühte sich, nicht hinzusehen, als sie die Beine übereinanderschlug. Dr. White – Anfang vierzig, braunes, schulterlanges Haar, Augen in der gleichen Farbe und sportlich – war durchaus attraktiv. Aber Paul hatte über die Sache mit der sogenannten Übertragung gelesen, die dazu führte, dass Patienten sich in ihren Therapeuten verliebten. Auch wenn ihm das sowieso nicht passieren würde, wollte er auf keinen Fall den Anschein erwecken, dass es vielleicht doch so wäre.
Er war hier, um sich helfen zu lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Auf eine weitere Beziehung, die diejenigen noch komplizierter machte, die er schon hatte, legte er keinen Wert.
»Sind Sie gerade im Begriff, eine Zeitung zu stehlen?«
»Nein, nein«, beeilte er sich zu erklären und hielt das Titelblatt hoch. »Ich wollte nur einen Artikel lesen, den ich hier drin entdeckt habe.«
»Du meine Güte«, sagte sie schuldbewusst. »Vermutlich war es keine so gute Idee, ausgerechnet die draußen hinzulegen.«
Paul grinste. »Ich bin tatsächlich über die Überschrift gestolpert. Wäre sie mir nicht aufgefallen, hätte ich wahrscheinlich zu einer Golfzeitschrift gegriffen. Obwohl ich gar nicht Golf spiele.«
»Die sind von meinem Vater«, erklärte sie. »Er ist dreiundachtzig, geht aber gelegentlich immer noch auf den Golfplatz, wenn ich die Zeit finde, ihn zu begleiten. Er liebt die Driving Range und haut immer noch einen ganzen Eimer Bälle weg wie kein anderer. Jedenfalls verläuft er sich dort nicht so leicht wie draußen auf dem Platz.« Sie streckte ihre Hand nach der Zeitschrift aus, und Paul gab sie ihr. Sie warf noch einen Blick auf die Überschrift und ließ das Heft auf einen kleinen Beistelltisch fallen.
»Wie geht es dem Kopf?«, erkundigte sie sich.
»Physisch oder psychisch?«
»Im Moment dachte ich eher physisch.« Sie lächelte.
»Dr. Jones sagt, dass ich mich ganz gut mache, aber auch, dass wir bei der Schwere der Verletzung noch ein Jahr auf Nachwirkungen achten müssen. Und ich spüre sie immer noch, das können Sie mir glauben.«
»Wie würden Sie die beschreiben?«
»Ich habe Kopfschmerzen. Und ab und zu vergesse ich etwas. Manchmal betrete ich ein Zimmer und weiß nicht mehr, warum ich hineingegangen bin. Manchmal weiß ich sogar nicht einmal mehr, wie ich dorthin gekommen bin. War ich gerade noch im Schlafzimmer, finde ich mich im nächsten Augenblick in der Küche wieder, ohne sagen zu können, wieso. Squash spiele ich auch noch nicht. Das Risiko, von einem Schläger getroffen zu werden oder gegen eine Wand zu laufen, ist mir zu groß. Aber Lust hätte ich schon. Bald vielleicht, aber ich lasse mir Zeit.«
Anna White nickte. »Okay.«
»Und der Schlaf ist immer noch … na ja.«
»Dazu kommen wir später.«
»Mein Gleichgewichtssinn hat sich allmählich verbessert, und beim Lesen kann ich mich wieder ziemlich gut konzentrieren, auch wenn es eine Weile gedauert hat. In ein paar Monaten werde ich vermutlich wieder unterrichten können. Im September vielleicht.«
»Sind Sie seit dem Vorfall überhaupt schon auf dem Campus gewesen?«
Paul nickte. »Ein paarmal schon, um mich einzugewöhnen. Im Ferienprogramm habe ich einen Kurs abgehalten – einen, den ich schon einmal gegeben habe, sodass ich nicht alles neu ausarbeiten musste. Ich habe mit ein paar Studenten ein Tutorium gemacht und eine sehr gute Diskussion in Gang bekommen. Aber das war’s dann auch schon.«
»Das College hat sehr viel Geduld mit Ihnen.«
»Ja, aber die hätten sie vermutlich sowieso gehabt, und in Anbetracht der Tatsache, dass es jemand von der Fakultät war, der versucht hat, mich umzubringen … waren sie natürlich noch entgegenkommender.« Er stockte und fuhr mit der Hand über die linke Schläfe, über die Stelle, an der er von der Schaufel getroffen worden war. »Ich sage mir immer, dass es noch schlimmer hätte kommen können.«
»Da haben Sie sicher recht.«
»Für mich hätte es genauso wie für Jill und Catherine in dem Volvo enden können.«
Anna nickte nachdenklich. »So schlimm die Dinge auch sind, sie können immer noch schlimmer sein.«
»Das glaube ich auch.«
»Gut, so viel zu Ihrer körperlichen Verfassung. Lassen Sie uns jetzt über mein Fachgebiet sprechen. Wie würden Sie Ihre Stimmung in der letzten Zeit beschreiben?«
»Mal rauf, mal runter.«
»Sehen Sie ihn noch, Paul?«
»Sie meinen Kenneth?«
»Ja, Kenneth.«
Paul zuckte mit den Schultern. »In meinen Träumen, natürlich.«
»Und?«
Paul zögerte, als wäre es ihm unangenehm. »Manchmal … auch sonst.«
»Haben Sie ihn seit unserer letzten Sitzung gesehen?«
»Ich bin bei Walgreens einkaufen gewesen und war mir ziemlich sicher, ihn in der Schlange vor der Kasse gesehen zu haben. Ich wurde panisch und bin rausgegangen, ohne die Sachen zu kaufen, die ich im Einkaufswagen hatte. Dann bin ich ins Auto gestiegen und wie der Henker davongefahren.«
»Haben Sie wirklich geglaubt, dass er es war?«
»Nein. Dass er es nicht wirklich sein konnte, war mir klar«, räumte Paul zögernd ein.
»Und warum?«, fragte sie und neigte den Kopf in seine Richtung.
»Weil Kenneth im Gefängnis sitzt.«
»Wegen zweifachen Mordes und eines Mordversuchs«, fügte Anna hinzu. »Und wenn der Polizist nicht im richtigen Moment vorbeigekommen wäre, wären es sogar drei Morde gewesen.«
»Ich weiß.« Paul rieb die Handflächen aneinander. Dass dem Polizisten das kaputte Rücklicht an Kenneths Volvo aufgefallen war und er zur Kontrolle mit dem Streifenwagen bei ihnen gehalten hatte, verdankte er dem puren Zufall.
Anna beugte sich vor und stützte die Ellbogen auf die Knie. »Es wird mit der Zeit besser werden. Das verspreche ich Ihnen.«
»Und was ist mit den Albträumen?«, fragte er.
»Haben Sie die immer noch?«
»Ja. Vor zwei Tagen hatte ich wieder einen. Charlotte musste mich wecken.«
»Erzählen Sie mir davon.«
Paul schluckte und sammelte sich einen Moment. »Ich konnte kaum etwas sehen. Alles war verschwommen, bis ich merkte, dass ich in Plastikfolie eingehüllt war. Ich habe versucht, sie wegzubekommen. Es gelang mir nicht. Schließlich konnte ich durch die Folie etwas erkennen. Ein Gesicht.«
»Kenneth Hoffman?«
Paul schüttelte den Kopf. »Sollte man meinen. In den meisten Träumen war er es ja auch. Aber das, was ich auf der anderen Seite der Hülle sah, war ich selbst. Ich habe mich angeschrien, dass ich da rauskommen soll. Ich hatte das Gefühl, in das Plastik eingewickelt und gleichzeitig außerhalb zu sein. Zum größten Teil aber war ich drinnen und bekam keine Luft. Ich habe versucht, mich freizustrampeln. Es war anders als mein normaler Albtraum. Manchmal denke ich, dass Charlotte eine der beiden Frauen im Kofferraum des Wagens ist. Ich habe diese vage Erinnerung, dass ich, bevor ich bewusstlos wurde, dachte, Kenneth hätte Charlotte umgebracht.«
»Warum haben Sie das gedacht?«
Er zuckte mit den Schultern. »Sie war nicht mit zur Aufführung gekommen. Da ist mir das einfach durch den Kopf gegangen.«
»Klar.«
»Jedenfalls bin ich froh, dass Charlotte da ist, wenn die Albträume kommen, und mich da rausholt. Beim letzten habe ich mit den Armen wild um mich geschlagen, während ich versucht habe, mich aus der Folie zu befreien.«
»Finden Sie danach wieder in den Schlaf zurück?«
»Manchmal, aber ich habe dann auch Angst vor dem Einschlafen. Weil ich befürchte, dass der Traum nur unterbrochen wurde.« Er machte kurz die Augen zu, als wollte er nachsehen, ob die Bilder noch da waren, die er in der Nacht gesehen hatte. Als er sie wieder öffnete, sagte er: »Ich glaube, es war vor vier Tagen, da habe ich geträumt, ich hätte mit ihnen am Tisch gesessen.«
»Mit wem?«
»Sie wissen schon. Mit Jill Foster und Catherine Lamb. In Kenneths Haus. Wir haben unsere Entschuldigungen geschrieben. Die Frauen trugen ein hässliches Grinsen im Gesicht, und das Blut quoll ihnen aus der aufgeschlitzten Kehle. Sie lachten mich aus, weil ich vor der Schreibmaschine saß und nicht wusste, was ich schreiben sollte. Und sie sagten ›Wir sind schon fertig! Wir sind schon fertig!‹. Kennen Sie das, wenn man im Traum Wörter nicht richtig erkennen kann? Wenn alles nur ein einziger Wirrwarr ist?«
»Ja«, pflichtete Anna White ihm bei.
»Es ist kaum auszuhalten. Ich soll etwas tippen, oder Kenneth, der wie dieser Scheiß-Nosferatu – entschuldigen Sie bitte den Ausdruck – auf der anderen Seite des Tisches steht, bringt mich um. Andererseits aber weiß ich, dass er das sowieso tun wird.« Pauls Hände begannen zu zittern.
Anna berührte seinen Handrücken. »Machen wir eine kurze Pause.«
»Ja. Danke.«
»Sprechen wir von etwas anderem. Wie läuft’s mit Charlotte?«
Paul zuckte mit den Schultern. »Ganz gut so weit.«
»Überzeugend klingt das nicht.«
»Doch, wirklich. Es geht besser. Sie hat mir sehr geholfen, obwohl es schwer für sie sein muss, zuzusehen, was ich durchmache. Bevor das alles passiert ist, lief es ja nicht so perfekt zwischen uns. Charlotte, glaube ich, hatte eine Phase, in der sie ihr ganzes Leben infrage gestellt hat. Vor zehn Jahren wäre sie im Traum nicht darauf gekommen, ihr Leben hier in Milford zu verbringen und Immobilien zu verkaufen. Nicht dass daran etwas auszusetzen wäre, aber ich glaube, dass sie in ihrer Jugend andere Vorstellungen hatte. Seit ich fast umgebracht worden wäre, sieht sie die Dinge aber offenbar mit anderen Augen. Es läuft jetzt besser.«
»Und Ihr Sohn? Josh?«
Paul sah sie betroffen an. »Was da passiert ist, hat ihm natürlich schwer zugesetzt. Dass der Vater sterben könnte, ist für einen Neunjährigen nicht leicht zu verkraften. Aber so lange war ich ja nicht im Krankenhaus. Ich war zwar noch nicht ganz wiederhergestellt – und bin es immer noch nicht –, aber immerhin hat sich herausgestellt, dass ich so schnell nicht sterben würde. Er ist abwechselnd bei seiner Mom und bei mir, sodass er wenigstens nicht immer mitbekommt, wenn ich nachts schreiend aufwache.«
Paul bemühte sich um ein Lachen, und auch Anna lächelte. Beide schwiegen einen Moment. Anna spürte, dass Paul über etwas nachdachte, und wartete.
Schließlich unterbrach er die Stille. »Ich möchte Sie um etwas bitten«, brachte er hervor.
»Gerne.«
»Mit Charlotte habe ich schon darüber gesprochen. Sie findet die Idee nicht schlecht, möchte aber, dass ich Sie um Ihre Meinung bitte.«
»Ich bin ganz Ohr.«
»Es lässt sich ja kaum verbergen, dass ich mich … Wie soll ich es ausdrücken? Verfolgt fühle? Ich glaube, dass mich das, was Kenneth getan hat, nicht mehr loslässt.«
»Ich würde es eher traumatisiert nennen. Aber, ja. Sie haben schon recht.«
»Nicht, weil er mich beinahe umgebracht hätte. Das allein würde schon reichen. Aber ich habe ihn gekannt. Er hat mich unter seine Fittiche genommen, als ich ans West Haven kam. Er war mein Freund. Wir sind zusammen etwas trinken gegangen, haben geredet, sind uns vertrauter geworden. Wir waren beide Science-Fiction-Freaks. Wie konnte mir verborgen bleiben, dass er ein Monster ist?«
»Monster können über ausgezeichnete Fähigkeiten verfügen, sich zu verstellen.«
Paul schüttelte den Kopf. »Andererseits habe ich mich bereits vorher immer wieder gefragt, ob ich ihn überhaupt kenne. Erinnern Sie sich an Walter Mitty?«
»Der aus den Fabeln von James Thurber?«
Paul nickte. »Ein unauffälliger Durchschnittstyp, der sich in die unterschiedlichsten heroischen Rollen hineinfantasiert. Kenneth gab offiziell den langweiligen Professor und in einem geheimen Leben den Frauenheld. Mit dem Unterschied, dass dieses geheime Leben nicht das Produkt seiner Fantasie war. Es war real. Er verfügte über diesen gewissen Charme, dem Frauen – einige zumindest – einfach nicht widerstehen konnten. Gegenüber allen anderen hat er das nie durchblicken lassen, und er prahlte auch nicht mit seinen sexuellen Eroberungen.«
»Er hat mit Ihnen also nie über die Frauen gesprochen, mit denen er sich traf?«
»Nein, aber geredet wurde viel. Wir wussten alle Bescheid. Bei jeder Veranstaltung im Fachbereich, zu der er seine Frau Gabriella mitbrachte, haben sich alle gefragt, ob sie vielleicht die Einzige ist, die von nichts weiß.«
»Kannten Sie seinen Sohn?«
»Len.« Paul nickte. »Kenneth hat den Jungen geliebt. Er war ein wenig – ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, ohne dass es verletzend klingt –, aber er war ein wenig langsam. Dass er komplett gestört ist, möchte ich nicht sagen, aber von einer Zukunft am College darf man bestimmt nicht ausgehen. Trotzdem schleppte Kenneth ihn mit auf den Campus, wo er stundenlang in der Bibliothek herumhing und sich Kunstbücher ansah. Kenneth stellte für Len immer einen Stapel Bücher zusammen, in denen er dann Seite für Seite blättern konnte. Len mochte das. Er betrachtete gerne Bilder.« Paul sah Anna ratlos an. »Wie lässt sich das mit dem vereinbaren, was Kenneth getan hat? Zwei Frauen umgebracht? Und wie er es getan hat. Erst zwingt er sie dazu, sich zu entschuldigen, um ihnen dann die Kehle … Ich krieg das nicht in meinen Kopf.«
»Das ist nicht einfach, ich weiß. Aber Sie wollten mich um etwas bitten.«
Er überlegte. »Statt zu versuchen, all das hinter mir zu lassen, möchte ich mich der Situation stellen. Ich möchte mehr erfahren. Ich möchte alles wissen. Über Kenneth. Ich möchte mit den Menschen reden, die in seinem Leben eine Rolle spielten. Nicht nur über das Schlechte. Nein, auch über das Gute. Ich möchte alle Kenneths verstehen, die in ihm schlummern. Ich würde gern persönlich mit ihm sprechen, wenn sie mich ins Gefängnis lassen. Falls er mich überhaupt sehen will. Ich glaube, dass das, was ich suche, die Antwort auf eine bedeutsamere Frage ist.«
Anna stellte die Finger zu einem Dach zusammen. »Und die wäre?«
»War Kenneth böse? Ist Kenneth böse?«
»Ich könnte jetzt einfach Ja sagen, sodass Sie sich die Mühe nicht mehr machen müssen.« Sie holte tief Luft und ließ sie langsam entweichen. »Aber egal, wie ich mich entscheide, glauben Sie wirklich, dass Ihnen damit geholfen ist?«
Paul zögerte einen Moment.
»Wenn ich dem Bösen in der realen Welt ins Gesicht sehen kann, dann muss ich es im Schlaf vielleicht nicht mehr fürchten.«
Zwei
Anna begleitete Paul Davis hinaus. Während er zu seinem Wagen ging, blieb sie bei ihrem Lincoln SUV stehen und öffnete behutsam die hintere Tür, damit ihr Vater nicht herausfiel.
»Komm rein, Dad.«
»Hallo, Joanie. Ich muss kurz eingenickt sein.«
»Ich bin’s, Anna. Ich bin nicht Mom.«
»Ach ja. Hast ja recht. Trotzdem sollten wir jetzt losfahren. Joanie geht schon bald zum Essen.«
»Sie ist doch gar nicht mehr in Guildwood, Dad«, korrigierte sie ihn einfühlsam. »Ich hole dir einen Kaffee. Eine halbe Kanne ist noch da.«
»Kaffee. Das klingt gut.«
Er arbeitete sich mit den Beinen zur Wagentür hinaus und rutschte dann wie ein Fallschirmspringer in Zeitlupe vorsichtig an den Rand der Rückbank, bis die Füße den Boden berührten.
»Ta da!«, triumphierte er. Er sah an sich herab und stellte fest, dass sich ein Schnürsenkel gelockert hatte. »Dann binde ich mir jetzt erst mal den Schnürsenkel zu.«
»Das machen wir, wenn wir drinnen sind«, sagte Anna, während sie die Autotür schloss und zusammen mit ihm zum Haus zurückging. Dort setzte sich ihr Vater gleich auf einen der beiden Stühle im Wartezimmer, um sich um den Schuh zu kümmern.
»Ich bring dir einen Kaffee, dann kannst du hinaufgehen und deine Lieblingssendungen ansehen«, sagte sie.
Er warf ihr ein knappes Okay zu.
Statt zurück in ihr Büro ging Anna ins Haupthaus. Sie betrat die Küche, nahm einen sauberen Becher aus dem Schrank und goss Kaffee aus der Kaffeemaschine ein.
Kaum hörbar vernahm sie das Türklappen des Nebeneingangs. Hoffentlich hatte ihr Vater nicht beschlossen, sich wieder ins Auto zu setzen. Dann fiel ihr ein, dass es vielleicht ihr nächster Patient sein könnte.
»Verdammt«, raunte sie. Anna sah es nicht gern, wenn ihr Vater Kontakt mit ihren Patienten aufnahm, am allerwenigsten mit demjenigen, der jetzt in ihrem Terminplan stand. In ihrer Not, schnell wieder in ihr Büro zu kommen, blieb sie mit dem Finger am Henkel des Kaffeebechers hängen und riss ihn zu Boden.
»Himmel! Auch das noch!« Anna nahm eine Rolle Küchenpapier vom Halter, ging auf die Knie und wischte den Schlamassel auf. Anschließend warf sie das durchtränkte Papier weg, goss eine weitere Tasse Kaffee ein und ging ins Büro.
Dort fand sie ihren Vater ins Gespräch mit einem hageren Mann von Ende zwanzig vertieft, der auf dem anderen Stuhl Platz genommen hatte. Nach vorne gebeugt, die Ellbogen auf die Knie gestützt, hörte er ihm interessiert zu.
»Hallo«, begrüßte er Anna. »Ich plausche gerade ein wenig mit Ihrem Vater.«
Anna rang sich ein Lächeln ab. »Das ist schön, Gavin. Aber Sie können gern schon reingehen.«
Gavin schüttelte dem alten Mann die Hand. »Schön, Sie kennengelernt zu haben, Frank.«
»Hat mich auch gefreut, Gavin.« Frank White deutete mit einer Kopfbewegung auf seine Tochter. »Sie kriegt Sie wieder hin, keine Sorge.«
»Das will ich hoffen«, entgegnete Gavin.
Gavin ging in Annas Büro, während sie ihrem Vater den Kaffee reichte. Dann sah sie zu seinen Füßen hinab.
»Du hast deine Schnürbänder ja immer noch nicht gebunden«, sagte sie.
»Das ist doch kein Problem.« Schulterzuckend stand Frank auf. »Er scheint ein netter Kerl zu sein.«
Wenn du wüsstest, dachte Anna.
»Möchtest du nicht in dein Zimmer gehen und etwas fernsehen?«
»Kann ich machen. Vielleicht trainiere ich auch noch etwas an der Maschine.«
»Hast du doch schon, Dad. Eine Stunde bist du heute bestimmt schon gerudert.«
»Ach ja, richtig.«
Sie begleitete ihn bis zur Treppe ins Haupthaus. Der Anblick der Kaffeetasse in seiner Hand, die losen Schnürsenkel und die Treppenstufen ließ sie nichts Gutes ahnen.
»Warte, Dad.«
Anna ging auf die Knie und band ihm den Schnürsenkel zu. »Das musst du nicht«, sagte er ärgerlich.
»Das macht mir doch nichts aus«, antwortete sie. »Ich will nicht, dass du auf der Treppe stolperst. Gib mir den Becher.«
»Was fällt dir ein, ich bin doch kein Kleinkind«, protestierte er.
Anna seufzte. »Schon gut.«
Sie blieb trotzdem stehen und ließ ihn nicht aus den Augen, während er sich die Stufen hocharbeitete, in einer Hand den Kaffeebecher, in der anderen das Geländer. Oben angekommen, drehte er sich zu ihr um.
»Ta da!«, rief er erneut.
Anna lächelte ihm traurig zu und ging durchs Haus zurück in ihr Büro. Dort fand sie Gavin auf der anderen Seite ihres Schreibtisches vor, auf dem der geschlossene Laptop stand. Voller Bewunderung für die Bücher in den Regalen strich er mit den Fingern über die Buchrücken. Gavin trug abgewetzte Jeans, Turnschuhe und ein eng anliegendes schwarzes T-Shirt. Er war nicht nur dürr, sondern hatte auch noch ungepflegtes Haar und war gerade einmal eins fünfundsechzig groß. Von hinten konnte man ihn für einen Teenager halten, niemals aber für einen Mann von fast dreißig.
»Mr. Hitchens«, begrüßte sie ihn förmlich. »Bitte nehmen Sie Platz.«
Ungerührt wandte er sich um und ließ sich auf denselben Platz fallen, auf dem gerade noch Paul Davis gesessen hatte. »Ihr Vater ist sehr nett«, bemerkte er. »Er hat mir erzählt, dass er früher Trickfilme gemacht hat. Und er hat mir erzählt«, Gavin grinste, »dass Sie sich endlich einen Mann suchen sollen. Aber keine Sorge. Ich glaube nicht, dass er mich dabei im Auge hat.«
»Gavin, wir müssen über …«
»Aber er hat Sie Joanie genannt. Ist das Ihr zweiter Vorname?«
»Das war der Name meiner Mutter«, erklärte Anna widerwillig. Ihren Patienten gegenüber gab sie nur ungern persönliche Dinge preis. Und das galt besonders für Gavin Hitchens.
»Ach«, fuhr er fort, »dann ist Ihre Mutter …«
»Sie ist vor ein paar Jahren gestorben. Gavin, wir müssen uns an bestimmte Regeln halten.« Sie nahm den Ordner zur Hand, der auf dem Schreibtisch neben dem Computer lag. »Sie sind gekommen, um mit mir zu sprechen. Weder mit meinem Vater, noch mit anderen meiner Patienten. Nur mit mir. Es gilt, Grenzen einzuhalten.«
Gavin nickte betreten wie ein gescholtener Hund. »Natürlich.«
Anna warf einen kurzen Blick auf die Notizen, die in dem Ordner zusammengeheftet waren. »Machen wir also da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben.«
»Ich weiß gar nicht mehr, wo das war.«
»Wir haben über Empathie gesprochen.«
»Ach ja, richtig.« Er nickte zustimmend. »Ich habe viel darüber nachgedacht. Sie glauben, dass es mir daran fehlt, aber das stimmt nicht.«
»Das habe ich auch nie gesagt«, korrigierte Anna. »Aber das, was Sie tun, legt die Vermutung nahe.«
»Ich habe doch noch nie jemandem wehgetan.«
»Das ist nicht richtig, Gavin. Man kann Menschen auch wehtun, ohne ihnen körperlichen Schaden zuzufügen.«
Unbeeindruckt wandte der junge Mann den Blick ab.
»Seelische Belastung kann erheblichen Schaden anrichten«, sagte sie.
Gavin antwortete nicht.
»Ihr Handeln hätte tatsächlich dazu führen können, dass sich jemand verletzt. So etwas kann Folgen haben, die nicht voraussehbar sind. Wie das, was Sie mit Mrs. Walkers Kater gemacht haben.«
»Da ist doch überhaupt nichts passiert. Nicht mal dem Kater.«
»Sie hätte stürzen können. Sie ist fünfundachtzig, Gavin. Sie haben ihren Kater auf dem Dachboden eingeschlossen. Sie hat ihn gehört, hat von unten eine Leiter hochgeschleppt und ist hinaufgestiegen, um die Dachbodenluke zu öffnen und das Tier zu retten. Dass sie sich nicht das Genick gebrochen hat, grenzt an ein Wunder.«
»Vielleicht war ich das ja gar nicht«, murmelte Garvin mit gesenktem Kopf.
»Gavin, ich bitte Sie! Man konnte es Ihnen nur nicht nachweisen, so wie bei dem Telefonanruf. Aber alle Indizien deuten darauf hin, dass Sie es waren. Und wenn wir miteinander arbeiten wollen, dann müssen wir ehrlich zueinander sein. Haben Sie das verstanden?«
»Natürlich«, sagte er betroffen und bemüht, ihrem Blick auszuweichen.
»Es stimmt, das mit der Katze war ich. Und das mit dem Anruf auch. Ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Deshalb war ich ja auch bereit, zu Ihnen zu kommen. Ich möchte diese Dinge nicht tun. Ich möchte mich bessern. Ich möchte verstehen, warum ich das tue, und ein besserer Mensch werden.«
»Gavin, Sie sind nicht freiwillig hier. Es war Teil der Auflage und gehört zu Ihrer Strafe, sonst wären Sie nämlich ins Gefängnis gewandert.«
Er ließ die Schultern sinken. »Schon gut, ich weiß. Jedenfalls habe ich mich nicht gesträubt. Ich habe gehört, dass Sie gut sein sollen und dass Sie mich wieder hinbekommen. Ich bin froh, dass ich herkommen darf, bis ich ein besserer Mensch bin.«
»Ich stelle niemanden wieder her, Gavin. Ich versuche den Menschen zu helfen, damit sie sich selbst wiederherstellen können.«
»Okay, klar. Verstanden. Es muss von innen kommen.« Er bekräftigte seine Erkenntnis mit einem Nicken. »Und wie mache ich das?«
Anna holte tief Luft. »Fragen Sie sich nach dem Warum.«
»Warum?«
»Warum verstecken Sie die Katze einer alleinstehenden alten Frau? Warum rufen Sie einen trauernden Vater an und behaupten, der Sohn zu sein, der im Irak gestorben ist?« Anna hielt inne und fragte dann: »Was bringt jemanden dazu, so etwas zu tun?«
Gavin ließ sich die Frage durch den Kopf gehen. »Ich weiß«, sagte er langsam, »dass diese Taten grausam oder gemein wirken können.«
Anna beugte sich vor, die Ellbogen auf die Knien gestützt. »Gavin, sehen Sie mich an.«
»Was?«
»Ich möchte, dass Sie mich ansehen.«
»Klar, natürlich«, gab er klein bei und ließ den Blickkontakt zu. »Und jetzt?«
»Gibt es weitere Vorfälle, von denen Sie mir noch nichts erzählt haben?«
»Nein.«
»Etwas, woran Sie gedacht, es aber nicht getan haben?«
Gavin hielt ihrem Blick stand. »Nein.« Dann lächelte er. »Ich bin hier, um ein besserer Mensch zu werden.«
Drei
Auf dem Weg nach Hause war Paul froh, dass Dr. White ihm die Idee, sich näher mit Kenneth Hoffman zu befassen, nicht ausgeredet und darauf bestanden hatte, die Finger davon zu lassen. Er war inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass die Albträume, die er der Nahtoderfahrung zu verdanken hatte – »Nahtod« im buchstäblichen Sinne, denn er wäre wirklich fast gestorben –, ihn so lange begleiten würden, bis er das Ereignis verarbeitet hatte.
Es musste einen Weg geben, das Erlebnis jener grauenvollen Nacht in etwas umzumünzen, das ihn nicht mehr beherrschte. Er konnte nicht zulassen, dass sein Leben vom Fund zweier Frauen im Kofferraum und einem Schlag auf den Kopf bestimmt wurde. Es war grauenvoll gewesen, ja. Und traumatisch.
Trotzdem musste es einen Weg geben voranzukommen.
Vielleicht konnte er sich zunutze machen, was er von Berufs wegen tat, um mit der Situation umzugehen. Paul unterrichtete englische Literatur. Von Sophokles bis Shakespeare, Chaucer bis Chandler hatte er alles gelesen, doch kürzlich hatte er auch einen Kurs über die erfolgreichen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts abgehalten. Nora Roberts, Lawrence Sanders, Stephen King, Danielle Steel, Mario Puzo entpuppten sich – manchmal zum Leidwesen seiner Kollegen und des Fachbereichsleiters – bei den Studenten als großer Erfolg. Er selbst war der Meinung, dass das, was den Massengeschmack befriedigte, nicht zwangsläufig banal sein musste. Diese Autoren wussten, wie man eine Geschichte erzählte.
Auf diese Weise glaubte Paul, sich dem Thema Hoffman nähern zu können. Er würde einen Schritt zurücktreten, versuchen, das Geschehene aus der Distanz zu betrachten, und es dann wie eine Geschichte analysieren. Mit einem Anfang, einer Mitte und einem Schluss.
Von der Mitte und dem Schluss wusste Paul eine ganze Menge. Er war ja buchstäblich hineingestolpert.
Jetzt galt es, mehr über den Anfang zu erfahren.
Wer war Kenneth Hoffman wirklich? Ein angesehener Professor? Ein liebevoller Vater? Ein untreuer Ehemann? Ein sadistischer Killer? Konnte man all das gleichzeitig sein? Und wenn ja, steckte die Fähigkeit zu töten in jedem Menschen und wartete nur darauf, auszubrechen? Konnte …
Verdammt.
Paul war zu Hause angekommen.
Er saß in der Auffahrt seines Hauses im Wagen. Der Motor lief.
Er wusste nicht, wie er hergekommen war.
Er erinnerte sich, dass er eingestiegen war, nachdem er Anna Whites Praxis verlassen hatte. Auch daran, dass er den Schüssel ins Zündschloss des Subaru gesteckt und den Wagen gestartet hatte. Selbst daran, dass er den nächsten Patienten, einen jungen Typen von Ende zwanzig, hatte hineingehen sehen, konnte er sich erinnern.
Danach war alles weg. Bis zu dem Moment, als er in die Zufahrt eingebogen war.
Keine Panik. Das ist keine große Sache.
Natürlich war es das nicht. Er war eben in Gedanken gewesen, hatte auf Autopilot geschaltet. War ihm so etwas nicht vor der Attacke auch schon passiert? Hatte Charlotte ihn nicht schon häufiger mit dem zerstreuten Professor verglichen, der in Gedanken ständig woanders war, während sie mit ihm sprach?
Auch seine erste Frau Hailey hatte diesen Vergleich gezogen. Beide hatten ihm vorgeworfen, immer wieder in seine eigene Welt abzutauchen.
Das war alles. Kein Grund anzunehmen, dass er durchdrehte. Er befand sich auf dem Weg der Besserung. Sein Neurologe war fest davon überzeugt. Die Untersuchungen und das MRT hatten nichts Beunruhigendes ergeben. Diese seltsamen Kopfschmerzen hatte er immer noch, und hin und wieder die eine oder andere Erinnerungslücke. Aber es ging ihm besser, daran gab es keinen Zweifel.
Paul stellte den Motor ab und öffnete die Wagentür. Beim Aussteigen wurde ihm schwindlig. Er legte die Hand aufs Autodach und schloss für einen Moment die Augen, bis er wieder festen Boden unter den Füßen spürte.
Als er die Augen wieder aufmachte, fühlte er sich sicher. Fühlte …
»Es tut mir leid.«
Plötzlich war das Pochen in der Schläfe wieder da. Genau an der Stelle, an der Kenneth ihn mit der Schaufel getroffen hatte. Und wieder erlebte er den Schmerz. Wieder hörte er die Worte des Mannes, der ihn fast umgebracht hätte.
Sie hatten wirklich echt geklungen.
Als wäre Kenneth gerade tatsächlich da, als stünde er direkt neben ihm, hier vor seinem Haus. Paul spürte einen Schauer den Rücken hinunterlaufen, während er versuchte, Kenneths Stimme aus dem Kopf zu bekommen.
Kein gutes Omen für meinen Plan, überlegte Paul.
Nein, sagte er zu sich. Genau deshalb musste er mehr wissen. Er brauchte eine Kenneth-Austreibung. Er musste ihn am Kragen packen und sich aus dem Kopf zerren.
Paul schloss die Wagentür und behielt auf dem Weg die Schlüssel zum Haus in der Hand. Charlottes Wagen war nicht da, und Josh war diese Woche nicht bei ihnen. Er hatte das Haus also für sich allein, eine Weile zumindest. Als Immobilienmaklerin hatte Charlotte zwar keine geregelten Arbeitszeiten, war am späten Vormittag aber trotzdem selten zu Hause. Wenn sie nicht unterwegs war, um einem Interessenten ein Objekt zu zeigen, oder jemanden aufsuchte, der sein Haus verkaufen wollte, gab es doch immer eine Menge Arbeit in dem Büro, das sie sich mit einem halben Dutzend anderer Makler teilte. Einer davon war Bill Myers, den Paul schon viel länger kannte, als Charlotte dort arbeitete. Paul hatte Bill gebeten, bei seinen Kollegen ein gutes Wort für die Berufsanfängerin einzulegen. Der hatte ein paar Strippen gezogen, und Charlotte wurde ins Team aufgenommen.
Über ihre Arbeit war Charlotte auch an das Haus gekommen, in dem sie jetzt lebten. Sie wohnten im Point Beach Drive, einer Straße in Milford, die parallel zum Long Island Sound verlief. Die Rückseite des Hauses ging auf einen traumhaften Strandabschnitt hinaus. Sie liebten die frische Seeluft und das endlose Plätschern der auflaufenden Wellen.
Das Haus war über drei Ebenen gebaut. Ganz unten befanden sich die Garage, der Wäschekeller und der Abstellraum. In der Mitte die Küche und das Wohnzimmer. Die Schlafzimmer lagen ganz oben im Haus. Das Wohnzimmer und das große Schlafzimmer hatten kleine Balkone mit Blick auf den Strand und darüber hinaus.
Das Anwesen war stark in Mitleidenschaft gezogen worden, als Hurrikan Sandy 2012 über die Gegend hereingebrochen war. Der Eigentümer hatte ein Vermögen in die Restaurierung gesteckt, bevor er schließlich doch nicht mehr dort wohnen wollte. Das war kurz nachdem Paul und Charlotte geheiratet hatten, also genau der richtige Zeitpunkt, um ihr kleines Apartment gegen etwas Schöneres zu tauschen. Solange die Eiskappen an den Polen nicht zu schnell abschmolzen, war das hier für die absehbare Zukunft ein wunderbarer Ort.
Paul schloss die Haustür auf und stieg träge die Stufen hinauf. Manchmal wurde ihm schummrig, wenn er die Treppe hinauf- oder hinunterging. Und da ihm schon beim Aussteigen aus dem Wagen nicht wohl gewesen war, ließ er es ruhig angehen. Doch als er oben ankam und die Schlüssel auf die Kücheninsel warf, fühlte er sich gut.
Gut genug für einen kühlen Schluck.
Er ging an den Kühlschrank, nahm sich eine Flasche Bier heraus und schraubte sie auf. Er wollte gerade einen ordentlichen Schluck nehmen, als sein Blick auf die Wanduhr fiel. Sie zeigte 11:47 an. Ein bisschen früh vielleicht für ein Bier, aber was soll’s.
Er hatte zu tun.
An die Küche, die zur Straße hinausging, schloss sich ein kleiner Raum an, den die Vorbesitzer als Vorratskammer genutzt hatten. Er maß nicht mehr als zwei mal zwei Meter, und Paul hatte ihn zur, wie er es nannte, »kleinsten Ideenschmiede der Welt« umfunktioniert.
Von einer zwei Meter hohen Tür, die der Vorbesitzer nach den Renovierungsarbeiten in der Garage zurückgelassen hatte, hatte er ein dreißig Zentimeter breites Stück abgesägt und daraus eine Schreibtischplatte für die hintere Wand gemacht, ein paar Stützen daruntergesetzt und die Regale an den anderen Wänden, die ursprünglich Lebensmitteldosen und -schachteln vorbehalten gewesen waren, mit Büchern vollgestellt. Einige Regale mussten weichen, um Platz für ein gerahmtes Originalplakat zum Film Plan 9 aus dem Weltall zu schaffen, das er vor Jahren in einem Laden für Filmmemorabilien in London erstanden hatte. Da der Raum fensterlos war, hatte er die Wand hinter dem Schreibtisch mit Kork verkleidet, sodass er auf Zeitungsartikel, Kalenderblätter und seine Lieblings-Cartoons aus dem New Yorker sehen konnte, die er darangepinnt hatte.
In der Mitte des Schreibtisches stand der Laptop. Außerdem fanden dort noch ein Drucker und ein paar Kartons Platz, in denen er Stundenpläne, Vorlesungen, Rechnungen und andere Unterlagen aufbewahrte.
Paul ließ sich in einen Bürostuhl mit Rollen fallen und stellte die Bierflasche neben dem Laptop ab. Er tippte auf eine Taste, um den Bildschirm zu wecken, und gab sein Passwort ein.
Gedankenversunken starrte er den Computer eine Weile nur an. Er dachte an die Zeit zurück, als er sechs Jahre alt war und seine Eltern anfingen, ihn im Sommer mit ins öffentliche Schwimmbad zu nehmen. Es war unbeheizt, und Paul brachte es nicht über sich, vom flachen Bereich langsam immer weiter in den tieferen Bereich vorzudringen, während das kalte Wasser mit jedem Schritt Besitz von seinem Körper ergriff. Es war Folter. Er beschloss, es schnellstmöglich hinter sich zu bringen, etwa wie man ein Pflaster mit einem einzigen Ruck von der Wunde abzieht, und machte einen Satz vom Beckenrand hinein, sodass er am ganzen Körper gleichzeitig vom kalten Nass umgeben war. Das einzige Problem war, dass der Rest der Familie sich manchmal schon für den Heimweg bereit gemacht hatte, bis er endlich gesprungen war.
Jetzt stand Paul wieder am Beckenrand.
Er wusste, was er tun musste.
Er musste verstehen, was ihm passiert war. Und wenn es Lücken in der Geschichte gab, würde er versuchen, sie mit dem zu füllen, was passiert sein könnte. Taten Bildbearbeitungsprogramme das nicht auch? Berechnete der Computer bei grobkörnigen, unscharfen Bildern nicht, was fehlen könnte, und nahm die entsprechende Korrektur vor?
Was hatte Kenneth diesen Frauen gesagt, bevor er beschloss, sie umzubringen? Wie waren ihre intimen Momente gewesen? Welche Lügen hatte Kenneth seiner Frau Gabriella aufgetischt, wenn sie ihn zur Rede stellte?
Selbst eine ausgedachte Geschichte wäre besser als gar keine.
Paul öffnete den Browser.
Er tippte »Kenneth Hoffman« in das Suchfeld ein.
»So, du Mistkerl«, sagte er. »Dann machen wir uns jetzt mal besser miteinander bekannt.«
Paul drückte auf Enter.
Vier
Das Beste wäre, mit dem anzufangen, was sich im Internet über den Doppelmord finden ließ, glaubte Paul. Er hatte zwar schon eine Menge gelesen, nie aber mit dem Interesse, mit dem er sich jetzt dem Thema zuwenden wollte. Er erinnerte sich, dass es zum Zeitpunkt von Kenneths Verurteilung einen ausführlichen Bericht in einer Zeitung gegeben hatte, und wurde auch schnell fündig.
Es war der New Haven Star. An das Interview, das er der Journalistin gegeben hatte, erinnerte er sich gut. Die Überschrift der Geschichte lautete: »Hochschulskandal: ›Entschuldigungskiller‹ kassiert lebenslang für Doppelmord«.
Er beugte sich näher zum Bildschirm heran und las.
Von Gwen Stainton
Es gibt Dinge, vor denen selbst Anstellungen auf Lebenszeit nicht schützen.
So wurde Kenneth Hoffman, langjähriger Professor am West Haven College – der sogenannte »Entschuldigungskiller« – gestern wegen des brutalen Doppelmordes an Jill Foster und Catherine Lamb und versuchten Mordes an seinem Kollegen und Freund Paul Davis zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Damit kam nicht nur einer der grausamsten Mordfälle dieses Bundesstaates, sondern vielleicht auch der außergewöhnlichste Skandal in der Hochschulgeschichte Neuenglands zum Abschluss.
Ein längeres Verfahren hätte vermutlich weitere Einzelheiten ans Tageslicht gebracht, aber Hoffman verzichtete darauf und bekannte sich in allen Punkten der Anklage schuldig. Die Gründe für seine Entscheidung lassen sich unschwer benennen. Im Augenblick seiner Verhaftung war Hoffman gerade dabei, die Leichen der beiden Frauen zu beseitigen. Kurz zuvor hatte er Davis mit einer Schaufel bewusstlos geschlagen.
Wäre er nicht zufällig von einem Polizisten aus Milford entdeckt worden, der ihm wegen eines defekten Rücklichts nachgefahren war, wären es vermutlich drei Leichen gewesen, die Hoffman im Wald begraben hätte. Er war auf der Suche nach einem geeigneten Ort, als er von dem Polizisten gestellt wurde.
Paul griff nach dem Bier. Lies es. Lies genau. Schau nicht weg. Der Mann wollte mich umbringen und anschließend vergraben.
Du musst dich dem stellen, sagte er sich. Du darfst nicht wegsehen. Nicht zum ersten Mal kam ihm in den Sinn, dass er demjenigen, der Hoffmans Wagen auf dem Campus-Parkplatz angefahren und das Rücklicht demoliert hatte, eigentlich sein Leben verdankte.
Nach ausführlichen Interviews mit Gerichts- und Polizeibeamten, Freunden und Angehörigen von Hoffman und dessen Opfern sowie Personen aus dem Umfeld des West Haven College ist es The Star gelungen, ein umfassendes, wenngleich nicht weniger rätselhaftes Bild von dem zu zeichnen, was sich zugetragen hat.
Kenneth Hoffman, 53, Ehemann von Gabriella, 49, Vater von Leonard, 21, gehörte seit Jahren dem Kollegium des WHC an. Seine Fachgebiete waren Mathematik und Physik, noch besser aber kannte er sich möglicherweise auf einem anderen Gebiet aus – mit anderen Menschen seine Spielchen zu treiben.
Das West Haven College war und ist eine eng verschworene Gemeinschaft, in der Affären in der Regel nicht lange unentdeckt bleiben. Darüber hätte Hoffman Kurse abhalten können. Dem Vernehmen nach war Hoffman nach außen eigentlich kein Frauenheld. Er genoss einen guten Ruf als Dozent und wurde von den Studenten bewundert. Seine Affären mit Mitarbeiterinnen oder den Ehepartnerinnen seiner Kollegen handhabte er mit äußerster Diskretion.
Beweise für eine sexuelle Beziehung zu einer Studentin gibt es nicht. Hoffman schien klar zu sein, dass ihn so etwas beruflich in ernste Schwierigkeiten bringen konnte. Auch Vorwürfe wegen sexueller Belästigung wurden gegen ihn nie geäußert.
Trotzdem wussten alle Bescheid oder hatten zumindest einen Verdacht.
»Kann man wohl sagen!«, murmelte Paul vor sich hin. Er erinnerte sich an die Frau, die er, an dem Tag gerade selbst auf dem Weg zu Kenneths Büro, mit tränenüberströmtem Gesicht zur Tür herauskommen sah. Dass Studentinnen heulend die Sprechstunde eines Dozenten verließen, kam vor, wenn ihnen zum Beispiel ein Plagiat nachgewiesen worden war. Diese Frau aber war keine Studentin, sondern eine Kollegin.
Als Paul das Büro betrat, konnte er sich die Frage nicht verkneifen: »Was ist denn passiert?«
Kenneth war das sichtlich unangenehm. Er rang um eine Antwort und brachte schließlich nicht mehr hervor als: »Es war etwas Persönliches.«
»Personalie« hatte Paul zunächst verstanden und fragte nach: »Sie ist gefeuert worden?«
Kenneth blinzelte, offensichtlich verblüfft. »Wenn sie jemanden feuern wollten, dann wäre das …«
Er sprach den Satz nicht zu Ende.
Paul las weiter.
Während es so aussah, als hätte Hoffman immer nur eine Affäre nach der anderen gehabt, räumte er nach der Verhaftung in seiner Aussage ein, mit Jill Foster und Catherine Lamb gleichzeitig zusammen gewesen zu sein, ohne dass die eine von der anderen gewusst hatte.
Hoffmans Frau, Gabriella, war ebenfalls ahnungslos. Gabriella soll laut unterschiedlichen Quellen von einigen Seitensprüngen ihres Mannes in all den Jahren gewusst haben, nicht aber, dass er in den letzten Monaten zwei Geliebte hatte.
Jill Foster war stellvertretende Vizepräsidentin der Abteilung für Studentenangelegenheiten und mit Harold Foster, dem zweiten Geschäftsführer der Spar- und Darlehensbank in Milford, verheiratet, die ihren Sitz in der Innenstadt hat. Catherine Lamb war Vertriebsleiterin bei JCPenney und die Frau von Gilford Lamb, dem Chef des Personalreferats am College.
Gleich nach seiner Verhaftung gab Hoffman der Polizei gegenüber zu, immer besessener und besitzergreifender geworden zu sein, wenn es um Frauen ging. Er wollte sie alle für sich allein haben. Es ging so weit, dass er ihnen jeden sexuellen Kontakt zu ihren Ehemännern verbot. Eine Forderung, die zu erfüllen sich natürlich keine von ihnen imstande sah und deren Beachtung von Hoffman auch kaum erzwungen werden konnte. Im Verhör erklärte Hoffman, dass er sich betrogen fühlte, wenn eine mit jemand anderem schlief als mit ihm.
»Das war vielleicht überzogen«, räumte Hoffman mit einem Satz ein, den ein Ermittler aus Milford zur Untertreibung des Jahres erklärte.
»Das würde ich glatt unterschreiben«, sagte Paul, während er den Text herunterscrollte.
In dieser Phase »überzogener Forderungen« lockte Hoffman beide in die Falle.
Eines Abends lud er sie zu sich nach Hause ein, während seine Frau und sein Sohn zu einem ausgiebigen Fahrtraining unterwegs waren. (Leonard wollte an seiner Fahrtechnik arbeiten, um seine Chance auf Jobs zu verbessern, bei denen er Lkws fahren musste.) Die beiden Frauen hatten sich vermutlich auf ein romantisches Rendezvous gefreut und dürften überrascht gewesen sein, die jeweils andere dort anzutreffen. Doch da sie sich über ihre Arbeit am College kannten, gingen sie nun wahrscheinlich davon aus, dass der Grund für die Einladung ein anderer war.
Hoffman gab den perfekten Gastgeber und bot den Frauen Wein an, den sie auch annahmen, dem jedoch ein Betäubungsmittel beigemischt war. Bald danach waren Foster und Lamb bewusstlos. Als sie zu sich kamen, fanden sie sich in der Küche auf Stühle gefesselt wieder, eine altmodische Underwood-Schreibmaschine vor sich auf dem Tisch.
Hoffman verlangte, dass sie sich schriftlich für ihr – wie er später den Ermittlern gegenüber äußerte – »unmoralisches, zügelloses und hurenhaftes Verhalten« entschuldigten.
Mit einer Hand, die Hoffman ihr losgebunden hatte, schrieb Jill Foster: »es tut mir unendlich leid, dass ich dir so viel Schmerz bereitet habe, bitte vergib mir.«
Nachdem Hoffman auch Catherine Lambs eine Hand losgebunden hatte, schrieb sie: »ich schäme mich für das, was ich getan habe, und verdiene, was immer mir geschieht.«
»Klingt, als hättest du ihnen diktiert, was sie schreiben sollen«, murmelte Paul kopfschüttelnd.
Hoffman legte die beiden Seiten aus der Schreibmaschine in eine Küchenschublade und kam mit einem Steakmesser zurück, mit dem er den Frauen die Kehle durchschnitt.
Anschließend wickelte er die Frauen in Plastikfolie ein und lud sie in den Kofferraum seines Volvos. Die alte Schreibmaschine, die mit dem Blut der Opfer besudelt war, stellte er auf den Beifahrersitz.
Nördlich von Milford fuhr er in dem Glauben an den Fahrbahnrand, ein geeignetes Waldstück gefunden zu haben, in dem er die Leichen verschwinden lassen konnte. Paul Davis, ein Kollege am West Haven College, erkannte seinen Wagen und hielt an. Als Davis die Leichen im Kofferraum des Kombis entdeckte, wollte Hoffman ihn mit der Schaufel erschlagen, die er mitgebracht hatte, um die Opfer zu vergraben.
»Wäre die Polizei nicht zufällig vorbeigekommen«, erklärte Davis später in einem Interview, »wäre ich jetzt nicht hier.«
Davis konnte sich nicht erklären, was Hoffman, seinen früheren Mentor, dazu gebracht habe, etwas so Grausames zu tun.
»Ich glaube, dass es selbst bei Menschen, die uns am nächsten stehen, immer Dinge gibt, die wir nie erfahren«, sagte Davis.