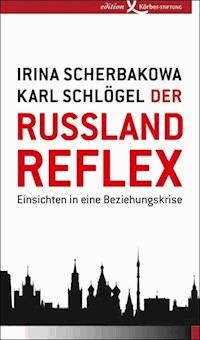9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Friedensnobelpreis 2022: Die russische Organisation Memorial mit Gründungsmitglied Irina Scherbakowa, die ukrainische Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties und Ales Bialiatski aus Belarus erhalten als Vorkämpfer für die Menschenrechte in Belarus, Russland und der Ukraine diesjährigen Friedensnobelpreis 2022. Marion-Dönhoff-Preis 2022: Irina Scherbakowa, Historikerin und Mitgründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, wird in diesem Jahr mit dem Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet. "Die Hände meines Vaters" ist eine epische russische Familiengeschichte vor dem Panorama der Oktoberrevolution, der Weltkriege wie des ganzen 20. Jahrhunderts. Die jüdische Großmutter, die Pogrome, die Oktoberrevolution und den Bürgerkrieg von 1917/18 überlebte. Der Vater, der im Zweiten Weltkrieg als Soldat um ein Haar seine Hände für immer verlor. Und sie selbst, die im berühmtem Hotel Lux aufwuchs und heute Repressionen ausgesetzt ist, weil sie sich leidenschaftlich der Aufarbeitung der Verbrechen der sowjetischen Gewaltherrschaft widmet: Irina Scherbakowa stammt aus einer Familie, die alle Schrecknisse des vorigen Jahrhunderts miterlebt hat. Und doch empfindet die renommierte Publizistin ihre Familiengeschichte als eine glückliche – sind ihre Vorfahren und sie doch immer wider alle Wahrscheinlichkeit davongekommen, Und so wird Irina Scherbakowas Buch zu einem beeindruckenden Porträt nicht nur einer Familie, der es stets mit viel Glück gelang, düstere Zeiten zu überstehen, sondern auch und vor allem die mitreißende Geschichte einer bewegten Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Ähnliche
Irina Scherbakowa
Die Hände meines Vaters
Eine russische Familiengeschichte
Aus dem Russischen von Susanne Scholl
Knaur e-books
Über dieses Buch
Die jüdische Großmutter hat die Pogrome, die Oktoberrevolution und den Bürgerkrieg von 1917/18 überlebt. Der Vater kämpfte als Offizier im Zweiten Weltkrieg vor Stalingrad. Die Familie lebte zur Stalinzeit im berüchtigten Hotel Lux: Irina Scherbakowa stammt aus einer Familie, die alle Schrecknisse des 20. Jahrhunderts miterlebt hat. Und doch empfindet die renommierte Publizistin ihre Familiengeschichte als eine glückliche – sind ihre Vorfahren und sie doch immer wider alle Wahrscheinlichkeit davongekommen, Und so wird Irina Scherbakowas Buch zu einem beeindruckenden Porträt nicht nur einer Familie, der es stets mit viel Glück gelang, düstere Zeiten zu überstehen, sondern auch und vor allem die mitreißende Geschichte eines bewegten Jahrhunderts.
Inhaltsübersicht
Gewidmet meinen Eltern
1Ein Heft für zwei
Urgroßmutter Etlja Jakubson, die erste Frau in unserer Familienmatrjoschka des 20. Jahrhunderts
Die Urgroßmutter spielt Schach
Vor hundert Jahren, im Februar 1917, kaufte meine Großmutter ein dickes Heft und gab es einem Buchbinder. Der fertigte dafür einen kunstvollen Einband aus schwerer dunkelroter Seide mit einem Rücken aus braunem Leder, auf dem in silbernen Lettern das Wort »Heft« stand und darunter die Initialen der Großmutter: MS für Mira Skepner. Das Heft war für zwei vorgesehen, für die Großmutter und ihren zukünftigen Mann Jakow Roskin, den sie im Herbst 1916 kennengelernt hatte.
Nicht alle Seiten dieses Heftes sind erhalten geblieben, viele Jahre später sollte meine Großmutter fast alle herausreißen, die sie beschrieben hatte. Sie wollte nicht, dass ihre Kinder und Enkel Einträge einer Gymnasialschülerin lasen, die ihnen sentimental und überschwänglich erscheinen mochten. Es blieben nur die Einträge des Großvaters erhalten. Aber eine ihrer Notizen überdauerte doch, und ich denke, dass das nicht zufällig geschah. Am 15. April 1917, kurz nach ihrem 19. Geburtstag, schrieb sie:
Die Ereignisse erfolgen mit schwindelerregender Geschwindigkeit. So viel Neues, Aufregendes! Das Leben klopft an die Türe, das neue Leben. Man muss die Türen weit aufreißen und dem neuen Gast mutig und freudig entgegentreten. Ich bin unendlich glücklich, dass ich jetzt lebe, jetzt Zeitung lese!
Mit diesen euphorischen Worten im Heft der Großmutter beginnt das Leben meiner Familie im 20. Jahrhundert. Die Ereignisse, über die Großmutter Mira in den Zeitungen las, waren auch wirklich unglaublich. Im März hatte Zar Nikolaus II. abgedankt und die Provisorische Regierung war gebildet worden, die unter anderem sogleich Presse- und Versammlungsfreiheit verkündet hatte sowie die Gleichheit aller Bürger Russlands ohne Unterschied des Geschlechts, des Glaubens oder der ethnischen Zugehörigkeit. Für meine Großmutter und meinen Großvater – junge Juden aus einer kleinen Kreisstadt im Südwesten des russischen Imperiums – bedeutete das eine entscheidende Veränderung. Alle diskriminierenden Einschränkungen, die 120 Jahre lang die Situation der Juden im Zarenreich bestimmt hatten, waren aufgehoben. Jetzt konnten sie sich frei in jeder Stadt des Landes ansiedeln und an jeder Universität studieren. Weil so etwas bis dahin absolut unvorstellbar gewesen war, hatte meine Großmutter an jenem 15. April 1917 vom Beginn eines neuen Lebens gesprochen, dem man »die Türen weit aufmachen« müsse. Wie neu dieses neue Leben tatsächlich sein würde, dass schon sehr bald nicht einmal mehr Spuren des vorangegangenen zurückbleiben sollten, das konnte sie sich allerdings nicht vorstellen.
Die Erinnerung meiner Familie, die ich hier nach bestem Vermögen aufzeichne, reichen nicht sehr weit zurück. Belegen lässt sich die Geschichte dieser für die damalige Zeit typischen jüdischen Familie in Russland von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an. In der alten Kreisstadt Starodub im Gouvernement Tschernigow finden sich erste Spuren meiner Vorfahren.
Die jüdische Bevölkerung, die sich hier innerhalb einiger Jahrhunderte angesiedelt hatte, kam aus Polen, der Ukraine und aus Weißrussland. Das Leben, das die Juden führten, war nicht leicht, immer wieder wurden sie Opfer blutiger Verfolgung, wie zum Beispiel im 17. Jahrhundert während des Kosaken-Aufstandes unter Bogdan Chmelnizki[1]. Regelmäßig gab es Pogrome, man jagte sie aus einem Schtetl weg, und kaum hatten sie sich in einem neuen angesiedelt, wurden sie wieder vertrieben.
Hier, im Südwesten des Russischen Reiches, waren Juden nach der zweiten Teilung Polens 1793 aufgetaucht. Durch den Petersburger Vertrag zwischen Preußen, Russland und Österreich war die Teilung besiegelt worden, und große Teile des Landes waren an das russische Kaiserreich gefallen. Nach einem Erlass der Zarin Katharina II. gestattete man den Juden, sich im sogenannten Rayon anzusiedeln. Der Ansiedlungsraum, ein ehemals zu Polen und Litauen gehörendes Gebiet von mehr als einer Million Quadratkilometern, erstreckte sich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Im Juni 1794 war dieses Territorium um das Gouvernement Tschernigow erweitert worden.
Ende der 1830er Jahre lebten in Starodub, einem wichtigen Knotenpunkt für den Handel zwischen polnischen, ukrainischen und russischen Städten, 2000 Juden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es schon 5000 von insgesamt 12000 Bewohnern.
Es ist schwer zu sagen, wann genau sich meine Vorfahren in Starodub niedergelassen haben. Ich weiß nur, dass meine Urgroßmutter Etlja Jakubson – die erste Frau in unserer Familienmatrjoschka des 20. Jahrhunderts – 1866 in der Stadt Pogar geboren wurde, wo die Familie ihres Vaters Naum Jakubson lebte. Russland befand sich damals in einer Zeit des Umbruchs. Unter Zar Alexander II. waren Reformen eingeleitet worden, die auch das Leben der jüdischen Bevölkerung ein wenig erleichterten. Sie durften sich nun auch außerhalb des Ansiedlungsrayons niederlassen, was bis dahin nur sehr reichen oder Juden mit akademischem Grad vorbehalten war. Auch die Beschränkungen, mit denen gewisse Berufe belegt waren, wurden gelockert. Juden hatten nur bestimmte Handwerke ausüben und Kleinhandel treiben dürfen. So wie meine Ururgroßmutter, die mit Porzellangeschirr handelte. Aus dieser Zeit ist ein kleiner ausgeschlagener Teller mit grünen Blümchen erhalten geblieben, den meine Großmutter Mira ihr Leben lang aufbewahrte.
Die Ehe meiner Urgroßmutter Etlja Jakubson kam durch einen Heiratsvermittler zustande. Man hatte sie nicht nach ihrer Meinung gefragt, und meine Großmutter erzählte später, Chaim Skepner sei nicht der Mann ihrer Träume gewesen. Aber die weiteren Entscheidungen in ihrem Leben sollte sie fortan selbst treffen.
Wir besitzen ein Foto von ihr, auf dem sie schon an die vierzig Jahre alt ist und das sie gemeinsam mit ihrem Mann und der Schwiegermutter zeigt. Während die beiden in angespannter Haltung vor ihr sitzen, die Hände auf dem Schoß, blickt meine Urgroßmutter Etlja selbstbewusst in die Kamera. Dem Betrachter wird sofort klar, wer hier das Sagen hatte. Sogar auf dieser gestellten Fotografie lässt sich ihr Charakter erkennen. Die kleinen tief liegenden Augen blicken ernsthaft und wach, an dem dunklen Kleid findet sich nichts Überflüssiges, sie trägt weder Hut noch Brosche, wie das auf Fotografien jener Zeit für Frauen üblich war.
Die Ururgroßmutter, deren Namen ich leider nicht weiß, Urgroßmutter Etlja und ihr Mann Chaim Skepner, um 1910
Etlja starb 1921, und was ich über sie weiß, habe ich von meiner Großmutter und ihren Schwestern erfahren. Aber da es hieß, von allen sechs Töchtern der Etlja Jakubson sei ihr meine Großmutter am ähnlichsten gewesen, kann ich mir die Stärke ihres Charakters sehr gut vorstellen, denn auch meine Großmutter war eine starke Frau. Wenngleich sie immer versicherte, mit ihrer Mutter könne sie sich nicht messen.
Ich weiß nicht, ob Urgroßmutter Etlja in eine Schule für jüdische Mädchen ging oder ob sie zu Hause unterrichtet wurde. Großmutter Mira erzählte, ihre Mutter habe die Bücher der russischen Klassiker, die sie in Warschau bestellte, nicht auf Russisch, sondern auf Jiddisch gelesen. Sie war jedenfalls nicht nur gebildet, sondern der Wohlstand der Familie und die gesamten Lebensumstände hingen von ihr ab. Etljas Mann, mein Urgroßvater Chaim, war religiös, etwas wunderlich und zerstreut und mischte sich nicht besonders in die Dinge des täglichen Lebens ein. Meine Großmutter erzählte, dass keines der Geburtsdaten ihrer sechs Schwestern und zwei Brüder gesichert war, denn es war stets Aufgabe des Vaters, in die Stadt zu fahren, um die Neugeborenen registrieren zu lassen. Und Chaim, ein zerstreuter und vergesslicher Mensch, bestimmte Jahr und Tag der Geburt ziemlich vage – er erinnerte sich zum Beispiel, dass eines seiner Kinder am Tag vor Pessach auf die Welt gekommen war. Deshalb steht in den Papieren meiner Großmutter auch, dass sie nur wenige Monate nach ihrer älteren Schwester geboren wurde, was in der Familie immer wieder für Gelächter sorgte.
Ich weiß nicht genau, wann Urgroßmutter Etlja beschloss, die Stadt Starodub zu verlassen, in der alle ihre Verwandten lebten. Es mag sein, dass die angespannte Atmosphäre in der übervölkerten Stadt, wo im ausgehenden 19. Jahrhundert fast die Hälfte der Bewohner Juden waren, zum Ortswechsel beigetragen hat. 1891 jedenfalls kam es in Starodub zu einem Pogrom, ausgelöst durch die Erlaubnis für die Juden, am Sonntag auf dem Marktplatz Handel zu treiben. In der Stadt brannten jüdische Häuser, jüdische Geschäfte wurden ausgeraubt, Fenster gingen zu Bruch, und Juden, die sich nicht rechtzeitig hatten verstecken können, wurden verprügelt.
Irgendwann um diese Zeit ging Etlja mit ihrem Mann und den älteren Kindern nach Iwaitenki. In diesem Dorf, 30 Kilometer von Starodub entfernt, wo die jüngeren Kinder geboren wurden, wollte sie sich in der Landwirtschaft betätigen. Ein erstaunlicher Schritt, als Frau und als Jüdin. Alexander III. hatte die Reformen, die sein Vater Alexander II. für die jüdische Bevölkerung auf den Weg gebracht hatte, weitgehend zurückgenommen. De facto war es Juden im Russischen Reich bis 1917 verboten, Land zu bestellen. Allein schon für die Pacht brauchte Urgroßmutter einen Strohmann – einen russischen Kaufmann –, der für seine Dienste eine monatliche Zahlung erhielt. Das Land, das sie in Iwaitenki pachtete, war seit dem 17. Jahrhundert im Besitz der inzwischen verarmten Familie des Grafen Gudowitsch. Hier wollte sie Tabak anbauen, eine wirtschaftlich gesehen sehr kluge Entscheidung: In jenem Teil des Landes gedieh Tabak gut, und Pogar, die Geburtsstadt meiner Urgroßmutter, lag kaum 50 Kilometer entfernt und schickte sich gerade an, ein Zentrum der Tabakverarbeitung zu werden. Bald sollte die dortige Tabakfabrik zu einer der wichtigsten in Russland werden. Die Bevölkerung in der Gegend war sehr arm, es gab also genügend Arbeitskräfte, die Etlja anheuern konnte. Und sie schien ein glückliches Händchen gehabt zu haben, denn das Geld aus dem Tabakanbau reichte, um die stetig wachsende Familie zu ernähren.
In den 1890er Jahren traf meine Urgroßmutter eine weitere und für die Familie lebenswichtige Entscheidung. In einer Zeit, da der Antisemitismus im Russischen Reich wieder deutlich zunahm, wählte sie für ihre Kinder den Weg der Assimilation. Für sie war das eine klare, eine naheliegende Entscheidung. Im Gegensatz zu ihrem Mann Chaim war ihr die Religion gleichgültig, sie hielt die jüdischen Feiertage nur formell ein und sprach mit den Kindern nur russisch. Weil auch die Kinderfrau Russin war, wuchs meine Großmutter auf, ohne Jiddisch oder auch nur das hebräische Alphabet zu lernen. Ein Kind nach dem anderen wurde ab dem zehnten Lebensjahr zur Ausbildung nach Starodub geschickt, wo es nicht nur ein Jungengymnasium, sondern ab 1902 auch eines für Mädchen gab.
Urgroßmutter wollte ihnen alle Chancen offenhalten, nach Möglichkeit sollte auf den Schulabschluss ein Studium folgen. Das war wichtig, denn bis 1917 durften außerhalb des Siedlungsrayons nur Juden mit höherer Ausbildung oder großem Besitz leben. An die Universität zu gelangen war damals nicht leicht, denn an den Universitäten galten Quoten für Juden, die bis 1917 mehrmals verschärft wurden. Im Ansiedlungsrayon lag sie bei 10 Prozent, obwohl Juden dort 40 Prozent der Bevölkerung stellten. In anderen Teilen galt eine 5-Prozent-Quote, in Moskau und St. Petersburg lag sie bei nur 3 Prozent.
Doch bis für die Kinder die Schulausbildung begann, ließ Urgroßmutter Etlja ihnen in Iwaitenki viele Freiheiten. Meine Großmutter Mira, das fünfte Kind von 14, von denen allerdings nur acht überlebten, stromerte stundenlang über die Felder und durch die Wälder der Umgebung. Sie hatte vor nichts Angst, weil sie immer von ihrem riesigen Hund Mischka begleitet wurde, der in den Erzählungen meiner Großmutter über ihre Kindheit eine wichtige Rolle spielte. Die Gegend rund um Iwaitenki war für sie bis zum Ende ihrer Tage die schönste auf der Welt. Ich glaube, dass in jenen jungen Jahren und in dieser Umgebung in ihr die Überzeugung reifte, ein glückliches Leben führen zu können.
Nicht nur die Großmutter liebte jene Gegend. So hat ein Reisender sie beschrieben, der am Beginn des 19. Jahrhunderts dorthin gelangt war:
Je näher man Iwaitenki kommt, umso eindrücklicher erhebt sich die Landschaft, die fruchttragenden Felder, auf denen der Buchweizen wächst, der junge Wald von wunderschönen sauberen Birken. Je weiter man geht, umso deutlicher sieht man die Freundlichkeit und das Wunderbare des ganzen Ortes. Die ununterbrochene Vielfältigkeit des Landes und der Hügel, der Wälder, Wiesen und Felder, des wunderbaren Blicks macht einen unvergesslichen Eindruck. Schade nur, dass es dem Unterfertigten nicht gegeben ist, lange Zeit in diesem herrlichen Erdenfleckchen zu verweilen. Ich glaube, dass, wer sich im Frühling oder zur besten Zeit des Sommers hier aufhält, keine Sehnsucht nach dem Süden Europas haben kann!
Ebendort entstand auch die ewige Sehnsucht der Großmutter nach Land. Wenn wir auf unserer Datscha außerhalb von Moskau waren und sie die dortige Lehmerde sah, zog sie immer einen Vergleich zu Iwaitenki: »Die Erde dort war schwarz und so fett, dass man sie hätte aufs Brot streichen können!« Als Kind brachte mich diese Aussage etwas durcheinander, denn ich stellte mir das buchstäblich vor: eine Semmel mit einem großen Klacks schwarzer Erde drauf.
Meine Großmutter verbrachte ihre Kindheit weder im Schtetl noch in Starodub, wo sie in einem jüdischen Umfeld gelebt hätte, sondern auf dem Land. Deshalb hatte sie auch keine Probleme, mit den »einfachen Leuten« zu reden. Sie war weder arrogant noch von den Ängsten der Intelligenzija geplagt, sie unterwarf sich weder noch spielte sie sich auf. Und sie fühlte sich in Russland nie fremd, nie als »Zugereiste«, sondern betrachtete sich von klein auf als Teil des Volkes.
Die Urgroßmutter führte ein offenes Haus, sie war sehr gastfreundlich und konnte Leere nicht ertragen. Was hin und wieder zu Verwerfungen mit der Kinderfrau geführt haben muss. Meine Großmutter erinnerte sich daran, dass die Kinderfrau sich sehr aufregte, wenn Etlja mit ihrem ältesten Sohn Lew und dessen Studentenfreunden Schach spielte und über das Leben redete, anstatt dafür zu sorgen, dass die jüngeren Kinder gefüttert und ins Bett gebracht wurden.
Lew war, wie die Mehrheit der jüdischen Jugend, Sozialrevolutionär und ein entschiedener Gegner des Zarenregimes. Die Sozialrevolutionäre – ein besonderer Zweig der breiten Bewegung der »Narodniki« (nach dem russischen Wort »narodnik«, Volksfreund) – wollten Russland erneuern, das Land unter den Bauern aufteilen und diese zum Sozialismus führen.
Im Jahrzehnt nach der Revolution wurde Lew mehrmals verhaftet. Im Gefängnis wurde er krank, und nachdem er schließlich wieder freigelassen wurde, starb er Ende der 1920er Jahre. Meine Großmutter war von klein auf überzeugt, dass ihr Bruder in Bezug auf das Land und die Lage der Bauern vor 1917 recht gehabt hatte. Viele Jahre später, in den 1960er oder 1970er Jahren, als meine Eltern und ich einmal darüber redeten, wohin die Machtergreifung der Bolschewiki Russland geführt hatte, wiederholte die Großmutter immer nur eines: »Ihr habt nicht gesehen, wie das russische Dorf vor der Revolution lebte und wie sehr wir uns nicht langsame, sondern sofortige Veränderungen gewünscht haben!«
Bei einem der örtlichen Narodniki fand ich eine Beschreibung der Dörfer rund um Iwaitenki vom Beginn des 20. Jahrhunderts, so wie die Großmutter sie gesehen hatte:
Armut, Elend und Schmutz springen sofort ins Auge. Aber trotz der wirklich ganz offensichtlichen Armut – welcher unglaubliche Alkoholismus! Manche haben ein halbes Jahr lang kein Brot, die ganze Familie ernährt sich ausschließlich von Kartoffeln, es gibt kein Futter für das Vieh, keine warme und ordentliche Kleidung, eine Menge anderer Probleme, für deren Lösung das Geld nicht reicht, das man auch nirgends aufbringen kann, aber für Wodka reicht es immer, der ist bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit vorhanden. Und erstaunlicherweise trinken die Ärmsten, die Elendsten manchmal mehr als die wohlhabenderen Menschen! Sie tränken aus Kummer, sagen die einfachen Dörfler.
Die Großmutter musste natürlich zugeben, dass die harte Politik Stalins den Bauern nicht nur nichts gebracht hatte (wonach die Sozialrevolutionäre gestrebt hatten, die von den Bolschewiki gleich nach der Machtergreifung ausgeschaltet wurden), sondern ihre Lage stark verschlechterte. Aber damals, 1917, wirkten auf sie und meinen Großvater die sehr einfachen politischen Losungen Lenins: das Land den Bauern, Friede den Völkern und Brot den Hungernden.
Was die Zigeunerin vorhersagte
Als Großmutter Mira zehn Jahre alt wurde, war es mit ihrem freien Leben in Iwaitenki vorbei. Die Mutter setzte sie in die Kutsche, die schon voll war mit Lebensmitteln für die Verwandten und die Direktorin des Mädchengymnasiums, und brachte sie nach Starodub. In ihr geliebtes Iwaitenki kam sie jetzt nur noch in den Ferien, die sie immer ungeduldig erwartete. (Als diese Gegend siebzig Jahre später an die Sperrzone um Tschernobyl grenzte, war sie zum Glück nicht mehr am Leben.)
Meine Großmutter liebte es, von ihrem ersten Tag am Gymnasium zu erzählen, das ihre ältere Schwester Rachel kurz zuvor abgeschlossen hatte. Rachel war schlank, hatte einen wunderbaren Zopf, war sehr gebildet, zurückhaltend und von ausgeglichenem Charakter. Nie beteiligte sie sich an den kleineren oder größeren Streitereien, die es ständig und vor allem zwischen Esfir und Lija gab, den anderen älteren Schwestern meiner Großmutter. Rachel ließ sich aber auch nicht erweichen, die zwei miteinander zu versöhnen, was meine Großmutter ihr Leben lang versuchte.
Die Direktorin des Gymnasiums erwartete in Mira eine kleinere Ausgabe ihrer älteren Schwester, doch darin hatte sie sich gründlich getäuscht. Die neue Schülerin war rothaarig, sommersprossig, nicht besonders erzogen, lachte gerne, hatte eine hässliche Schrift und machte unglaubliche Fehler. Aber da es am Mädchengymnasium keine Beschränkungen für die Aufnahme jüdischer Schülerinnen gab und die Urgroßmutter immer pünktlich für den Unterricht ihrer Töchter zahlte und die Direktorin beschenkte, wurde auch Mira in die Vorbereitungsklasse aufgenommen.
Sie lebte von nun an in der Stadt bei ihrer Tante, der Schwester der Urgroßmutter, und freundete sich sehr mit ihrer Cousine an, die dasselbe Gymnasium besuchte. (Es war 1902 im neoklassizistischen Stil gebaut worden, so wie man zu jener Zeit in der Provinz solche öffentlichen Gebäude eben baute. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Schule schwer beschädigt, in den 1950er Jahren aber wiederaufgebaut, und noch heute befindet sich die örtliche Schule dort.)
Mira kam 1908 nach Starodub, einige Jahre nach einem besonders schrecklichen Pogrom an den Juden. Am 17. Oktober 1905, während der ersten russischen Revolution, sah sich Zar Nikolaus II. genötigt, das sogenannte Oktobermanifest zu verkünden, das die Bildung einer Volksversammlung beinhaltete und den Untertanen eine ganze Reihe bürgerlicher Freiheiten versprach.[2] Die Bevölkerung war aufgerüttelt, überall fanden Kundgebungen statt. Die Ersten forderten weitergehende Reformen, erstmals wurden auch Stimmen laut, die die Abschaffung judenfeindlicher Gesetze wie die des Ansiedlungsrayons verlangten. Die russischen Ultrarechten, die sogenannten Schwarzen Hundertschaften, die sich den Monarchismus, den Großmacht-Chauvinismus und den Antisemitismus auf ihre Fahnen geschrieben hatten, strömten auf die Straßen. Unter ihren Anhängern verbreitete sich das Gerücht, die Juden hätten den Zaren gezwungen, seine Macht einzuschränken und das Oktobermanifest zu verkünden. In unzähligen Städten und Schtetln kam es daraufhin zu blutigen Pogromen, in deren Verlauf Hunderte Menschen getötet wurden und Tausende verletzt. Auch an Starodub ging das nicht spurlos vorbei: die Synagoge wurde niedergebrannt, ebenso die meisten jüdischen Geschäfte, es gab Tote.
Unsere Familie hatte Glück, keiner unserer Verwandten kam damals zu Schaden. Und meine Großmutter erzählte, dass es ihrem Großvater sogar gelungen sei, der marodierenden Meute ein Schnippchen zu schlagen. Während die noch durch die Nachbarstraße zog, zerschlug er die Fenster des Hauses, warf Kleider in den Hof und zerschnitt die Federbetten, damit es so aussah, als sei die Meute schon da gewesen. Solche Geschichten wurden in vielen Familien erzählt und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so gewesen war.
Wie auch immer, diese Pogrome hatten Folgen, auch in Starodub. Zum einen radikalisierte sich die jüdische Jugend sehr stark, nach 1917 waren viele aktiv an der Revolution beteiligt, darunter auch mein Großvater. Zum anderen setzte eine Emigrationswelle ein: Großmutter erinnerte sich daran, in den Gesprächen der Erwachsenen oft das Wort »Schiffskarte« gehört zu haben. Es ging um Passagen nach Amerika oder Argentinien, die jüdische Organisationen für jene bezahlten, die emigrieren wollten. Die Frage der Emigration wurde auch in unserer Familie besprochen. Mein Urgroßvater Chaim Skepner legte plötzlich Entschlossenheit an den Tag und reiste nach Palästina, um auszuloten, ob man sich dort niederlassen konnte. Er trat die Reise nicht alleine an, sondern mit einer ganzen Gruppe von Juden, die den gerade aus dem Gefängnis freigelassenen Menachem Beilis begleitete. Beilis, Aufseher einer Kiewer Ziegelbrennerei, war 1911 wegen des angeblichen Ritualmordes an einem ukrainischen Knaben verhaftet worden, der Fall wurde politisch instrumentalisiert und zu einer Art russischer Dreyfus-Affäre. Er spaltete die russische Gesellschaft und war ähnlich wie die berühmte französische Affäre von Antisemiten in der russischen Regierung inszeniert und, unterstützt von der Schwarzen Hundertschaft, zu einem Politikum gemacht worden. Im Unterschied zu Dreyfus wurde Beilis aber freigesprochen und reiste sofort mit seiner Familie nach Palästina, um nie mehr nach Russland zurückzukehren.
Anders mein Urgroßvater. Ich weiß nicht, warum meine Familie am Ende nicht nach Palästina übergesiedelt ist. Vielleicht war dem Urgroßvater das Leben dort zu schwer erschienen, oder die Urgroßmutter hatte nicht ohne ihre älteren Kinder weggehen wollen, die gar nicht daran dachten, Russland zu verlassen. Vielleicht hat aber auch der wenig später beginnende Erste Weltkrieg entsprechende Pläne zunichtegemacht.
Während ihrer Zeit im Gymnasium von Starodub hatte meine Großmutter Heimweh nach zu Hause, nach Iwaitenki. Zum Glück fand sie in der Stadt viele Freundinnen, mit einigen von ihnen war sie ihr weiteres Leben lang befreundet. Ein paar von ihnen lernte ich noch persönlich kennen, andere kannte ich nur von alten Fotos. Allerdings war es schwer, in den Gesichtern dieser vom sowjetischen Leben gezeichneten alten Frauen die hübschen Gymnasialschülerinnen wiederzuerkennen, die der immer gleiche Fotograf damals in Starodub aufgenommen hatte.
Großmutter Mira (vorne rechts) mit ihren Schulfreundinnen, 1915
Als sie ungefähr 13 Jahre alt waren, spazierten die Mädchen einmal in einer größeren Gruppe durch die Stadt. Eine Zigeunerin trat in ihren Weg und bot ihnen an, die Zukunft aus der Hand zu lesen. Sie waren alle neugierig, und die Zigeunerin, wie es ihr jahrhundertealter Beruf verlangte, versprach ihnen für wenig Geld Wunderbares für die Zukunft: weite Reisen, bildschöne Bräutigame, Reichtum. Doch als die Reihe an meiner Großmutter war, sagte sie: »Dir sind kein Geld und keine großen Reisen vorherbestimmt. Aber du wirst mit deinen Kindern und Enkelkindern Glück haben!«
Die Mädchen kicherten, wer kann sich in diesem Alter schon Enkel vorstellen? Meine Großmutter war natürlich enttäuscht. Den anderen hatte die Zigeunerin ein interessantes, ja sogar romantisches Leben in Wohlstand versprochen, ihr »nur« Kinder und Enkel! Aber wenn sie sich später an diese Geschichte erinnerte, sagte sie immer: »Die Zigeunerin hat doch recht gehabt!«
Im Herbst 1916 lernte meine Großmutter Jakow Roskin kennen. Er war schon 22, vier Jahre älter als sie. Aber gemäß seinen Einträgen in jenem gemeinsamen dunkelroten Heft spielte der Altersunterschied keine Rolle: Die Großmutter war damals bereits die Dominierende in ihrer Verbindung, und daran sollte sich auch nichts mehr ändern.
Im Gegensatz zur verhältnismäßig wohlhabenden Familie meiner Großmutter (was nur der Energie und Geschäftstüchtigkeit meiner Urgroßmutter zu verdanken war) kam mein Großvater aus einer sehr armen Familie. Jakow musste später keine vorrevolutionären Besitztümer verschweigen, wie das viele taten, um ihre soziale Herkunft in den Fragebogen zu vertuschen, nachdem die Zugehörigkeit zur besitzenden Klasse zu einem großen Makel geworden war. Mein Großvater war das älteste von vier Kindern. In der Biografie für seine Kaderakte schrieb er 1939: »In der Kleinstadt lebte die jüdische Familie eines Kleinhändlers in der ewigen Angst vor Verelendung. Aber als ich, sein ältester Sohn, zehn Jahre alt wurde, brachte mich mein Vater im örtlichen Gymnasium unter.«
Großvater Jakow (obere Reihe Mitte) als Gymnasiast in Starodub, 1912
Wie in vielen jüdischen Familien, so sah man auch in der meines Großvaters in der Bildung die einzige Möglichkeit, die Armut zu überwinden. Allerdings hatten die Roskins nicht genügend Geld, um das Schulgeld zu bezahlen. »Mit 14 Jahren begann ich, Geld zu verdienen, indem ich schlechtere Schüler unterrichtete. Mit meinem Verdienst erhielt ich mich nicht nur selbst, ich half auch der Familie«, schrieb mein Großvater.
Jakow beendete das Gymnasium zwei Jahre vor Beginn des Ersten Weltkrieges, aber wegen der Beschränkungen, die für die Aufnahme jüdischer Studenten galten, konnte er nicht wie erhofft an der Kiewer Universität sein Studium aufnehmen. Ein Jahr lang gab er weiter Nachhilfeunterricht, und als er ein wenig Geld zusammengespart hatte, fuhr er im Herbst 1913 ins mährische Brünn, wo er in das Polytechnikum eintrat.
Doch schon ein Jahr später, im Sommer 1914, musste Jakow nach Starodub zurückkehren. Das ärmliche, halbverhungerte Leben, das er führte, hatte seine Gesundheit angegriffen, er bekam Lungentuberkulose. Er wurde von der Armee zurückgestellt und schlug sich irgendwie durch, indem er verschiedene Gelegenheitsarbeiten übernahm. Aus den späteren Briefen an Mira geht hervor, dass das für ihn eine sehr schwere Zeit gewesen war. Immer wieder kam er ins örtliche Krankenhaus, in ein Zimmer mit anderen Tuberkulose-Patienten, von denen einer nach dem anderen starb.
Wie ihm schien, war die Begegnung mit meiner Großmutter seine Rettung. Mira war sehr optimistisch und lebensfroh, und das, so meinte er, habe ihn ins Leben zurückgeholt.
In jenem Herbst 1916, als sie sich zum ersten Mal begegneten, ging meine Großmutter in die letzte Klasse des Gymnasiums und hatte nichts mehr mit jenem Dorfmädchen gemein, das man acht Jahre zuvor in die Stadt gebracht hatte. Sie war eine schöne junge Frau mit rotbraunem Haar, die Hamsun und Ibsen liebte und inzwischen auch eine schöne Schrift hatte. Vor allem aber war sie für ihr Alter sehr erwachsen, energisch und entschieden. Das erkannte sogar die strenge Direktorin des Gymnasiums an, die nach ihrer Abschlussprüfung zu ihr sagte: »Dass aus so einer Bauerngretel so ein gebildetes Mädchen geworden ist!«
Wie die plötzlich zwischen Mira und Jakow entflammte Liebe von meiner Urgroßmutter aufgenommen wurde, weiß ich nicht. Jakow, der nur wenige Straßen von Mira entfernt lebte und ihr trotzdem täglich mehrere Briefe schrieb, konnte aber eigentlich nicht als akzeptabler Bräutigam angesehen werden: Er war arm, hatte keinen Beruf und war krank. Doch meine Urgroßmutter hatte ihre Kinder nicht umsonst so frei erzogen – ihre Töchter durften selbst entscheiden, mit wem sie ihr Schicksal verbinden wollten. Aber wer weiß, vielleicht hätte die Geschichte eine andere Wendung genommen, wenn nicht im Februar 1917 die Revolution begonnen hätte, die alles veränderte.
Mira, Jakow und Miras Cousine (rechts) 1917 in Starodub
»Freiheit! Freies Leben!«, schrieb mein Großvater am 3. März 1917[3] in jenes dunkelrote Heft. »Was für eine Freude, was für ein Glück! Vor uns liegt die Freiheit – vor allen 200 Millionen Menschen!« Das klingt sogar noch enthusiastischer und naiver als der Eintrag der Großmutter.
Natürlich konnten sich zu jenem Zeitpunkt, unmittelbar nach der Abdankung des Zaren, nicht nur meine Großeltern – junge Menschen aus der Provinz –, sondern auch jene, die in Russland die Macht übernommen und die Provisorische Regierung eingesetzt hatten, nicht vorstellen, was ein halbes Jahr später, im Oktober 1917, geschehen würde. Gut möglich, dass mein Großvater damals wirklich noch nichts von jenem Menschen gehört hatte, der genau einen Monat nach der Abdankung des Zaren aus der Schweizer Emigration kommend mit einer Gruppe Gleichgesinnter in einem versiegelten Waggon am Finnischen Bahnhof in Petrograd ankommen sollte. Die kleine ultralinke Partei, der sie vorstanden, zählte zu jenem Zeitpunkt in ganz Russland nicht einmal 25000 Mitglieder. Schon ein Jahr später sollten die Bolschewiki einen blutigen Bürgerkrieg vom Zaun brechen, dessen wichtigster Schauplatz die Ukraine sein würde.
Im Sommer 1917 verbesserte sich der Gesundheitszustand meines Großvaters – vielleicht hat auch seine revolutionäre Euphorie dazu beigetragen, die Krankheit zu besiegen. Nach der Februarrevolution herrschte in Russland ein Nebeneinander von Provisorischer Regierung und Arbeiter- und Soldatenräten. Solche Räte waren landesweit ins Leben gerufen worden, und Jakow war mit Feuereifer dabei. Er stand der Provisorischen Regierung immer kritischer gegenüber, zumal der Weltkrieg, der ihm sinnlos erschien, weiterging. Weder er noch meine Großmutter teilten jene Verehrung und jenen Enthusiasmus, der in jenen Monaten Alexander Kerenski zuteilwurde, der zunächst Kriegsminister und dann Vorsitzender der Provisorischen Regierung wurde.[4]
Die Zeitungen wetteiferten damals darum, den selbstverliebten, ständig posierenden und am Ende nur allzu leicht von den Bolschewiki abgesetzten Anführer der Februarrevolution mit Komplimenten zu überschütten. Kerenski wurde als »Ritter der Revolution«, »Volkstribun«, »Geist der russischen Freiheit«, »Volksführer«, »Retter des Vaterlandes« und so weiter beschrieben. Selbst meine Großmutter hatte keinen Monat nach der Absetzung des Zaren zu ihrer Abschlussprüfung das Thema »Alexander Kerenski – ein Ideal als Mensch und Bürger« bekommen. Als ich sie später fragte, was sie geschrieben und wie sie sich da rausgeredet habe, sagte sie schmunzelnd: »Ich hab einfach beschrieben, wie ich mir dieses Ideal vorstelle, und am Ende hab ich gesagt, dass es Menschen gibt, die meinen, dass Kerenski diesem Ideal entspricht.«
Nach ihren Briefen zu urteilen hatte meine Großmutter einen sehr genauen Plan für die Zeit nach ihrer Abschlussprüfung. Sie wollte nach Kiew gehen und sich dort an der medizinischen Fakultät einschreiben. Denn im März 1917 waren alle Einschränkungen für Juden abgeschafft worden. Jakow, der sich nicht von ihr trennen wollte, kam mit.
Natürlich kannte er damals die Bilder nicht, die Marc Chagall zu dieser Zeit in der weißrussischen Stadt Witebsk malte, ja er wusste nicht einmal, dass es diesen Maler gab. Aber gerade, als Chagall sein berühmtes Bild »Über der Stadt« malte, in dem ein junges Paar über die kleinen Häuser eines Städtchens wie Starodub fliegt, schrieb mein Großvater eine Notiz in das dunkelrote Heft, die wie eine Unterschrift zu Chagalls Bild wirkt: »Meine Liebste, wir fliegen! Wir betrachten das uns umgebende Leben jetzt von oben. Wir sind so stark, dass uns die Schwierigkeiten des Lebens nicht erschrecken dürfen. Wir sind immer beisammen …«
Im Strudel des Bürgerkrieges
Meine Großmutter liebte Michail Bulgakows Roman »Die weiße Garde«[5], in dem das Leben in Kiew in den Jahren 1918/1919 beschrieben wird. Es schien ihr, als ob nur Bulgakow imstande gewesen wäre, das Chaos und das Durcheinander zu beschreiben, das damals in dieser Stadt herrschte. Der Beginn des Romans war für sie wie eine Metapher auf ihr damaliges Leben in Kiew:
Groß war es und fürchterlich, das eintausendneunhundertachtzehnte Jahr nach Christi Geburt, das zweite nach Beginn der Revolution. Reich war es im Sommer an Sonnenschein und im Winter an Schnee, und besonders hoch standen am Himmel zwei Sterne: der abendliche Hirtenstern Venus und der rote, flimmernde Mars. […] Über dem Dnepr ragte das mitternächtliche Wladimir-Kreuz von der sündigen, blutüberströmten und verschneiten Erde in die düstere Höhe. Von Weitem schien es, als wäre der Querbalken verschwunden und mit dem senkrechten Balken verschmolzen und als hätte sich das Kreuz in ein drohendes scharfes Schwert verwandelt.
Als sie im September 1917 in Kiew ankamen, waren Mira und Jakow noch voller Hoffnungen. Sie hatten sich ein Zimmerchen bei Bekannten gemietet und genossen das Leben in der Stadt. Doch bald schon war klar, dass sie nicht lange studieren würden. Bereits im Spätsommer hatte sich angedeutet, dass der nach wie vor andauernde Krieg die Arbeiter- und Soldatenräte spaltete. Es kam zu einem Linksruck, Lenins Bolschewiki beherrschten die Sowjets – die Arbeiter- und Soldatenräte – von Moskau, Petrograd und anderen großen und wichtigen Arbeiterstädten. Und im Oktober schließlich erfolgte der Putsch unter Lenins Führung in Petrograd gegen die Provisorische Regierung.
Bis zu ihrem endgültigen Sieg im Jahr 1920 versuchten die Bolschewiki zweimal, die Sowjetmacht in Kiew zu errichten. Und in all dieser Zeit kämpften in Kiew und der gesamten Ukraine verschiedene Kräfte gegeneinander: Anhänger der Provisorischen Regierung, darunter vor allem Tausende Offiziere der russischen Armee, die nach dem Waffenstillstand mit Deutschland dort feststeckten. Das waren andererseits deutsche Einheiten, die Kiew und andere Teile der Ukraine besetzt hatten und die die 1918 ausgerufene Ukrainische Volksrepublik mit dem Hetman Skoropadskyj an der Spitze unterstützten. Und die sogenannte dritte Kraft – verschiedene Gruppierungen unter der Führung von Ataman Petljura.
»Demonstration für die Freiheit«, wie auf dem Transparent zu lesen ist, im März 1917 in Petrograd
© Archiv Internationale Gesellschaft Memorial
Für die Zeitgenossen war es schwer, sich in diesem Durcheinander zurechtzufinden. Von 1917 bis 1920 wechselten die Machthaber in Kiew 14-mal! Am ruhigsten war die Zeit von März bis Dezember 1918, als die Stadt von den Deutschen besetzt war. Die Kiewer Bürger sind sich in ihren Erinnerungen an jene dunkle Zeit in einem einig: »Unter den Deutschen« habe Ordnung geherrscht, es sei ungefährlich gewesen, sich auf der Straße aufzuhalten, in den Geschäften habe es Waren zu kaufen gegeben, und die Restaurants und Theater seien voll gewesen. (Diese Erinnerungen an die ruhige Zeit der deutschen Besatzung sollten noch eine verhängnisvolle Rolle spielen, als 23 Jahre später eine ganz andere deutsche Armee in Kiew einmarschierte.)
Kiew war 1918 voll mit Leuten aus Moskau und Sankt Petersburg, die vor dem beginnenden roten Terror der Bolschewiki geflüchtet waren. Unglaublich, wie viele Großmütter und Großväter meiner Bekannten und Freunde damals in Kiew waren! Meine hingegen entschieden sich, nach Starodub zurückzukehren. In ihrer Heimatstadt erschien es ihnen sicherer als in diesem blutigen Durcheinander des beginnenden Bürgerkrieges.
Allerdings war es auch in Starodub alles andere als ruhig. Die Stadt war in der Hand deutscher Einheiten, nur einige Dutzend Kilometer entfernt lag die Macht wiederum in der Hand der Roten Armee. Meine Großeltern hätten sich auch nicht im bis dahin so friedlichen Iwaitenki verstecken können. Das gräfliche Landgut war abgebrannt, das Haus der Urgroßmutter zerstört, die Felder verwüstet. Ihres Eigentums und ihrer Lebensgrundlage beraubt, hatte Etlja mit den jüngeren Kindern Zuflucht bei Verwandten in Starodub gefunden.
Die kleine Stadt war hoffnungslos überfüllt mit Flüchtlingen, Jakow und Mira hatten kein Geld, sodass ihnen nichts anderes übrigblieb, als bei Jakows Eltern unterzuschlüpfen. Meine Großmutter hätte sich nicht träumen lassen, dass sie jemals mit solchem Elend konfrontiert sein würde. Ihre Schwiegermutter verließ das Bett kaum noch, und im Haus gab es praktisch nichts, nicht einmal Bettwäsche. Mira krempelte die Ärmel hoch und versuchte nach Kräften, die schlimme Lage zu verbessern. Die Rettung kam in Form von Säcken mit Meersalz, die sie im Schuppen fanden. Irgendwann einmal hatte der Arzt Jakows Mutter Bäder mit diesem Salz verschrieben, und seit jener Zeit lagen diese Säcke da. Im Hungerjahr 1918 war Salz unglaublich rar, und sie verkauften es nach und nach auf dem Markt.
Vor diesem ohnehin schon düsteren Hintergrund ereignete sich eine Familientragödie, von der meine Großmutter, die so viel über jene Zeit sprach, nie genau erzählte. Vielleicht weil sie bis ans Ende ihrer Tage der Meinung war, dass die Verantwortung für die Familie und alle ihre Mitglieder bei ihr lag. Auch wenn sie in diesem Fall machtlos war. In der Familie meines Großvaters Jakow gab es Tuberkulose, eine Krankheit, die oft das Elend begleitet. Ihm selbst war es zum Glück gelungen, die Tuberkulose zu besiegen, aber für seinen jüngeren Bruder mündete sie in den Tod. Der talentierte junge Künstler hatte wegen der Lungenkrankheit sein Studium an der Kunstakademie in Kiew abbrechen und nach Hause zurückkehren müssen. Damit konnte er sich nicht abfinden. Die Krankheit schien ihm jede Perspektive genommen zu haben, er kämpfte mit Depression, und während eines seiner Anfälle erschoss er sich. Wir haben kein Foto von ihm, nur eine Mappe mit wunderschönen Zeichnungen. Auf einer ist meine Großmutter Mira zu sehen, wie sie sich im Hof ihr langes Haar in einer Schüssel wäscht.
Zeichnung von Haim Roskin, 1919: Mira wäscht sich die Haare in einer Schüssel
In den Jahren 1918 und 1919 sympathisierte mein Großvater vielleicht nicht direkt mit den Bolschewiki, sehr wohl aber mit den linken Sozialisten. Gemeinsam mit einigen seiner Freunde trat er der Jüdischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei »Poale Zion« (»Arbeiter Zions«) bei. Diese Partei, die damals unter jungen Juden sehr populär war, machte aktiv Propaganda für den Zionismus und warb für die Idee einer Übersiedlung nach Palästina. In den Jahren von 1919 bis 1922 entbrannten in der Partei heftige ideologische Diskussionen. Es herrschte Uneinigkeit, ob man der Sozialistischen Internationalen beitreten und auf die zionistische Ideologie verzichten sollte. Im Dezember 1922 löste die Partei sich schließlich auf. Ein Teil der Mitglieder, die sich zu bolschewistischen Positionen bekannten, wurde in die Reihen der Kommunistischen Partei Russlands, KPR (B)[6] aufgenommen.
Großvater vollzog diesen Schritt schon nach einem Jahr bei »Poale Zion«. Sein Weg war jetzt der der neuen Machthaber, wobei er sich in der Folge immer wieder wegen seiner vorangegangenen »kleinbürgerlichen und mit den Ideen des Zionismus zusammenhängenden Verwirrung« rechtfertigen musste. Mit der Machtübernahme der Bolschewiki in Starodub im Jahr 1919 begann er, wie er in seiner Autobiografie schreibt, »aktiv in den Organen des Sowjets zu arbeiten«. Er wurde Vorsitzender des städtischen Rates der Gewerkschaften und Herausgeber der örtlichen Zeitung Kommunist. Ein Jahr später wurde er auf Verfügung des Gouvernement-Komitees der Kommunistischen Partei zum Chefredakteur der Zeitung Polesskaja Prawda ernannt. Diese Zeitung existiert in Weißrussland unter anderem Namen bis heute, und im Internet kann man Artikel aus den ersten Exemplaren finden und sehen, was mein Großvater damals publizierte.
Großvater Jakow und Großmutter Mira 1919 in Starodub
Da die Zeitung in der rund 150 Kilometer entfernten Stadt Gomel erschien, musste Großvater umziehen. Großmutter blieb noch in Starodub, wo 1921 ihre ältere Tochter geboren wurde, die sie Edlja nannte, zu Ehren meiner Urgroßmutter Etlja. Obwohl meine Großeltern Atheisten waren, blieben in der Familie doch einige jüdische Bräuche erhalten: zum Beispiel der, dass man Kinder nicht nach noch lebenden nahen Verwandten benennen durfte. Mira musste also einen Trick anwenden und änderte einen Buchstaben im Namen.
Aber auch noch in Starodub erreichte sie das Echo des Bürgerkrieges, in dem nicht nur ihr Familiennest in Iwaitenki zerstört wurde, sondern der meine Urgroßmutter am Ende auch ihr Leben kostete. In den Jahren 1920 und 1921 gab es eine Typhusepidemie im Land, bei der Millionen Zivilisten starben. Allein in der Stadt Gomel erkrankten mehr als siebentausend Menschen – ungefähr jeder Zehnte. Auch Mira und die kleine Edlja, damals noch kein Jahr alt, bekamen Typhus. Meine Großmutter erinnerte sich, wie sie mit 40 Grad Fieber im Bett lag und ihre Mutter versuchte, ihr langes Haar zu bürsten, das ihr wegen des Typhus auszufallen begann. Als sich Mutter und Tochter langsam erholten, erkrankte auch Etlja an Typhus. Sie hatte sich bei der Pflege der beiden angesteckt. Etlja, die immer so stark und ausdauernd erschienen war, hatte diesmal keine Kraft mehr, sich der Krankheit entgegenzustellen.
Mit dem Tod meiner Urgroßmutter im Jahr 1921 zerriss das Band, das die Familie bis dahin zusammengehalten hatte. Von da an musste meine Großmutter diese Rolle übernehmen. Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter folgte sie Jakow nach Gomel, wo die kleine Familie bis 1924 blieb. Dann wurde mein Großvater nach Moskau versetzt, zur Arbeit im Exekutivkomitee der Komintern, der Kommunistischen Internationale. Damit begann eine neue Periode im Leben meiner Großeltern – Mira und Jakow sollten nie mehr an ihren Geburtsort zurückkehren.
2Im Wohnheim »Proletarier aller Länder …«
Hotel Lux
Im gleichen Zimmer
Ende Juli 2007, an meinem letzten Arbeitstag vor dem Urlaub, riefen mich Journalisten vom holländischen Fernsehen an und baten um ein Interview. Sie bereiteten einen Beitrag zum siebzigsten Jahrestag des Beginns des Großen Terrors vor. So werden in der Geschichtsschreibung jene 14 Monate vom August 1937 bis zum November 1938 genannt, in denen das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten (NKWD) mehr als eineinhalb Millionen Menschen verhaftete und fast 700000 erschoss. Es war die intensivste und schlimmste Periode der Stalin-Repressionen.
Ich reagierte nicht sehr erfreut auf die Anfrage, ich hatte vor dem Urlaub noch jede Menge zu tun. In dem kleinen und vollgestopften Gebäude von »Memorial«[7] konnten wir uns nirgends niederlassen, und ich sagte ziemlich unwirsch, dass ich bereit wäre, ihnen eine halbe Stunde zuzugestehen, wenn sie irgendwo um den Puschkin-Platz herum in einem Café einen passenden Ort fänden. Dann legte ich den Hörer auf und hoffte, nichts mehr von ihnen zu hören. Aber die Holländer riefen schon bald zurück: Sie hätten im Hotel »Zentralnaja« für 50 Dollar ein Zimmer für zwei Stunden gemietet, wo wir das Interview aufnehmen könnten.
Es ist erstaunlich, welche merkwürdigen Zufälle es doch gibt. Dieses Hotel im Haus Nummer 10 an der Twerskaja-Straße war jenes bekannte Hotel »Lux«, wo die Familie meiner Mutter von 1924 bis 1945 lebte. Damals lautete die Adresse noch Gorki-Straße Nummer 36, und sie findet sich auf Dutzenden Briefen aus dem familiären Briefwechsel wieder.
Das Wort »Lux« habe ich gehört, solange ich denken kann. Dieses Wort, oder besser, dieser Ort, war in meiner Kindheit und Jugend das, was man heute ein echtes »Memo« in der Familienerinnerung nennt. Sogar fast alle unsere Möbel stammten aus dem »Lux«. Wenn man sich unter die Sessel und Tische bückte, konnte man metallene Plättchen finden, auf denen »Hotel Lux. Wohnheim der Komintern« geschrieben stand.
Worte wie Lux oder Komintern, die in den Gesprächen der Erwachsenen häufig fielen (vor allem seitens der Großmutter), waren für mich als Kind völlig unverständlich. Was denn für ein Luchs? Und warum hatten sie in einem Hotel gelebt und nicht in einer normalen Wohnung? Später erfuhr ich natürlich, was es mit alldem auf sich hatte. Das »Lux«, erbaut zu Beginn des 19. Jahrhunderts, hatte wunderbarerweise den Brand Moskaus während des napoleonischen Vormarsches 1812 überstanden. Angeblich soll Stendhal hier kurz abgestiegen sein, der damals in der französischen Armee diente. Von diesem ursprünglichen Gebäude blieb dennoch kaum etwas erhalten. Es wurde mehrfach umgebaut und erweitert. So befand sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Erdgeschoss die in ganz Moskau berühmte Bäckerei des Kaufmanns Filippow mit einem dazugehörigen Café, das von bekannten russischen Künstlern gestaltet worden war. Nach der Revolution wurde das Hotel verstaatlicht, man baute erneut an und um. Von 1921 an fungierte es als Gästehaus der Kommunistischen Internationalen.
Mit anderen Worten: Das »Lux« war das Wohnheim der Komintern und blieb es bis zu deren Auflösung 1943. In seinen 300 Zimmern lebten zu manchen Zeiten an die 600 Menschen, vor allem politische Emigranten, Parteifunktionäre, die in die UdSSR geflüchtet waren. 1954 wurde der normale Hotelbetrieb wiederaufgenommen, unter dem Namen »Zentralnaja«.
Merkwürdigerweise war niemand aus meiner Familie – weder die Großmutter, noch die ältere Schwester meiner Mutter, noch meine Mutter selbst – nach 1945 je wieder in dieses Hotel gegangen, das eine so wichtige Rolle im Leben unserer Familie gespielt hat. Dabei waren es von der Wohnung, in der ich aufwuchs und wo meine Eltern bis zu ihrem Tod lebten, gerade einmal drei Haltestellen mit dem Trolleybus oder 15 Minuten zu Fuß. Mein Vater arbeitete viele Jahre in der Redaktion einer Zeitschrift, die ihren Sitz auf der anderen Straßenseite hatte. Und ich selbst schaute oft in der Bäckerei im Erdgeschoss vorbei, die nach wie vor sehr beliebt war, um gutes Brot zu kaufen oder Kuchen oder um einen Kaffee zu trinken. Wir alle gingen also häufig am ehemaligen »Lux« vorbei, aber wir überschritten nie seine Schwelle.
Dieser Ort lebte in der Erinnerung der Familie wie ein Mythos, und ihn real werden zu lassen, war offenbar nicht nur schwer, sondern auch schmerzhaft. Für die Großmutter wahrscheinlich, weil es sie an ihre zwanzig Lebensjahre erinnerte, die sie dort mit meinem Großvater verbracht hatte. Und an den erlebten Schrecken der 1930er Jahre, als viele Nachbarn durch den NKWD festgenommen wurden. Für meine Mutter vielleicht, weil das ehemalige »Lux« die Kulisse für die längst verschwundene Welt ihrer Kindheit gebildet hatte, mit ihrem romantischen Glauben an die Weltrevolution und den Kommunismus, den sie später entschieden abgelegt hatte.
Wie auch immer, ich traf mich jedenfalls mit den holländischen Journalisten in der Hotelhalle mit ihren vielen Kiosken und kleinen Geschäften, die dort wie überall anderswo in den 1990er Jahren aus dem Boden geschossen waren und hier überlebt hatten. Sonst war dieses Hotel im Jahr 2007 noch genauso, wie es zu Sowjetzeiten gewesen war. Man hatte es nicht renoviert, und deshalb waren die Zimmer auch recht günstig. Sie hatten weder Bad noch Toilette, alle sanitären Einrichtungen befanden sich auf dem Gang wie zu Zeiten meiner Mutter: Um duschen zu können, musste man sich damals beim Kommandanten erst einen Bon holen und sich dann anstellen, bis das Bad frei war.
An der Rezeption gab man uns einen großen alten Schlüssel und nannte uns die Zimmernummer. Wir stiegen in den Lift (der allerdings nicht mehr der alte war, sondern zu Breschnews Zeiten ausgetauscht worden war), fuhren in den 4. Stock, gingen durch den langen Korridor und machten vor einem Eckzimmer halt. Noch bevor die Türe geöffnet war, begriff ich, dass dies das Zimmer meiner Mutter gewesen war. Wir (ich schreibe automatisch »wir«, obwohl ich erst vier Jahre nach dem Auszug meiner Familie aus dem »Lux« geboren wurde) hatten zwei nebeneinanderliegende Zimmer und dieses Eckzimmer hatten sich meine Mutter und ihre Schwester geteilt.
Obwohl ich nie dort gewesen war, erkannte ich sofort alles wieder, so viel hatte ich über dieses Zimmer gehört. Nichts hatte sich verändert, nur die Wände waren hellgrün übermalt worden, so wie in billigen Provinzhotels, und es gab zwei Betten. Die Nische war auch noch vorhanden, in der die Großmutter einen kleinen Spirituskocher stehen hatte, auf dem sie schnell etwas zubereiten oder Tee machen konnte. Für größere Kochaktionen gab es eine Gemeinschaftsküche. Ich erkannte das alte Holzparkett wieder, das meine Mutter mit fünf Jahren hatte wischen wollen, wofür sie statt eines Lappens aber das weiße Filzbarett der Schwester des Großvaters verwendet hatte. Ich erkannte die Fensterrahmen und die breiten steinernen Fensterbretter, auf denen meine Mutter seinerzeit ihre Spielsachen aufbewahrt hatte. Ich wusste zum Beispiel, dass sie eine »Negerpuppe« aus Zelluloid besessen hatte, die allerdings nicht erhalten geblieben ist. Wir haben aus jener Zeit im »Lux« (von den Möbeln einmal abgesehen) nur Weihnachtsschmuck aufgehoben, den man 1936 zu produzieren begann, als die UdSSR offiziell das Feiern unter dem Weihnachtsbaum erlaubt hatte. Bis dahin war der Weihnachtsbaum als bürgerlich und religiös abgelehnt worden.
Ich sah nach, ob ich auf dem Fensterbrett vielleicht von meiner Mutter eingeritzte Buchstaben oder Zeichen finden konnte, aber dort gab es nur Flecken und Risse. Dann trat ich auf den kleinen Balkon hinaus. Von diesem Balkon hatte meine Mutter im Juni 1934 mit nicht einmal sieben Jahren »Flugblätter« hinuntergeworfen. An jenem Tag waren die geretteten Teilnehmer einer Expedition triumphal in Moskau empfangen worden. Ihr Schiff, die »Tscheljuskin«, war denkbar schlecht für eine solche Reise gerüstet und – nach einer monatelangen Drift im Packeis – im Nordpolarmeer gesunken. 104 Seeleute und Passagiere hatten einen Monat auf einer Eisscholle ausgeharrt, bis sie ausgeflogen werden konnten. Zuvor hatte Stalin ein Hilfsangebot der Vereinigten Staaten abgelehnt. Die Rettung durch sowjetische Piloten wurde von der Propaganda groß aufgebauscht und man feierte die Helden: Man fuhr sie in offenen Autos zum Empfang im Kreml, wo ihnen die Auszeichnung »Held der Sowjetunion« verliehen wurde (die man eigens für die Rettung der Schiffbrüchigen ins Leben gerufen hatte), und diese Autos fuhren langsam genau unter dem Balkon meiner Mutter vorbei. Sie war so aufgeregt wegen dieses Ereignisses, dass sie rasch in Blockbuchstaben auf mehrere herausgerissene Seiten ihres Schulhefts geschrieben hatte: »Es leben die Tscheljuskiner!«, und die Blätter freudig vom Balkon aus auf den unten vorbeifahrenden Konvoi warf. Sie vermischten sich mit den offiziellen Jubelflugblättern, die von Flugzeugen herab auf den Konvoi und die Straße segelten. Dennoch war ihre Aktion bemerkt worden. Wenig später klopfte der Hausvorsteher des »Lux« an die Zimmertüre und hielt meiner Mutter eine Strafpredigt.
Solange sie im »Lux« lebten, hatte meine Mutter immer das Gefühl, sich im Zentrum der wichtigsten Ereignisse auf der Welt zu befinden. Schließlich lebte sie in der UdSSR, in Moskau, der wichtigsten Stadt, und noch dazu an der wichtigsten Straße: Hier führten die Paraden entlang, die vor dem Kreml auf dem Roten Platz endeten. Da sah man Demonstranten mit Flaggen und Transparenten, Truppen mit Kanonen und Panzern oder auch Gruppen von Turnern vorbeiziehen, die Stalin und Genossen, die das Geschehen von einer Tribüne vor dem Mausoleum verfolgten, die neuesten sportlichen Fortschritte demonstrierten. Vom Balkon aus sah meine Mutter hinunter auf die festliche Beleuchtung und die zu solchen Anlässen geschmückten Häuser. Besonders eindrucksvoll war das im November 1937, auf dem Höhepunkt des Großen Terrors. Entlang der gesamten Gorki-Straße hatte man riesige leuchtende lateinische Ziffern aufgestellt – XX, zum zwanzigsten Jahrestag der Oktoberrevolution. Als ich diesen alten Balkon betrat, hatte ich das Gefühl, die roten Fahnen und die Stalin-Porträts unten auf der Straße sehen zu können.
Ich holte mein Mobiltelefon hervor. Meine Mutter hob sofort ab und ich fragte sie ohne weitere Erklärungen: »Mama, das Eckzimmer im vierten Stock im ›Lux‹ war doch deines?«
»Ja«, antwortete sie, »warum fragst du?«
»Sag ich dir später«, entgegnete ich. »Nur so viel: Man hat mich hierhergebracht, um über das Jahr 1937 zu reden.«
Inzwischen hatten die Holländer die Kamera aufgestellt und alles für die Aufnahmen vorbereitet. Ich konnte es nicht fassen, dass sie mich ausgerechnet in dieses Zimmer gebracht hatten. Aufgeregt versuchte ich ihnen zu erklären, wo wir uns hier befanden und warum ich dieses leere Hotelzimmer so genau inspiziert hatte. Aber ich glaube, sie haben nicht verstanden, wovon ich sprach, sie nickten nur höflich und drängten darauf, mir endlich die vorbereiteten Fragen stellen zu können.
An das Interview kann ich mich heute kaum noch erinnern, aber das Gefühl, dass es eigentlich kein Zufall gewesen sein konnte, dass es ausgerechnet hier geführt worden war, hallte noch lange nach. Hier an diesem Ort über den Großen Terror und über das Jahr 1937 zu sprechen war eine merkwürdige Koinzidenz. Im »Lux« waren siebzig Jahre zuvor Dutzende Menschen verhaftet worden. Und in diesem Zimmer hatten meine Nächsten gelebt, die nur mit viel Glück diese schwere Zeit überstanden hatten.
Ich war froh, dass ich das Hotel ein letztes Mal betreten hatte, bevor es für lange Zeit leer stehen sollte. Inzwischen ist es von einem Investor gekauft worden, doch schon seit einigen Jahren hinter Gerüsten und Bauvorhängen versteckt, auf denen »Wiederaufbau« geschrieben steht. Es soll dort ein neues Hotel entstehen, aber es gibt Gerüchte über Schwierigkeiten mit dem Investor. Wenn man hinter den Bauzaun schaut, sieht man, dass dort nur noch Teile der Fassade stehen, der Rest des Gebäudes ist verschwunden. In einigen Jahren wird sich in der Millionenstadt Moskau wohl niemand mehr an dieses merkwürdige Hotel erinnern (abgesehen vielleicht von dem einen oder anderen Historiker), in dem einst Hunderte Menschen gelebt haben, die der Glaube an die Weltrevolution hier zusammengeführt hat.
Und es kann schon sein, dass nur wir noch Bruchstücke der Familienerinnerung aufheben, die Adresse auf den alten Couverts und die Sessel aus dem »Lux«.
Der sowjetische Wecker
Im Oktober 1924 wurde mein Großvater auf Beschluss des Zentralkomitees der Partei von Gomel nach Moskau versetzt, in den Apparat des Exekutivkomitees der Komintern. Die Komintern oder auch »Dritte Internationale« war 1919 auf Lenins Veranlassung gegründet worden, als weltweit gemeinsames Zentrum für die Führung der Weltrevolution, an deren Unausweichlichkeit die Bolschewiki glaubten. Über die Komintern ist viel geschrieben worden, und ich werde mich hier nicht auf die schweren und sogar tragischen Details einlassen, wie zunächst die Bolschewisierung und später die Stalinisierung der kommunistischen Parteien vor sich ging; nicht darauf, wie »die Revolution ihre Kinder fraß« und was aus vielen Führern der weltweiten kommunistischen Bewegung wurde, die die Säuberungen unter Stalin überlebt hatten und die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hause zurückkehrten, um dort kommunistische Regime zu errichten. Aber gleichzeitig kann ich die Geschichte der Familie meiner Mutter nicht ohne diesen Hintergrund erzählen. Er begleitete und begleitet bis zu einem gewissen Grad bis heute unser Leben. Familiäre Bindungen, enge Freundschaften, unsere Wohnung, das alles hat auf die eine oder andere Weise etwas mit der Komintern zu tun.
Mein Großvater Jakow hat – abgesehen von den Einträgen in jenem dunkelroten Heft – weder Tagebücher noch Erinnerungen hinterlassen. Er starb Anfang 1957, noch vor jener Epoche, in der einige seiner Zeitgenossen Memoiren zu schreiben begannen. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, dass mein Großvater, hätte er länger gelebt, seine Erinnerungen niedergeschrieben hätte. Er war ein sehr bescheidener Mensch, immer an sich selbst zweifelnd, und überdies nahm er Literatur und Text sehr ernst. Das sieht man an seiner Bibliothek, die nichts mit der Bibliothek eines Parteifunktionärs gemein hat und ihn als Intellektuellen zu erkennen gibt, der sich nicht nur für die russische Poesie interessierte – für Pasternak oder Achmatowa –, sondern auch für die zeitgenössische westliche Literatur und sogar für den Modernismus. Unter seinen Büchern finden sich die »Dubliners« von James Joyce und Zeitschriften, in denen zum ersten Mal Ausschnitte aus Joyce’ »Ulysses« und aus »Manhattan Transfer« von John Dos Passos abgedruckt waren.
In den Briefen meiner Mutter an den Vater (und beide Töchter schrieben ihm sehr oft, denn für sie war er die wichtigste intellektuelle und moralische Autorität) finden sich ständig Erwähnungen der Bücher, die sie gerade las. Im Sommer 1942 – meine Mutter war gerade 15 Jahre alt geworden und aus Moskau evakuiert – schrieb sie ihm, welch großen Eindruck Dostojewskis »Schuld und Sühne« auf sie gemacht habe. (Das sollte ihr ganzes Leben so bleiben – mein Vater fühlte sich mehr zu Tolstoi hingezogen, meine Mutter zu Dostojewski.) Und als sie in die Universität eintrat, beschrieb meine Mutter in einem Brief an ihren Vater einen Poesieabend im Jahr 1945, bei dem sie zum ersten Mal hörte, wie Boris Pasternak seine Gedichte las.
Ich denke, mein Großvater hatte instinktiv begriffen, welches literarische Talent man besitzen musste, um jene schwer zu erklärenden, furchtbaren Vorgänge zu beschreiben, deren Zeuge er gewesen war. Dabei war für ihn die Bewahrung der Erinnerung an die verschiedenen Ereignisse in seinem Leben ganz sicher sehr wichtig, denn er legte eine Art Archiv an. In einem alten Lederkoffer, der nach seinem Tod auf einem Kofferboden aufbewahrt wurde, fand ich seine Publikationen, Artikel und Broschüren, Papiere und Zeugnisse, sogar Einladungen und Eintrittskarten zu verschiedenen Festlichkeiten. Dank dieses Koffers weiß ich jetzt, dass mich meine kindliche Erinnerung nicht getrogen hat: Ich war tatsächlich mit ihm am 7. November 1952 auf dem Roten Platz. Der Großvater hat die Eintrittskarte aufgehoben!
Die Eintrittskarte meines Großvaters für die Feier am Roten Platz, die im Gedenken an die Oktoberrevolution am 7. November 1952 stattfand
Mit einer großen Truppenparade wurden damals die Feierlichkeiten zum 35. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution eingeläutet. An Stalin erinnere ich mich allerdings nicht, obwohl er sicher auf der Tribüne vor dem Mausoleum stand – zum letzten Mal vor seinem Tod.
Der Großvater hob auch Mitteilungen auf, die ihm die Führer des Exekutivkomitees der Komintern gesandt hatten, Georgi Dimitrow und Dmitri Manuilski.[8] Zweifellos hat er sein Archiv mehrmals ausgemistet, denn dort finden sich weder Notiz- noch Telefonbücher aus den 1930er Jahren, nur die Hüllen ohne den entsprechenden Inhalt hat er aufbewahrt. Es ist naheliegend, warum er sich davon getrennt hat. Notizbücher waren bei Hausdurchsuchungen während des Großen Terrors wichtige Indizien – sie konnten Beweise für Verbindungen zu Volksfeinden liefern. Daher finden sich auch in den Briefen, die er in jenen Jahren an seine Frau und die Töchter schrieb – meistens auf kleinen Briefbogen mit sehr exakter und kleiner Schrift –, kaum Konkretes über seine Arbeit. Er wusste genau, dass jede zusätzliche Information gefährlich sein konnte.
Ich habe es immer bedauert, dass ich ihn nicht habe ausfragen können (er starb ja, als ich erst sieben Jahre alt war), und als ich sah, was sich in diesem alten Koffer befand, bedauerte ich das umso mehr. Von allen meinen Nächsten habe ich die meisten Fragen an meinen Großvater. Immerhin fand ich unter seinen Papieren einige offizielle Lebensläufe und sehr genau ausgefüllte Fragebogen aus unterschiedlichen Zeiten. Solche Fragebogen mussten alle sowjetischen Bürger ausfüllen, bei sehr vielen Gelegenheiten und ganz besonders, wenn es um die Arbeit oder die Aufnahme in die Partei ging. Ein »schlechter« Fragebogen – wegen »gefährlicher« Familienangehöriger, der Abstammung und später auch der Nationalität – konnte den Weg zum Studium versperren, eine Karriere verhindern oder sogar zum Anlass einer Verhaftung werden. Darüber hinaus konnte ich Dokumente aus seiner Kaderakte sichten, die im ehemaligen Parteiarchiv aufbewahrt wird (im heutigen Russischen Staatsarchiv für soziopolitische Geschichte, RGASPI), sodass ich eine genauere Vorstellung davon bekam, womit er beschäftigt war.
Großvater kam 1924 nach Moskau.
Zu dieser Zeit war es Stalin schon gelungen, sehr viel Macht in seinen Händen zu bündeln, denn Lenin befand sich nach einem schweren Gehirnschlag seit fast zwei Jahren völlig isoliert auf einem ehemaligen Adelsgut in Gorki. Nach Lenins Tod begann Stalin, aktive junge Kader in den Parteiapparat zu holen. Die neuen Funktionäre, die vornehmlich aus der Provinz zur Parteiarbeit nach Moskau kamen, verdrängten nach und nach die »alten Bolschewiki«, die Parteimitglieder der ersten Stunde aus der Zeit vor der Revolution. Auf diese neuen Kader stützte Stalin sich später bei seinem Kampf gegen Leo Trotzki, Grigori Sinowjew und Lew Kamenew, mit denen er nach Lenins Tod das Triumvirat gebildet hatte, den engsten Machtzirkel der Kommunistischen Partei. Meinen Großvater, der gebildet war und Fremdsprachen sprach (in einem Fragebogen schreibt er: Deutsch – fließend, Französisch – ausreichend), versetzte man aus der Redaktion der Zeitung, die er in Gomel herausgegeben hatte, nach Moskau zur Komintern. Von diesem Augenblick an bis zum Jahr 1943 war er Mitarbeiter des Sekretariats, politischer Assistent des Sekretärs des Exekutivkomitees (1924 war das Grigori Sinowjew) und Redakteur der Zeitschrift Die Kommunistische Internationale. Er gab Bücher für die Komintern heraus und schrieb Reden für Dmitri Manuilski, den wichtigsten Vertreter der stalinschen Politik in der Komintern. Und er verfasste Artikel und Broschüren, die sich mit der Außenpolitik und den aktuellen Aufgaben der ausländischen kommunistischen Parteien befassten.
In seinem Koffer fand ich auch ein Büchlein mit Erzählungen von Schutzbündlern, das er 1935 herausgegeben hatte. Die Schutzbündler waren eine paramilitärische Organisation der österreichischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP), die 1934 am Februaraufstand in Wien gegen die Regierung Dollfuß teilgenommen hatte. Der Bundeskanzler hatte oppositionelle Organisationen verboten und ein quasifaschistisches Regime errichtet. Nach der Niederschlagung des Aufstandes waren viele führende Mitglieder hingerichtet worden, andere waren in die Tschechoslowakei und in die UdSSR geflüchtet, wo wiederum drei Jahre später viele von ihnen Opfer des Stalinterrors wurden.
In den Erzählungen der Schutzbündler finden sich viele Details, die diese Zeit lebendig werden lassen und auch für den heutigen Leser die Tragödie ihrer Niederlage im Jahr 1934 nachvollziehbar machen. Andere Texte aus dem Koffer meines Großvaters kann heute wohl nur noch ein Historiker einordnen, obwohl sie leicht verständlich und klar geschrieben sind. Sie spiegeln die propagandistische Aufgabe wider, die die Führung der Komintern ihm gestellt hatte.
Wie weit glaubte mein Großvater an das, was er schrieb? Hat er sich ständig selbst überzeugt von der politischen Zielrichtung der stalinschen Außenpolitik? Hat er den im August 1939 zwischen Stalin und Hitler geschlossenen Nichtangriffspakt befürwortet, der den wichtigsten Grundgedanken der Komintern, die antifaschistische Idee, zunichtemachte?
Ich habe viele solcher Fragen an meinen Großvater. Und es fällt mir nicht leicht, sie zu beantworten. Er war zweifellos ein kluger und verstehender Mensch. Nicht umsonst fragten ihn ständig Verwandte und Bekannte um Rat und später auch die Freunde seiner heranwachsenden Kinder. Aber er war eben auch ein Idealist. Dass ihm sein Glaube an die Sowjetmacht und den Kommunismus trotz allem bis Ende der 1940er Jahre erhalten blieb, geht sehr deutlich aus seinen Briefen hervor. In einem Brief an meine Mutter schreibt er im Jahr 1947 aus Bulgarien, dass er gerade den Roman »Mutter« wieder gelesen habe und über die prophetischen Worte Maxim Gorkis nachdenke, dass »Russland irgendwann die leuchtendste Demokratie der Welt« sein werde.