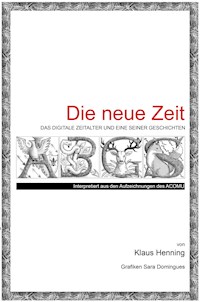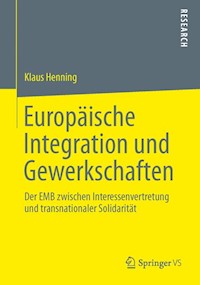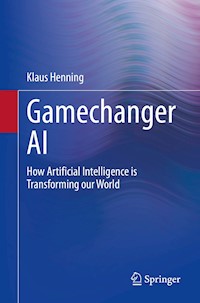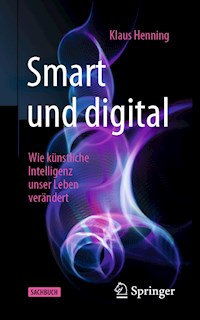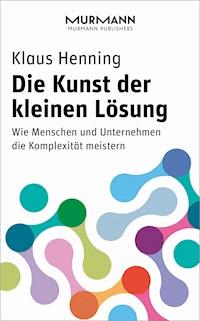
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Murmann Publishers
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Dieses Buch ermutigt Menschen in Unternehmen, die sie umgebende Komplexität und Dynamik zu meistern. In kurzen Geschichten entdeckt der Leser die Kunst der kleinen Lösung, die am wirksamsten ist. Im Mittelpunkt steht einzig der Weg zur effektivsten Lösung. Klaus Henning weiß, warum. Er blickt auf ein jahrzehntelanges Erfahrungswissen zurück. Immer war er Wanderer zwischen Politik, Wirtschaft und Universität: als Ingenieur, Hochschullehrer und Hochschulstratege, als Unternehmensberater, Regierungsberater oder als gleichzeitiger "Katholik und Protestant". 15 kleine Geschichten mit großem Aha-Effekt: zum Beispiel wie man es geschafft hat, in einem Krankenhaus die Mahlzeiten warm zum Patienten zu bringen und dabei 300.000 Euro IT-Kosten gespart hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Henning
DIE KUNST DER KLEINEN LÖSUNG
Dank
Herzlichen Dank für alle, die mir geholfen haben,
dass dieses Buch entstanden ist.
Renate Henning, Christoph Schlegel, Sebastian Kutscha,
Giuseppe Strina, Günther Refle und viele andere Freunde und
Freundinnen waren dabei treue Wegbegleiter. Allen, die mir ermöglicht
haben ihre Geschichte zu erzählen danke ich ganz besonders.
Orte, Namen und Daten sind zum Teil verändert.
Die Kunst der kleinen Lösung hat mir auch geholfen,
mich selber besser zu verstehen. Und diejenigen,mit denen ich zusammenarbeiten durfte.
I. WANDERN ZWISCHEN DEN WELTEN
Handschuhe brauche ich nicht
In 2800 Metern Höhe beginnt es kritisch zu werden. So war es auch an diesem Spätsommertag. Wir befanden uns weit oberhalb der Baumgrenze, in den Schweizer Alpen. Wir waren eine kleine Gruppe, drei Männer. Zwei Geschäftspartner und ich. Wir wollten auf eine Hütte steigen, diese lag bei knapp 3000 Metern. Am Morgen war es recht kühl und daher empfehlenswert, Handschuhe zu tragen. Der eine nahm die Handschuhe, der andere lehnte ab: »Das brauche ich nicht.« Er war sich da sehr sicher.
Wir wanderten los. Und je höher wir stiegen, desto kälter wurde es. Die Temperatur lag vielleicht noch bei ein, höchstens zwei Grad. Das kann im Sommer passieren. Im August können in den Bergen schnell 30 Zentimeter Schnee liegen. Und auf der Höhe kann es ohnehin kalt sein. Der Berg ist nicht berechenbar. Wie gesagt: Zwei trugen Handschuhe, einer nicht. »Nein, keine Handschuhe.« Schritt für Schritt stiegen wir nach oben, es war ein beschwerlicher, aber machbarer Weg. Bald ließen wir die Baumgrenze hinter uns. Schmale Serpentinen nach oben, vorbei an Felsen, an Disteln, immer weiter unserem Ziel entgegen.
Wir hatten es fast geschafft. Wir konnten die Hütte bereits sehen, eine kleine Hütte mit einer Schweizer Fahne. Plötzlich blieb er stehen, unser Kamerad ohne Handschuhe. Mitten auf dem schmalen Weg. Er rührte sich nicht mehr, ging weder vor noch zurück. Er stand da neben einem Schneefeld und blickte zu Boden. Wir sprachen ihn an. Er antwortete nicht. Er schien völlig neben der Spur zu sein. Ich ging näher zu ihm hin: »Was ist los?«
Er blickte nicht auf, sagte nur: »Ich kann nicht mehr, Klaus, ich drehe jetzt um und gehe alleine zurück.« Fast 1000 Höhenmeter Abstieg. Noch dazu war ein Gewitter im Anmarsch. »Nein, das machst du jetzt nicht!«, rief ich ihm zu. In seiner Lage wäre er keine 100 Höhenmeter weiter gekommen. Für ihn wäre der Abstieg lebensbedrohlich geworden. Das ist das Tückische an den Bergen. Plötzlich sagte er: »Klaus, ich glaube, ich habe mir die Finger erfroren.« Er hatte ja keine Handschuhe an, und die Temperatur war inzwischen unter den Nullpunkt gefallen.
Jetzt mussten wir handeln. Wir rieben seine Hände mit Schnee ab, um sie aufzuwärmen. Wir sprachen ihm gut zu, wir verwiesen auf die Hütte, die nicht mehr weit sei. »Es sind höchstens noch 10 oder 20 Minuten Fußweg, schau, da vorne«, sagte ich ihm. »Das schaffst du!« Doch er wollte nicht mehr. Er konnte nicht mehr. Wir redeten ihm zu, wir versprachen, ihn zu stützen, nahmen ihm den Rucksack ab. Und irgendwie schafften wir es, ihn zum Weitergehen zu bewegen. Wir schleppten ihn mehr, als dass er ging. Mehr als eine Stunde haben wir für den Weg gebraucht. Die Hütte hatten wir immer im Blick. Endlich waren wir oben angekommen. Er war vollkommen erschöpft. Auch an uns hatte dieser Aufstieg gezehrt.
Wir stolpern über Kleinigkeiten
In der Hütte wärmten wir uns auf, er aß eine Suppe, wir tranken etwas. Langsam kamen wir wieder zu Kräften. Es war offensichtlich, dass er an diesem Tag an eine Grenze geraten war. Er wirkte immer noch abwesend. Eigentlich ein kräftiger Mann, ein Macher, der vor nichts zurückschreckt. Aber der Berg hatte das anders gesehen. Der Berg hat ihm gezeigt, wie weit man gehen kann – und wie weit nicht. Nach unserem Hüttenaufenthalt schien er gestärkt, er konnte absteigen. Ich ging hinter ihm, ließ ihn nicht eine Sekunde aus den Augen. Schweigend gingen wir dem Tal entgegen. Unten, beim Arzt, gab es Entwarnung: Er hatte sich die Finger nicht erfroren.
Oft hat man das Große vor Augen und sieht das kleine Hindernis nicht.
Kleinigkeiten. Wir stolpern über die Kleinigkeiten. Wir haben einen prächtigen Berg im Visier – und verzichten auf Handschuhe.
Das ist nicht nur am Berg so. Das ist mir in den vergangenen Jahrzehnten zu häufig begegnet. Oft hat man das Große vor Augen und sieht nicht das kleine Hindernis.
Im Berg kann es tödlich enden. Im Alltag endet es oft im Chaos.
Die Beobachtung reicht, um ein System zu verändern
Mir ist es zur Aufgabe geworden, Wege durch das Chaos zu bahnen. Ob als Wissenschaftler, als Unternehmer und vor allem als Berater, immer stand und stehe ich vor der Frage: Wie lässt sich die Komplexität einer Situation, die Komplexität eines Systems meistern? Nicht selten hängt es an einem kleinen Detail. Ein Schraube, die neu justiert wird, ein Gespräch, das geführt werden sollte. Solche kleinen Lösungen zu finden ist nicht einfach. Es sind nicht die »Man muss doch nur …«-Lösungen. Es sind diejenigen kleinen Lösungen, die eine große Wirkung haben. Und nicht so viele unerwünschte Nebenwirkungen. Das setzt aber voraus, dass man die Komplexität und Dynamik einer Situation wahrnimmt.
Im Berg ist es vor allem die Beobachtung. Man muss das Wetter im Blick haben. Den Weg. Die Bergsteigerkollegen: wie sie atmen, wie sie sich bewegen. Welche Kleider sie tragen. Ob sie Pausen machen. Nur ein kleines Detail kann den Unterschied machen. Und ein Berg verzeiht nichts. Er zeigt dir deinen Fehler sofort. Er kennt kein Pardon für deinen Hochmut.
Das Wechselspiel zwischen Detail und Ganzem ist komplex. Die kleine Lösung ist nicht einfach.
Vermeintliche Kleinigkeiten sind auch Pausen. Keiner wird auf einen Berg kommen, wenn er auf Pausen verzichtet. Pausen können zu lang sein, man kann auch zu viele Pausen machen. Das passiert, wenn man zu Beginn losstürmt und dann feststellt, wie sehr man sich überschätzt hat. Es ist ein ständiges Austarieren, um immer das richtige Maß zu finden. Wer Kleinigkeiten außer Acht lässt, riskiert eine Menge. Wenn man das Besteigen eines Bergs als ein System betrachtet, nennen wir es das »System Aufstieg und Abstieg«, und dieses System kann zusammenstürzen, wenn man ein Detail außer Acht lässt. Auch um das System am Laufen zu halten, ist das Detail wichtig. Und der Blick für das Ganze. Es ist das Wechselspiel zwischen dem Detail und dem Ganzen. Der Versuch, alles zu beherrschen und im Griff zu haben, misslingt in der Komplexität. Manchmal muss man mit der Lupe hinschauen. Immer aber ist ein »Hubschrauberblick« nötig, um den Überblick zu behalten. Es geht darum, Komplexität zu meistern, nicht, sie zu beherrschen. Dieses Wechselspiel zwischen dem Detail und dem Ganzen ist nicht einfach. Sie ist auch nicht einfach: die kleine Lösung.
Berge lehren uns Demut
Ich würde nicht behaupten, dass ich die Berge verstanden habe. Wer versteht schon die Natur? Berge können fantastisch schön sein und ebenso grausam. Wer einmal gesehen hat, wie in unmittelbarer Nähe mehrere Bergsteiger tödlich abstürzen, weiß, was ich meine. Von einer Sekunde auf die nächste. Berge sind unberechenbar. Sie lehren uns Demut. »Sei dir nicht so sicher«, scheinen sie dir jedes Mal mit auf den Weg zu geben. »Du hast zwar Erfahrung, du hast schon einige Berge erklommen, aber das heißt nicht, dass du alles kannst – weder am Berg noch im Leben.«
Sie lehren nicht nur Demut. Sie zeigen einem auch, wie man wirklich ist.
Das Wandern in Bergen, das Bergsteigen, bringt einen näher zu sich selbst. Man erfährt etwas über sich. Wie ist man, was kann man, wie reagiert man, wie geht man damit um, wenn man mit sich selbst konfrontiert ist? Über alldem fühle ich mich als Christ gerade in den Bergen der Schöpfung sehr nahe. Hier zeigt sie sich in ihrer vollen Schönheit, in ihrer Rauheit, in ihrer Erhabenheit, in ihrer Größe. Berge sind Orte, an denen ich zu Gott finde. Der Blick auf Berge, die Stille, das Zurückgeworfen, sein auf sich selbst, da fange ich an zu begreifen. Da bin ich bei mir. Da arbeite ich an mir. Von außen betrachtet mag dieses Trotten dem Gipfel entgegen langweilig erscheinen. Immer ein Schritt nach dem anderen. Erstaunlich ist aber, was sich im Innern abspielt, wie sehr man ins Denken kommt, wie klar man sieht.
Geht man bergauf, kommt man ins Nachdenken.
Ich erinnere mich an viele stundenlange Wanderungen. Wenn man in einen Dialog mit sich selbst tritt, wenn man mit sich selbst konfrontiert wird. Und die Erfahrung, wie es ist, schwierige Situationen zu meistern. Situationen, in denen es auf eine Kleinigkeit ankommt. Ich habe beispielsweise immer ein Stück Draht dabei. Ohne diesen Draht mache ich mich nicht mehr auf den Weg.
Ohne Draht gehe ich nicht auf die Berge
Und das hat einen Grund: Einmal bin ich in den Schweizer Alpen mit meiner Frau und einem Bergführer auf einen Viertausender gestiegen. Ein großartiges Erlebnis. In den frühen Morgenstunden sind wir los, haben dann gegen Mittag den Gipfel erreicht und genossen, was man auf 4000 Metern genießt: einen grandiosen Blick. Bis dahin war alles gut. Dann stiegen wir ab.
Während des Abstiegs brach mein Steigeisen an einer Felskante. Wir trugen Steigeisen, weil wir über einen Gletscher und über Eisplatten gehen mussten. Ohne Steigeisen ist das lebensgefährlich. Mein rechtes Steigeisen war nun gebrochen. Eine unangenehme Situation. Zufällig hatte ich ein Stück Draht dabei und konnte das Eisen notdürftig reparieren. So schleppte ich mich mit einem kaputten Steigeisen an den Schuhen über den Gletscher. Schritt für Schritt.
Es ging gut, irgendwie. Aber seitdem habe ich bei jeder Bergtour, auch wenn sie nicht über Schnee und Eis geht, immer ein Stück Draht dabei.
Immer.
Im Grunde lassen sich meine Erfahrungen auf drei Erkenntnisse bringen:
Das Ganze in den Blick nehmen. Immer wieder sich auf den größeren Zusammenhang konzentrieren und die Fülle der Komplexität wahrnehmen und aushalten.
Ein Schritt nach dem anderen. Es sind oft Kleinigkeiten, die eine große Unternehmung scheitern lassen.
Auf die vermeintlichen Kleinigkeiten achten. Und verstehen, ob und welche Auswirkungen sie auf das Ganze haben.
Dieses Buch ist den kleinen Lösungen gewidmet. Weil es oft das »Stück Draht« ist, das in komplexen Systemen fehlt. Weil vom »Stück Draht« oft der Erfolg einer ganzen »Tour« abhängt.
Überfordert von der Komplexität
In einer bezaubernden Bergwelt, mit dem kräftigen Geruch der Latschen und einer strahlenden Sonne, kann sich innerhalb von Minuten das Wetter massiv verschlechtern. Von einem Augenblick auf den nächsten regnet es, stürmt, schneit es. Urplötzlich befindet man sich in einer chaotischen Situation. Genau so können sich auch Organisationen oder Unternehmen verhalten. Von einem Moment zum nächsten kann in solchen Systemen die Komplexität und die Dynamik einer Situation dramatisch anwachsen. Und dann?
Man wird die Komplexität nie beherrschen können. Ich kann den Wetterumschwung in den Bergen nicht verhindern. Aber ich kann die Zeichen des Wetters wahrnehmen und verstehen lernen. Zwar lautet der Wunsch: Wir wollen das beherrschen. Doch die ernüchternde Erkenntnis lautet: Komplexität lässt sich nicht beherrschen. Man kann Komplexität nur zu meistern versuchen.
Wir können Komplexität und Dynamik nicht beherrschen, allenfalls schaffen wir es, sie zu meistern.
Und wie man sie meistern kann, wie man Chaos, wie man die Dynamik einer solchen Situation meistern kann, das will ich in diesem Buch zeigen.
Denn, und das ist eine Erkenntnis nach 50 Jahren in Wissenschaft, Unternehmen, Politik: Es gilt erst einmal, Komplexität und Dynamik auszuhalten, vor allem, wenn ich sie nicht ändern kann.
Mit Aushalten ist hier nicht einfach Geduld gemeint. Es geht darum, die Wahrnehmung über die Komplexität auszuhalten. Immer wieder. Und es sind die kleinen Dinge, die beachtet werden müssen. Und in den vielen kleinen Dingen und der oft mühsamen Wahrnehmung der Komplexität der Dinge findet sich oft das Entscheidende: die kleine Lösung.
Die kleine Lösung ist aber nicht die einfache Lösung. Die »Man muss doch nur …«-Haltung ist gefährlich. Vielmehr muss ich in komplexen Systemen diagnostizieren und aushalten lernen – die ganze Komplexität an mich heranlassen –, zunächst ohne einzugreifen. Und dann gilt es, alle möglichen Ansatzpunkte zu prüfen. Und dann die kleinste Lösung mit dem größten Effekt zu wählen. Manchmal aber ereignet sich die »kleine Lösung« sogar wie von selbst.
Immer geht es um den »großen Wurf« – warum eigentlich?
Das Chaos lauert überall. Wie bahne ich mir einen Weg durch das Chaos? – das ist zu meinem Leitmotiv geworden. Zu verstehen, wie sich eine statische Situation in eine dynamische Phase und dann in eine turbulente und schließlich in eine chaotische Phase wandelt, habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Und diesem Prozess etwas entgegenzusetzen. Die vier genannten Phasen sind Merkmale einer anwachsenden Dynaxity.
Die vier Phasen von Dynaxity – statisch, dynamisch, turbulent, chaotisch.
Dynaxity ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus Dynamik und Komplexität (»complexity«). Das können Sie bei Wikipedia nachlesen. Oder bei Heijo Rieckmann, der das Wort erfunden hat. Und die Dynaxity sollte man in allen Systemen, allen Organisationen, allen Unternehmungen im Blick haben. Wird der Entwicklung der Dynaxity keine besondere Beachtung geschenkt, steht eine Menge auf dem Spiel, bis zur Gefahr des Scheiterns.
Wir haben uns daran gewöhnt, immer den »großen Wurf« zu fordern. Vor allem natürlich in der Politik. Fast jeden Tag taucht bei großen Fragen wie Klimawandel, demografischer Wandel oder Bildung der Wunsch nach dem »großen Wurf« auf. Viele scheinen sich mit diesem Wunsch nach vermeintlicher Größe besonders hervortun zu wollen. Ständig werden »neue Strukturen« gefordert, auch der Ruf nach »neuen Besen« erklingt erstaunlich schnell. Als ob damit alles gut würde. Dabei gibt es genügend Beispiele, dass gerade darin nicht die richtige Lösung liegt. Wir hoffen oft auf den weißen Ritter, auf den Mann mit dem Geldkoffer, auf denjenigen, der mit einem Schwert den Weg bahnt. Die Hoffnung, dass mit einem Mal sämtliche Probleme gelöst sind, ist verständlich. Sie ist allerdings trügerisch. Die Lösung ist oft viel kleiner. Sie löst nie alles, aber oft vieles. Sie ist oft nicht einfach zu finden, und sie ist oft unscheinbar. Zum Beispiel ein Stück Draht. Ein Paar Handschuhe. Die Pause zur richtigen Zeit. Eben die kleine Lösung.
Die Trümmer wieder wohnlich machen
Die Welt lag in Trümmern, als ich geboren wurde.
Es waren die letzten Kriegswochen. Die Industriestadt Göppingen, wenige Kilometer vor Stuttgart, war das Ziel zahlreicher Fliegerangriffe. Wie in vielen deutschen Städten lebten die Menschen in ständiger Angst und verbrachten die Nächte in Bunkern. Meine Mutter erzählte mir immer wieder folgende Geschichte: Es war Fliegeralarm. Sie packte mich, ging mit mir auf dem Arm in den Luftschutzkeller. Wir blieben, bis die Bomber abgezogen waren. Und als wir wieder hochkamen, an diesem Morgen, war alles zerstört. Nur unser Haus stand noch.
Chaos war von Anfang an da.
Das äußere Chaos eines zerstörten Landes. Kaputt geschossen, kaputt gebombt. Vom großen Deutschland waren nur Trümmer geblieben.
Und bei den meisten Deutschen gab es ein großes inneres Chaos und eine große Verunsicherung. Und nach der Befreiung der Konzentrationslager wurde erst das Ausmaß der deutschen Verbrechen bewusst. Ein Land und seine Menschen hatten sich in ein komplettes Chaos hineinmanövriert. Was zunächst blieb, war ein Leben in Ruinen. So startete meine Generation mit einer Hypothek im Gepäck ins Leben.
Es ist ein Wort aus der Bibel, das mich – halb als Auftrag, halb als Erklärung – durch das Leben begleitet: »Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen; die Grundmauern vergangener Generationen wirst du wieder aufrichten.« (Jesaja 58, 12).
Die Trümmer wieder wohnlich machen. Die »Grundmauern« wieder aufrichten.
Mitten im Chaos eine Lösung zu finden. Aus vielen kleinen Lösungen entsteht dann manchmal etwas Großes.
Trümmer wieder wohnlich machen
Ich bin und war sicher nicht der Einzige, der die Trümmer wieder »wohnlich« machen wollte. Das war ein unausgesprochener Auftrag an die Generation unserer Eltern – und auch an unsere Generation, die Generation der Kriegskinder. Und es ist sicher auch eine Erklärung, warum viele von uns so viel wagten, so viel ihrer Kraft investierten, so viel auf die Beine stellten. Man denke nur an die vielen Unternehmensgründer der Nachkriegszeit.
Ich bin Ingenieur geworden. Das liegt nahe, eignet sich der Beruf doch vortrefflich, um Dinge »wohnlich« zu machen. Gerade dieser Beruf beschäftigt sich mit dem Aufbau von Systemen. Einerseits soll etwas noch besser, noch schneller, noch effektiver funktionieren. Andererseits denkt ein guter Ingenieur nicht nur an das Funktionieren eines Systems. Sondern auch daran wie ich etwas gestalten muss, damit im Falle der Störung und Krise nichts ungeordnet zusammenbricht. Das drohende Chaos meistern ist ein Aspekt, der mich schon immer fasziniert hat.
Ready for Breakdown
Ein Ingenieur denkt schon beim Aufbau eines Systems an dessen Zusammenbruch. Ein Beispiel sind Brücken oder Hochhäuser. Viele kennen vielleicht den Film aus den 1950er Jahren, der eine im Sturm hin und her schwingende Hängebrücke in den USA zeigt, die nach einiger Zeit schließlich zerbirst. Auch ein Wolkenkratzer wird so konstruiert, dass er im Falle einer Zerstörung »geordnet« zusammenbricht. Und auch ein Kraftwerk sollte »geordnet« zusammenbrechen und nicht völlig unkontrolliert, wenn es von einem Erdbeben oder einer Wasserwelle erfasst wird.
Den geordneten Zusammenbruch von Anfang an mitdenken.
Der Grund dafür ist einfach: Schadensbegrenzung. Um wie viel gravierender wäre die Zerstörung, wenn das Haus nicht ineinanderfällt, sondern seitlich umkippt – und viele andere Häuser zerstören würde? Deshalb ist der Zusammenbruch quasi beim Entwurf schon mitgedacht. Das hat nichts mit Pessimismus zu tun oder mit einem unterentwickelten Glauben an die eigene Konstruktion. Winograd und Flores haben diesen Gedanken in ihrem Buch Understanding Computer and Cognition dargelegt. Das hat mich in meinem Denken stark beeinflusst. Wenn etwas zusammenkracht, soll es möglichst wenig Schaden anrichten.
Wie gesagt: Es geht nie darum, das Chaos zu beherrschen, es geht darum, es zu meistern. Oft genug werden die Mängel der Systeme erst offenkundig, wenn das System zusammenbricht.
Deshalb muss schon bei der Entwicklung von komplexen Systemen gelten: Ready for Breakdown. Denn »unkaputtbar« gibt es nicht. Unser Glaube an die Technik bietet eine trügerische Sicherheit. Doch vor allem wir Ingenieure, Informatiker und Naturwissenschaftler sind leider viel zu oft zu technikverliebt, als dass wir unserer geliebten Technik Böses zutrauen.
»Unkaputtbar« gibt es nicht.
Die computergestützte Technik gibt einem noch mehr das Gefühl, schnelle und genaue Lösungen auch für die kompliziertesten Probleme zu erhalten.
Nicht wenige Studenten und vor allem auch Professoren sind der festen Meinung, wir seien heute in einem Stadium angelangt, in dem alle Probleme technisch lösbar sind. Das ist ein Irrtum. Technische Machbarkeit muss immer auch die jeweiligen Fähigkeiten der beteiligten Menschen berücksichtigen.
Aber zurück zu meinen Grunderfahrungen. Mein Vater arbeitete nach dem Krieg als Ingenieur bei Siemens. Das Land berappelte sich wieder. Man konstruierte, man baute, man ermöglichte eine Zukunft. Mein Weg schien vorgezeichnet, und doch war er es nicht. Ich habe Elektrotechnik studiert, im Wesentlichen in München. Parallel begann ich dann, auch politische Wissenschaft zu studieren. Das war eine Entscheidung, die mein weiteres Leben stark beeinflusste. Wenn ich nach dem Grund gefragt wurde, habe ich immer gesagt: »Auf zwei Beinen steht es sich besser.«
Ich war und bin der Überzeugung, dass die Welt nie nur aus einem Blickwinkel betrachtet werden kann. Sie ist viel zu komplex. Ich kann ein technisches Problem nicht nur als technisches Problem betrachten, weil Technik für Menschen da sein soll. Auf der anderen Seite kann ich nicht einfach technischen Fortschritt ablehnen, wie es viele meiner Altersgenossen taten, nur weil mit dem technischen Fortschritt auch immer Risiken und Zerstörungspotenziale verbunden sind. Ich begab mich also schon während meines Studiums mitten in das Spannungsfeld Mensch und Maschine und ahnte nicht, dass ich da drin bleiben sollte. Und dass ich mich darin bis heute äußerst wohl fühle.
Jede Woche fast ein atomarer Kollaps?
Alles hat eine Vorgeschichte. Nichts passiert zufällig. Vor meinem Studium war ich Mitte der sechziger Jahre zwei Jahre lang bei der Bundeswehr in der Ausbildung zum Nachschuboffizier, zuletzt bei einem Jagdbombergeschwader, und zwar einem Atomwaffengeschwader. Ich war sozusagen mittendrin im Kalten Krieg. Ein Atomwaffengeschwader, das war nicht nur Militär oder Logistik – das war immer auch Politik. Es war der negative Aspekt des »technischen Fortschritts« mit seinem Zerstörungspotenzial.
Europa stand zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem atomaren Kollaps. Und zwar jede Woche. Wir haben das in einer furchteinflößenden Regelmäßigkeit erlebt.
Ständig gab es sogenannte Alarmflüge. Wir wussten nie, ob es ein Ernstfall war oder eine Übung. Wir befanden uns in einem Daueralarm. Immer schien die Welt am Rande eines Krieges zu stehen. Immer war die Bedrohung unmittelbar. »Bereite dich auf den Abgrund vor.« Drohten schon wieder Trümmer? Welche Rolle spielten die technischen Möglichkeiten, welche die Politik? Wer beherrscht hier wen? Das wollte ich verstehen. Der rein technische Blick schien mir nicht ausreichend.
Ich will mehr als nur Technik!
Schon im zweiten Semester Elektrotechnik habe ich als Wahlvorlesung Frederic Vester »Vom technokratischen zum kybernetischen Zeitalter« gehört. Der 2003 gestorbene Biochemiker war einer der Ersten in Deutschland, der unter Berufung auf die Kybernetik ein systemisches, vernetztes Denken propagierte. Er sah als Eigenschaften eines Systems ein vernetztes Wirkungsgefüge, in dem die Wechselwirkungen zwischen den Teilen wichtiger sind als die Eigenschaften der einzelnen Teile. Seine Vorlesung war für mich ein Wendepunkt. Danach habe ich das Parallelstudium politische Wissenschaften begonnen. Einerseits faszinierte mich der kybernetische Ansatz, andererseits war mir klar: »Ich will mehr als nur die Technik!« Das grenzenlose Vertrauen in die Technik hielt ich für nicht angebracht.
Bei der Bundeswehr hatte ich erlebt, wie schon damals Kampfflugzeuge vollautomatisch flogen. Alle Probleme schienen technisch lösbar. Wie riskant war das? Wie riskant darf Technik überhaupt sein? Und wer hatte die Verantwortung? Diejenigen, die die Maschinen entwickelten? Oder diejenigen, die sie einsetzten? Darf alles gebaut werden, was machbar ist? Wo ist die Grenze? Und wer zieht gegebenenfalls Grenzen? Und mit welcher Begründung?
Technik über alles – und wer trägt die Verantwortung?
Früh war klar, dass ich dafür mehr als nur technische Antworten benötigte.
Und früh suchte ich mir Menschen und Vorbilder, die Antworten geben konnten – oder zumindest die richtigen Fragen in die Debatte warfen.
Neben der Erfahrung in einem Jagdbombergeschwader hat mich die Zeit davor an der Logistikoffiziersschule in Hamburg geprägt. Meine experimentelle Prüfungsarbeit enthielt die Aufgabe, einen Munitionstransport mit 40 Lastwagen quer durch Deutschland zu bringen. Wie steuert man einen solchen Nachschubtransport? Als gravierendes Problem dieser Aufgabe erwies sich ein heiß gelaufenes Radlager eines mit Sprengstoff gefüllten Lastwagens. Wegen dieses Radlagers mussten umgehend die Menschen in den umliegenden Orten evakuiert werden. Ein verunglückter Munitionstransporter hätte durchaus eine Katastrophe auslösen können.
Oft hängt alles von der Logistik ab.
Es hat mir gezeigt: Das Funktionieren eines Systems hängt oft von einer vermeintlichen Kleinigkeit ab. Das Erlebnis hat mich auch tief und emotional mit der Logistik verbunden. Wie werden die Dinge in Bewegung gebracht?
Wie organisiert man intelligent und nachhaltig den Warennachschub?
Wie hält sich ein Organismus durch eine laufende »Nährstoffversorgung« am Leben? Faszinierende Fragen, in gewisser Weise auch globale Fragen. Denn viele Systeme müssen am Laufen gehalten werden. So zog sich neben dem Strang der Kybernetik die Logistik wie ein roter Faden durch mein Leben.
Die Welt als riesiges Uhrwerk?
Im Grunde gab es für mich nie eine eindeutig nur technische Frage und nie eine eindeutig nur politische oder nur emotionale oder nur religiöse Frage.
Geprägt von Frederic Vester habe ich von Anfang an einen systemischen Ansatz verfolgt, der gleichzeitig die Menschen, die Organisation und die Technik in den Blick nimmt. Also das relevante »System«. Das geht aber nur, wenn man vorgezeichnete Wege verlässt. Ein Ingenieursjob bei Siemens oder einem anderen Großkonzern – und da gab es genügend Angebote – hätte mich in meiner Sichtweise eingeengt. Das hat mich nicht gereizt. Weil mir immer etwas gefehlt hätte.
Es gab den Drang, aus dem reinen »Maschinenmodell« auszubrechen. Der Glaube des Menschen, dass die Welt funktioniert wie ein riesiges Uhrwerk, ist alt. Den hat schon der Philosoph René Descartes vertreten.
Aber die Welt als riesiges Uhrwerk ist ein Modell, eine Denkweise, ein Glaube. Dennoch sitzt dieses »Maschinenmodell« bis zum heutigen Tag tief in unserem Bewusstsein – meist als Gewissheit. Die Erfahrung lehrt uns aber etwas anderes: Die Welt funktioniert nicht so.
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Bewusstsein gewandelt, von der Welt als Maschinenmodell zu dem Bild der Welt als einem lebenden, auf den Menschen zentrierten Organismus. Der Begriff »lebende Systeme« gewinnt an Bedeutung.
Auch Organisationen sind lebende Systeme.
Organisationen können also sowohl als Maschinen als auch als »Lebewesen« betrachtet werden. Beide Sichtweisen haben ihren Wert, aber die Sichtweise »Lebewesen« ist wichtiger, wenn man Komplexität meistern will.
Haben die Gesellschaft, die Wissenschaft und die Industrie aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt? Ich fürchte, eher nein. In einer neuen Welle der Technologisierung spielte zum Beispiel das Schlagwort »Wissensmanagement« in den 1990er Jahren eine zentrale Rolle. Diesem Ansatz zufolge kann mit Hilfe von Wissensingenieuren die spezielle Expertise der Facharbeiter erfasst und in eine Wissensdatenbank eingegeben werden. Wenn dies gelingt, werden die Wissensträger als Person nicht mehr benötigt. Deren Know-how liege sicher in der Datenbank.
Es wiederholte sich der Irrglaube: Die Technik richtet alles. Und fast ein Jahrzehnt hat es gebraucht, bis die Entwicklung (wieder) an dem Punkt war, dass beim Wissensmanagement der zentrale Träger des Wissens mit all seinen Facetten der Mensch ist, der unterstützt wird durch den »Datenträger« Maschine. Der Glaube, mit einer hochpreisigen IT-Software ließen sich im Grunde alle Probleme eines Unternehmens oder einer Organisation lösen, ist immer noch weit verbreitet. Und nicht wenige IT-Systemberater schüren genau diesen Glauben. Wenn ich in Unternehmen als Berater unterwegs bin, ermutige ich daher gemäß meinem Ansatz: Schaut nicht nur auf die IT! Treibt es nicht zu weit mit eurer Technikliebe! Das trübt den Blick!
Erst der Mensch, dann die Organisation und dann die Technik
Die Technik scheint immer wieder zu dominieren: Wir sammeln Unmengen an Daten und wissen noch nicht einmal, wofür. Wir gehen davon aus, dass wir die Daten später einmal vielleicht benötigen. Wir planen eine gigantische Energiewende, wollen den Strom aus der Nordsee bis Baden-Württemberg leiten, und haben keine Ahnung, wie die Menschen das finden. Wir verlieben uns in ein technisches Projekt und lassen alles andere links liegen, zum Beispiel die Menschen.
Im Kern geht es mir um einen Umstellungsprozess vom falschen Ansatz: »Erst die Technik, dann die Organisation und dann der Mensch« hin zu einem Ansatz: »Erst der Mensch, dann die Organisation und dann die Technik«. Der HOT Approach: »First Human, then Organisation, then Technology«.
Wenn es gelingt, diese drei Elemente in der richtigen Reihenfolge nachhaltig zu vernetzen, also systemisch zu denken, dann lassen sich viele komplexe Schwierigkeiten vergleichsweise geschickt lösen. Mit kleinen Lösungen, von denen ich Ihnen im Buch einige exemplarisch vorstellen werde. Beispiele, bei denen der Glaube an die teure IT-Lösung fast die naheliegende Lösung übertrumpft hätte. Oder bei denen Probleme mit wenigen, aber richtigen Worten gelöst werden könnten. Oft reicht ein Satz. Oft muss nur ein Handgriff anders vorgenommen werden. Oft sind es wenige Zentimeter. Es liegt so nahe. Doch wir haben es verlernt, den kleinen Lösungen zu trauen. Wir haben uns an gigantische Lösungen gewöhnt. Wir glauben zu oft an den »großen Wurf«. Ich habe gelernt: Lieber tausend kleine Schritte als einen großen Big Bang. Dann gelingt in Summe auch ein großer Wurf.
Der HOT Approach: First Human, then Organisation, then Technology
Die wirklich nachhaltigen technischen Entwicklungen, die heute noch unsere Arbeiten in Industrie und Produktion prägen und verändern, sind meines Erachtens diesem Ansatz gefolgt. Und wenn wir nicht den Menschen an die erste Stelle setzen, werden wir auch in Zukunft Ideen wie die des selbstfahrenden Autos oder des flächendeckenden Einsatzes erneuerbarer Energien nur schwer umsetzen können. Technische Neuerungen müssen von Anfang an die Menschen und Organisation einschließen – nur so haben sie Durchsetzungskraft und dann auch Akzeptanz.
Wir handeln oft wie Frischverliebte: Wir sehen nur das Rosarote und die ungeahnten Möglichkeiten, aber selten potenzielle Mängel oder Probleme.
Gelingt es aber Mensch Organisation und Technik gemeinsam zu denken, dann ist dies ein entscheidender Schlüsselfaktor für Deutschland. Ein Faktor mit Potenzial als Exportartikel. Man denke hier nur an Großprojekte wie die bereits erwähnte Energiewende, die ein systemisches Denken voraussetzt, die nicht ohne den Menschen gedacht werden kann. Gelingt es uns, dieses Projekt systemisch umzusetzen – und nicht nur rein technisch –, dann könnten wir eine ganz besondere Fähigkeit exportieren: in Systemen zu denken und komplexe Systeme zu entwickeln. Und mit vielen kleinen Lösungen das Große zu entwickeln.
Neue Exportartikel aus Deutschland
Wenn Ingenieure und Naturwissenschaftler von Anfang an nicht nur das »technische System« sehen, wenn Betriebswirte und Controller sich von dem Glauben lösen, alles über Zahlen zu beurteilen und zu steuern, und wenn Sozial- und Geisteswissenschaftler parallel dazu auch noch ihre Technikskepsis aufgeben – dann kann es funktionieren. Dann haben auch hiesige Großprojekte wie die Energiewende das Potenzial, als »Exportartikel« weltweit vermarktet zu werden. Wenn wir sie mit vielen kleinen Lösungen verwirklichen.
Die Energiewende exportieren
So, wie wir schon lange viele kleine Lösungen mit großem Erfolg exportieren. Gerade darin sind wir ja Weltmeister. Mit Dichtungen, Ventilen, Schrauben, Kolben. Weil wir viele kleine Komponenten so gut entwickeln und produzieren, sind wir so stark im Weltmarkt. Kleine Lösungen für große Probleme.
Genauso haben wir im Ruhrgebiet in den vergangenen Jahrzehnten etwas Enormes geleistet: einen Strukturwandel. Mit vielen kleinen Lösungen. Schritt für Schritt. Die Region stand für Bergbau und Stahlindustrie. Darauf begründete sich die Existenz der Firmen und ihrer Arbeiter. Das bestimmte auch das Selbstverständnis der Menschen. Inzwischen hat sich das Ruhrgebiet in eine Ansammlung vieler Dienstleistungszentren und neuer Industrien gewandelt. Die Industriekerne sind bewahrt worden, entgegen den weltweiten Trends. Aber es gibt neue Arbeit, es herrscht ein neues Denken – und ein neues Selbstverständnis. Dieser Strukturwandel ist eine enorme Leistung. Es verdient größten Respekt, was die Menschen dort auf den Weg gebracht haben. In vielen kleinen Schritten. Das kann man im Grunde nicht oft genug sagen.
»Enabled by Germany« hat Zukunft.
Wir neigen in Deutschland ja dazu, unsere Erfolge nicht gebührend zu feiern, sondern in falscher Bescheidenheit kleinzureden. Viele motiviert eher die Suche nach einem noch in der Suppe befindlichen Haar. Selten finden wir etwas uneingeschränkt gut. Ich finde den Strukturwandel beeindruckend – und sehe darin auch Exportpotenzial, beispielsweise für die sogenannten Megacitys dieses Planeten, die aus allen Nähten platzen – und dringend einen Strukturwandel benötigen. So könnten wir beginnen, um es überspitzt zu formulieren, nicht nur Schrauben zu exportieren, sondern Systeme und Konzepte. Problemlösungen für die Megaprobleme dieser Welt.
So ließe sich das von uns allen sehr geschätzte und stolz vertretene »Made in Germany« künftig noch mehr zu einem »Enabled by Germany« entwickeln.
Hier liegt viel Potenzial für Arbeit und Wachstum. Und davon könnten wir auch in Zukunft gut leben.
Wenn man vom eigenen Schnarchen aufwacht
Der umfassende und möglichst vollständige Blick auf Systeme ist ein Lebensthema. Ich habe über Mensch-Maschine-Systeme promoviert und über die Entropie in der Systemtheorie habilitiert. Neben meiner Tätigkeit als Institutsleiter an der RWTH Aachen, wo ich später auch Dekan der Fakultät für Maschinenwesen war, habe ich parallel ein Institut für Unternehmenskybernetik übernommen und weiterentwickelt.
Unternehmen sind vor allem lebende Systeme.
Auch Unternehmen sind lebende Systeme, in denen Informationen und Ressourcen durch komplexe Prozesse zu Waren oder Dienstleistungen werden. Diesem Denken liegt der Geist der Kybernetik zugrunde. Die Kybernetik lehrt vor allem, wie man in großen Systemen durch kleine Steuersignale das Große beeinflussen kann. Allerdings nur, wenn man das Große verstanden hat, nicht nur in seiner Funktionsweise, sondern auch in den Wechselwirkungen seiner Teile. Die Kybernetik hat mich geprägt. Wenn ich gefragt werde, was Kybernetik eigentlich ist, sage ich gerne: »Kybernetik ist, wenn man vom eigenen Schnarchen aufwacht.«
Das heißt: Die Dinge, die man irgendwie anstößt, fallen einem oft irgendwie wieder auf den Kopf, meistens »von hinten«. In der Kybernetik sind das die gefürchteten NRFs, die Neben-, Rück-, Fernwirkungen. Und die sind häufig stärker als die beabsichtigten Effekte. Und sie sind oft nicht nur stärker, sie sind darüber in komplexen Situationen grundsätzlich nicht prognostizierbar. Und kybernetische Wirkungen finden wir überall.
Sie müssen bereit sein zu scheitern