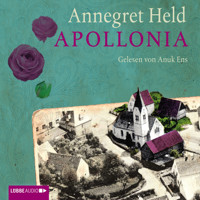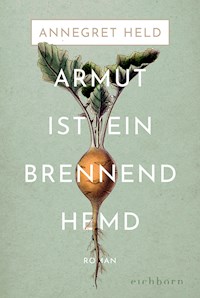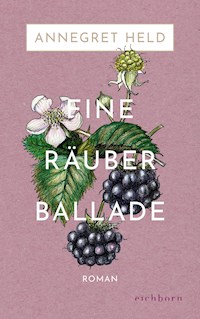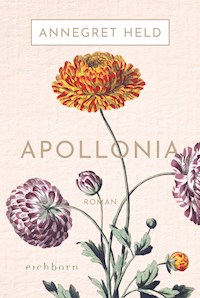6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Eher durch Zufall gerät Lotta, Mitte zwanzig, als Stationshelferin in ein Pflegeheim. Dort sorgt sie mit ihren Kollegen für alte Menschen, die zu krank oder zu verwirrt sind, um diesen Ort jemals aus eigener Kraft wieder zu verlassen. Der Tod ist allgegenwärtig und spaziert so zufällig über die Station, als müsste er sich überlegen, wen er diesmal mitnimmt. Annegret Held gelingt das Unglaubliche: ein höchst lebendiges Buch über das Leben und Sterben mitten unter uns, und ein leidenschaftliches Plädoyer für eine barmherzigere Sicht der Dinge, die alle Komik, alle Weisheit und allen Trost umschließt. Mit mitreißender Sprachkraft und voller Sympathie für ihre Figuren schildert sie die raue Wirklichkeit dieses vergessenen Ortes und nennt das Liebenswürdige und das Problematische, das Harmlose und das Bedrohliche beim Namen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Dreizehn Kännchen Kaffee
Einen warmen Pullover
Frau Wissmar?
Der schöne Fredderik
Jewgeni Schiwrin
Nach der Arbeit
Italien war ein schönes Ziel gewesen
Geh doch mal nach oben
Ein allerletzter Fisch
Jewgeni Schiwrin
Was sollte sie
Es war ein weiter Weg
Einen genauen Schnitt
Frau Wissmar
Ein hohes Haus
Ivy betrachtete sein Bein
Der Morgen dämmerte
Was es heute gab
Vielleicht war es ein Fehler gewesen
Fredderik hatte einen anderen geküsst
Nie wieder
Gianna stand auf dem Dach
Uljana Schiwrin
In ewiger Stille
Einen Brühwürfel
Das älteste Sotzbacher Mädchen
Ein Morgenwind
Fünfzehn Tropfen
Klatschnass
Der Nachmittagskaffee
Jewgeni Schiwrin
Fredderik war zurückgekehrt
Padre!
Eine neue Mütze
Kurtacker?
Aber was machst du!
Das älteste Sotzbacher Mädchen
In Bälde
Das war ein Taufgebet
Das war ein Taufgebet
So hatte Ivy
Die Nacht brachte Lotta
Binden über Binden
Ey, ich kann echt nix dafür
Schlimmer konnte es nicht kommen
Komm nach Hause
Nadjeschda
Ein neuer Morgen
Da stimmte doch was nicht
Zwölf Kännchen Kaffee
Nackte Weiber überall
Der Schafstall war mit Heu
Frau Dr. Kolchewski!
Blumen?
So, Ein Uhr
Wie ein Drachen
Dreimal klopfte sie an
Frau Wissmar!
Das älteste Sotzbacher Mädchen
Grundig, Philips
Ein Honigmond
Die Welt wollte
Rosalinde war nicht liegen geblieben
Die Nachtschwester
Es war in Königswinter
Elf leere Kännchen
Die kleine, schwarz gekleidete Donna
Kevin
Das älteste Sotzbacher Mädchen
Der Abendwind wehte
Lotta aber träumte
Rosalinde trank
Ferien auf Saltkrokan!
Jewgeni Schiwrins Lippen
Donna Lucia Pia
Aber Klara!
Lotta streichelte
Uljana Schiwrin
Shoushou Wollweber
Ich esse keinen Brei!
Im Keller ist es duster
Warum dürfen Frauen
Der Frankfurter Wellenschrank
Gianna, Ivy, Nadjeschda, Kevin
Lotta berührte
Oichee, murmelte Schiwrin
Frau Schlecker
Mein Sohn, oh mein Herr
Wo, bitte, soll ich hingehen?
Zwölf Kännchen Kaffee
Bestimmt war im Frühling
Kurtacker
Ein weißer kleiner Lichtstreif
Der Schreiner Siegmund Brecht
Heute geschlossen
Oh Gott, du hast in dieser Nacht
Als hätte Ivy Dreck gefressen
Pater Ludolfus
Ivy, sagte Rosalinde
Ey, sagte Ivy
Blaufuchs
Pater Ludolfus
Zu Bacharach am Rheine
Als der Schreiner Siegmund Brecht
Rosalinde
Jeff stand da
Fünfzehn Tropfen
Der Schreiner
Der Langhaarschneider
Als Nora Eisbrenner
Das Bett war gemacht
Gianna starrte Frau Eisbrenner an
Es war still
Ich weiß nicht
Das Sotzbacher Mädchen
Im Zimmer
Blumen für Rosalinde
Shoushou Wollweber
Das Mondlicht
In einen wunderbaren, dämpfenden, weißen Kokon
Über die Autorin
Annegret Held, 1962 im Westerwald geboren, arbeitete u.a. als Polizistin, Sekretärin, Altenpflegerin und Luftsicherheitsassistentin – und ist erfolgreiche Autorin. Sie bekam den Berliner Kunstpreis der Akademie und den Glaser-Förderpreis, ist PEN-Mitglied und lebt im Westerwald und in Frankfurt. Im Eichborn Verlag sind bisher erschienen MEINE NACHTGESTALTEN, DIE LETZTEN DINGE und FLIEGENDE KOFFER. APOLLONIA knüpft thematisch an ihren Roman BAUMFRESSERIN an, der ihr Dorf im Westerwald schildert, und vom Feuilleton sehr gefeiert wurde.
Annegret Held
Die letztenDinge
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© by Eichborn AG in der Bastei Lübbe AG, August 2005
Umschlaggestaltung: Christina Hucke, unter Verwendung
eines Photos von © Brand X Pictures
Lektorat: Doris Engelke
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-83874947-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Ich widme dieses Buch all jenen, die ihre Tage beschließen und sich der Obhut helfender Menschen anvertrauen müssen.
Ich widme es ebenso den unzähligen, flügellahmen Engeln auf Erden, die sich ihrer annehmen.
Ihnen meine tiefste Achtung, meinen höchsten Respekt.
Dreizehn Kännchen Kaffee wackelten auf dem Tablett hin und her, als Lotta ihren Wagen schob. Die Kännchen hatten keine Deckel und ihre Zuten waren angeschlagen. Aber der Kaffee duftete über den ganzen Flur von Zimmer zu Zimmer und über die Gänge von Station zu Station durch das ganze Haus.
Sieben Schnabelbecher wackelten ebenso und jeder Schnabelbecher hatte einen anderen Deckel. Gelbe Becher hatten blaue Deckel, blaue Becher hatten grüne Deckel und die meisten Becher waren gelblich weiß und ihre Schnäbel leicht zerbissen. Lotta schob den Wagen und der Zettel in ihrer Kittelschürze war ganz verknittert, so oft hatte sie ihn schon gelesen:
Meier mit Milch und Zucker Schlecker schwarz, Diabetikerkuchen Frau Norken: 1 Schnabelbecher mit Milchkaffee Kurtacker: Betreten verboten Was? Betreten verboten? Eben ging Lotta am Türschild von Herrn Kurtacker vorbei und blieb stehen. Starrte auf die Tür. Sie sollte diese Tür nicht öffnen? Oder sie sollte Kaffee und Kuchen an der Tür abstellen? Oder sollte Herr Kurtacker nichts bekommen? Hatte er eine Nahrungsmittelallergie? Lotta beugte sich vor und sah durchs Schlüsselloch: da saß ein Mann, seltsam zur Seite gebeugt, als wollte er etwas aufheben, ein schwarzer, ungekämmter Schopf fiel in sein Gesicht, der Oberkörper war nackt, Musik lief, AC/DC waren das wohl. Das reinste Rockkonzert. Lotta stutzte, der Mann war gar nicht alt. Vielleicht fünfzig. Jetzt kurvte er aus der Sicht und verschwand, der Bass vibrierte noch eine Weile durch das Schlüsselloch. Vielleicht mochte er keinen Kaffee, sondern lieber einen Whisky oder so.
Lotta zögerte; keine Schwester weit und breit, kein Pfleger, nur sie und ihr kleines bisschen Mut, sie beschloss, eine Ausnahme zu machen von dieser Regel auf dem zerknitterten, karierten Papier, sie konnte sagen, sie hätte das überlesen. Einfach mal die Nase zur Tür hereinstecken, der Mensch war doch kein Tier, er konnte ihr doch nichts tun, vielleicht sagte sie einfach mal guten Tag. Sie griff nach der Türklinke. Aber was war das? Die Tür ging nicht auf, sie war zweifach, dreifach abgeschlossen, nichts zu machen. Die hatten ihn eingesperrt, ging das überhaupt, durfte das sein?
Lotta wünschte sich, eine Schwester wäre dabei, hätte ihr alles gezeigt und erklärt und sie vorgestellt. Aber Schwester Rosalinde musste dringend Medikamente stellen, sagte sie, und sie sei froh, wenn sie sich nicht kümmern müsse. Und es stehe ja alles auf dem Papier. Also: Frau Schlecker schwarzen Kaffee und einen Kuchen. Lotta schaute noch mal auf das angeschlagene Kännchen ohne Deckel und den kleinen Kuchen. Das Haus müsse sparen, sagte Schwester Rosalinde. Eine Serviette hätte nicht geschadet. Ein Würfelchen Zucker. Ein Häubchen Sahne. Aber nichts da. Lotta seufzte und zuckte die Schultern.
Na ja. Die Leute hier hatten alle den Krieg überlebt und sich jahrelang von Rüben und Brennnesseln ernährt. Sie würden auch das überstehen. Lotta legte das Stück Marmorkuchen auf den Teller und trug ihn hinein.
Sehr tapfer, Frau Schlecker, sagte sie. Besser als Steckrüben und Beeren aus dem Wald.
Was?, krähte Frau Schlecker aus dem Sessel.
Kaffee trinken. Und Kuchen essen, sagte Lotta. – Ich kann Ihnen im Augenblick nicht helfen, denn ich muss weiter, ich blicke hier noch nicht so durch.
Waas?, krähte Frau Schlecker.
Lotta überlegte sich, sie müsste etwas netter sein. Das waren doch alte Leute. Da konnte man nicht so mit umgehen. Sie warf ihren braunen Zopf auf den Rücken und beugte sich zu Frau Schlecker herunter:
Wie geht es Ihnen denn?
Hm?
Wie es Ihnen geht!
Beschissen, krähte Frau Schlecker.
So. Dann. Gut. Dann gehe ich jetzt mal wieder.
Ick werde hier nich bleiben, sagte Frau Schlecker. – Ick jehe jetz nach Hause und denn werde ick euch alle anzeigen. Bei der Stadt, beim Oberbürgermeister. Jawoll.
Ja, dann. Guten Appetit, sagte Lotta.
Sie musste weiter. Den lieben langen Flur. Am Anfang des Flures war der Speisesaal, in der Mitte ein Aufenthaltsraum mit Fernseher, in den man durch eine Glaswand schauen konnte und in dem drei Leute vor sich hinkrümelten. Vor den Aufzügen befand sich das Schwesternzimmer und alle Räume für die Medikamente und die Wäsche. Lotta versuchte, sich alles zu merken.
Und sie ging zu Norken und Meier und Sturm und Schiwrin. Und der eine konnte nichts mehr sehen und die andere konnte nichts mehr hören und die Dritte nicht mehr laufen und der Vierte nichts mehr denken und der Fünfte war nicht mehr ganz dicht. Jeder wackelte und schniefte auf seine Weise vor sich hin und man musste sich fragen, ob das denn alles so seine Richtigkeit hatte.
Dem Herrgott ist am Ende die Schöpfung ein wenig aus der Hand geglitten, dachte Lotta, als sie ihren Wagen schob. Sie hatte noch fünf Kännchen Kaffee zu verteilen, drei Schnabelbecher und sieben Stückchen Marmorkuchen.
Einen warmen Pullover, ein Hemd, irgendein Hemd, Größe 50 oder so. Hier waren doch verdammt noch mal Hemden genug. Pflegehelferin Gianna wühlte emsig in der Kleiderkammer unter dem Dachjuchhee und suchte etwas für Herrn Wickert – Herr Wickert – ein Leben für die Henninger-Brauerei. Dem einen sein Tod ist dem andern sein Brot. In dem Fall sein Pullover. Gianna, nicht so groß, nicht so schlank, nicht so jung, schüttelte die grauen Löckchen, schniefte und wühlte weiter: Wo war denn hier mal was, hier hingen die Röcke, dort die Blusen. Wenn man ein wenig schüttelte, kam vielleicht noch ein wenig Leben heraus von dem Menschen, der sie zuletzt getragen hatte. Ein wenig Tosca, ein wenig Pfeifentabak, ein Hauch von Rosenduft, eine Spur von Irish Moos, irgendetwas, das aus dem Leben der Dahingegangenen erzählte, ein Shanty, ein Schneewalzer, ein Treffen am Silbersee.
»Der Sommer, seiner Feste müd, hält seinen Kranz in welken Händen …« So stand es auf dem Kalender im Speisesaal. »… Nun löst sich sacht, der letzte Tanz, der Regen stürzt, es fliehn die Gäste …« Herbert Hesse oder so.
Hier oben waren auch alle schon geflohen. Das Leben war aus den Kleidern geflohen. Die Franziskanerinnen, die das Haus früher betreut hatten. Gianna wollte auch fliehen. Aus dieser staubigen Kleiderkammer, mit all ihrem Geflüster, den allzu eng gehängten Geschichten, dem ineinander verwebten und verhäkelten ewigen Spinnengesang seiner Bewohner.
Gianna hatte jetzt ungefähr, was sie brauchte, drei Hemden, einen blauen Trainingsanzug, zwei Pullover, dicke Socken für Wickerts dicke Füße.
Wickert! Hatte sein Leben lang Bierfässer gerollt und von jedem Fass was abgetrunken. Jetzt stapfte er hier herum und hatte vorne und hinten nichts Anständiges mehr anzuziehen, aber immer noch Durst. Schnell jetzt. Schnell weg hier. Ihr Herz klopfte und stockte. Ihre Augen flackerten. Warum regte sie sich denn so auf? Sie regte sich auf, weil …
Schschsch … machte es. Herzstillstand. Gianna bekam einen Herzstillstand.
Madonna, sagte Gianna. – Was war das, was war das, ich habe nichts gesehen. Madonna.
Und sie kniff die Augen ganz fest zu, aber da war es schon wieder. Ein Hauch, eine Einbildung, eine Sehstörung. Es blies, das war der Wind, der Wind, der durch den Dachboden fuhr. Der immer und jedes Mal an der gleichen Stelle an ihr vorüberschwebte. Der Wind schwebte. So war das in der Kleiderkammer. Gianna würde sich nie daran gewöhnen. – Madonna … Madonna … dio mio flüsterte Gianna vor sich hin, stürzte aus der Tür und knallte sie hinter sich zu. Sie wickelte die Pullover und Socken zu einem Knäuel zusammen und stürzte auf die Dachterrasse, suchte hektisch nach der Schachtel Marlboro und zündete sich eine Zigarette an. Mamma Mia. Schon wieder. Sie wurde verfolgt von seltsamen Ahnungen, von Wahrnehmungen, sie hatte etwas empfunden, das es gar nicht gab.
Einbildung, sagte sie sich. Alles Einbildung. Aber was geschah alles in einem Haus, in dem so viele Menschen starben, Mamma Mia, es lag daran, dass die Schwestern und Pfleger die Fenster nicht öffneten, wenn ein Mensch davonging, da konnte die Seele nicht davonfliegen und verirrte sich im Haus, die arme Seele. Sie hatte es hundertmal gesagt.
Gianna schimpfte, fluchte wie ein Bauer, ärgerte sich über ihre Raucherei, die ihr Gesicht so elend aussehen ließ, sie zertrampelte die Zigarette und bekreuzigte sich. – Muss ich bete, ganz viel bete. Und für alle, die nich bete, auch, oh dio mio.
Frau Wissmar?
Frau Wissmar war die Personalchefin von der Degussa gewesen, so hieß es. Lotta klopfte noch mal an. – Hallo?
Frau Wissmar, 98 Jahre alt, lebte seit acht Jahren hier -seit sie ihr Haus angezündet hatte und nichts mehr übrig geblieben war als die Chippendalemöbel, ihre Kleider und ein Lodenmantel. Lotta hörte kein »Herein« und ging einfach los. Kännchen Milch mit Zucker. Marmorkuchen.
Frau Wissmar sah nicht auf. Sie saß im Rollstuhl an ihrem Tisch und trug einen blau karierten Faltenrock, einen fein gehäkelten, blassgelben Pulli und die Frisur einer ewigen Mireille Matthieu mit stark herausgewachsener Kastanienfarbe. Ihre Hände mit langen, schlanken Fingern hatte sie gespreizt, als wolle sie sie auf eine Klaviertastatur legen. Aber sie legte die drei Finger auf einen Stapel Papier. Er bestand aus dem »Goldenen Blatt«, dem Pfarrbrief, der »Frau im Spiegel«, dem Gemeindebrief, der Seniorenzeitung und dem Speiseplan für die nächste Woche.
Wie ist Ihr Name?, fragte Frau Wissmar ohne aufzusehen.
Lotta. Lotta Heinz. Ich bin neu hier.
Einen Augenblick, bitte.
Frau Wissmar trennte den Gemeindebrief und den Speiseplan von den Frauenzeitschriften, legte sie auf den Rundbrief des Seniorenzentrums und sortierte diesen dann nach vorne. – So, sagte sie. Nahm den Stapel auf und schien ihn durchzuzählen. Stieß ihn noch mal auf die Tischplatte auf, damit er bündig wurde, teilte ihn noch einmal und legte einen der Papierstöße in eine Ecke.
So, sagte sie und wirkte sehr befriedigt. – Ist das auch erledigt.
Dann drehte sie sich um.
Ja, Frau Schmidt. So. Jetzt habe ich Zeit für Sie. Was kann ich für Sie tun?
Lotta fing an zu stottern.
Ich habe Ihnen Kaffee und Kuchen gebracht.
So. Aha. Wie?
Frau Wissmar schien aus dem Konzept gebracht. Dann fasste sie sich.
Ja ja. Gut. Dann. Stellen Sie es dorthin.
Sie konnte kaum den Kopf heben und zeigte mit ihren schlanken, grazilen Fingern auf den Nachttisch, drehte sich dann im Rollstuhl zu Lotta hin. Ihre Füße standen X-beinig und dürr zueinander gedreht in einer Art blass-türkisen Mokassins mit goldener Schnalle. Schuhe aus den 70er Jahren.
Gut, sagte Lotta. Stellte alles auf den ausgezogenen Nachttisch und wünschte einen guten Appetit. Aber Frau Wissmar griff schon wieder nach einem neuen Stoß Papier.
Der schöne Fredderik , der hatte es ihm angetan. Der Fredderik. Er hatte ihm den Mund zerbissen, die Nacht geraubt, die Haut gefetzt, der Fredderik. Der Fredderik würde dafür büßen müssen mit noch mehr Bissen und noch mehr Schrunden, die Leidenschaft, die Triebe, die Hiebe, heute Nacht ging es weiter. Wenn er dann noch konnte. Ivy musste sich an die Wand lehnen. Nicht Mann, nicht Frau. Ivy konnte sich einfach nicht entscheiden. War auch egal. Jetzt noch sieben Leute waschen und ins Bett bringen, dazu die dicke Berta, das schaffte nicht mal er, denn Berta wog zwei Zentner und brauchte einen Lifta. Ivy rieb sich die Stirn. Diese Bewegung setzte drei Muskeln in Bewegung, den Trapezius, die hinteren Deltamuskeln und die Romboiden, Ivy kannte nämlich jeden seiner Muskeln ganz genau. Er sorgte für sie, jeden Tag, und das ließ er sich auch was kosten. Nicht umsonst hatte er heute Nacht Fredderik erobern und diese Leidenschaft in ihm entfachen können. Ach Fredderick, der schöne Fredderik, wie war seine Haut so samtweich und welch einen Griff hatte er, der Fredderick, wenn er ihn an die Wand presste, das hatte sich gelohnt, die Nacht mit Fredderick. Ivy hatte Kohldampf, er musste sich gleich ein halbes Hähnchen holen, sonst wurde er wahnsinnig. Eigentlich machte er eine Diät mit Quark und Himbeeren, ein spezielles musclefood, das hatte er aus der Zeitschrift »Men’s health«.
Wie der junge Marlon Brando, sagten die Leute. Das gefiel ihm. Auch wenn er keine Brando-Filme kannte, so hatte er sich doch einen Gang zugelegt, von dem er sich vorstellte, dass Brando so gegangen sei vor wer weiß wie viel Jahren. Wovon die Leute immer erzählten. Und Marlon, der lange, lange vor seiner Zeit gewesen war. Heute hatte Ivy etwas Mühe, sich aufrecht zu halten. Ihm zitterten die Knie. Er brauchte einen Kaffee, sonst konnte er die dicke Berta unmöglich ins Bett bringen. Hinten stand Lotta, die neue Stationshilfe. Sie musste doch noch irgendwo einen Kaffee haben. Genau, da stand der Wagen mit dem Kanister und Ivy ging zu ihr, nahm eine Tasse und goss sie voll.
Ey du.
Hallo.
Oh, du bist bestimmt Lotta, die neue Stationshilfe.
So isses.
Ich bin Ivy. Mache hier den Spätdienst. Und du, wie gefällt es dir?
Och, ich bin eigentlich ganz froh.
Lotta plapperte auf einmal drauflos.
Ich bin hier ganz froh, dass ich das gefunden habe. Weißt du, ich bin in England gewesen wegen so einem Kerl und das ist nicht gut gegangen. Industriearbeiter in Manchester. Sah gut aus, aber war doch nix. Und da habe ich mir gedacht, ich gehe wieder zurück, aber ich will ja nicht bei meinen Eltern wohnen und da habe ich es geschafft, erstmal hier ein Zimmer zu kriegen, und muss nicht ins Dorf zurück und da kann ich mich erst mal um alles kümmern und habe Geld und …
Wieso, wo wohnst du denn?
Ich habe HIER ein Zimmer gekriegt, unter dem Dach.
Du wohnst im ALTERSHEIM?
Na ja, das Zimmer ist ganz schön, es hat ein rundes Fenster und du hast einen Blick über die ganze Stadt! Es sieht aus wie in dem Film »Die verbotene Tür« von dem Opernhaus da in Paris, also es sieht ein bisschen aus wie über den Dächern von Paris.
Aber dafür wohnst du im ALTERSHEIM!
Na ja, es ist billig. Und irgendwas ist ja immer.
Was hast du denn gelernt?
Ich hatte Krankengymnastin angefangen. Also, nicht fertig gemacht. Wegen dem Brian. Ich bin vom Campingplatz aus – gleich – mit zu ihm.
Ivy schüttete den Kaffee in einem Zug in seinen großen Mund. Seine Haare waren dunkel und seine Augen ebenso. Eine südländische Variante von Marlon.
Das war auch immer mein Problem. Ich kann einfach nix fertig machen. Ich halte keine Ausbildung durch. Kann mir einfach nix sagen lassen.
Bist du kein richtiger Pfleger?
Nur Pflegehelfer. Aber ich arbeite wie sieben Pfleger zusammen. Das kannst du mir glauben. Wenn ich könnte, wäre ich gerne Polizist. Aber zu spät.
Wieso denn, fragte Lotta. – Kannst du dich doch immer noch bewerben.
Nö, mit 28 ist es zu spät, da nehmen sie einen nicht mehr. Ich war genau vier Wochen zu spät.
Ah. Pech. Sag mal – Was ist los mit Herrn Kurtacker? Wieso sperrt ihr ihn ein?
Ou Mensch, der. Das ist ein Fall für sich. Wir sperren ihn nicht ein. Der sperrt uns aus. Wir gehen nur zum Essenbringen rein.
Ach so.
Ich muss los.
Ivy löste sich von der Wand und ging, Schritt für Schritt. Er musste sich ein Hähnchen holen. Er musste eine halbe Stunde schlafen. Er wollte sich ein Hähnchen holen UND schlafen. Bei Frau Sturm. Er legte sich ein wenig bei Frau Sturm auf das Sofa. Wenn er jetzt nicht schlief, konnte er unmöglich all die Leute ins Bett bringen. Sie hätten den Tequila nicht trinken sollen. Wenn er zu Frau Sturm kam, dann freute sie sich wie verrückt. Sie würde ihn zudecken und ein Kissen zurechtstopfen und Schmiere stehen. Wenn Rosalinde kam, dann sagte Frau Sturm, sie bräuchte eine neue Windel, diese lief davon und in der Zeit weckte sie Ivy. Sie waren ein eingespieltes Team, Frau Sturm und er, sie würde ihn niemals verpfeifen, nie. Er war schließlich ihr Liebling, ein großer Liebling, der Liebling aller. Und wenn er wieder beisammen war und den Dienst geschafft hatte, dann ging er wieder ins Brother Louie und würde Fredderik suchen und wenn er ihn gefunden hatte, dann würde er ihn zugrunde richten, heute Nacht.
Jewgeni Schiwrin war ein Männlein mit feuerrotem Haar. Sein Mund war verschlossen, seit langer Zeit. Dabei hatte er mit fünfzig noch Deutsch gelernt, und er hatte sich auch unterhalten. In Kassel, im Knüllwald, als sie die großen Tunnels gebaut hatten für den ICE, da war er dabei gewesen, als Ingenieur, Schiwrin hatte sich durchgesetzt wegen seines Fachwissens, da waren Sprachen kein Hindernis, er war eben gut. Wenn er sich jetzt erinnerte, stand er immer noch im Tunnel und prüfte die Stahlkonstruktionen, ICE-Strecke Kassel–Göttingen, das war sein Stolz gewesen, sein Meisterwerk, seine Reifeprüfung in Deutschland. Aber er fand nicht mehr die Worte, um den Tunnel zu beschreiben. Über die Tunnels hatte er seine Familie vergessen. Das warfen sie ihm vor. Sie hatten ihm immer alles Mögliche vorgeworfen, er hatte nie zugehört und sich in seine Tunnels vergraben. So hatte er auch nicht bemerkt, wann seine Frau und seine beiden Töchter ihn langsam ausgestoßen hatten aus der Familie. Vielleicht war es das feuerrote Haar, mit dem sie ihn immer gehänselt hatten. Das Haar quoll wie Werg hervor, wie geknautschtes Rosshaar, es ließ sich nicht richten, nicht kämmen, es quoll nur immer weiter; wellig und trocken wie Holzwolle, saß es wie eine Mütze auf seinem Haupt. Dazu rote Augenbrauen und eine rote Haut, die sich ständig schuppte, nur seine Brille war schwarz gerandet und seine Augen waren trübe. Er war kein Mann, kein Goliath, vielleicht hatte seine Frau sich selber nie verziehen, dass sie ihm gefolgt war, gefolgt in die Ehe und gefolgt nach Deutschland. Sie hätte einen besseren haben können, ganz bestimmt. Seine Töchter waren verschieden. Die eine schneewittchengleich und gut. Die andere kam mehr nach ihm und war bösartig obendrein. Schiwrin hatte sich in das dürre Gehäuse seines Körpers verschanzt. Was sollte er noch? Was wollte er noch? Es war aus.
Draußen polterte und bollerte es an der Tür. Jetzt brachten sie schon wieder was zu essen. Er wollte nichts essen, er konnte nichts essen, er sollte immer trinken, dauernd waren sie hinter ihm her, er solle trinken. Dabei wollte er nichts anderes als auf dem Sofa liegen, nichts hören, nichts sagen müssen, er konnte doch nicht mehr reden, er konnte kein Deutsch mehr, nur noch Russisch. An manchen Tagen nur noch Jiddisch.
Ein laut rufendes Etwas hatte sich genähert. Eine Stimme drang zu ihm, wie plötzlich Sonne in einen finsteren Brunnenschacht fiel.
Dobri djen, Herr Schiwrin. Ich bin Schwester Nadjeschda. Aus Sibirien.
Wos? ... Aaah, nakonjetz russkaja duscha.
Endlich mal eine russische Seele!
Da, sagte Nadjeschda. – tui vidisch rabotaju medizinskoj sjesestrj!
Ja, wie du siehst, arbeite ich hier als Krankenschwester. A otkuda tuj?
Und wo kommst du her?
Is Peterburga.
Oichee … Jetzt musste Herr Schiwrin nach langer, langer Zeit einmal lachen. Oijoijoi. Nadjeschda. Nadja. Sibirsk. Ein russisches Wort.
Schwester Nadjeschda lachte auch, fing an zu husten und hielt sich die Faust vor den Mund. Ihre zarten Ohrringe mit einem grünen Stein und kostbaren russischen Ornamenten zitterten. Nadjeschda wog doppelt so viel wie Herr Schiwrin und war einen Kopf größer als er. Sie wurde auf einmal streng, überkreuzte die Arme und musterte ihn von oben bis unten.
Wie geht, Herr Schiwrin?
Oichee, Herr Schiwrin grinste in sich hinein. – Gutt, geht gutt.
Geht NICHT gut, Herr Schiwrin. Sitzen immer allein! Haben Kopfschmerzen!
Herr Schiwrin schüttelte den Kopf. Er hatte keine Kopfschmerzen.
Aber Arzt hat gesagt, habe schwere Kopfschmerzen! Ich gebe Medikament!
Nadjeschda duldete nicht, dass er keine Kopfschmerzen hatte. Herr Schiwrin hatte einen Tumor, das wusste hier jeder. Wieso hatte er keine Schmerzen? Das konnte gar nicht sein.
Njet.
Herr Schiwrin, wo ist Frau?
Kommt nicht.
Kommt nicht?
Nadjeschda wurde zornig. – Kann nicht lasse Mann alleine!
Oichee, lachte Herr Schiwrin. – Ist böse Frau.
Naaain. Ich rufe an, Frau.
Njet! … Keine Frau anrufen.
Aber Nadjeschda duldete keinen Widerspruch.
Als sie schon beinahe draußen war, rief Herr Schiwrin ihr nach: Wo hast du gelernt, sibirische Pflanze?
In Tuberkulosekrankehaus. Von Gefängnis. In Gefängnis alle hatten Tuberkulose. Das schwere Arbeit, oichee.
Und Herr Schiwrin lachte leise, nach langer, langer, langer Zeit.
Nach der Arbeit betrat Lotta ihr Dachzimmer, knöpfte sich den Kittel auf und sah sich verwundert um. Dass sie so ein Zimmer bekommen hatte. Das hohe, bogenförmige Fenster, das über alle Dächer der Stadt blickte. Die Dächer von Paris! Nein, Paris war es nicht. Es waren die Dächer einer mitteldeutschen Stadt und zwar im Rhein-Main-Gebiet. Trotzdem sah es aus wie Paris. Das Fenster war eingelassen in ein schräges Dach, es war eine Gaube, Lotta war verliebt in das Gaubenfenster. Der Rest des Zimmers war ungewollt fünfeckig, mit unterschiedlich langen Wänden. Hineingewurstelt in ein Altersheimdach, vermutlich um Schornsteine herumgebaut, so mancher Hausmeister und manche Nachtschwester hatte hier vorübergehend eine Bleibe gefunden. Eine Kochecke gab es nicht, aber Lotta konnte zwei Kochplatten bekommen. Es gab ein Bett, einen Tisch und zwei Stühle, einen Kühlschrank und einen Kleiderschrank.
Wirklich sehr hübsch!, sagte sich Lotta. – Die fünf Ecken!
Sie kramte einen weiteren zerknitterten Zettel aus der Schürze, glättete ihn und hängte ihn mit einem Reißbrettstift neben die Tür, zum Auswendiglernen:
Arbeitsanweisung:
Wäsche täglich (Schmutz und Rein)
Frühstücks-, Mittagessens- und Kaffeetisch vorbereiten, verteilen und nach dem Essen das Geschirr wieder abräumen
Spülbecken und Nachttische in den Zimmern täglich reinigen
Wäsche für die Pflegewagen sortieren
Alle vierzehn Tage Betten und Bettgestelle reinigen
Alle vierzehn Tage Rollstühle säubern
Einmal pro Woche Stationszimmer und Stationszimmerschränke reinigen
Das war ja nicht so schwer zu kapieren. Das konnte sie machen und wenn sie was nicht wusste, notfalls mal jemanden fragen.
Lotta öffnete ihre schwere Reisetasche und zerrte all ihre Habseligkeiten über die einfachen Dielenbretter, sie suchte nach ihrem alten, hellblauen Frotteepyjama, der so wunderbar bequem war. Glück gehabt. Einfach nur Glück gehabt. Einen Job und ein Zimmer, vierzehn Tage nach ihrer unrühmlichen Heimkehr aus England. Mehr brauchte sie nicht. Mehr wollte sie nicht. Nur einen Unterschlupf und etwas Geld, um hier wieder Fuß zu fassen. Gottseidank. Jetzt konnte sie Luft holen.
Konnte man Luft holen in einem Zimmer, das über einem Pflegeheim lag? War das Luft? Lotta riss das halbrunde Fenster auf und sogleich pfiff ein ordentlicher Wind in das Zimmer hinein. Luft aus dem Rhein-Main-Gebiet. Na ja. Besser, als weiterhin bei ihrem Bruder zu leben, dessen Frau sie schon auf die Nerven ging. Sie könnte es sich hier gemütlich machen, hatte die Pflegedienstleiterin gesagt. -Sie können Bilder aufhängen, natürlich – ein Mobile oder was … ich meine, Sie werden ja nicht gleich die Wände einreißen, nicht?
Nein, Lotta hatte keineswegs vor, die Wände einzureißen, dafür hatte sie jetzt keine Kraft. Höchstens mal auf dem Dachboden herumstöbern, sehen, was es alles gab, Lotta war zufrieden damit, alles im Zimmer auszuprobieren: das Licht, den Kühlschrank, das Telefon. Alles funktionierte. Das Zimmer war hell gestrichen, das Bad war groß und weiß, so groß, wie sie es in England nicht gehabt hatte. Eine schöne, bequeme Badewanne mit einem breiten Rand für Shampoo und Schwamm und Buch. Da stand noch eine Flasche Badedas. Unwiderstehlich. Wer hatte wann sein Badedas hier vergessen? Es hieß, das Zimmer habe lange leer gestanden. Aber alles roch gut und frisch, als hätte man es extra für sie hergerichtet.
Sollte sie jetzt gleich ein Bad nehmen, oder erst noch ihren Bruder anrufen? Er konnte dann auch die Eltern informieren. Wenigstens. Er verstand sich ja mit den Eltern sowieso besser als sie. Er war auch nie mit einem Arbeiter aus Manchester durchgebrannt.
Lebenserfahrung ist das! hatte Lotta gesagt.
Aber die Eltern hatten darauf bestanden, Lotta zu verzeihen, und Lotta wollte nicht verziehen bekommen. Jetzt bestanden die beiden darauf, mit Lotta wieder liebevoll ins Gespräch zu kommen und über die vergangenen Jahre zu reden. Aber Lotta wollte nicht über die vergangenen Jahre reden. Und darum drückte sie sich vor ihrem katholischen Dorf und blieb lieber in der Stadt, auch wenn sie dort kaum mehr jemanden kannte. Sie hatte nicht gewusst, wie kaum mehr. Nun ja, sie würde die alten Freunde schon wieder aufstöbern. Irgendwo. Oder sie suchte sich eben neue Freunde. Es gab so viele Menschen auf der Welt.
Lotta ließ sich aufs Bett fallen. Das Bett war schön. Funkelnagelneu, frisch zartgelb bezogen, ein Bett aus schönem, hellem Buchenholz mit dem Geruch von Möbelhäusern. Außerdem hatte das Bett Hebel, Bremsen und Rollen. Ein Bett, mit dem man allerlei anstellen konnte. Lotta probierte im Liegen einen Hebel. Das Bett fuhr langsam hoch. An einem anderen Hebel fuhr es wieder herunter. Bei diesem Knopf hob sich das Fußteil. Bei jenem das Kopfteil. Das war großartig. Dann sah sie unter dem Laken weiße Streifen hindurchschimmern, Streifen von der Matratze. Lotta stand auf, streifte das Laken an einer Ecke zur Seite und starrte entsetzt auf den schlichten, grauen Stoff mit den dicken eingewebten weißen Balken unterschiedlicher Breite. Vielleicht war die Matratze fünfzig Jahre alt. Oder hundert. Es war eindeutig dieselbe Matratze, wie sie unten auf der Station verwendet wurde. Plötzlich wurde Lotta von dem Gefühl befallen, in dem Bett könnte schon jemand gestorben sein. Oder zwei. War doch möglich? Wer weiß, wer hier schon drauf gelegen hatte und seinen persönlichen Abdruck in Rosshaar und Schaumstoff hinterlassen hatte?
Das war grauenhaft. Wie man sich bettet, so liegt man, dachte Lotta. Nicht dran denken, sie durfte einfach nicht dran denken. Lotta stopfte ganz schnell das Laken wieder fest und versteckte die Matratze noch unter zwei Lagen Bettbezug und Blumenwäsche. Es hatte hier nie eine Altersheimmatratze gegeben, sie hatte das graue Teil nie gesehen, sie schlief auf einer schlichten guten Unterlage und wollte nie wieder daran denken.
Ging sie lieber in die Badewanne und las ein schönes Buch. Lotta sah in den Spiegel. Ihr brauner langer Zopf hatte sich gelöst. Sie hatte grüne Augen und eine kleine Narbe mitten auf der Stirn. Als Kind war sie vom Baum gefallen und hatte dieses Mal behalten, sie erinnerte sich noch an das viele Blut. Lotta hat ein Loch im Kopf, hatten sie gesagt. Jetzt war das Närbchen angefüllt mit vertrocknetem Schweiß. Schnell in die Wanne.
Warum hatte die Frau damals ihr Schaumbad nicht mitgenommen? Irgendeiner auf Station hatte etwas gesagt von: früher mal eine darin gewohnt … hat in den Sack gehauen. Und: Hier hält es ja keiner lange aus. Wer ging, dem weinte man auch nicht nach. Es kam schon jemand Neues. Der dann auch wieder ging, eines Tages. So war Lotta gekommen. Und so wollte sie wieder gehen. Das sagte sie sich gleich: Das hier ist nur ein Übergang, bis ich wieder Fuß gefasst habe. Vielleicht in einem Jahr oder in einem halben, keinesfalls bleibe ich länger als ein Jahr.
Lotta war zufrieden. Warf die Kleider auf die Stühle, ging nackt ins Bad und sah sich vorher noch mal um. Ein schönes Zimmer. Ein schönes Zimmer mit fünf Ecken und einem großen runden Fenster mit dem Blick auf die Dächer von Paris.
Ein wunderschönes Zimmer.
Nur – es war in einem Altersheim. Aber irgendwas war ja schließlich immer.
Italien war ein schönes Ziel gewesen . Die lichtvolle Insel Sizilien, der rauchende Ätna und davor Fredderik, der ihm die Zunge zeigte. Und wie er ihm die Zunge zeigte! Das war sein liebstes Bild, Fredderik mit der rausgestreckten Zunge. Daran hatte er wunderbare Erinnerungen.
Ivy betrachtete die Fotos genauso, wie es seine alten Damen taten, die immer wieder die Schwarzweiß-Bilder herausholten und sie anschauten, stundenlang. Er sah die Fotos an, wie alte Erinnerungen. Wieso Erinnerungen? Er musste dafür sorgen, dass er morgen eine neue Erinnerung hatte. Wo war die Telefonnummer? Ivy konnte sie auswendig. 0179/5734812. Rückwärts konnte er sie, vorwärts konnte er sie, die Nummer war ein Gebet. Sein Gebet um einen nackten Rücken und ein emporgerecktes Kinn und um Schweiß in den Kuhlen der Schlüsselbeine, der Fredderik, der Fredderik, der sollte ihn küssen und ihm das liebeslüsterne Fell über die Ohren ziehen, seine Privathure, sein Hurenbock, sein Man-Eater.
Ach Fredderik, ruf mich ein einziges Mal an. Ein einziges Mal du. Mich. Unruhig stapfte Ivy in seiner Dachwohnung umher, streifte die weißen Wände entlang, rieb sich an der Raufaser, tippte der beleuchteten Muttergottes auf den Kopf. Fredderik, Fredderik, wer konnte da helfen? Wer konnte losgehen und ihn für Ivy suchen?
Er wollte ihn verwünschen und verfluchen, weil er ihn so brauchte, den Elenden, wo trieb er sich nur herum? Im Brother Louie, natürlich, im Brother Louie und auf der Straße und bei Freunden, welchen Freunden? Hungrig war Ivy, hungrig nach seinem schönen Freund, dem mit den sanften Kuppen unter dem leichten Hohlkreuz, wie ein Eisläufer, der stramme Hintern eines Läufers, so war sein Fredderik, von der Brust ganz zu schweigen. Flaum. Ivy lief alles Wasser zusammen, und Wasser wurde zu Wein und Wein wurde zu Meeresschaum und der Meeresschaum wollte sich ergießen, wieder und wieder, wo war Fredderik?
Ivy fluchte und griff nach der Jacke. Er musste ihn finden. Zufällig finden, so zufällig, als hätte er ihn nie gesucht! Wäre nie, nie auf die Idee gekommen, ihn zu suchen, hätte nie an ihn gedacht, nie, und das war das Einzige, das half, das wusste schließlich jeder.
Geh doch mal nach oben und sieh nach, ob wir irgendwas für Herrn Schiwrin haben, sagte Schwester Rosalinde. – Er hat ja nur noch diesen blöden, glänzenden Turnanzug aus Plastik. Dass der aber auch keinen hat, der ihm mal ein paar Klamotten von daheim holt.
Gianna erbleichte.
Bin ich erste gestern in die Kleiderkammer gewese, fir de Wickert, de alte Esel. Kann eine andere gehe.
Wer denn? Gianna, die sind doch alle unterwegs, bist doch nur du da und Schiwrin hat sich schmutzig gemacht, ich bin das leid. Guck mal, guck mal nach allem, Unterhemden, Socken, der braucht einfach alles. Bitte die kleinste Größe, er ist … nicht so ein Goliath.
Gianna rang mit sich. Sie wollte nicht mehr in die Kleiderkammer. Sie konnte warten, bis Ivy wiederkam oder Nadjeschda. Aber Nadjeschda war eine richtige Schwester, der konnte sie nichts sagen, und Ivy, wer weiß. Gianna wagte keine Widerrede, sie war nur eine kleine Fabrikarbeiterin, die im Akkord gearbeitet hatte und hier in Deutschland mühevoll den Pflegehelferinnenkursus besucht hatte. Wenn Rosalinde etwas sagte, dann musste sie es auch machen. Außerdem: der arme Schiwrin. Ihr Herz tat weh, wenn sie an ihn dachte. Also gut. Bereits auf der Treppe fing sie an zu beten.
San Pietro, San Paolo, San Giacomo, San Filippo, Sant’ Ambrogio …
Die Tür zur Kleiderkammer stand offen. Weit offen. – Kleine Größen, sagte sich Gianna. Ganz klein. – Hatte einen Hintern wie zwei Hände so groß … Schiwrin, Schiwrin, der Mensch war verloren, trieb so allein auf der Erde herum … Gianna steckte den Kopf tief in die Schränke, prüfte Pullover um Pullover und Hemd für Hemd. Jedes Hemd, das sie herauszog, konnte das letzte sein. Sie kniff die Augen zusammen, betete unaufhörlich vor sich hin, fand endlich eine Auswahl von Socken und Hosen, etwas für oben, etwas für unten, da noch ein guter Winterpullover, vielleicht zu groß, egal, besser zu groß als zu klein. Das musste genügen.
Sie drehte sich mit geschlossenen Augen, wollte tunlichst schnell die Kammer verlassen, blind und schnell, aber sie stieß sich an dem Tisch mit der Nähmaschine, an der die Meierin immer die alten Namensschilder aus den Kleidern trennte und neue hineinnähte. Manchmal war keine Zeit für neue Namensschilder. Da blieben die alten Namen drin und schon trug sie ein neuer Alter. Gianna holte tief Luft, öffnete die Augen … und sah es. Ein weißer Schatten, ein weißer Schatten, der an sie heranwollte, Gianna schrie gellend.
Beinahe wären ihr die Kleider für Schiwrin aus der Hand gefallen und sie rannte, raste davon, stolperte durch die Hintertür hinaus aufs Dach, nein, Dach war auch falsch, sie musste hinunter, unter Menschen.
Madona Santa, alle Eilige! schimpfte sie. – Warum ihr abte nicht geholfe!!
Fiel um ein Haar die Treppe hinunter, trat beinahe die Tür vom Stationszimmer ein und warf alles auf das Sofa.
Rosemarie schaute von einer Wunddokumentation auf.
Was ist denn mit dir los?
Ich gehe nichte mehr in de Kleiderkammer! Gehe ich nix mehr obbe hin! Warum alle macke nicht die Fenster auf, wenn eine stirbt? Obe at sich ein Seele verfloge!
Was sagst du?
Ab ich obe eine weiße Schatte gesehe, wie ein Frau, ich schwöre, bei Gott, bei Muttergottes, habbe ich gesehe, da iste was! Habe ich gesehe!
Rosalinde atmete tief ein und ließ den Kugelschreiber auf das eng bekritzelte Blatt sinken. Decubitus. Anfangsstadium. Frau Wilhelm stündlich gelagert. Leichte Verfärbung. Maßnahmen.
Da bist du nicht die Erste, sagte Rosalinde. – Und nicht die Letzte …
Abbe andere auch schon gesehe ...?
Rosalinde zwinkerte ein wenig, setzte die Brille ab und sah Gianna lange an.
Tja …
Gianna plumpste in den Sessel.
Aber was … was solle macke?
Rosalinde zuckte nur hilflos die Schultern.
Gott musse helfe, der Gott in Himmel!
Ach der, sagte Rosalinde. – Der ist doch blind und taub. Sitzt den ganzen Tag da oben und isst Philadelphia.
Santa Maria, Sant’ Ambrogio, San Vincenzo. Was macke. Was macke? Der arme Gespenst at sich verfloge. San Bernardo, San Domenico, San Francesco.
Ein allerletzter Fisch mit Kartoffelpüree und Petersilie, Kopfsalat und Kompott wartete einsam auf Lottas Wagen. Auf die Serviette hatte Schwester Rosalinde den Namen gekritzelt: Kurtacker. Herr Kurtacker. Dessen Zimmer sollte sie aber nicht betreten. Unschlüssig stand Lotta herum, Schwester Nadjeschda war schon fort und Gianna half auf der anderen Station aus. Je kälter der Fisch wurde, umso schlimmer konnte es mit Herrn Kurtacker werden. Er sei ungeduldig, hieß es. Er werfe mit Bierflaschen, hieß es. Er sei noch nicht mal ein richtiger Mensch, hatte Gianna gesagt. – Er ist kein Tier … er ist kein Mensch … er ist der … KURTACKER!!!
Lotta hatte einen Schlüssel bekommen, für alle Fälle. Wenn mal was sei. Sie betrachtete den Schlüssel und ließ ihn einmal hin- und herpendeln.
Ach, was soll’s.
Sie würde schnell das Essen hinstellen und wieder fortlaufen. Ganz fix ging das. Herr Kurtacker hatte ein Recht, normal zu essen, auch wenn er selbst nicht normal war. Wenn man ihn nicht normal behandelte, wurde er vielleicht noch schlimmer. Denn Gianna hatte gesagt: Wenn er guckte, aus die schiefe Auge, durch die schwarze Haar, wenn hat diese Blick – dann iste richtiger Teufel!
Lotta schluckte. Krallte sich das Tablett und trug es wie zum Schutze vor sich her. Nahm den Schlüssel und drehte ihn dreimal um. Die Tür öffnete sich. Da saß Herr Kurtacker mit dem Rücken zu ihr. Nackter Oberkörper. Roter Rollstuhl. Ein mit Taschen und Klamotten voll geladener Fernsehsessel. Den Kopf seitlich aufgestützt, sah er aus dem Fenster. Vor seinem Fernseher standen in Reih und Glied etwa fünfzig verschiedene Figuren aus Überraschungseiern. Der Fernseher war aus, die Musik ebenso. Das Bett war zerwühlt und schmutzig. Aus der Nachttischschublade quollen Plätzchen, Rasierapparat, Bildzeitung und alte Fotos. Jetzt drehte Kurtacker sich um und sah sie an. Sein Gesicht war schief, unrasiert, und die Haare fielen ihm in die Augen. Wild und schwarzäugig blickte er sie an.
Ich – ich bringe das Mittagessen.
Kurtacker bedeckte die schiefe Hälfte seines Gesichtes, winkte ihr zu und kam herangerollt. Sein linker Arm lag schwach und muskellos auf seinen Knien, der andere Arm schob den Reifen. Herr Kurtacker war krumm, buckelig und finster.
Lotta überlegte sich, schnell zu verschwinden, bevor Herr Kurtacker bemerkte, wie kalt sein Fisch inzwischen war. Und bevor die Schwestern bemerkten, dass sie verbotenerweise zu ihm hineingegangen war.
Aber dann hielt sie irgendetwas zurück. Eine Art Spannung oder Faszination. Dem Ungeheuer so nahe zu sein. Was war denn so ungeheuerlich an ihm? Gut, er hatte schon die Fensterscheiben eingeschlagen. Gut, er hatte Ivy schon mal eine Flasche übergezogen. Gut, er hatte der letzten Stationshilfe den Arm ausgekugelt. Aber vielleicht geschah das ja nur aus einem momentanen Unwohlsein? Vielleicht konnte man Herrn Kurtacker helfen, sich wohler zu fühlen?
Fehlt noch was? Salz oder so?
Verwirrt blickte Kurtacker auf. Sagte dann eher verschüchtert: Nein, … nein … Gut so.
Ich bin neu, sagte Lotta. Verschränkte die Arme hinter dem Rücken.
Kurtacker drehte sich mühsam um. Seine Stimme glitt wie Geröll über den Asphalt. – Ja. Ja. Er musterte sie verstohlen unter der Hand, die das schiefe Gesicht bedeckte. – Schön. Wunder … wunderbar. Bist ein schönes Mädchen.
Lotta wagte sich immer mehr.
Kann sein, dass der Fisch ein wenig kalt ist.
Daraufhin zuckte er zusammen. Warum? Weil sie noch immer da war? Oder weil der Fisch kalt war? Weshalb hatte er gezuckt?
Ein weiteres Grollen schien ihn zu packen. Seine nackte, linke Schulter schob sich hoch, sein Knie in der blauen Turnhose wippte, er nahm mit der Rechten die Gabel und stocherte im Fisch. Probierte. Schmeckte, wie kalt der Fisch war, und sein Grollen nahm zu, er geriet ins Schnaufen – und von einer Sekunde zur anderen schien Kurtacker zu bersten vor Wut, seine Augen glühten, die Haare fielen ihm noch tiefer in die Stirn und er zitterte, – der ist kalt! Der ist kalt! Der ist kalt … Himmel … und … Jetzt liefen ihm die Worte aufeinander, stauten sich, er konnte sie nicht mehr einzeln artikulieren, sie verknäulten sich in einem wütenden Laut einer unfähigen Zunge und explodierten dann, Kurtacker explodierte, hieb mit der Faust in das Porzellan und griff nach dem Teller, hob ihn hoch und feuerte mit aller Macht, Lotta duckte sich blitzartig, drehte sich, dann raste sie fort und knallte die Tür hinter sich zu. Drinnen hörte sie es toben und wüten, der Fisch klebte irgendwo an einer Wand. Mit fliegenden Fingern drehte Lotta den Schlüssel dreimal um. Sie sank gegen die Wand.
Shit, sagte Lotta. – Shit. Der hätte sie beinahe getroffen. Hatte sie mit dem Fischteller bombardiert. So plötzlich. So kraftvoll. So böse.
Kurtacker, der leidige Hund, der krumme Elendskerl, er hätte ihr das Augenlicht nehmen können oder den schönen Mund entstellen, Kurtacker, der blinde Tobsüchtige, in seinem staubigen Heim!
Lotta zitterte und hielt sich an dem hölzernen Handlauf fest. An der Reling, an der ihr jetzt eine kleine, runde, wackelige Frau mit einem Stock entgegenkam.
Guten Morgen!
Guten Tag!
Ich bin das älteste Sotzbacher Mädchen. Und ich bin hier geboren! Hier im Haus. Und ich habe bei der Frankfurter Rundschau gearbeitet. Krieg ich auch was zu essen?
Aber Frau Siefert, äm, ich habe Ihnen doch eben im Speisesaal einen Fisch hingestellt!
MIR? Nein, das kann nicht sein. Ich habe noch gar nichts gekriegt. Ich krieg immer gar nix.
Ach.
Lotta hatte keine Kraft mehr für die Wahrheit und suchte lieber noch einen Fisch. Irgendwo musste schließlich noch einer sein. Und während sie auf dem Wagen und im Speisesaal suchte, ging das Sotzbacher Mädchen wackelnd davon, ließ sich im Fernsehzimmer nieder und legte dem alten Alwis die Hand auf das Knie.
Gucke mal, da bin ich. Ich bin das älteste Sotzbacher Mädchen. Und ich bin hier geboren. Hier im Haus. Und ich habe bei der Frankfurter Rundschau gearbeitet.
Deddededei, sagte Alwis.
Als Lotta mit dem Fisch ankam, hatte das Sotzbacher Mädchen ihn schon lange vergessen.
Jewgeni Schiwrin lag auf seinem Sofa und befand sich in einem Tunnel. Vielleicht war es gut, dass er sein Leben in einem Tunnel verbracht hatte wie ein Maulwurf. Denn bei Tage war er unansehnlich. Das war der einzige Grund, warum seine Frau und seine Töchter ihn verabscheut hatten, das alleine.
Niemand konnte ihm etwas anderes erzählen, er hatte sich schon gewundert, warum seine Frau ihn überhaupt geheiratet hatte. Wegen dem Geld bestimmt, sie hatte ihn geheiratet, um sich ihr Leben lang über ihn zu beschweren, ihr Leben war ein einziges russisches Klagelied gewesen. Immerhin hatten sie zwei Töchter gezeugt, im Dunkeln, so wie er die Dunkelheit liebte, in der ihn niemand sah. In der Dunkelheit war er Spezialist geworden, er konnte die Dunkelheit stützen, dafür sorgen, dass sie niemanden begrub, sie ausbauen, immer neue Wege in die Erde finden, die Erde urbar machen, graben, graben, tiefer graben durch Berge und in die größten Tiefen.
Das Stanowoj-Hochland, sein liebstes, sein mächtigstes Gebirge, so hoch, dass die Gipfel voll Gletscher waren, und so kalt, dass bei minus 60 Grad keine Maschinen mehr arbeiteten, im Sommer aber so warm, dass der Boden vom Tau zerfloss. Doch trotz der sinkenden Taiga, der Erdbeben und der ansteigenden Flüsse im Osten hatten sie es geschafft: Durch acht Tunnel und über 142 Brücken über die Sümpfe fuhr am 27. Oktober 1984 nach zehn Jahren Bau zum ersten Mal die Baikal-Amur-Magistrale von Ust-Kut nach Komsomolsk durch Sibirien.
Als die Juden von Russland nach Israel gingen, von Israel nach Österreich, von Österreich nach Deutschland, da war er mitgegangen. Sie hatten ihn sofort eingestellt, darauf war er sehr stolz. Er hatte nur seine Arbeiten vorlegen müssen, seine Pläne, die Fotos, das war schon alles. Obwohl er noch kein Deutsch konnte. Aber der Kasseler Tunnel war nichts gewesen gegen das Stanowoj-Hochland. Einfach gar nichts. Wenn man in der Taiga gelernt hatte, was war da schon Kassel-Wilhelmshöhe?
Nun schien sich ein Tunnel durch seinen Kopf zu bohren, ein Tumor, so nannten sie das, Tumor wie Tunnel, etwas schien seinen Kopf zu teilen und Licht hineinzulassen und in dem Licht geschahen seltsame Dinge. Wieso blieben die Möbel nicht stehen? Wieso ruckte alles um ihn her? Sobald er sich umdrehte und in dieses Zimmer hineinsah, begann der Tisch zu laufen, der Stuhl sich zu drehen, nichts blieb an seinem Platz, darum wagte er es nicht, sich umzudrehen, und schaute in die dunkle Ritze im Sofa. Von ihm aus konnte es immer dunkel sein. Aber er bekam keine Ruhe. Keine Ruhe. Es klopfte. Klopfte fest an seine Tür. Dann wurde die Tür aufgerissen und ein Paar weiße Gummischuhe näherten sich quietschend seinem Bett.
Jewgeni Schiwrin! – Warum du liegst iemer auf dem Sofa!
Es war Nadjeschda. Schiwrin kicherte.
Tag und Nacht du liegst auf dem Sofa! Warum du stehst nicht auf!
Oichee, sagte Schiwrin. – Ich liege gerne hier. Ich muss ruhen. Ich bin alt.
Aber du musst bewegen! Wenn du liegst, kriegst nur dumme Gedanke. Ich habe dein Frau angerufe!
Oichee! Nun drehte Schiwrin sich um und sah verängstigt zu Nadjeschda auf.
Sie stand vor ihm, unerbittlich. Die Arme verschränkt vor dem kräftigen Körper. Das dunkle, kurze Haar verschwitzt, feine Perlen überall, auf der Stirn, in der Halskuhle, auf der Oberlippe. Dann tupfte sie sich die Stirn mit einem Zellstofftuch.
Du sollst nicht das machen, sagte Schiwrin.
Muss!, sagte Nadjeschda. MUSS!
Schiwrin lachte wieder. – Was hat gesagt?
Hat gesagt – kommt nicht. Aber Tochter kommt.
Welche?
Valerija. Kommt an Dienstag. Du musst aufstehen, ich will dich waschen.
Nein, sagte Schiwrin. Muss nicht waschen.
Doch! Kann nicht mehr warten! Du wäschst dir nicht, du bist krank, du sitzt ganze Tag auf die Toilette oder liegst auf Sofa. MUSS pflege lasse!
Aber Schiwrin wollte nicht. Wollte nicht, dass ihn jemand nackt sah. Er konnte sich selbst waschen, er war erst 58 Jahre alt. Was sollte das, diese Pfleger waren immer hinter ihm her, das mochte er nicht. Aber wie sich gegen Nadjeschda wehren, wie? Sie duldete keinen Widerspruch. Und seine Tochter hatte sie auch noch herbeigeschafft. Valerija. Das war die schöne Tochter. Schneewittchengleich. Du gutmütige Tochter. Sie würde ihn besuchen, er regte sich auf und sein Herz schlug plump unter den dürren Rippen. Er durfte nicht so armselig hier liegen, er hatte keine Unterhemden, keinen Turnanzug, keine Socken, nichts mehr. Fragend sah er Najdeschda an. Niemand durfte erfahren, dass vor seinen Augen die Möbel hin und her liefen. Das war nicht richtig, das war nicht normal und es ängstigte ihn.
Hast du Schmerzen in deine Kopf?
Schiwrin schüttelte den Kopf. Warum fragten sie nur immer nach Kopfschmerzen? Er hatte keine Kopfschmerzen. Er kam nur von der Toilette nicht runter. Der Bauch, der war es. Der schien alles nach außen stülpen zu wollen. Auch jetzt trieb es ihn wieder zur Toilette, dumpf, unerbittlich, wenn nichts passieren sollte, dann musste er sofort gehen.
Hilf mir auf die Toilette.
No gutt.
Najdeschda nahm ihn unter dem Arm und führte ihn langsam, sie hatte so viel Kraft, sie hätte ihn tragen können. Najdeschda ist wie ein Doktor, sagten die anderen. Sie wusste alles, sie konnte alles, sie wachte streng die Ausführungen der Pflegehelfer.
So. Gehst du Toilette und wann fertig, dann du klingelst – ich komme helfen! Muss pflege lassen. MUSS!
Sie schob ihn auf die Toilette und ging ihrer Wege. Ewig noch hörte man die Gummisohlen der ausgetretenen, weißen Clogs über die Gänge quietschen, da ging sie und sprach unentwegt mit sich selbst.
Uui, muss ich noch Verbände machen, muss ich noch Medikamente stellen, muss ich noch Frau Schlecker Sprietze geben, uuh, wann ich soll das machen, uuui, bin ich kapuut, … Rucken schon geplatzt.
Was sollte sie später Schwester Rosalinde sagen? Wenn ein Teller fehlte? Oder sie Herrn Kurtacker besuchte und da klebte ein Fisch an der Wand? Lotta konnte auf keinen Fall wieder in sein Zimmer gehen! Vielleicht Ivy? Konnte Ivy später unauffällig den kaputten Teller und den Fisch an der Wand herausholen?
Es war aber Rosalinde, die da den Gang entlangkam, sie sah aus wie von hinten beleuchtet, das war das Licht aus dem Westfenster, es strahlte sie an, Rosalinde, der ramponierte, flügellahme und geschlagene Engel der Station.
Und? Wie ist es? Kommst du klar?
Ja, na klar, das geht schon.
Schön, wunderbar. Gut, dann, dann hänge ich jetzt mal Herrn Bellheim neue Nahrung an. Also, wenn was ist, kannst du mich jederzeit rufen, ja?
Stationsschwester Rosalinde mit den fortgeflogenen Haaren. So viel gerannt, da waren ihr die Haare fortgeflogen. Die kastanienbraune Frisur, die ihr geblieben war, stand leicht zerzaust, vermutlich gerauft, entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Sie zwinkerte nervös unter der Brille, griff nach einem zerknitterten Zettel und las:
Herr Bellheim, Nahrung, 500 ml, Katheterbeutel.
Gut, ich mach dann mal, also wenn was ist, ich bin da hinten bei Herrn Bellheim, … siehst ja, wo die grüne Lampe brennt.
Bei Rosalinde brannten immer alle Lampen, die roten und die grünen, ihr brannten die Sohlen, ihr brannte das Haar, sie verbrannte sich bei jedem Meter, den sie über die Gänge rannte, verbrannte die ganze Mütterlichkeit, sie rannte und brannte, irgendwann würde sie verglüht sein. Aber noch hatte sie gut 60 Kilo, 60 Jahre auf dem Buckel, noch konnte sie einigermaßen alles essen, wenn auch keinen Zucker. Der Bauch war rund genug, da ließ sich gut hineinspritzen. Rosalinde war niemals krank. Nie. Auch wenn ihr das Herz schmerzte und ihre Haut fahl wurde, auch wenn sie nach Luft rang und über den Dienstplänen japste, auch wenn sie sich häufiger mal setzen musste und sich selbst so viele Tabletten zuteilte wie all den Hilfsbedürftigen der Station, Rosalinde war niemals krank. Lange nicht so krank wie die anderen, die alle vier Wochen mal umfielen und für einige Tage verschwanden, sich auftankten, heimlich dicke Butterbrote aßen, um Kraft zu kriegen, um wiederzukommen, um wiederkommen zu können. So krank war Rosalinde nie.
Ist noch Fisch da von heute Mittag? Irgendwo ein Rest?, fragte Ivy und lehnte sich in den Türrahmen des Stationszimmers.
Also, ein Fisch ist bestimmt noch übrig. Der klebt bei Herrn Kurtacker an der Wand.
Ivy beugte sich erschrocken zu ihr.
Du warst bei Kurtacker drin? Das sollst du doch nicht! Der ist doch … der ist doch … ei ei ei … du … Nase!
In Lottas Augen sammelte sich plötzlich das Wasser. Ein Tropfen der Erinnerung an den ganzen unglücklichen Moment, als sie vom Scherbengericht bedroht war, von einem fliegenden Fisch.
Ivy sah Lottas Augen tropfen, packte sie am Genick wie ein Karnickel und schüttelte sie hin und her.
Das hätte aber schief gehen können!
Ja, aber es war ja keiner von euch da … und wieso ist der überhaupt im Pflegeheim? Der gehört ja in die Klapse. Tschuldigung.
Na ja, seine Mutter, weißt du. Seine Mutter lebt hier um die Ecke. Sie will ihn immer besuchen. Da hat sie uns gebeten …
Aber der ist doch noch gar nicht so alt!
Noch keine fünfzig. Es gibt keine Pflegeheime für junge Menschen.
Wenn er nur nicht so bösartig wäre.
Er kann ja nichts dafür. Als Kind immer im Gipsbett, wegen dem Rücken da. Dann ein Schlaganfall und dann eine Schädelverletzung, durch einen Unfall. War schon heftig. Den hat das Schicksal kreuzlahm geschlagen. Er hat sozusagen keine Kontrolle über seine Aggressionen. Irgendso’n Schädellappendings. Wir könnten ihn höchstens zudröhnen, das will ja keiner. Wenn er in die Psychiatrie kommt, wird er zugedröhnt. Hast du noch Fisch übrig?
Nee. Mittag ist vorbei. Lange schon.
Musst mir mal was aufheben!
Ivy zwinkerte und steckte die Hände in die Hosentaschen. Es ging ihm gut. Bis jetzt noch. Er war froh über jede Stunde, die er gut gearbeitet hatte, ohne dass ihn die Nachwehen der Nacht einholten. Der Nacht, die ihm alles gegeben hatte, was er sich wünschte. Vielleicht zu viel. Nach einem Dreivierteljahr, drei Wochen und fünf Tagen war es auf einmal zu viel. Was war nur in ihn gefahren? Sehr unbehaglich das Ganze, besser nicht daran denken. Es schmeckte aber noch nach Blut.
Er hatte den Impuls, Lotta noch einmal im Genick zu fassen. Dann ließ er es. Ach nein, lieber doch nicht.
Lotta betrachtete ihn verstohlen. Sie spürte noch seinen Griff im Nacken. Ivy hatte heute ein Muskelshirt angezogen. Ein Muskelshirt! Wer sollte ihn denn bewundern, hier im Altersheim.
Aber da kam schon die Erste, es war das Sotzbacher Mädchen. Sie wackelte hin und her an ihrem Stock, strahlte Ivy an und ihre leuchtend weißen, kurzen Haare waren zu einer Irokesenfrisur hochgekämmt.
Gell, du hast mich gern?
Ivy lachte schallend.
Aber klar, mein Sotzbacher Mädchen! Und wie! Du bist doch mein bestes Stück!
Und er legte den Arm um sie und schüttelte sie kräftig.
Wieso haben Sie denn heute eine Irokesenfrisur?, fragte Lotta.
Ouh, das habe ich gemacht. Ich fand, es steht ihr ganz gut, sagte Ivy.
Gell, ich hab noch schönes Haar?, fragte das Sotzbacher Mädchen.
Ja ja, sehr schönes Haar, sagte Lotta.
Dann kam Alwis orientierungslos mit dem Gehwagen herangewackelt.
Deddededei, sagte Alwis.
Sag doch nicht immer deddededei, sagte das Sotzbacher Mädchen.
Also, ich weiß nicht, sagte Lotta.
Sie fuhr Frau Siefert über die Haare, bis der Irokesenkamm kippte und sie endlich wieder aussah wie ein braves, altes Mädchen.
Oooch, sagte Ivy. – War doch gerade so schön.
Ich bin das älteste Sotzbacher Mädchen. Und ich bin hier geboren. Hier im Haus.
Sie stand auf und klopfte Ivy an die Brust.
Ich hab euch alle gern. Gell, ihr habt mich aach gern?
Deddededei, sagte Alwis.
Ach Mädel aus Sotzbach, du bist die Schärfste.
Und er nahm sie hoch, schleuderte sie einmal im Kreis und das Sotzbacher Mädchen kreischte mit zahnlosem Mund. Ivy setzte sie wieder ab, sie kicherte, er fuhr ihr durch die Haare und stellte den Irokesenkamm sorgfältig wieder auf.
Ou Mann, ich muss weiter. Muss noch die Frau Sturm ins Bett bringen und den Heller, dann soll ich noch ’n paar wiegen, ou Mann, vor allem muss ich mal eine rauchen. Das ist das Wichtigste. See you later.
Ivy stopfte sich das enge T-Shirt in den Hosenbund, fummelte was am Handy, drehte sich auf dem Absatz um und ging breitbeinig davon. Frau Schlecker fuhr heran.
Fahr mich mal ein bisschen.
Mir ist ganz schwindelig, sagte das Sotzbacher Mädchen.
Deddedei, sagte Alwis.
Und Ihnen? Wie geht es Ihnen?, fragte Lotta.
Beschissen, krähte Frau Schlecker.
Krieg ich noch ’n Kaffee? fragte das Sotzbacher Mädchen. – Ich hab noch gar nix gekriegt. Alle anderen haben Kaffee gekriegt, aber ich, ich krieg immer gar nix.
Deddedei, sagte Alwis.
Es war ein weiter Weg . Von Ulm nach Mannheim, von Mannheim hier hoch. Ein Weg, so weit wie von Frankfurt bis Wladiwostock. Ein Weg, den sie nie wieder zurücklegen wollte, nie wieder. Aber was konnte sie gegen die russische Schwester schon ausrichten. – Er ist doch Ihr Vater, hatte sie gesagt. Kommen Sie!
Auf diesen Ton reagierte Valerija immer noch. Nachdem sie den Rest ihrer Kindheit in Deutschland verbracht hatte. Aber den sozialistischen Befehlston aus dem Kader hatte sie zutiefst verinnerlicht. Außerdem musste man einem Menschen, der im Sterben lag, einen Wunsch erfüllen. Auch wenn er sie noch so geärgert hatte, der Vater, der nie für sie da war, der ihr keine Geschichten erzählt hatte, der mit der Mutter nicht sprach, mit ihr nicht sprach, mit niemandem sprach, außer vielleicht mit den Fröschen und Mäusen unter der Erde. Was sollte sie mit ihm? Er hatte sie alle damals hierhergeschleppt, fremd, sich selbst überlassen, in einem Nest bei Kassel, sie konnten die Sprache nicht, viel weniger die Mutter, er hatte sie in Deutschland ausgesetzt und sie dann allein gelassen.
Telegrafenmast um Telegrafenmast zog an ihr vorbei, die rotgoldene Sonne über der BASF, schwer schob sich der Zug jeden Meter weiter, es war, als hielte er sich an den Gleisen fest, als wollte er nicht voran, wie ein Kind, dessen Schlitten zu schnell den Hügel herunterfuhr.
Heute war Valerija glücklich verheiratet. Ihr Mann betete ihre Schönheit an. Mein russisches Schneewittchen, sagte er immer. Sie sei ein wenig biestig, aber sie sei nun mal sein Schneewittchen. Das solle nur jeder sehen.
Und jetzt sollte sie ihren Vater wieder ausgraben. Den in sich selbst verschütteten Schiwrin, wie ein Opfer eines Grubenunglückes unter sich selbst begraben. Ein Leben in der Finsternis. Noch immer wohnte der Groll in ihr. Aber weniger Groll, als die Schwester hegte, und weniger als die Mutter. Vielleicht weil Schiwrin ihr am wenigsten von seiner Unansehnlichkeit vererbt hatte. Da konnte sie großzügiger sein.
Der Zug näherte sich unaufhörlich seinem Ziel. Valerija warf das lange, schwarze Haar auf den Rücken und stand auf. Es war schwer auszusteigen. Aber vielleicht musste sie nur einmal herkommen, nur ein einziges Mal. Dann hatte sie ihre Pflicht getan.
Einen genauen Schnitt . Den erforderte das Katheterpflaster. Ein Schnitt zu tief, dann war das Pflaster zu klein und reichte nicht über die Kompresse, ein Schnitt zu hoch und das Pflaster klebte auf einem der zahlreichen Bläschen einer malträtierten Haut. Frau Wilhelm ließ sich alles gefallen. Sie packte ihren Bauch fester und zog ihn nach oben, damit Ivy besser kleben konnte.
Halt, sagte er, noch mal. Verzeihung, ich muss es noch mal abreißen.
Macht nichts, sagte Frau Wilhelm und verzog vor Schmerz das Gesicht.
Ivy hatte sich verschnitten. Er verschnitt sich immer, er hatte keine ruhige Hand.
Das Pflaster entglitt ihm und klebte auf den brandigen Bläschen, er ruckte kurz, eine winzige Pfütze schwappte an dem Plastikröhrchen vorbei aus der Bauchwunde heraus, ein winziges, rotes Bauchrestchen war zu sehen, ein Mützchen aus rohem Fleisch. Aus den zerrissenen Bläschen lief das Wasser.
Mist, verdammt noch mal.
Frau Wilhelm tätschelte ihm den Arm.
Ist nicht so schlimm, mein Junge, wer will auch da noch was festkleben, da ist ja schon alles verklebt, wie viele Jahre habe ich den Katheter schon.
Aber Ivy brach plötzlich der Schweiß aus. Seine Hände fingen an zu zittern. Kräftige Arme hatte er, aber seine Hände blieben nicht ruhig. Die wilden Nächte, die laute Disco, der Fredderik, der nur auf Partys zu finden war, der Fredderik, der niemals schlief. Hatte er Fredderik erst wild gemacht, dann gab er auch keine Ruhe mehr, um vier nicht, um fünf nicht und um sechs Uhr auch nicht. Er musste sich das Zeugs aus dem Leib lassen. So konnte es nicht weitergehen.
Frau Wilhelm schrie leise auf. Ivy hatte aus Versehen an dem Schlauch gerissen, ein Tropfen Blut quoll aus der Bauchwunde, vermischte sich mit dem gelben Pfützchen, Ivy fluchte.
Junge, sagte Frau Wilhelm und tätschelte ihm noch mal die Hand. – Du bist ein guter Junge. Aber vielleicht holst du mal Schwester Rosalinde.
Gereizt schüttelte Ivy das verklebte Pflaster von seinen Händen.
Das geht schon. Ich habe mich nur eben vertan.
Er tupfte die Wunde sauber, desinfizierte sie und klebte schließlich das Pflaster mit Kompresse recht und schlecht über den Katheter.
Sehen Sie? Geht doch.
Gottseidank hatte Frau Wilhelm einen so dicken Bauch, dass man den Verband kaum sah, er verschwand in den Tiefen von Nachthemd, Bauchdecke und Bettbezug.
Ivys Geschicht war hochrot. Er war fertig. Die Nächte machten ihn fertig. Bescheuerte Nächte, Rasen und Sucht und Eifersucht, eine endlose, kopflose Jagd, ein ewiger Hunger nach Liebe und etwas, das außerhalb seines Selbst stattfand, mit einem Mal hasste er es. – Ich muss aufhören damit, ich muss aufhören. Fredderik … Fredderik war so komisch gegangen heute Morgen. Nein er, er selbst war komisch gewesen. Manchmal verstand er sich selbst nicht. Heute wollte er Fredderik nicht sehen.