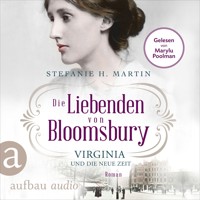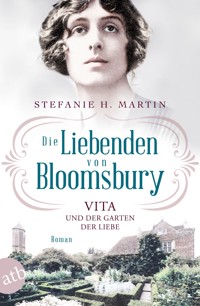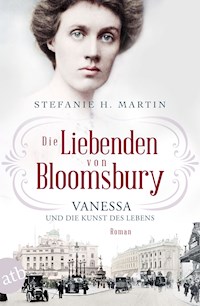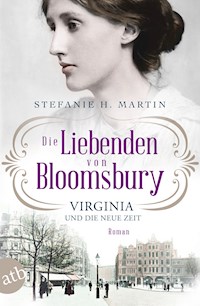
10,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bloomsbury-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Auftakt der großen Saga über die Frauen von Bloomsbury
London, 1903. Während ihre Schwester Vanessa Kunst studieren möchte, will die hochintelligente Virginia nur eines: schreiben – und zwar in einer neuen Form, der modernen Welt angemessen. Mit ihren Brüdern gründen sie eine Wohngemeinschaft in Bloomsbury, die schon bald zum Hort geistiger Freiheit und Inspiration wird. Doch die Gesellschaft ihrer Zeit sieht für unverheiratete Frauen kein Leben in Freiheit vor, und immer wieder verlangt man von Virginia, sich einen Ehemann zu suchen ...
Ein so überraschender wie mitreißender Roman über Virginia Woolf – Ikone der literarischen Moderne und der Frauenbewegung
„Wer uns unserer Träume beraubt, beraubt uns unseres Lebens.“ Virginia Woolf
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Ähnliche
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Stefanie H. Martin
Die Liebenden von Bloomsbury – Virginia und die neue Zeit
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Mit der Macht der Worte
1. Kapitel
London, 31. Dezember 1903
London, Hyde Park Gate, 23. Februar 1904
2. Kapitel
Manorbier, Pembrokeshire, März 1904
Paris, Mai 1904
3. Kapitel
London, 4. Mai 1904
Hyde Park Gate, 8. Mai 1904
Hyde Park Gate, 10. Mai 1904
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
46, Gordon Square, August 1904
Zur gleichen Zeit in Burnham Wood, Welwyn
7. Kapitel
46, Gordon Square, Oktober 1904
8. Kapitel
The Porch, Cambridge, 26. Oktober 1904
9. Kapitel
46, Gordon Square, Anfang November 1904
Tilbury Docks, 19. November 1904
10. Kapitel
46, Gordon Square, Januar 1905
11. Kapitel
12. Kapitel
46, Gordon Square, März 1905
13. Kapitel
46, Gordon Square, Juni 1905
Kings Bench Walk, Juli 1905
14. Kapitel
15. Kapitel
46, Gordon Square, Oktober 1905
16. Kapitel
46, Gordon Square, November 1905
London, Februar 1906
17. Kapitel
Cleeve House, Wiltshire, Juli 1906
London, 31. Juli 1906
18. Kapitel
Athen, 12. Oktober 1906
19. Kapitel
Dover, 1. November 1906
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
46, Gordon Square, 7. Februar 1907
23. Kapitel
Manorbier, Pembrokeshire, 7. Februar 1907
24. Kapitel
Fitzroy Square, London, 19. Februar 1907
25. Kapitel
29, Fitzroy Square, März 1907
29, Fitzroy Square, April 1907
26. Kapitel
Rye, Sussex, im August 1907
46, Gordon Square, im Oktober 1907
27. Kapitel
28. Kapitel
46, Gordon Square, 4. Februar 1908
29. Kapitel
April 1908
30. Kapitel
31. Kapitel
Trevose House, St. Ives, 20. April 1908
Trevose House, Freitag, 24. April
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
67, Belsize Park Gardens, London, Juni 1908
35. Kapitel
46, Gordon Square, Oktober 1908
36. Kapitel
46, Gordon Square, Dezember 1908
37. Kapitel
38. Kapitel
29, Fitzroy Square, 17. Februar 1909
67, Belsize Park Gardens
39. Kapitel
29, Fitzroy Square, am nächsten Tag
Hambantota, Ceylon, April 1909
29, Fitzroy Square, Mai 1909
Nachwort
Literaturliste
Ausgewählte Werke:
Biographien:
Ausgewählte Literatur über Bloomsbury:
Zeitgeschichtliches:
Impressum
Wer von dieesem Roman begeistert ist, liest auch ...
»It is perhaps as difficult to write a good life as to live one.«
»Es ist vermutlich genauso schwer, ein Leben gut zu erzählen, wie ein gutes Leben zu führen.«
Lytton Strachey, Eminent Victorians, 1918
Mit der Macht der Worte
Es sind die dunklen Tage, die Raum für Licht geben.
An diese Worte ihrer Mutter erinnerte sich Virginia genau, auch wenn der Rest von ihr wie hinter einer wehenden Gardine verborgen blieb. Ihr Porträt im Salon zeigte eine Frau von großer Schönheit, die Virginia nicht mit den Umrissen hinter dem Gazestoff in Verbindung bringen konnte.
Der Tag, an dem ihre Mutter für immer verschwunden war, lag neun Jahre zurück, doch das Licht, von dem sie gesprochen hatte, war ausgeblieben. Die Räume im Haus am Hyde Park Gate hatten sich noch mehr verfinstert, als zwei Jahre später Stella gestorben war, Virginias große Schwester, durch die zumindest etwas Licht auf sie hatte scheinen können, weil Stella selbst wie eine Mutter gewesen war. Und bald würde nun der Vater folgen.
Wenn sich die Gardine nur beiseiteziehen ließe, dachte Virginia oft, wenn sie nur noch einmal einen klaren Blick auf ihre Mutter erhaschen könnte, dann würde das Licht auch ihr Inneres fluten. Aber je mehr sie versuchte, den irritierenden Stoff zu lüften, desto mehr schien sich das Gewebe zu verdichten, und sie hatte zunehmend das Gefühl, die freie Sicht auf das zu verlieren, was im Jetzt geschah.
Vielleicht, hoffte sie, gäbe es Worte mit der Macht einer Zauberformel, die dieses Wunder bewerkstelligen konnten. Die ihr den Blick freigeben würden auf die Wahrhaftigkeit dessen, was gewesen war. Was immer noch war. Und was sein würde.
1. Kapitel
London, 31. Dezember 1903
Es war seit Tagen nicht richtig hell geworden. Die Wolken hingen so tief über den Häusern, dass Virginia manchmal dachte, sie müsse sie greifen können, wenn sie sich aus dem Fenster in ihrem Zimmer lehnte. Die kleine Lampe auf ihrem Schreibpult brannte unablässig. Sie war seit fast einer Woche nicht mehr draußen gewesen, hatte sich mit einer abgegriffenen Aischylos-Ausgabe ihres Bruders in ihr Zimmer verkrochen und übersetzte die leuchtenden, bilderreichen Verse des griechischen Dichters, um der Düsternis, die sich wieder einmal über das Haus der Familie Stephen gesenkt hatte, zu entgehen. Es gelang ihr jedoch nur halb, denn immer wieder störten Besucher, die ihren Vater ein letztes Mal sehen wollten, ihre konzentrierte Einsamkeit und erinnerten sie daran, was ihre eigentliche Aufgabe als Tochter des sterbenden Leslie Stephen wäre: ihm in seinen letzten Stunden so gut wie möglich beizustehen. Aber dem Tod schon wieder so nahe zu sein, ertrug sie nicht.
So war der Ausflug, den Vanessa für heute Nachmittag vorgeschlagen hatte, eine willkommene Abwechslung. Ihre Schwester hatte nicht einmal gesagt, wo sie hinwolle, aber es war Virginia gleich. Allein die Tatsache, ein paar Stunden ganz allein mit ihr verbringen zu können, ließ den Tag ein wenig heller erscheinen.
Vanessa hatte eine Droschke rufen lassen. »Bringen Sie uns nach Bloomsbury, bitte!«, rief sie zu dem Droschkenfahrer hinauf, der sie mürrisch anstarrte. Zum Glück war es eine geschlossene Kabine, so dass sie gegen den einsetzenden eisigen Regen geschützt waren.
»Bloomsbury?«, fragte Virginia und bestieg die Kutsche hinter Vanessa. »Warum Bloomsbury?«
»Ich möchte mir die Gegend genauer ansehen. Die Häuser dort sollen sehr günstig sein.«
Darum ging es also. Seit die Ärzte festgestellt hatten, dass im Bauch des Vaters ein Geschwür wuchs und der Tod unausweichlich war, sprach Vanessa davon, das große Elternhaus am Hyde Park Gate verkaufen zu wollen. Virginia indes verbat sich, ihre Gedanken in die Zukunft zu richten, als hieße das, dem Tod die Tür zu öffnen und dazu einzuladen, den letzten Rest vertrauten Lebens zu stehlen.
Die Droschke hielt unmittelbar vor dem Gebäude der Slade School of Fine Art, der Fakultät der Künste des University College London. Inzwischen hatte der Regen nachgelassen, hier und da schien sogar ein Sonnenstrahl die Wolkendecke durchdringen zu wollen.
Einige junge Frauen in ihrem Alter gingen gerade unter lautem Gelächter auf das Gebäude der Slade zu, unter dem Arm großformatige Mappen und tragbare Staffeleien. Kurz darauf gesellten sich zwei Männer zu dem Grüppchen, leger gekleidet und mit ähnlichen Mappen. Sie begrüßten einander zwanglos und verschwanden gemeinsam durch das Haupttor im Inneren der Kunstschule. Von Vanessa wusste Virginia, dass an der Slade Frauen und Männer gemeinsam studieren durften, die einzige Einrichtung in ganz England, wo dies möglich war.
»Wenn es an der Slade geht, warum dann nicht auch anderswo? Vielleicht nicht unbedingt in Cambridge, aber wenigstens hier in London!«, sagte Virginia, während sie zu den trotz der frühen Nachmittagsstunde hell erleuchteten Fenstern des Gebäudes hinaufsah.
»Warum eigentlich nicht auch in Cambridge?«, fragte Vanessa.
Virginia schürzte die Lippen. »Es gibt dort bereits Girton und Newnham«, sagte sie. Das waren beides reine Frauen-Colleges, an denen Frauen zwar studieren konnten, jedoch noch keine akademischen Titel verliehen bekamen. »Aber dennoch, ich finde, es sollte kein Unterschied gemacht werden zwischen Frauen und Männern, sofern sie die Eignung zu einem Studium besitzen.«
Vanessa lachte freudlos. »Sag das nicht zu laut, sonst erklärt man dich noch für verrückt.«
»Verrückt kann man werden, wenn man lernen will und es nicht darf. Und immer allein im Zimmer sitzt mit den Büchern«, sagte Virginia. »Bei euch Künstlern ist es besser. Du darfst immerhin an der Royal Academy lernen.« Vanessa hatte ein Stipendium für ein Kunststudium erhalten, was bei Virginia Bewunderung, aber auch Neid hervorrief.
»Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal dort war«, sagte Vanessa. »Unentwegt muss ich mich mit den Haushaltsbüchern herumschlagen, während du Zeit für deine Bücher hast.«
Gern hätte Virginia widersprochen und ihr vorgehalten, dass Vanessa ihre Ausbildung bald würde fortsetzen können, während sie selbst niemals die Chance auf ein Studium bekäme, so wie sie auch nie eine Schule besucht hatte. Dieses Privileg war immer nur den Brüdern vorbehalten gewesen. Aber die Schwester sah erschöpft aus, und Virginia wollte nicht mit ihr darüber streiten, wer von ihnen das härtere Los zu tragen hatte.
Vanessa hatte nach dem Tod ihrer Halbschwester Stella mit nur achtzehn Jahren – trotz einer ausgeprägten Zahlenschwäche – die Führung der Haushaltsbücher übernehmen müssen, wie auch alle anderen häuslichen Pflichten, deren Stella sich nach dem Tod der Mutter angenommen hatte – und das waren zahlreiche. Der Haushalt der Stephens war groß, und das vielköpfige Personal musste angeleitet, die Gäste bewirtet und natürlich die aufwendige Pflege des Vaters organisiert werden. Dazu kamen die verhassten Bälle, zu denen der älteste Stiefbruder George sie und auch Virginia immer wieder ausführte, um sie den Gepflogenheiten entsprechend in die Gesellschaft einzuführen. Immerhin diese Termine waren seit der schweren Erkrankung des Vaters seltener geworden.
Sie machten kehrt und wanderten Richtung Tottenham Court Road. Zu dieser Stunde herrschte in diesem Teil Bloomsburys eine hektische Betriebsamkeit. Droschken und Pferdekarren rumpelten über das Pflaster, Dienstboten drängelten sich durch die Menge der zahlreichen Passanten, als hinge ihr Leben von der Erledigung ihrer Aufträge ab, und ab und zu knatterte ein Automobil mitten durch eine der unzähligen Pfützen.
Virginia betrachtete die mehrstöckigen Gebäude des Viertels, die so viel einfacher und ärmlicher aussahen als die Stadtvillen in Kensington. »Und warum muss es ausgerechnet Bloomsbury sein? Ich finde, das wirkt hier alles entsetzlich schäbig!«
»Mir gefällt es«, entgegnete Vanessa und ließ den Blick über einen schmalen zweistöckigen Ziegelsteinbau gleiten, der sich zwischen den beiden Nachbarhäusern zusammenzukauern schien. Im untersten Fenster hing ein Schild: Zu vermieten.
»Das hier wäre vermutlich zu klein«, sagte sie, zückte aber dennoch ihr Notizbuch, um sich die Adresse zu notieren.
»Wir könnten doch auch in Kensington bleiben«, fand Virginia. »Es hat viel mehr Charme. Außerdem kennen wir hier niemanden.«
»Eben«, sagte Vanessa nur.
Sie wandten sich Richtung Süden und kamen zum Bedford Square. »Ich glaube …«, Virginia wies unauffällig in Richtung einer Gruppe junger Männer, die rauchend an einer Straßenecke standen und sie verstohlen musterten, »… mir gefallen die Leute hier nicht.«
»Du bist so ein Snob.« Vanessa bedachte sie mit einem Kopfschütteln. »Hier leben viele Künstler. Es ist vielleicht nicht so à la mode wie Kensington, dafür aber ist es …« Sie ließ den Rest des Satzes bedeutungsschwanger in der feuchtkalten Luft hängen.
»Dafür ist es – was?«
Vanessa sog die kalte Luft ein. »Man kann hier freier atmen, findest du nicht?«
Virginia tat probehalber ebenfalls einen tiefen Atemzug. »Nein.« Sie zeigte auf ein offen stehendes Fenster direkt über sich. »Es riecht nach ranzigem Öl.«
Zum ersten Mal seit langer Zeit lachte Vanessa. »Du bist bockig.«
»Ziegenböcke sind so.«
Die Schwestern nannten einander oft bei ihren Spitznamen aus der Kindheit. Virginia war die Ziege oder der Ziegenbock und Vanessa der Delfin.
Sie versetzte Virginia einen Stoß in die Seite und hakte sich bei ihr ein.
»Komm, Böcklein, sei nicht so mürrisch!«
Sie wies auf ein dreistöckiges Haus mit hohen Fenstern und weißen Verzierungen unter dem Dachfirst.
»Sieh mal, das ist doch hübsch. Steht ebenfalls zur Vermietung.« Sie kritzelte schon wieder in ihrem Notizbuch herum und zog dann Virginia mit sich, ohne deren Antwort abzuwarten.
»George wird niemals nach Bloomsbury ziehen«, sagte Virginia und entzog Vanessa ihren Arm. »Du kannst dir die Mühe sparen, diese Leute zu kontaktieren.« Sie wies auf Vanessas Notizbuch.
»Nein. Natürlich wird er das nicht«, entgegnete Vanessa und lächelte.
Virginia blieb abrupt stehen. »Soll das etwa heißen …?«
Vanessa warf einen raschen Blick über die Schulter, als fürchtete sie, der älteste Stiefbruder könnte plötzlich aus dem Nichts auftauchen und ihr Gespräch belauschen. »Ich will nicht mehr mit George unter einem Dach leben. Auch mit Gerald nicht, aber vor allem nicht mit George.« Sie sah Virginia vielsagend an.
Die wich ihrem Blick aus. »Mir ist kalt«, sagte sie. »Gehen wir weiter.«
Sie kamen zum Gordon Square, der ganz in der Nähe der Slade lag, wo sie ihren Ausflug begonnen hatten. Ein großzügiger Platz mit dreistöckigen Wohnhäusern, die rings um einen kleinen Park angeordnet waren. Hier ging es etwas beschaulicher zu als in den überfüllten Straßen. Auch die Häuser wirkten freundlicher als die, die sie bisher gesehen hatten. Sie umrundeten den Platz, fanden jedoch nirgends einen Hinweis, dass eines der Häuser zur Vermietung oder zum Verkauf stünde.
»Hier könnte ich es mir vorstellen zu leben«, gab Virginia widerstrebend zu. »Ein Haus nur für dich, mich, Adrian und Thoby. Ohne Duckworth-Brüder.« Sie lächelte. »Das klingt … überlegenswert.«
»Das klingt paradiesisch.« Der Widerschein des aufklarenden Himmels ließ Vanessas Augen für einen Moment aufleuchten.
Kurz glaubte Virginia, eine unsichtbare Tür habe sich geöffnet und ein warmer Wind, wie eine Meeresbrise, wehe durch die Straße. Eine Sinnestäuschung gewiss, aber sie war plötzlich voller Eifer. »Und du bekommst ein Atelier und ich eine eigene Schreibstube«, sagte sie. »Ich werde Romane schreiben, und du malst Bilder, die in Ausstellungen gezeigt werden, und wir müssen niemandem den Tee servieren und keine geistlosen Gespräche mehr führen.«
»Siehst du!«, sagte Vanessa. »Genau das meine ich. In Kensington wäre all das nicht möglich.«
»Nein. Wahrscheinlich nicht.« Virginia sog ein weiteres Mal die Luft ein, aber diesmal mischte sich eine Spur von Urin in den Geruch von feuchtem Stein und Regen. Sie rümpfte die Nase.
Gerade wollte sie hinzufügen, dass es vielleicht doch nicht unbedingt Bloomsbury sein müsse, da sagte Vanessa: »Wir behalten die Lage im Blick«, notierte sich Gordon Square mit einem dicken Ausrufezeichen versehen in ihrem Notizbuch und ließ es in ihre Manteltasche gleiten. »Aber noch ist Vater nicht tot«, setzte sie hinzu und hob den Arm, um eine nahende Droschke heranzuwinken.
»Das klingt, als könntest du es kaum erwarten, dass er endlich stirbt.«
Nur Vanessas leicht hochgezogene linke Braue verriet Virginia, dass ihre Schwester den Kommentar überhaupt gehört hatte.
***
London, Hyde Park Gate, 23. Februar 1904
»Heilige Maria Mutter Gottes, möge der Herr seiner Seele gnädig sein und ihn aufnehmen in seiner unendlichen Güte.«
Es war eine wohlbekannte Stimme, die die Stille im Haus am Hyde Park Gate durchschnitt. Nur Sekunden später wurden die Schiebetüren zum Salon aufgezogen, und Cousine Rosamond schob sich herein, voll ausstaffiert mit Trauerschleier, Kreppkragen und Krinoline, dicht gefolgt von ihrer Schwester Dorothea in schlichtem, hochgeschlossenem Schwarz, mit streng zurückgekämmtem Haar und schwarzer Haube.
»Das wird er, meine Liebe, das wird er!«, deklamierte Dorothea, während ihr Blick vom prasselnden Kaminfeuer zum bereits aufgetischten Teegebäck huschte. Erst dann wandte sie sich Virginia und deren beiden Brüdern Adrian und Thoby zu, die sich am Kaminfeuer zusammendrängten, als könnten sie auf diese Weise dem zu erwartenden Beileidsschauer der Cousinen trotzen. Nur George, der in einem Sessel abseits in der Dämmerung saß, erhob sich, um die Nichten des Verstorbenen zu begrüßen. Vanessa hatte mit dem Läuten der Türglocke fluchtartig den Salon verlassen, um sich vor dem unablässigen Strom von Nachbarn und Verwandten in Sicherheit zu bringen, der das Haus am Hyde Park Gate 22 seit Leslie Stephens Ableben am gestrigen Vormittag flutete.
»Dorothea, Rosamond, danke, dass ihr gekommen seid«, sagte George und verneigte sich. Rosamond segelte jedoch gleich mit ausgebreiteten Armen auf Virginia zu.
»Mein armes Vögelchen!«, rief sie. »Schon wieder ein solch schwerer Verlust! Erst eure Mutter, dann Stella und nun noch …« Ihre Worte gingen in heftiges Schluchzen über.
Virginia, eingezwängt zwischen Rosamonds Brust und der Sessellehne, schloss die Augen und hielt die Luft an, um den Geruch von Mottenkugeln, der aus dem Trauerkleid der Cousine drang, nicht einatmen zu müssen. Zum Glück dauerte die Umarmung nur wenige Sekunden, dann schob sich Dorotheas rotwangiges Gesicht neben das ihrer Schwester.
»Ich hoffe, er hat seine Letzte Ölung erhalten?«
Streng blickte sie auf Virginia herab, als hätte es in ihrer Verantwortung gelegen, den agnostischen Vater in seinen letzten Stunden noch auf den rechten Weg zurückzubringen. Leslie Stephens Abkehr von der Kirche war ein seit Langem viel besprochenes Thema bei den streng religiösen Cousinen, und so lange Virginia denken konnte, waren sie eifrig darum bemüht gewesen, sie, Vanessa, Thoby und Adrian das gebotene Maß an Gottesfurcht zu lehren. Gelungen war es ihnen nicht.
»Ich nehme an, ihr wollt ihn noch ein letztes Mal sehen?«, fragte George.
Rosamond schlug die Hand vor den Mund, und Dorothea zückte ein Taschentuch, um ihre Augenwinkel zu betupfen. Beide nickten. Unter lautem Seufzen und Klagen ließen sie sich von George und Thoby aus dem Raum führen.
Schweigend blieb Virginia mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Adrian im Salon zurück. Dieser starrte reglos in die Flammen und schien das ganze Treiben kaum wahrzunehmen.
»Sie haben nur auf diesen Tag gewartet, um sich mit ihren grotesken Trauerkleidern hier breitmachen zu können«, unterbrach Virginia irgendwann das Schweigen. »Wie widerliche Käfer, die über einen Kadaver herfallen.«
Adrians Blick flackerte kurz zu ihr herüber, jedoch ohne ein Zeichen der Zustimmung.
»Ihre Nahrung ist die Trauer. Und die Kleider haben sie bestimmt schon bei Queen Victorias Begräbnis getragen.«
»Dann würden sie jetzt nicht mehr passen«, gab Adrian zu bedenken. Es waren die ersten Worte, die er seit Stunden gesprochen hatte.
»Stimmt. Wir füttern sie zu gut. Hast du gesehen, wie unverfroren Dorothea das Gebäck angestarrt hat?«
»Virginia!« George war unbemerkt zurückgekommen und hinter sie getreten, auf diese typische George-Art, bei der sich ihr die Nackenhaare aufstellten.
»Die Beerdigung ist erst morgen«, begehrte Virginia auf. »Warum müssen sie heute schon kommen?«
»Weil es sich so gehört. Und jetzt geh und such deine Schwester, es ist Zeit für den Tee. Tante Minna müsste jeden Moment eintreffen.«
Tante Minna war die fast achtzigjährige Tante von George und Gerald, Schwester ihres verstorbenen leiblichen Vaters, die nur wenige Häuser weiter allein mit ihrem Papagei und ihrem italienischen Diener lebte. Das gemeinsame Teetrinken mit ihr war eine der Streben des Korsetts der Wohlanständigkeit, das Virginia und Vanessa als die letzten verbliebenen weiblichen Mitglieder im Stephen-Haushalt zu tragen hatten.
Virginia fand Vanessa in ihrem Zimmer vor der Staffelei. Schatten lagen unter ihren Augen, ihre Schultern waren in tiefer Konzentration nach vorn gebeugt, der Kopf leicht geneigt, als suchte sie auf der Leinwand nach einem Schlupfloch, das es ihr erlauben könnte, in eine Welt ohne Trauerfeiern, Beileidsbriefe und Verwandtenbesuche zu entschwinden. Sie schien Virginias Eintreten gar nicht bemerkt zu haben, denn sie zuckte zusammen, als Virginia sie ansprach.
»Tante Minna kommt gleich.« Virginia betrachtete die Leinwand, auf der ihre Schwester zu zeichnen begonnen hatte. Nur wenige Linien, skizzenhaft angedeutet, waren auf dem Bild zu sehen. »Woran arbeitest du?«
»Wenn ich das wüsste.«
»Du weißt nicht, was es werden soll, wenn du ein Bild anfängst?«
»Normalerweise schon.«
»Warum hier nicht?«
Vanessa sah Virginia an, als wollte sie sagen: Ist das nicht offensichtlich? »Ich habe gestern begonnen, daran zu arbeiten«, sagte sie. »Gleich nachdem Vater …« Sie schloss die Augen, und Virginia glaubte schon, sie wolle nun doch ein paar Tränen wegblinzeln, aber dann sagte ihre Schwester mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung: »Es ist vorbei. Endlich vorbei.«
Vanessa hatte sich im Hintergrund gehalten, während ihr Vater auf dem Bett mit dem Tod rang, ihre Miene unbeteiligt. Sie hatte sofort den Raum verlassen, als sie sicher sein konnte, dass es endgültig der letzte Atemzug gewesen war. Der eigentümlichen Stille, die danach eingetreten war, hatte Virginia ohne Vanessa standhalten müssen.
»Vanessa! Virginia!« George. Seine Ungeduld ließ das Haus erbeben.
»Oder doch nicht ganz vorbei«, sagte Vanessa und rollte mit den Augen. Sie straffte die Schultern und ging zur Tür. »Lass uns brav sein und ihnen unsere schönsten Trauergesichter zeigen.«
»Geh schon vor«, sagte Virginia. »Ich schaue, ob die Kerze in Vaters Zimmer noch brennt.«
»Sie brennt ganz sicher«, gab Vanessa zurück. »Und wenn nicht …« Sie hob die Schultern, um anzudeuten, wie unwichtig es war, ob im Zimmer eines Verstorbenen eine Kerze brannte oder nicht.
Mit ihren Worten lagerte sich eine weitere Schicht Sprachlosigkeit auf die unsichtbare Wand, die sich zwischen Virginia und ihrer Schwester aufbaute. Immer hatten sie über alles miteinander reden können, ihre Gefühle waren im Gleichklang gewesen. All die Jahre seit Stellas Tod war Vanessa ihre engste Freundin, Vertraute und sogar mütterliche Trösterin gewesen, doch auf einmal schien die Schwester sich von ihr zu entfernen – und Virginia blieb mit all ihrer Trauer und den ungesagten Worten allein zurück.
***
Unten im Salon hatten sich die untröstlichen Cousinen und Tante Minna um Tee und Gebäck versammelt.
»Wo steckt Virginia?«, fragte Tante Minna, während ihre beringte Hand zögernd über dem Teller mit dem Teegebäck schwebte, unentschlossen, ob sie einem zweiten mit Clotted Cream gefüllten Hörnchen oder einem Butterscone den Vorzug geben sollte.
Bevor Vanessa darauf antworten konnte, schob Cousine Rosamond ihren Teller ein Stückchen vor und sagte: »Minna, würdest du mir noch eins von diesen köstlichen Hörnchen reichen?«
»Es ist zu bedauerlich, dass ihr dieses wunderbare Haus hier aufgeben müsst«, ließ sich nun Cousine Dorothea vernehmen und nippte an ihrem Tee. Auch wenn sie dabei den kleinen Finger geziert abspreizte, wirkte die feine Porzellantasse in ihrer Hand wie ein vom Zerdrücken bedrohter Schmetterling.
»Solange die Mädchen unverheiratet sind, dürften es die Mittel kaum erlauben, ein solch großes Haus zu unterhalten.« Rosamond hatte immer eine Erklärung für alles.
»Mit wem gehen die Mädchen aus?« Tante Minna hatte sich inzwischen für das gefüllte Hörnchen entschieden und blickte – das Gebäck in Bissweite vor dem Mund – fragend in die Runde.
»Das Haus, es geht um das Haus!«, rief Dorothea.
»Welches Haus?«
»Na, dieses hier! Sie müssen es aufgeben!«
»Ah.« Die Tante rückte ihre Brille zurecht. »Aber in Kensington gibt es auch kleinere hübsche Häuser anzumieten. Vielleicht nicht in direkter Nachbarschaft, aber gerade gestern …«
»Wir bleiben nicht in Kensington«, warf Vanessa ein. Einen Moment herrschte Stille.
»Nicht in Kensington?« Tante Minna blinzelte verwirrt.
»Es wird Bloomsbury.« Virginia war unbemerkt in den Raum getreten. Ihre zierliche Gestalt hob sich dunkel vor dem Schein des Kaminfeuers ab.
Vanessa schüttelte warnend den Kopf.
»Bloomsbury!«, entfuhr es synchron den Kehlen der Cousinen, während Tante Minna sich schwerfällig zu Virginia umzudrehen versuchte, was bei der Steife ihrer Glieder eine gewisse Zeit in Anspruch nahm.
»In Bloomsbury gibt es unzählige große und günstige Häuser zu mieten und …«, ein boshaftes kleines Lächeln umspielte Virginias Lippen, als sie mit klarer, akzentuierter Stimme fortfuhr, »… die Slade befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Ihr wisst, was das ist, nehme ich an.«
»Zu spät?«, fragte Tante Minna verständnislos. »Was ist zu spät?«
Ohne den Blick von Vanessa zu lösen, kam Virginia zum Tisch, beugte sich zu Tante Minna hinunter und sagte direkt neben ihrem Ohr: »Die Slade, Tante Minna. Eine Kunstakademie. Dort kann Vanessa studieren.«
Dorothea verschluckte sich an ihrem Tee, und Rosamond hüstelte aus Solidarität mit, während Tante Minna sich ein paar Schweißtropfen von der Stirn tupfte.
»Nun«, sagte sie dann. »Ein wenig Zeitvertreib und die Kenntnis der schönen Künste haben noch keiner jungen Dame geschadet. Ich hoffe allerdings, ihr werdet es mir nachsehen, dass ich den weiten Weg nach Bloomsbury kaum werde auf mich nehmen können.«
»Gewiss, Tante Minna«, sagte Vanessa. »Auch wenn wir das natürlich außerordentlich bedauern werden.«
Die alte Dame biss nun endlich herzhaft in ihr Hörnchen, und Virginia wandte sich angewidert ab.
»Obwohl Bloomsbury … nun, es ist … ich vermute, es wird nur vorübergehend sein, nicht wahr? Aus finanziellen Gründen?« Tante Minna nickte, wie um sich selbst zu bestätigen. »George wird schon dafür sorgen, dass ihr in den richtigen Kreisen verkehrt. Dann werden die Verehrer Schlange stehen.«
»Er tut das ja schon eine Weile, aber bislang …« Rosamond hob die Schultern und wandte die Handflächen himmelwärts.
Tante Minna zwinkerte ihr zu. »Zwei so hübsche junge Damen – das wird schon noch! Vanessa ist allerdings schon fünfundzwanzig, und Virginia …« Sie wandte sich erneut Virginia zu, die zurück an den Kamin geflüchtet war, und klopfte mit der Hand einladend auf den Stuhl neben sich. »Komm her, Liebes, setz dich doch zu mir. Iss etwas! Du bist so schrecklich dünn.«
»Danke, Tante Minna, aber ich habe keinen Hunger. Ihr entschuldigt mich bitte.« Sie stürzte aus dem Raum.
Tante Minna sah ihr nach und schüttelte den Kopf. »Sie sollte nicht so viel lesen. Das ist schlecht für die Haltung. Ihr Rücken ist schon ganz krumm.«
»Der Kummer«, seufzte Rosamond. »Sie hat sehr an ihrem Vater gehangen. Wie wir alle, nicht wahr, Vanessa?« Die letzten drei Worte waren so laut gesprochen, dass selbst Tante Minna sie gut hören konnte.
»Selbstverständlich«, sagte Vanessa, ohne eine Miene zu verziehen.
Rosamond faltete die Hände vor der Brust. »Herr, sei seiner Seele gnädig. Wir werden für ihn beten.«
Und Cousine Dorothea setzte ein inbrünstiges »Amen« hinzu.
2. Kapitel
Manorbier, Pembrokeshire, März 1904
Nur wenige Wochen nach dem Tod ihres Vaters mietete George ein Haus in einem abgelegenen Küstenort von Wales. Manorbier lag im Schatten einer normannischen Burg, die sich an die schroffe Steilküste klammerte. Die wenigen Häuser des Ortes schienen sich zu ihren Füßen zusammenzukauern, und bis auf eine kleine Kirche auf einem Hügel gab es weit und breit nichts als Gras, Felsen und ein paar Schafe, die dem steten Wind trotzten.
George, Gerald, Adrian und Thoby gingen auf Rebhuhnjagd, und Vanessa brachte Stunden an ihrer Staffelei zu, um die dramatische Landschaft vor ihrer Haustür auf der Leinwand festzuhalten. Sie alle waren wie junge Hunde, die nach einer langen Zeit im Zwinger endlich wieder ins Freie gelassen wurden. Für Virginia jedoch war die plötzliche Freiheit nach den langen Jahren der Enge und Düsternis am Hyde Park Gate ein Schock. Bisweilen übermannte sie die Weite der Natur regelrecht, und sie zitterte ohne äußeren Anlass. Sie unternahm einsame Spaziergänge entlang der Küste, und der Blick auf das Meer und der Wind in ihrem Gesicht brachten ihrem aufgewühlten Inneren ein wenig Ruhe, auch wenn sie immer wieder fürchtete, jeden Moment könne sich eine Felsspalte vor ihr auftun und sie verschlingen.
Gemäß dem Wunsch ihres Vaters hatten sie seine Asche auf dem Grab der Mutter verstreut. Virginia stellte sich vor, wie der Regen die feinen Partikel in den Boden wusch, wo sie sich mit den verrotteten Resten dessen vermischten, was einmal ihre Mutter gewesen war, und daraus wieder neues Leben erwachsen konnte. Trost brachte ihr dieser Gedanke allerdings nicht.
Einige Male nahm sie etwas zu schreiben auf ihre Spaziergänge mit, legte sich an einer windgeschützten, trockenen Stelle auf den Boden und lauschte den Geräuschen, die sie umgaben. An windstillen Tagen war es, als könnte sie die Erde atmen hören. In diesen Momenten glaubte sie, verstehen zu können, was die Welt im Inneren zusammenhielt, und sie suchte nach den Worten, um dieses Gefühl der Erkenntnis zu beschreiben.
Den Rücken in eine felsige Nische oberhalb der steil abfallenden Küste gepresst, die Beine angezogen und den Blick auf das Meer gerichtet, begann sie zu verstehen, was sie eigentlich schreiben wollte. Wie sie schreiben wollte. Es musste möglich sein, eine Sprache zu finden, die ihre eigene wäre, eine Sprache, die wie das Auf und Ab der Wellen klang, die diesem Atmen der Erde, wie sie es manchmal zu hören meinte, entsprach. Eine Sprache, die nicht nur abbildete, was sie sah und was in der äußeren Welt geschah, sondern die den tiefen Zusammenhang zwischen dem Geist des Einzelnen und dem großen Ganzen spürbar werden ließ. Oft glaubte sie, in den versteckten Nischen ihres Geistes wartete die Geschichte einer Frau darauf, dass sie sie entdecken und in Worte kleiden würde. Diese Frau könnte sie eine Reise zu den unberechenbaren Wogen des Lebens antreten lassen, mit einer Sprache, die den Klang dieser Wogen nachbilden würde.
Sie hatte viele Bücher mitgebracht, Bücher, die sie in den vergangenen Monaten beiseitegelegt hatte, weil sie keine Muße fand. Nun blätterte sie durch die Seiten, las Shakespeare, Dante, Plato, Euripides und hatte das Gefühl, dass sich ihre Fähigkeit, zu denken und Zusammenhänge zu verstehen, mit jedem Wort, das sie von diesen großen Männern las, erweitere. Im Lesen und im Schreiben, so glaubte sie, trete sie in Kontakt mit dem alles verbindenden Geist, der auch einen Plato oder Shakespeare erfüllt haben mochte. Und dass der Geist, den sie in der Erde atmen hörte, derselbe war, den auch ein Plato wahrgenommen und mit seinen klaren, schönen Worten zum Ausdruck hatte bringen können. Sie musste nur die richtigen Worte finden, um selbst ein schöpferischer Teil dieses Ganzen zu werden.
Wenn jedoch die Düsternis sie wieder überkam, schämte sie sich dieser Gedanken. Wie konnte sie als Frau es wagen, in geistige Welten eindringen zu wollen, die nur von Männern geschaffen worden und ganz gewiss nicht für sie bestimmt waren! Sie hatte nie eine Schule besucht, würde niemals eine Universität von innen kennenlernen. Ihr Drang nach geistiger Entwicklung war anmaßend, und so ließ sie die Ehrfurcht vor den Geistesgrößen, deren Texte sie las, zusammenschrumpeln wie eine gerade erst sich entfaltende Blüte in der glühenden Mittagssonne.
Sie führte Gespräche. Aber nicht mit Vanessa, die doch immer ihre erste Ansprechpartnerin gewesen war, und schon gar nicht mit ihren Brüdern, die ohnehin niemals verstanden hätten, was sie bewegte. Ihre Geschwister schienen auf einer helleren Seite des Lebens angekommen zu sein. Über den Vater, seinen Tod und das, was sie zurückgelassen hatten, sprachen sie nicht. Sie redeten über Rebhühner und seltene Schmetterlinge, über köstliches Gebäck und eigenartige Käfer, die es nur hier zu geben schien. Meist hörte Virginia auch gar nicht zu, wenn die Geschwister bei Tisch über Nichtigkeiten diskutierten. Sie saß schweigend da und nickte an Stellen, die ihr dafür passend erschienen, ohne jedoch zu wissen, ob es wirklich so war.
Stattdessen führte sie Gespräche mit ihrem Vater. Im Geiste versuchte sie, ihm zu erklären, was sie entdeckt hatte. Dass sie glaubte, eine eigene Sprache finden zu müssen, für eine Literatur, die sich grundsätzlich von der seinen und all der anderen Schriftsteller vor ihm unterschied.
»Was für ein Unsinn«, sagte er dann. »Die Sprache ist ein Regelwerk, dem wir alle unterliegen, das wir nicht missachten können, wenn wir einander verstehen wollen.«
»Aber«, so antwortete sie ihm im Geiste, »diese Regeln sind von Männern gemacht. Sollen sie für uns Frauen in gleicher Weise gelten? Wo doch so viele Dinge für uns nicht gelten, die für Männer selbstverständlich sind?«
»Du willst schreiben?«, fragte er dann. »Nun, schreib. Aber bilde dir nicht ein, dass das, was du dir in deinem schwachen weiblichen Geiste ausdenkst, von Bedeutung sein wird.«
»Könnte es nicht sein«, entgegnete sie, »dass mein schwacher weiblicher Geist, wie du ihn nennst, so viel stärker werden könnte, wenn er nicht aufs Gebären und Versorgen reduziert würde, sondern sich an Universitäten mit euch klugen Männern austauschen dürfte? Wenn er nicht eingesperrt und verlacht, sondern geachtet und gefördert würde?«
»Ich habe dir immer Bücher zum Lesen gegeben«, verteidigte sich ihr Vater. »Du darfst dich nicht beschweren.«
»Mehr wäre möglich gewesen«, war ihre Antwort darauf. Sie warf ihm vor, dass sich alles immer nur um ihn und seine Arbeit als Biograph gedreht habe, dass er dem Leben bedeutender Männer so viel mehr Aufmerksamkeit und Zeit gewidmet habe als ihr und ihrem Wunsch, selbst Schriftstellerin zu werden. Aber sie bat ihn auch um Verzeihung, ihn in den letzten Jahren seines Lebens alleingelassen zu haben mit seiner alles verzehrenden Trauer um ihre Mutter. Wie viel näher hätten sie einander kommen können, wenn diese Gespräche, die sie nun im Geist mit ihm führte, tatsächlich stattgefunden hätten. Nun war es zu spät und das Versäumte nie mehr nachzuholen.
»Denkst du noch manchmal an ihn?«, fragte sie einmal Vanessa, als sie gemeinsam mit Vanessas Staffelei loszogen, um eine besonders schöne Stelle aufzusuchen. Virginia hatte einige Tage zuvor einen Felsvorsprung entdeckt, von dem aus man die gesamte Küste überblicken konnte. Im spätnachmittäglichen Dunst erinnerte der Landstrich an die steingewordenen Falten einer ins Meer sinkenden Abendrobe.
»Wenig«, sagte Vanessa. »Und wenn …« Sie zog entschuldigend die Schultern hoch.
»Wenn?«, fragte Virginia.
Die Schwester sah sie nicht an, als sie nach einer ganzen Weile antwortete: »Wenn, dann mit Erleichterung.«
Nach all dem, was Vanessa in den letzten Monaten hatte leisten, hatte ertragen müssen, war die Antwort zu erwarten gewesen; ihre Körperhaltung, die Zufriedenheit, die sich in ihrer Miene spiegelte, und ihr wiederkehrendes fröhliches Lachen sprachen für sich, und doch rückten die Worte ihre Schwester ein weiteres Stückchen von ihr weg, hinaus in die Helligkeit, wo sie mit ihren Brüdern ihre neu gewonnene Freiheit feierte, während Virginia im Schatten zurückblieb. Es wäre der richtige Moment gewesen, um von ihrer eigenen Freudlosigkeit zu erzählen, dem Gefühl, so viel Wichtiges mit ihrem Vater versäumt zu haben. Und auch von den Gedanken um ihr Schreiben, aber all das schien sich in einem undurchdringlichen Nebel zu verlieren, wenn sie es zu formulieren versuchte. So nickte sie nur. »Es ist ja auch so schön hier«, sagte sie. »Wer will da an Trauriges denken.«
»Eben«, sagte Vanessa.
Es war schön, aber über die Wochen wurde die Abgeschiedenheit des Ortes den Geschwistern langweilig.
»Ich würde gern nach Venedig reisen«, sagte Gerald.
»Und Florenz. Wir müssen unbedingt auch nach Florenz. Ich muss die Uffizien sehen«, fiel Vanessa ein.
»Was ist mit Paris?«, fragte Thoby. »Mein Freund Clive Bell lebt zurzeit dort, und …«, er sah Vanessa bedeutungsvoll an, »er könnte dich dort in die Kunstszene einführen. Soweit ich weiß, hat er einige sehr interessante Bekanntschaften gemacht.«
Vanessa war begeistert. Virginia weniger. Noch vor einem Jahr wäre sie mit der Aussicht auf ausgedehnte Reisen aus dem Häuschen geraten, jetzt aber hatte sie nur ein Bedürfnis: sich auf den nackten Fels oberhalb eines sehr steilen Kliffs zu legen, dem Rauschen der Wellen und des Windes zu lauschen und die Erde »atmen« zu hören.
Nur das. Und sonst nichts.
***
Paris, Mai 1904
Für Thobys Studienfreund Clive Bell gab es keinen schöneren Ort der Welt als Paris, auch wenn er außer London und Wiltshire, wo er herkam, noch nicht allzu viele Orte kannte. Seit Januar hielt er sich in der Stadt auf, um an seiner Dissertation zu arbeiten. Das zumindest war der offizielle Grund, den auch sein Vater für ehrenwert genug erachtete, um seinen langen Aufenthalt hier zu finanzieren. Sehr viel mehr als die Bibliotheken mit ihren staubigen Büchern reizten Clive jedoch die Bars und Cafés rund um den Montmartre, in denen zahlreiche der meist mittellosen Künstler der Stadt anzutreffen waren. Er hatte bereits Bekanntschaft mit einigen von ihnen gemacht und seine Leidenschaft für die schönen Künste entdeckt.
Clive war Virginia und Vanessa Stephen erst ein einziges Mal begegnet, hatte diesen denkwürdigen Moment aber noch lebhaft in Erinnerung. Damals hatten die Schwestern ihrem Bruder Thoby – Clives ehemaligem Zimmergenossen in Cambridge – einen Besuch abgestattet. Er hatte nur einen kurzen Blick auf diese beiden wunderschönen Wesen in ihren weißen Sommerkleidern erhaschen können, aber in diesen wenigen Minuten hatte er sich in sie verliebt. Genau wie alle anderen jungen Männer, die Zeuge der Szene wurden – ja sogar diejenigen, die sich üblicherweise nicht in erster Linie in junge Damen zu verlieben pflegten, und davon gab es am Trinity viele.
Clive gehörte eindeutig zu den jungen Männern, die sich ausschließlich und mit stürmischem Herzen in junge Damen verliebten. Und so hatte Thobys Ankündigung, dass seine Schwestern einige Tage in Paris weilen und auf Clive als Fremdenführer zählen würden, bei ihm für höchste Nervosität gesorgt.
An diesem sonnigen Maitag sollte Clive die bezaubernden Schwestern auf ausdrücklichen Wunsch Vanessas in den Salon des Indépendants begleiten – die alljährliche Frühjahrsausstellung avantgardistischer Künstler in Paris. Er wusste, dass Vanessa selbst eine ambitionierte Malerin war, und das machte ihn umso nervöser.
Er musste eine ganze Weile im Foyer des Hotels auf die beiden Damen warten. Als sie dann endlich die Treppe herunterkamen, richteten sich nicht nur Clives Augen auf sie. Beide trugen sie Sommerkleider, die dunklen Haare waren hochgesteckt, und die Art und Weise, wie sie vor ihn traten, die Hände in distinguierter Zurückhaltung vor dem Körper gefaltet, war so durch und durch britisch, dass Clive fast Heimweh befiel. So entzückend die Pariserinnen sein mochten, an die Grazie dieser beiden Damen reichte keine von ihnen heran. Er verneigte sich tief und stammelte ein paar unzusammenhängende Worte, die von der Größeren der beiden, Vanessa, mit einem amüsierten Blick aus ihren kühlen blaugrauen Augen bedacht wurden. Im Gegensatz zu ihrer zartgliedrigen Schwester erschien ihm Vanessa mit ihren weiblichen Kurven fast einschüchternd. Nun reichte sie ihm die Hand und sagte mit überraschend dunkler Stimme: »Wir entschuldigen uns für die Verspätung. Ich hoffe, Sie mussten nicht allzu lange warten?«
Clive hatte sich inzwischen gefasst. »Auf manches lohnt es sich, sehr lange zu warten«, sagte er und hauchte einen Kuss auf den ihm dargebotenen Handrücken. »Miss Vanessa Stephen, nehme ich an?« Dabei sah er ihr in die Augen.
»Sie sagen es«, erwiderte sie errötend und senkte den Blick. Aha. Ganz so selbstsicher war sie also doch nicht.
Er wandte sich Virginia zu, die sie aufmerksam zu beobachten schien. Ihre linke Augenbraue hob sich ein wenig skeptisch, als hielte sie Clive für unwürdig, ihre Schwester so unverhohlen betrachten zu dürfen. Dann zeichnete sich auf ihren Lippen ein spöttisches Lächeln ab, und auch sie bot ihm die Hand dar.
»Miss Stephen. Ich bin hocherfreut, Sie kennenzulernen.«
»Virginia! Nennen Sie uns doch bitte beim Vornamen, lieber Mister Bell, sonst können meine Schwester und ich uns am Ende selbst nicht mehr auseinanderhalten.« In ihren Augen blitzte es schalkhaft, und Clive konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie ihm mehr sagen wollte, als die Worte es vermuten ließen. Er kam aber nicht dahinter, was das sein sollte.
»Sehr gern«, sagte er und verbarg seine Verwirrung hinter einer erneuten Verbeugung. »Wollen wir uns auf den Weg machen? Wir starten unseren Rundgang im Grand Palais. Dort erwartet uns ein Freund von mir, Gerald Kelly; kennen Sie ihn vielleicht, Miss Ste… äh … Miss …?«
»Vanessa, lieber Mister Bell, mein Name ist Vanessa«, sagte die kühle Schöne mit dieser sinnlichen Stimmfarbe, die Clives Inneres in Aufruhr brachte. »Und, nein, ich kenne keinen Gerald Kelly. Wer ist er?«
»Ganz wie Sie wünschen. Miss Vanessa also. Kelly ist ein Freund aus Cambridge-Tagen. Er ist selbst Maler, wie Sie, und stellt einige seiner Porträts im Salon aus. Wichtiger aber …« Clive hielt inne, um in den Genuss zu kommen, die Blicke beider Damen auf sich ruhen zu sehen.
»Nun, Mister Bell, wollen Sie uns verraten, was wichtiger ist? Oder müssen wir irgendetwas dafür tun, um es zu erfahren?«, fragte Virginia.
Thoby hatte ihn bereits vor seiner jüngeren Schwester gewarnt. »Sie hat eine scharfe Zunge und einen ebensolchen Verstand«, hatte er gesagt. »Eigentlich gehört sie nach Cambridge, mehr noch als du oder ich, aber sie ist auch attraktiv genug, um eine hervorragende Partie zu machen. Der Mann, der sie einmal heiratet, wird viel Grips und ein mächtig dickes Fell brauchen.«
»Ja … also – nein«, sagte Clive und ließ mit glühenden Wangen seine Hand in der Hosentasche verschwinden. »Sie müssen nichts tun, selbstverständlich nicht. Wir …«, eine weitere kurze, effektvolle Pause, »werden Monsieur Rodin einen Besuch abstatten.«
»Rodin?«, kam es aus beiden Mündern gleichzeitig.
Clive lächelte zufrieden. Der Coup war gelungen. »Der Meister lädt Sie ein, ihn in seinem Atelier zu besuchen.«
Das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Clives Freund, Gerald Kelly, kannte einen jungen Bildhauer, der wiederum mit Rodin gut bekannt war und häufig für ihn arbeitete. Kelly also hatte auf Clives Drängen vereinbart, dass er mit den Stephen-Schwestern das Atelier des Meisters besuchen dürfe. Ob Rodin darüber nun unterrichtet war, wusste Clive nicht. Was er aber wusste, war, dass Rodin niemals eine junge hübsche Dame abweisen würde. Und schon gar nicht zwei.
Sie machten sich auf den Weg zum Grand Palais. Vanessa war schon einmal in Paris gewesen, für Virginia jedoch war es der erste Besuch, und sie nahm die Eindrücke mit großer Begierde in sich auf, schien kaum zu wissen, wohin sie zuerst blicken sollte, stellte Clive tausend Fragen, die er nicht zu beantworten wusste, und kommentierte alles um sich herum mit wohlgeformten Sätzen. Sie erinnerte ihn ein wenig an ein Eichhörnchen, das vor dem nahenden Winter in hektischer Betriebsamkeit sämtliche Kostbarkeiten, deren es habhaft werden konnte, in sein Versteck zu bringen suchte. Vanessa war deutlich gelassener, in ihrem Gesicht spiegelte sich eine beseelte Zufriedenheit, die ihr etwas Madonnenhaftes verlieh. Clive wollte sie unablässig ansehen, weshalb er entweder rückwärts vor den beiden herlaufen oder sich den Hals verrenken musste. Beides führte dazu, dass er mehrfach stolperte. Das blieb den beiden Damen nicht verborgen, doch sie waren so charmant, schweigend darüber hinwegzusehen. Die Blicke, die sie einander zuwarfen, entgingen ihm indes nicht, er war jedoch zu euphorisch, um sich davon verunsichern zu lassen. Wenn ihm an diesem wundervollen Tag überhaupt etwas Kopfzerbrechen bereitete, dann war es die Frage, welche der beiden Damen ihm besser gefiel: die schöne, ruhige, unnahbare Vanessa oder die intelligente, lebhafte, fragile Virginia.
***
»Ich finde diese Glaskuppel wirklich beeindruckend, sie schafft ein wunderbares Licht, aber es wird recht heiß hier drinnen, findest du nicht?«, fragte Virginia ihre Schwester, die nun schon seit zehn Minuten mit Clive vor demselben Bild stand und über die ungewöhnliche Maltechnik des unbekannten Künstlers diskutierte. Über zwei Stunden waren vergangen, seit sie aufgebrochen waren, und seither hatte sie mit Vanessa nicht ein einziges vertrauliches Wort wechseln können. Dieser Möchtegern-Bohemien Clive war ihrer Schwester nicht von der Seite gewichen. Sein pausenloses Geschwätz über das Pariser Nachtleben und all die Künstler, die er angeblich kannte, standen so sehr im Widerspruch zu seinen biederen Knickerbockern, den rötlichen Locken und dem pausbäckigen Landjunkergesicht, dass Virginia ihn einfach nicht ernst nehmen konnte. Obendrein hatte er ihnen auch noch diesen Gerald Kelly aufgehalst, der immer, wenn sie das Wort an ihn richtete, zu stammeln begann. Seine Porträts mochten ja ganz ansprechend sein, aber der Kerl selbst war eine Zumutung: kaum größer als ein Schuljunge, mit kleinen Schweinsaugen und unablässig rot glühenden Ohren.
Vanessa schien das alles nicht zu stören. Sie widmete jedem Bild in dieser Ausstellung ihre konzentrierte Aufmerksamkeit, fragte Clive, ob er den Künstler kenne, und erklärte ihm geduldig, mit welcher Maltechnik man diesen oder jenen Effekt erzielen konnte. Dabei steckten sie die Köpfe so vertraulich zusammen, als würden sie sich schon ewig kennen. Virginia wollte endlich wieder hinaus an die frische Luft und Paris erkunden – die Seine, die breiten Prachtalleen, die elegant gekleideten Menschen mit ihrer ungezwungenen Selbstsicherheit.
»Was sagtest du, Ginia?«, fragte ihre Schwester zerstreut, ohne den Blick von dem Bild zu wenden.
»Ich glaube, Ihre Schwester sehnt sich nach frischer Luft«, sagte Clive. Er schien ein aufmerksamer Zuhörer zu sein.
»Wann werden wir bei Monsieur Rodin erwartet?«, fragte Virginia, nur um ihm nicht zustimmen zu müssen.
»Richtig, Rodin«, rief Clive mit Blick auf seine Uhr, als wäre ihm diese Nebensächlichkeit tatsächlich entfallen.
»Wir dürfen kommen, wann es uns passt«, mischte sich Gerald Kelly ein.
»Aber gewiss doch nicht zu spät am Nachmittag?«, fragte Virginia.
»Je später, desto höher die Wahrscheinlichkeit, Rodin selbst dort anzutreffen.« Es war der erste Satz, den Kelly, ohne sich zu verhaspeln, gesprochen hatte.
»Oh!« Vanessa sah von Kelly zu Clive. »Ich dachte, er erwarte uns?«
»So ist es vereinbart«, sagte Clive ohne die Spur einer Verunsicherung. »Machen wir uns also auf den Weg.«
Er war nicht nur ein aufmerksamer Zuhörer, sondern auch ein glänzender Lügner. Was Vanessa nur an ihm fand?
Monsieur Rodin war tatsächlich anwesend. Das Tor zum Atelier stand offen, und sie konnten einfach hineingehen. Von Clive wussten sie, dass Rodin eine ganze Heerschar begabter Künstler und auch Künstlerinnen beschäftigte, die seine in Ton oder Gips entworfenen Skulpturen in Marmor meißelten oder, je nach Auftrag, in Bronze gossen. Als sie die lichtdurchflutete Halle betraten, stand der Meister gerade oben auf einer Leiter und rief barsche Kommandos zu einem Mann hinunter, der mithilfe einer Art hölzernem Riesenzirkel Linien und Punkte auf einen gewaltigen Marmorblock zeichnete. Ein paar Meter weiter beugte sich eine junge Frau über eine weibliche Büste und bearbeitete die Kinnpartie, indem sie mit vorsichtigen Schlägen auf einen spitzen Meißel kleine Splitter ablöste. Ein muskulöser Bursche hämmerte mit deutlich mehr Elan auf einen mannshohen Stein ein, dessen geplante Form noch nicht zu erkennen war.
Überall lagen und standen Werkzeuge und Leitern herum, das Dröhnen scharfer Hiebe mit Eisen auf Marmor hallte von den Wänden wider, während in der steinstaubschwangeren Luft der intensive Schweißgeruch der fleißigen Zuarbeiter des Meisters hing, der dort oben auf der Leiter thronte wie ein Heeresführer auf seinem Schlachtross.
Als er die Besuchergruppe erblickte, runzelte Rodin kurz die Stirn, nickte dann aber und stieg langsam die Leiter hinab. Er wechselte ein paar Worte mit seinem Gehilfen, der sich umdrehte und ebenfalls nickte. Rodin winkte die Gruppe zu sich.
Clive ergriff sofort das Wort und erklärte in gebrochenem Französisch ihr Anliegen.
»Anglaises?«, Engländerinnen?, fragte Rodin, und sein Blick wanderte an Clive vorbei hin zu Vanessa, dann zu Virginia und wieder zurück zu Vanessa. Die Art und Weise, wie er ihre Schwester ansah, gefiel Virginia ganz und gar nicht. Der buschige Bart, die lange, spitze Nase und auch der herrische Tonfall erinnerten sie an ihren Vater – ein schmerzvoller Gedanke, verbunden mit der Sorge, eine Schreibaufgabe, die der Vater gestellt hatte, nicht zufriedenstellend erfüllt zu haben. Die bohrende Unzufriedenheit, die sich seit dem Vormittag immer mehr gesteigert hatte, wuchs sich in diesem Moment zu einem heißen Wutgefühl aus, dessen sie nur Herr werden konnte, indem sie mit dem linken Daumen über ihren rechten Daumenknöchel rieb und zugleich ihren Oberkörper vor- und zurückschaukeln ließ. Nur gerade so viel, dass die Spannung entweichen und sie freier atmen konnte. Niemand würde etwas bemerken; es war mehr ein inneres Schaukeln, eine ausgefeilte Technik, mit der sie sich schon oft vor unkontrollierten Gefühlsausbrüchen bewahrt hatte.
»Haben Sie mich verstanden?«, fragte Rodin und sah sie direkt an. Er sprach Englisch, sogar recht passabel, und wie es schien, hatte er soeben ein paar gewichtige Dinge gesagt, denn alle anderen nickten ehrfürchtig. Sicherheitshalber nickte auch Virginia, woraufhin der Meister lächelte und sie mit einer einladenden Geste zum Rundgang durch sein Atelier aufforderte.
»Was hat er denn gesagt?«, zischelte Virginia ihrer Schwester hinter vorgehaltener Hand zu.
»Wir dürfen alles ansehen, aber nichts anfassen – vor allem nicht die verhüllten Skulpturen«, flüsterte Vanessa. »Wo bist du nur mit deinen Gedanken?«
Gedanken. Virginia konnte schon gar nicht mehr denken, so sehr brodelte es in ihr. Sie beobachtete Rodin, der sich der Bildhauerin an der Büste genähert hatte. Er stand unschicklich nah hinter ihr, beobachtete eine Weile ihr Tun und griff dann um sie herum, als wollte er sie umarmen. Er führte ihre Hände, die das Werkzeug hielten, wohl um ihr zu zeigen, wie sie es besser machen konnte, aber in Virginias Kopf verschob sich plötzlich etwas. Es war wie ein Riss mitten durch die Szene, und sie sah nicht mehr Rodin, sondern George – und sich selbst, über ihre Griechischvokabeln gebeugt. George, der sie von hinten umfasste und sie in den Nacken küsste. Sie streichelte. Den sie gewähren lassen musste – weil er älter war. Weil er ein Mann war.
Sie stand ein wenig abseits von den anderen, die sich von Rodins Gehilfen das hölzerne Vermessungsinstrument erklären ließen. Auf einem Podest neben ihr erhob sich ein schmaler, hoher Gegenstand, verborgen unter einem weißen Tuch. Nichts anfassen – vor allem nicht die verhüllten Skulpturen, hörte sie Vanessas Stimme. Doch diese stand weit entfernt und beachtete sie nicht. Nichts anfassen, flüsterte die Stimme. Anfassen, anfassen, anfassen!
Mit einem kräftigen Ruck riss Virginia das Tuch herunter. Darunter kam blendend weißer Marmor zum Vorschein. Ein weiblicher Torso, Brüste, die sich ihr entgegenreckten, die sanfte Wölbung eines Bauches. Ihre Hand legte sich ganz von allein auf die kühle Rundung – eine Wohltat, die die heiße Wut in ihrem Inneren schlagartig befriedete.
Hinter ihr ein Schrei, ein Poltern und ein heftiger Stoß, der sie zur Seite taumeln ließ. Rodin, der sich vor ihr aufbaute und einen Schwall Flüche über sie ergoss. Und Vanessa, die herbeigeeilt kam und sie von ihm fortzog.
»Was tust du? Bist du verrückt geworden?«, schimpfte sie. »Ich habe dir doch gesagt, wir dürfen hier nichts anfassen!«
Am liebsten hätte sich Virginia die Ohren zugehalten. Das Hämmern um sie herum hallte in ihrem Kopf wider und schien ihn spalten zu wollen.
»Ich möchte bitte gehen«, sagte sie leise. Jetzt, da ihr Zorn auf dem kühlen Marmor verglüht war, überkam sie die Scham über ihre Tat. Noch schlimmer jedoch war der Schmerz, der sich vom Nacken aus über ihren ganzen Kopf ausbreitete. Sie sah zu Boden, aber sie spürte die Blicke von Clive und Gerald Kelly wie Nadelstiche in ihrem Rücken. »Ich möchte endlich zurück nach Hause, Vanessa. Bitte, lass uns heimfahren!«
3. Kapitel
London, 4. Mai 1904
Zwei Tage später kam George, um Virginia und Vanessa nach London zurückzubegleiten. Vanessa hätte noch wochenlang in Paris bleiben mögen, die Museen durchstreifen und mit Mister Bell und seinen Künstlerfreunden bis spät in die Nacht in Cafés hocken und über die Kunst diskutieren. Aber die Rückkehr war unvermeidlich. Virginia zeigte beunruhigende Anzeichen einer nervösen Krise, die Vanessa nicht ignorieren konnte. Sie redete beinah ununterbrochen, aß kaum und schlief wenig. Nach ihrem merkwürdigen Sabotageakt in Rodins Atelier waren sie ins Hotel zurückgekehrt, wo Virginia mehrere Stunden geschlafen hatte. Danach wollte sie unbedingt Mister Bells Angebot wahrnehmen, ihn ins Chat Blanc, eine Künstlerkneipe in Montmartre, zu begleiten, wo auch Rodin häufig anzutreffen war. Einen Grund für ihr seltsames Verhalten gab sie nicht an; ihr sei einfach danach gewesen, sagte sie nur, und vor einem Wiedersehen mit Rodin habe sie auch keine Angst. Ob sie sich bei ihm entschuldigen solle, wenn sie ihn dort anträfen?
Zum Glück war Rodin nicht dort gewesen, und sie hatten die Bekanntschaft mit einer ganzen Reihe junger Maler gemacht. Sogar geraucht hatten sie und sich herrlich verrucht dabei gefühlt. Natürlich erzählte Virginia ihrem Stiefbruder auf der Rückfahrt haarklein von ihren Sittenwidrigkeiten und weidete sich an seinem Entsetzen. Wenn sie in dieser aufgepeitschten Stimmung war, stichelte und provozierte sie, wo sie nur konnte.
Mister Bell hatte Vanessas Hand beim Abschied unnötig lange festgehalten und sie dreimal daran erinnert, ihm unbedingt zu schreiben, sobald sie wohlbehalten in London eingetroffen seien. Sie fand ihn amüsant, wenn auch wenig distinguiert, was sie jedoch nicht störte – anders als Virginia. »Eitel, plump und allzu bemüht, einen gebildeten Eindruck zu machen«, war ihr Urteil über den armen Kerl, der sich solche Mühe gegeben hatte, ihnen die spannendste Seite von Paris zu zeigen. Thoby mochte ihn sehr, und das allein war für Vanessa ein Grund, ihn ebenfalls zu mögen – egal was Virginia sagte.
Nach den langen Wochen des Reisens, die voller Kunst, Schönheit und Lebensfülle gewesen waren, legten sich die Stille und Leere des Hauses am Hyde Park Gate bleischwer auf Vanessas Schultern. Auch Virginia rang merklich nach Luft, als sie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in die dunkle, kühle Halle traten. Thoby war in Cambridge, Gerald bei der Familie seines verstorbenen Vaters Herbert Duckworth, und dann war da noch Adrian, der laut George seit Tagen sein Zimmer kaum verlassen hatte. Die Krankenschwestern, die den Vater gepflegt, die Tanten, die jeden Tag ein und aus gegangen waren, die Dienstboten, die so viele Jahre für das Wohl der vielköpfigen Familie gesorgt hatten – sie alle waren fort. George und Vanessa hatten entschieden, nur die Magd und die Köchin zu behalten und den Rest der Dienerschaft mit den allerbesten Empfehlungen zu entlassen.
Das gesamte Dachgeschoss mit den früheren Kinderzimmern, Vaters Arbeitsräume, das ehemalige Elternschlafzimmer sowie Stellas Räume, in denen sie so kurze Zeit nur mit ihrem Ehemann gewohnt hatte, standen nun leer, bis auf die verwaisten Möbel, Teppiche und Vorhänge, in denen der Staub der Erinnerung hing.
In der Nacht nach ihrer Rückkehr träumte Vanessa dann zum wiederholten Male, dass sie ihren Vater umbrachte. Sie hatte ihn schon mit Arsen getötet, das sie in sein Essen gemischt hatte, mit einer langen Giftspritze, in sein Ohr eingeführt, und in dieser Nacht erstickte sie ihn mit einem der kostbaren Seidenkissen aus dem Bett ihrer Mutter.
»Wir müssen endlich einen Käufer für dieses Haus finden«, sagte sie am nächsten Morgen zu George. Er hatte eine gut bezahlte Anstellung als Privatsekretär des Finanzministers Austen Chamberlain, verließ jeden Tag pünktlich um Viertel vor neun das Haus und hatte überhaupt keine Eile, nach einer neuen Bleibe zu suchen. Vanessa fürchtete, er könne trotz ihrer unmissverständlichen Andeutungen in letzter Zeit immer noch nicht begriffen haben, dass sie und Virginia künftig nicht mehr mit ihm unter einem Dach leben wollten. Aber George gehörte nicht zu den Menschen, die zwischen den Zeilen zu lesen verstanden. Gerald hingegen hatte längst eine neue Bleibe für sich gefunden und plante seinen Umzug für Juni.
»Wir können nicht verkaufen, bevor wir etwas Neues haben«, sagte George, während er den Sitz seiner Krawatte im Spiegel begutachtete.
»Für uns würde sich bald etwas finden lassen«, sagte Vanessa. Es war klar, wer mit diesem uns gemeint war, denn ein wir hatte es zwischen den Stephen- und Duckworth-Kindern nie gegeben. »In Bloomsbury gibt es reichlich Häuser zu mieten. Ich verstehe natürlich, dass Bloomsbury für dich in deiner Position und mit deinem Einkommen nicht infrage kommt«, setzte sie hinzu.
»Da hast du völlig recht«, sagte George, als wäre der Sachverhalt damit geklärt und Bloomsbury vom Tisch. Er setzte seinen Hut auf und machte Anstalten, das Haus zu verlassen.
Es half nichts. Klare Worte mussten her. Jetzt. »Virginia, Thoby, Adrian und ich werden nach Bloomsbury ziehen«, sagte sie schnell.
George zögerte, drehte sich jedoch nicht um. Dann riss er die Tür auf und ging.
***
Hyde Park Gate, 8. Mai 1904
George war wütend. Jemand musste Vanessa zur Vernunft bringen. Es war völlig ausgeschlossen, dass er nach Bloomsbury zöge – und noch weniger konnte er zulassen, dass seine beiden Stiefschwestern in einem ungeordneten Haushalt ohne männlichen Vormund lebten. Er verkehrte in respektablen Kreisen, die Leute würden sich das Maul über ihn zerreißen, wenn er Vanessa gewähren ließe. Aber er kam gegen sie nicht an. Schon längst hatte er es aufgegeben, sie zu Abendgesellschaften, Bällen oder gar Wochenendbesuchen auszuführen, wo es unter normalen Umständen für sie ein Leichtes hätte sein sollen, einen passablen Ehemann zu finden. Mit ihrer mürrischen Schweigsamkeit hatte sie ihn schon bei mehreren Gelegenheiten unmöglich gemacht. Und ihn zurückzustoßen, als er ihr einen völlig harmlosen Kuss auf diese zarte weiße Stelle unterhalb des Ohrläppchens gegeben hatte, war eine unverzeihliche Demütigung. Sie brachte seiner Bewunderung ihrer Schönheit keinerlei Wertschätzung entgegen, und so hatte George beschlossen, sie einfach zu ignorieren. In dieser Angelegenheit aber war Ignorieren offenbar die falsche Strategie. Sie legte es ihm wohl als stilles Einverständnis aus, dass er bislang nicht gegen ihre verrückten Pläne protestiert hatte. Nun musste er seine Strategie ändern.
Auch wenn Vanessa glauben mochte, er sei dumm – George wusste sehr wohl, wie seine halsstarrige Schwester zu beeinflussen war. Er kannte ihre Schwäche. Und die hieß Virginia. Nur wenn Virginia ihren Segen zu dem Unternehmen Bloomsbury gab, würde Vanessa ihre Pläne in die Tat umsetzen. Und Virginia steckte in der Vergangenheit fest, das war für George offensichtlich. Am Abend ihrer Rückkehr aus Paris war sie als Erstes in das Arbeitszimmer ihres Vaters gegangen. Er wusste nicht, was sie dort getan hatte, aber dass sie den Tod Leslies trotz der ausgiebigen Reisen nach der Beerdigung nicht verwunden hatte, sah selbst ein Blinder. Hier musste er ansetzen.
An diesem Abend kehrte er erst spät nach Hause zurück, um sicherzugehen, dass Vanessa sich bereits zurückgezogen hatte. Sie ging gern früh schlafen, im Gegensatz zu Virginia, in deren Zimmer oft bis spät in die Nacht Licht brannte. So auch heute. Es war weit nach zweiundzwanzig Uhr, als George leise an ihre Tür klopfte. Er wartete nicht, dass sie ihn hereinbat. Das tat er nie.
Sie saß an ihrem Pult am Fenster und starrte in die Dunkelheit. Offenbar hatte sie sein Klopfen nicht gehört.
»Virginia«, sagte er leise.
Sie fuhr herum. Ihre Augen lagen noch tiefer in den Höhlen als sonst. Paris hatte sie offenbar sehr erschöpft. Auch das war Vanessas Schuld. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten die beiden schon viel früher die Heimreise nach London angetreten.
Er ging auf sie zu und streichelte ihr übers Haar. »Du schläfst nicht«, stellte er fest.
Stumm schüttelte Virginia den Kopf.
»Komm«, sagte er, griff ihre Hand und wollte sie zum Bett ziehen.
Virginias Augen weiteten sich, und sie schüttelte heftiger den Kopf.
»Nein«, beruhigte er sie. »Heute werde ich nicht bei dir liegen. Ich möchte mich nur ein wenig zu dir setzen.«
Er zog sie hoch und schob sie mit sanftem Druck zum Bett.
»Es war sehr einsam hier, weißt du. Das Haus ist so leer, wenn ihr nicht da seid.« Er streichelte ihre Hand. »Du zitterst ja, ist dir kalt?«
Virginia reagierte nicht auf seine Frage, presste nur fest die Lippen zusammen.
»Komm her, Zicklein. Ich wärme dich«, sagte George und zog sie eng an sich. Sie war so zart, wer würde sie beschützen, wenn Vanessa ihn aus ihrer Mitte verdrängte?
Er schob seine Nase zwischen ihre Haare und sprach ganz dicht an ihrem Ohr: »Hör, Liebes, du hängst sehr an diesem Haus, nicht wahr?«
Diesmal nickte sie.
»Dein Vater würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass du von hier fortgehen willst.«
Sie sah ihn stirnrunzelnd an und schien protestieren zu wollen, dann aber blinzelte sie verwirrt, als wären ihr die Worte des Widerspruchs plötzlich entglitten.
»Ich verdiene gut und kann euch gern eine Weile dabei unterstützen, das Haus zu halten.« Er strich ihr eine Strähne aus der Stirn und steckte sie mit einer ihrer Haarnadeln wieder fest. Dann küsste er ihre Schläfe. »Dein Vater hat viel in dieses Haus investiert. Du bist hier groß geworden.«
Eine Träne. Dann noch eine. Zärtlich wischte er sie beiseite. »Ich weiß, wie schwer es für dich ist. Vanessa versteht das nicht. Sie war nie so eng mit eurem Vater verbunden wie du. Du warst sein Liebling.«
Bei seinen letzten Worten krümmte sich Virginia und stöhnte.
»Du darfst ihn nicht im Stich lassen. Er ist tot, aber …« Behutsam nahm er ihr Gesicht in beide Hände und bohrte seinen Blick in den ihren. Ein letzter Satz. Dann würde er aufstehen und so leise aus dem Zimmer gehen, wie er gekommen war. »In diesem Haus lebt er weiter. Wir sind ihm das schuldig. Virginia. Du bist ihm das schuldig.«
***
Hyde Park Gate, 10. Mai 1904
»Miss Vanessa! Kommen Sie, schnell!«
Vanessa sprang aus dem Bett und warf sich ihren Schlafrock über. Sie lag schon seit geraumer Weile wach im Bett und studierte die Annoncen in der Morgenzeitung, die sie in aller Frühe heraufgeholt hatte, noch bevor George sie mit in sein Büro nehmen konnte.
Sie riss die Tür auf und überrannte beinah Sophie, die händeringend davorstand.
»Miss Virginia hat den Verstand verloren!«, rief die aufgeregte Dienstmagd und zeigte die Treppe hinauf. Jetzt hörte auch Vanessa ein dumpfes, gleichmäßiges Poltern aus dem Dachgeschoss, dann ein Heulen. Eine Gänsehaut überlief sie. Allzu lebhaft war die Erinnerung an ihre schwachsinnige Halbschwester Laura, die dort oben jahrelang eingesperrt gewesen war, bevor ihr Vater sie endlich in einer Anstalt untergebracht hatte. Genauso hatte es geklungen, wenn die Raserei Laura erfasste.
»Sie ist im Arbeitszimmer. Die Köchin sagt, sie sei die ganze Nacht dort oben gewesen. Ich habe versucht, sie zum Frühstücken zu bewegen, aber …«
Vanessa hörte nicht weiter zu, so schnell sie konnte, rannte sie die Treppen hinauf und blieb vor der verschlossenen Tür des Arbeitszimmers stehen, um ihren Puls unter Kontrolle zu bringen. Sie musste Ruhe ausstrahlen, wenn sie Virginia gegenübertrat.
Im Moment war es still. Hatte ihre Schwester sich beruhigt? Leise öffnete sie die Tür.
Auf dem großen Schreibtisch des Vaters lagen mehrere Bücher kreuz und quer durcheinander, einige davon aufgeschlagen. Offenbar hatte Virginia sie aus den Regalen gezerrt, denn auch auf dem Boden davor lagen Bücher. Eine der Gardinen vor dem Fenster, das zur Straße hinausging, war heruntergerissen.
Ein Blutfleck an der Wand direkt daneben.