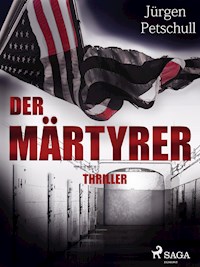Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
In 11 Kapiteln erzählt Jürgen Petschull die Geschichte der Berliner Mauer von Walter Ulbrichts berühmtem Satz "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten" bis zu deren Öffnung und Fall im November 1989. Der Schwerpunkt wird dabei auf die bewegten Tage des Mauerbaus im August 1961 sowie auf ihre nicht minder bewegten letzten Tage im Herbst 1989 gelegt. Zahlreiche historische Text- und Bilddokumente runden Petschulls Darstellung ab. Ein packendes Zeitdokument zum wohl einschneidendsten deutschen Trauma der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.Jürgen Petschull, 1942 in Berlin geboren, ist ein deutscher Schriftsteller und Journalist, der unter anderem lange Jahre für den Stern Reportagen und Serien über zeitgeschichtliche Themen verfasst hat und Chefreporter von Geo war. Heute lebt Petschull in Bremen sowie in einem Haus am Flüsschen Oste und schreibt Sachbücher und Romane, die häufig auf tatsächlichen historischen Geschehnissen basieren. Viele seiner Bücher sind in mehrere Sprachen übersetzt worden.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Mauer
August 1961 – November 1989 vom anfang und vom ende eines deutschen bauwerks
Jürgen Petschull
Saga
Vorwort
Ende der Mauer – Anfang der deutschen Einheit?
November 1989. Ganz Berlin ist eine Wolke, ein Herz, eine Seele. Nicht wiedervereinigt, doch wiedervereint.
Am Ende hat eines der traurigsten Kapitel deutscher Geschichte überwiegend heitere Seiten: Auf der Mauer treten Feuerschlucker auf, kreisen Sektflaschen, reichen sich Polizisten (West) und Grenzsoldaten (Ost) die Hände, sinken sich Deutsche (BRD) und Deutsche (DDR) in die Arme, wird das Ende des kalten Krieges mit heißen Getränken und wärmendem Schnaps begossen. Seither beschäftigt eine Frage die geteilte Nation: War das Ende der Mauer der Beginn der deutschen Einheit?
„Die Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk der Welt“, sagt Berlins Regierender Bürgermeister Walter Momper. „Ich habe meiner Tränen kaum Herr werden können“, gesteht Willy Brandt. Der Chefredakteur der „Zeit“, Theo Sommer, hat sein Ohr am Volke und hört heraus: „In den Herzen der Deutschen läuten die Glocken.“ Und als im Bundestag „Einigkeit und Recht und Freiheit“ angestimmt wird, da entringt sich dem Abgeordneten Hubert Kleinert der Stoßseufzer: „Mein Gott, auch das noch.“
*
Überraschen konnte der Massenausbruch unterdrückter Gefühle kaum. Nichts hat die Deutschen so sehr getrennt wie die Mauer in Berlin, physisch, politisch und emotional. 28 Jahre, zwei Monate und 26 Tage lang verlief hier für die meisten von uns die Front zwischen Gut und Böse, zwischen sozialer Marktwirtschaft und sozialistischer Zwangsherrschaft, zwischen Demokratie und Diktatur.
Für die einen war das von Hunden und Minen und von Männern mit Maschinenpistolen gesicherte Bauwerk aus Beton „die Schandmauer“, errichtet von „kommunistischen Unterdrückern, die 17 Millionen Deutsche in ein riesiges Gefängnis gesperrt haben“. Für andere galt es als „moderne Friedensgrenze“, als „antiimperialistischer Schutzwall“, als „Bollwerk gegen westliche Militaristen, Revanchisten und Monopolkapitalisten“. Dabei wurde auf beiden Seiten der Mauer vergessen – oder böswillig unterschlagen –, daß nach dem Krieg engagierte Menschen in Deutschland-West wie in Deutschland-Ost eine bessere Welt bauen wollten, in der sich die Katastrophe des Hitler-Reiches nie wiederholen sollte:
Die Deutsche Demokratische Republik war als Staat mit marxistischen Idealen gedacht, mit Gleichheit und Brüderlichkeit, ohne Ausbeutung des Menschen durch den Menschen – aber mit staatlicher Planung, mit Vorrang des Kollektivs und Einschränkungen für den einzelnen. Zum Wohle aller. In der Bundesrepublik Deutschland wurde mit Hilfe der westlichen Siegermächte ein demokratisches System installiert, mit freien Wahlen, mit Meinungs- und Pressefreiheit, mit politischem und wirtschaftlichem Wettbewerb und mit Recht auf Selbstverwirklichung für den einzelnen. Zum Wohle aller.
Der Wettkampf der Systeme, von den Supermächten USA und UdSSR in beiden Teilen Deutschlands angefacht und weiter geschürt, eskalierte zum 13. August 1961. Berlin wurde geteilt. Mitten in der Stadt wuchs die Mauer. Die jeweils von ihrer gerechten Sache überzeugten Deutschen hüben und drüben entfremdeten und verfeindeten sich noch mehr.
Die Mauer wurde zum Monument dieser politischen Entfremdung – gleich von welcher Seite aus man sie betrachtete. Sie war Anlaß und Schauplatz ungezählter menschlicher Tragödien. Familien und Freundschaften sind durch sie zerrissen worden. Menschen wurden getötet, verletzt und ins Gefängnis gesperrt, weil sie die Mauer überwinden wollten. Ein 22jähriger Ostberliner starb noch im Februar 1989 im Kugelhagel. Er war das 80. Todesopfer.
Für dieses Leid sind diejenigen verantwortlich, die die Mauer gebaut haben: die damaligen Machthaber in Ost-Berlin und in Moskau. Mitverantwortlich sind aber auch Politiker und Meinungsmacher im Westen, die die DDR politisch und wirtschaftlich in den Ruin treiben wollten – Konrad Adenauer und Axel Springer, um zwei herausragende Persönlichkeiten aus der Zeit des kalten Krieges zu nennen.
Aber, so stellte sich bei den Recherchen für dieses Buch auch heraus, es ist nicht auszuschließen, daß durch den Mauerbau Schlimmeres verhütet worden ist – ein Krieg um Berlin, der schnell zu einem Atomkrieg geworden wäre. Erst als in den USA die Archive geöffnet wurden, als die Pläne der Militärs an die Öffentlichkeit kamen und Mitwirkende der Geschichte zu sprechen begannen, wurde klar, wie knapp wir alle davongekommen sind. Deutsche, Amerikaner und Russen. Der damalige US-Präsident John F. Kennedy wußte, wovon er sprach, als er wenige Tage nach der Teilung Berlins im Weißen Haus in Washington sagte, er könne die Aufregung der Deutschen nicht recht verstehen, die ein energisches Eingreifen der Amerikaner in Berlin forderten. „Es ist keine sehr schöne Lösung“, sagte Kennedy, „aber die Mauer ist, verdammt noch mal, besser als ein Krieg ...“
*
Und heute, 28 Jahre später? Herrscht nach den vom Volk in der DDR erkämpften Reformen, nach der Öffnung der Grenzen Friede, Freude, wenigstens Zufriedenheit im Lande über die unerwartet positive Wende der späten Nachkriegsgeschichte? Leider nicht. Schon sind rechte CDU-Politiker, Kanzler und Generalsekretär vorneweg, beim Ausheben alter Gräben zu beobachten. „Freiheit oder Sozialismus“ hieß die demagogische Wahlkampf-Devise der „Christlichen Demokraten“ in den sechziger Jahren. Hilfe für die DDR erst, wenn dort dem Sozialismus in allen denkbaren Formen für alle Zeit abgeschworen wird, heißt es heute. Nun sind sowohl die nun verblüffend reformfreudigen alten Parteien der DDR (inklusive der Basis der SED) ebenso wie die neuen radikal-demokratischen Volksbewegungen nicht für die Abschaffung, sondern ausdrücklich für eine „demokratische Erneuerung des Sozialismus“. Wie in der Sowjetunion Gorbatschows soll auch auf deutschem Boden ein gesellschaftliches Modell in eine zweite Versuchsphase gehen: Nachdem totalitäre Kommunisten von Stalin bis Honecker ihre Völker mit Gewalt und mit Meinungsterror, durch Gefängnisstrafen und Arbeitslager, durch Mauer und Schießbefehl zu ihrem vermeintlichen Glück zwingen wollten, sollen jetzt Selbstbestimmungsrecht und freie Wahlen, Freizügigkeit und offene Grenzen, mehr Leistungsprinzip und Marktwirtschaft mit sozialistischen Idealen von einem besseren, humaneren Zusammenleben in einer Gesellschaft vereinbart werden. Ein historisches, ein dramatisches, ein zerbrechliches Unternehmen, dessen Gelingen beste Absichten aller Beteiligten und aller Nachbarn voraussetzt. Denn nach dem Sturz der korrupten SED-Clique um Erich Honecker und Günter Mittag kann das Experiment „Demokratischer Sozialismus“ ebenfalls am natürlichen Egoismus der beteiligten Bürger scheitern – den von Marx konzipierten „neuen Menschen“, der sein persönliches Wohlergehen zugunsten der Gesellschaft zurückstellt, hat es bisher bestenfalls als Prototypen, nicht aber als massenhafte Erscheinung gegeben. Wenn dennoch eine Mehrheit der Bevölkerung in der DDR eine völlig reformierte sozialistische Staatsform wünscht, sollten wir sie unterstützen. Demokratischer Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik – sozialer Kapitalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Das erst wäre ein wirklicher Wettkampf der Systeme.
Erst wenn dieser alternative Versuch in der DDR mißlingt – erst dann ist der Sozialismus als idealistisches Modell staatlichen Zusammenlebens endgültig gescheitert. Erst danach, so meint der Münchener Historiker Prof. Christian Meier, könne die Frage der Vereinigung der DDR mit der Bundesrepublik aktuell werden. (Nicht die der „Wiedervereinigung“ wohlgemerkt, denn was es so zuvor nie gegeben hat, kann auch nicht „wieder vereinigt“ werden.)
Doch: „Finanzhilfen für die DDR dürfen keine Finanzierung des Sozialismus werden“, hat Helmut Kohl seinen Volker Rühe verlautbaren lassen. Entpuppen sich also die jahrzehntelangen Sonntagsreden von „Hilfe für unsere unterdrückten Brüder und Schwestern drüben“ als das, was schon immer darin vermutet werden mußte: als Heuchelei? Es scheint, als fürchte die Bonner Nachhut des kalten Krieges (Abteilung rechter Flügel CDU/CSU) ein ernstzunehmendes gesellschaftspolitisches Konkurrenzmodell auf deutschem Boden, einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“, wie ihn der politisch wiederauferstandene Alexander Dubcek vor mehr als zwanzig Jahren in Prag proklamiert hat. Das wollen die Bonner und Münchener Deutschnationalen nicht. Sie berufen sich auch auf das Gebot des Grundgesetzes, nach dem die „Einheit der Deutschen“ anzustreben sei. Was das heißt? Da sind unserem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt. „Einheit der Deutschen“ könnte besonders enge Zusammenarbeit zweier Staaten verschiedener Gesellschaftssysteme bedeuten; oder „Vertragsgemeinschaft“, wie sie der neue DDR-Ministerpräsident Hans Modrow vorgeschlagen hat; oder Kooperation auf allen Gebieten; oder eine Konföderation der beiden souveränen Staaten in einem einigen Europa, mit oder ohne Nato und Warschauer Pakt. Helmut Kohls von den Sozialdemokraten unterstützter sogenannter „Zehn-Punkte-Plan zur Wiedervereinigung“ hat ein großes Deutschland mit sogenannten „föderativen Strukturen“ als Ziel. Die DDR wäre darin nicht Partner und schon gar nicht Alternativ-Modell, sondern letzten Endes ein eingemeindeter Bundesstaat.
Der Nestor der DDR-Reformbewegung, Stefan Heym, sieht in Kohls Plan „die Ouvertüre zur Vereinnahmung der DDR“. Er und seine Kampfgefährten fürchten „nach der Bevormundung durch die SED eine neue Bevormundung durch das große Geld“. Wen wundert es nach den Erfahrungen in diesem Jahrhundert, daß von deutschem Boden aus ein Gespenst um die Welt geht: die Furcht vor einem von Amerikanern, Engländern und Israelis bereits sogenannten „Vierten Deutschen Reich“. Von den historisch wohlbegründeten Ängsten in Polen und in der Sowjetunion nicht zu reden.
Während im Osten Europas Entspannung nach innen und außen praktiziert wird, ist bei uns noch nicht einmal die geplante Wehrpflichtverlängerung vom Tisch. Tiefflieger terrorisieren weiter die eigene Bevölkerung und üben „Gegenangriffe“ gegen einen weit und breit nicht mehr auszumachenden potentiellen Angreifer. Noch immer sollen Milliarden für den „Jäger 90“ verpulvert werden, noch immer ist nicht dementiert, daß neue US-Kurzstreckenraketen mit noch tödlicheren Nuklear-Sprengköpfen auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes in Schußposition gebracht werden sollen.
Nie war der „Wahnsinn Rüstung“ wahnsinniger als heute: Zielrichtung all dieser Vernichtungswaffen wären auch Schwerin, Dresden und Leipzig, Orte, in denen „unsere Brüder und Schwestern“ noch immer den Ruf auf den Lippen haben, der schon Geschichte gemacht hat. „Wir sind das Volk ...!“
Jürgen Petschull
Dezember 1989
*
Dieses Buch will Ursachen und Folgen der Ereignisse um den 13. August 1961 aufzeigen. Und es schildert die Freude der Menschen und die politischen Ereignisse, als 28 Jahre später die Mauer als Symbol des kalten Krieges zusammenbrach, als die Grenzen von Deutschland-Ost nach Deutschland-West geöffnet wurden. Bei den Arbeiten zu diesem Buch standen mir Dokumente (vor allem aus Washingtoner Regierungsarchiven) zur Verfügung, die bisher geheim waren, und Gesprächspartner, die bisher geschwiegen hatten. Für Informationen, Hinweise und Anregungen bedanke ich mich bei Zeugen und Mitwirkenden der Zeitgeschichte; besonders bei Willy Brandt und Egon Bahr, bei Professor Arthur Schlesinger jr. (Anfang der sechziger Jahre Berater Präsident Kennedys), Foy D. Kohler (damals stellvertretender US-Außenminister) und Allan Lightner (früher amerikanischer Gesandter in Berlin).
1. Kapitel
10. August 1961
„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten”
(DDR-Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht)
Für Donnerstag, den 10. August 1961, hat das Meteorologische Institut der Freien Universität Berlin eine durch das Hochdruckgebiet ‚Petroklus’ verursachte Fortdauer des sommerlich warmen Wetters vorhergesagt. Die Berliner packen die Badehosen ein. Am Wannsee ist heute auch der letzte Strandkorb besetzt. Aus den Kofferradios scheppern die neuesten Schlager. Gerhard Wendland singt „Tanze mit mir in den Morgen”, Bill Ramsey schwärmt von der „Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe”, das Orchester Bert Kaempfert spielt „Wonderland by Night”.
Teenager spazieren abends mit wippenden Petticoat-Röcken und Pferdeschwanz-Frisuren über die neonbeleuchteten Straßen. Junge Männer – Halbstarke genannt – tragen amerikanische Nietenhosen und kämmen sich die Locken wie ihr Rock’n’Roll-Idol Elvis Presley. Im Theater am Kurfürstendamm spielt Hildegard Knef die Hauptrolle in dem Stück „Nicht von gestern”. In den Kinos ist „Das Spukschloß im Spessart” mit Liselotte Pulver und Wolfgang Neuss der Lacherfolg der Saison.
Für die bevorstehende Berliner Funkausstellung wird eine technische Neuerung angekündigt: zum erstenmal soll ein „stereophonisches Rundfunkkonzert” direkt ausgestrahlt werden; zum Empfang, so heißt es, brauche man „zwei auf verschiedene Frequenzen eingestellte UKW-Geräte, von denen das eine den linken Kanal wiedergibt, während das andere den rechten überträgt”.
Sportfreunde reden über den bevorstehenden Kampf des beliebten Mittelgewichtsboxers Bubi Scholz gegen einen farbigen Südamerikaner. Uwe Seeler wurde „Fußballer des Jahres”. Heinrich Lübke ist Bundespräsident. In sechs Wochen, am 17. September, wird in der Bundesrepublik gewählt; doch der Wahlkampf schleppt sich bisher spannungslos dahin, denn der 85 Jahre alte amtierende Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) gilt als haushoher Favorit gegen den erst 48jährigen SPD-Kandidaten Willy Brandt, den Regierenden Bürgermeister von Berlin.
Politisch interessierte Bürger Westberlins, die für den Bonner Bundestag ohnehin nicht wählen dürfen, haben in diesen Augusttagen andere Sorgen. Denn am sommerlich-friedlichen Himmel über der früheren Reichshauptstadt zieht gefährliches Unwetter auf: Droht ein Krieg um Berlin?
Die Zeitung „Der Tagesspiegel” berichtet heute über zwei militärische Ereignisse:
Das eine erfreut in Berlin-Dahlem beim deutsch-amerikanischen Volksfest 20 000 Zuschauer. Dort wirbeln GIs bei einem schmissigen Schauexerzieren zum Boogie-Woogie-Rhythmus ihre Gewehre durch die Luft.
Das Zweite eignet sich nicht zur Volksbelustigung. Unter der Schlagzeile „US-Luftlandeübung für 4000 Fallschirmjäger” berichtet die Zeitung von einem Manöver im US-Bundesstaat Carolina. Codewort: „Schneller Schlag”. Annahme der Übung: Ein befreundetes kleines Land wird vom Feind umzingelt und dann besetzt. Aufgabe: Fallschirmjäger, Infanterie- und Luftwaffen-Einheiten sollen erst die Feinde vertreiben und dann die eingeschlossenen Freunde über eine große Luftbrücke mit Lebensmitteln versorgen.
Eine Militärübung, die den Berlinern aus der Blockadezeit 1948/49 nur allzu bekannt vorkommt.
Damals wollte die Regierung der Sowjetunion mit einem Federstrich das Potsdamer Viermächte-Abkommen über Berlin aufkündigen. Ganz Berlin sollte ihrer Besatzungszone einverleibt werden. Die Westalliierten – Amerikaner, Briten und Franzosen – widersetzten sich. Daraufhin blockierten die Sowjets die Zufahrtswege, die alle durch ihre Besatzungszone in die frühere deutsche Hauptstadt führen. Die Amerikaner richteten zur Versorgung der eingeschlossenen Bevölkerung eine Luftbrücke ein. Mit Lebensmitteln beladene Transportmaschinen – von den Berlinern „Rosinenbomber” genannt – landeten Stunde um Stunde auf dem Flugplatz Tempelhof. Ein Jahr lang. Bis die erfolglos gewordene Blockade Westberlins aufgegeben wurde.
Jetzt, zwölf Jahre später, drohen die Sowjets wieder. Aber diesmal ist Berlin besser auf eine Blockade vorbereitet. Seit Monaten schon rollen – unbemerkt von der Bevölkerung – Tausende von Kühlwagen und Kohlewaggons über Straßen und Schienen aus Westdeutschland in den Westsektor der geteilten Stadt. In neuerrichteten Lagerhäusern stapeln sich steifgefrorene Schweinehäften und Rinderteile bis unter die Decken. Butter und Margarine, Zucker und Mehl, Kaffee und Trockenkartoffeln lagern versteckt und gegen Diebstahl gesichert in stillgelegten alten Fabrikhallen. Jeder der 2,2 Millionen Westberliner – so hat der Senat in einer Studie errechnet – könnte ein Jahr lang mit täglich 2900 Kalorien ausreichend ernährt werden. Die Kohlehalden reichen aus, um die Stadt mit Heizmaterial, Gas und Strom zu versorgen. Medikamente im Wert von mehreren Millionen Mark liegen bereit. Es ist so viel Zement gehortet, daß Berlins Bauarbeiter zehn Monate lang arbeiten könnten. Sogar eine Million Paar Schuhe wurde mit Steuergeldern eingekauft, damit die Berliner im Ernstfall keine kalten Füße bekommen.
Der Ernstfall droht den Berlinern seit drei Jahren – aber noch nie war die Gefahr so groß wie in diesem August. „Der Geruch von Blut und Eisen hängt wieder über Europa”, schreibt das Hamburger Nachrichtenmagazin „Der Spiegel”: „Krieg um Berlin scheint möglich.”
Seit dem 27. November 1958 treibt die politische Entwicklung um Berlin scheinbar unaufhaltsam auf einen militärischen Konflikt der beiden Supermächte Sowjetunion und USA zu, seit der sowjetische Regierungschef Nikita Chruschtschow den drei Westmächten ein Berlin-Ultimatum gestellt hat. Anders als 1948 will die Sowjetunion die drei Westsektoren der Stadt nicht unter eigene Kontrolle bringen. Diesmal droht Chruschtschow damit, die Berlin-Verantwortung auf den sozialistischen deutschen Staat zu übertragen, der im Oktober 1949 unter sowjetischer Schirmherrschaft als „Deutsche Demokratische Republik” gegründet worden ist.
Chruschtschows Forderung: Innerhalb von sechs Monaten, bis zum 27. Mai 1960, sollen die Westmächte aus Berlin abziehen, soll Westberlin in eine „entmilitarisierte freie Stadt” umgewandelt sein. Für den Fall, daß sich die Westmächte einer solchen Regelung widersetzen, kündigt der Moskauer Machthaber den Abschluß eines separaten Friedensvertrags mit der DDR an. Die Folge: Die DDR würde die alleinige Kontrolle aller Zugangswege nach Westberlin erhalten, zu Lande, zu Wasser und auch in der Luft. Das bedeutet zwangsläufig, daß das Recht ungehinderten Durchgangsverkehrs alliierter Truppen nach Berlin erlischt. Und das heißt auch, daß der gesamte Zivilverkehr von und nach Westberlin und zwischen dem Ost- und dem Westteil Berlins von der DDR überwacht wird.
Der amerikanische Präsident Eisenhower, der französische Staatspräsident de Gaulle und der britische Premierminister Macmillan konsultieren die Bundesregierung und lehnen die Forderungen der Sowjets kategorisch ab. Die deutschen Politiker fürchten, daß Berlin ohne westlichen Militärschutz keine freie, sondern eine „vogelfreie” Stadt sein würde, die sowjetischen und deutschen Kommunisten wehrlos ausgeliefert wäre.
Hintergrund des sowjetischen Ultimatums ist der gewaltige Exodus aus der DDR. Seit die deutsche Teilung 1949 vollzogen wurde, sind Jahr für Jahr mehr als 200 000 Menschen, insgesamt bereits 2,6 Millionen, aus dem sozialistischen Ostdeutschland in das kapitalistische Westdeutschland abgewandert. Von neun DDR-Bürgern ist einer in den Westen geflüchtet. Die meisten der Flüchtlinge nahmen den kürzesten und leichtesten Weg – über die offene Sektorengrenze von Ost- nach Westberlin.
Dem „Ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden” laufen die Arbeiter und Bauern weg. Aber auch hochqualifizierte Fachkräfte. Aus den Chemie-Kombinaten gehen Forscher zu Hoechst oder Bayer Leverkusen. Ingenieure aus Eisenhüttenwerken und Bergbaubetrieben ziehen ins Ruhrgebiet. Ärzte und Apotheker machen im Westen Praxen und Geschäfte auf. Professoren und Lehrer flüchten vor dem kommunistischen Dogmatismus, dem sie sich unterwerfen müssen. Denn im Wirtschaftswunderland Westdeutschland wird den ehemaligen DDR-Bürgern nicht nur Wohlstand, sondern obendrein noch Demokratie geboten; ein parlamentarisches Parteiensystem, Meinungsfreiheit, die Möglichkeit zu reisen, wohin man will.
Noch ein weiteres Problem plagt die DDR-Volkswirtschaft: Während allein in Ostberlin 45 000 Arbeitskräfte fehlen, fahren 53 000 Ostberliner Tag für Tag zur Arbeit nach Westberlin. Die sogenannten „Grenzgänger” beziehen die Hälfte ihres Lohns in harter D-Mark. Die können sie entweder zum Kurs von 1:4 gegen Ostmark eintauschen oder sich damit in Westberlin Lebensmittel und Luxusgüter kaufen, von denen DDR-Arbeiter nur träumen.
Ende der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre werden die Folgen des großen Exodus für die Deutsche Demokratische Republik dramatisch. Wegen fehlender Arbeitskräfte müssen Teile der Ernte auf den Feldern bleiben. Volkseigene Industriebetriebe können Liefertermine nicht mehr einhalten. Exportaufträge gehen verloren. In Landkreisen und Kleinstädten ist die medizinische Versorgung der Bevölkerung gefährdet.
Durch die offene Grenze nach Westberlin – durch Flüchtlinge und Grenzgänger – entsteht der DDR-Volkswirtschaft Jahr für Jahr ein Schaden von 3,2 Milliarden Mark. Noch größer ist der Schaden für das Ansehen des Kommunismus in der Welt, besonders in den ideologisch noch nicht festgelegten Entwicklungsländern. Und das beunruhigt die großen Brüder der DDR im Moskauer Kreml mindestens ebensosehr wie die Wirtschaftsprobleme des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden. Deswegen stellt Chruschtschow sein Berlin-Ultimatum. Deswegen soll die DDR durch eine Kontrolle der Zufahrtswege die Möglichkeit bekommen, den Flüchtlingsstrom zu stoppen.
Die Westalliierten wollen die sowjetische Drohung gegen die Viermächte-Stadt Berlin zunächst auf dem Verhandlungswege vom Tisch bekommen. US-Präsident Dwight D. Eisenhower lädt Nikita Chruschtschow zu Gesprächen in die Vereinigten Staaten ein. Chruschtschow nimmt an. Er beginnt seine USA-Reise mit einem aggressivem Auftritt vor den Vereinten Nationen in New York, bei dem er mit einem Schuh auf das Rednerpodium schlägt, um seine Beschimpfungen der westlichen Imperialisten und Kriegshetzer wirkungsvoll zu unterstreichen.
Nach diesem stürmischen Auftakt jedoch verlaufen die Gespräche mit Eisenhower überraschend friedlich, ja freundschaftlich. Beim Abschluß des Staatsbesuches in Camp David präsentieren sich die beiden mächtigsten Männer der Welt der staunenden Öffentlichkeit als gütige Großväter. Sie einigen sich, daß über Berlin erst bei einem Viermächte-Gipfeltreffen im Mai 1960 in Paris verhandelt werden soll. – Doch zehn Tage vor der Konferenz wird ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug vom Typ U 2 über dem Gebiet der Sowjetunion abgeschossen. Empört über die (angebliche) Hinterlist des amerikanischen Präsidenten läßt Chruschtschow das Pariser Treffen platzen. Er verschiebt die „Lösung des Berlin-Problems” bis nach den amerikanischen Präsidentschaftswahlen.
Eisenhower kandidiert 1960 nicht mehr. Sein Vizepräsident Richard M. Nixon verliert die Wahl völlig überraschend und ganz knapp gegen einen erst 43 Jahre alten katholischen, gutaussehenden Außenseiter: Am 20. Januar 1961 wird John F. Kennedy als 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Schon kurz nach seinem Amtsantritt sagt der jüngste Präsident in der Geschichte der USA: „Die Welt muß wissen, daß wir für die Freiheit Berlins kämpfen werden, denn wir kämpfen damit für die Freiheit von New York und Paris.” Doch kurz darauf erlebt der dynamische junge Mann im Weißen Haus eine schwere Niederlage. Eine von der US-Regierung unterstützte, vom Geheimdienst CIA vorbereitete und von Exilkubanern ausgeführte Invasion des von Fidel Castro regierten kommunistischen Kuba scheitert kläglich. Das „Desaster in der Schweinebucht” wird vor allem Kennedy angelastet.
Chruschtschow glaubt, mit dem unerfahrenen jungen Mann leichtes Spiel zu haben. Er lädt Kennedy zu einem Gipfelgespräch über eine Lösung des Berlin-Problems nach Wien ein. Kennedy, der dringend einen außenpolitischen Erfolg braucht, nimmt an. Doch das Treffen der beiden ungleichen Regierungschefs endet unversöhnlich. Chruschtschow wiederholt seine alten Forderungen und droht mit Krieg. Kennedy berichtet Vertrauten, er sei „erschüttert darüber, wie leichtfertig der sowjetische Regierungschef mit dem Gedanken eines Atomkrieges umgeht”. Vom Abschlußessen, das am Abend des 16. Juni 1961 in der Botschaft der Sowjetunion in Wien stattfindet, wird folgender Dialog überliefert:
Chruschtschow zu Kennedy: „Krieg oder Frieden, das liegt nun in Ihrer Hand. – Wenn Sie eine Division nach Berlin schicken, schicke ich zwei!” – Kennedy: „Sie wollen Veränderungen erzwingen, nicht ich.” – Chruschtschow: „Der Friedensvertrag mit der DDR mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen wird bis zum Dezember dieses Jahres unterzeichnet.” – Kennedy: „Wenn das so ist, dann wird es ein kalter Winter.”
Von Chruschtschows Unnachgiebigkeit und von seinen Drohungen geschockt, läßt Kennedy nach seiner Rückkehr in Washington eine neue Analyse des militärischen Kräfteverhältnisses um Berlin, in beiden Teilen Deutschlands und zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion anfertigen. Das Ergebnis ist erschreckend: Unter Eisenhower hatte die Strategie der atomaren Abschreckung und damit die nukleare Aufrüstung in den USA absoluten Vorrang vor dem Ausbau der konventionellen Nachrüstung gehabt. Nun sind die USA und ihre westlichen Alliierten im Gegensatz zur Sowjetunion nicht ausreichend auf einen regional begrenzten, konventionellen Konflikt um Berlin vorbereitet.
Nach Informationen aus dem Weißen Haus und dem Pentagon stellt das Nachrichtenmagazin „US News and World Report” eine düstere Prognose für einen möglichen Krieg: „In Ostdeutschland stehen 26 kampfbereite Divisionen (20 sowjetische, sechs ostdeutsche). In Westdeutschland sind 22 Divisionen stationiert (sechs amerikanische, sieben westdeutsche, neun britische und französische). Im Fall eines bewaffneten Konflikts können die Sowjets in kürzester Zeit 50 weitere Divisionen an die Front bringen.” Um dieser gewaltigen Übermacht standzuhalten – so rechnet das Magazin weiter – seien die US-Streitkräfte gezwungen, schon bald taktische Atomwaffen einzusetzen. Die Sowjets würden mit gleicher Waffe zurückschlagen. „Die Seite, die zu verlieren droht, muß dann zwangsläufig ‚strategische Nuklearwaffen’ einsetzen – das bedeutet, Ziele im Heimatland des Gegners mit Atomraketen zu zerstören. So würde ein zunächst konventionell geführter Waffengang um Berlin schon bald zwangsläufig als atomarer Vernichtungskrieg der Großmächte enden ...”
Nach dieser bitteren Erkenntnis ordnet Präsident Kennedy Anfang Juli 1961 militärische Sofortmaßnahmen zur konventionellen Aufrüstung der amerikanischen Streitkräfte an.
1. Armee, Luftwaffe und Marine sollen in kürzester Zeit um 220 000 Soldaten auf insgesamt 1,7 Millionen Mann verstärkt werden. – 2. Der Präsident fordert vom Kongreß eine Erhöhung des Militärbudgets um 3,2 Milliarden Dollar. – 3. Die Stützpunkte der USA in Übersee, vor allem in Europa, sollen mit neuen konventionellen Waffen und mit mehr Munition im Wert von einer Milliarde Dollar zusätzlich versorgt werden. – 4. Die Lufttransport-Kapazität wird um 25 Prozent erhöht. – 5. Zwanzig bereits stillgelegte Truppen-Transportschiffe sollen sofort wieder flottgemacht werden.
In einer Fernsehrede an die Nation begründet John F. Kennedy am 26. Juli 1961 die Dringlichkeit dieser Mobilmachung. Es gehe nicht nur um Berlin, es gehe um die Verteidigung der westlichen Welt. Mit fester Stimme sagt er: „Wir wollen keinen Kampf – aber wir haben schon früher gekämpft. – Wir können und werden den Kommunisten nicht gestatten, uns allmählich oder mit Gewalt aus Berlin zu vertreiben. – Westberlin ist ein Symbol, eine Insel der Freiheit im kommunistischen Meer.” Die Stadt müsse als Schaufenster des freien Westens und als Schlupfloch für Menschen, die vor dem kommunistischen Regime in Ostdeutschland flüchten, erhalten bleiben. Kennedy bietet in seiner Rede der Sowjetunion Verhandlungen an, aber er sagt auch: „Über die Freiheit Berlins gibt es nichts zu verhandeln!” Seine Rede wird im Westen bejubelt. Konrad Adenauer und Willy Brandt, die beiden deutschen Wahlkämpfer, schicken Glückwunschtelegramme. Der Westen, so der Tenor, habe endlich wieder eine feste Führung.
Kennedy, der junge Mann, der als intelligenter Sonnyboy und strahlender Wahlsieger mit seiner hübschen Frau Jacqueline ins Weiße Haus eingezogen ist, scheint in den ersten sechs Monaten seiner Amtszeit um Jahre gealtert. Er wirkt ernst und verschlossen. Mit finsterer Miene, so berichten seine Berater, eilt der Präsident in diesen Tagen, Ende Juli 1961, von einer Berlin-Konferenz zur nächsten. „Kennedy hatte keine Zeit mehr, sich mit amerikanischer Innenpolitik oder mit anderen Fragen zu beschäftigen”, sagt sein Berater Arthur M. Schlesinger, „er war ein Gefangener Berlins.”
Der amerikanische Präsident hat in diesen Tagen stets eine schwarze Aktentasche bei sich. Darin liegt ein Ringordner mit zwei Dutzend „Aktionsplänen” für Berlin, die im State Department und im Pentagon ausgearbeitet worden sind. Foy Kohler, damals stellvertretender Außenminister und Chef der „Berlin Task Force” (der „Berlin Einsatzgruppe”) des State Departments erinnert sich: „Wir hatten für den Präsidenten alle Zwischenfälle, Störmanöver und Aggressionen vorhergesehen und durchgespielt, die wir uns nur vorstellen konnten. Wir haben Behinderungen des Luftverkehrs und der freien Zufahrt auf der Autobahn, bewaffnete Zwischenfälle an der Grenze, militärische Konflikte und deren Folgen ausgearbeitet, Gegenmaßnahmen und alternative Gegenmaßnahmen vorgeschlagen und Reaktionen bei Feind und Freund einkalkuliert.” In Kennedys Mappe steckt auch ein Report des früheren US-Außenministers und jetzigen Präsidentenberaters Dean Acheson, der Chruschtschows Berlin-Ziele so analysiert: Die enorme Flüchtlingswelle soll gestoppt und dadurch das angeschlagene Regime in Ostdeutschland stabilisiert werden. – Westberlin soll erst politisch und militärisch neutralisiert und später von der DDR übernommen werden. – Die Grenzen der DDR sollen legalisiert und international anerkannt werden. – Die Nato-Allianz soll durch einen Konflikt um Berlin aufgeweicht und möglichst zerbrochen werden.
Außer den jeweils aktuellen CIA-Geheimdienstberichten enthält die Berlin-Akte Kennedys auch vertrauliche Mitteilungen. So schildert ihm der Vorsitzende des Washingtoner Wirtschaftsrates Walter W. Heller nach seiner Rückkehr von einer Deutschlandreise auch Gespräche „mit dem eindrucksvollen deutschen Verleger Axel Springer”. Heller an Kennedy über Springers Einschätzung der politischen Lage: „Wenn ein separater Friedensvertrag der Sowjetunion mit Ostdeutschland zustande kommt, glaubt Springer, daß Westberlin von Ostdeutschland durch Stacheldraht und Barrikaden abgesperrt werden wird.” Laut Springer müsse man im Fall einer Berlin-Blockade mit einem Volksaufstand in Ostdeutschland rechnen. Heller an Kennedy: „Springer drückte die dringende Hoffnung aus, daß die Politik der Vereinigten Staaten auf eine solche Entwicklung vorbereitet ist – sonst werde es ein zweites Ungarn geben.”
Für seine Berlin-Unterlagen läßt sich John F. Kennedy von Generalstabschef Lemnitzer einen schriftlichen Bericht über Einsatzbereitschaft und Versorgung der in Berlin stationierten 6000 US-Soldaten geben. Lemnitzer antwortet auf Kennedys Anfrage: „Die Munition reicht für 18 Tage. Ersatzteile für 30 Tage. Lebensmittel für 180 Tage. Flugzeugtreibstoff ebenfalls für 180 Tage und Benzin für 300 Tage.”
In Washington, so scheint es, ist der amerikanische Präsident bis ins Detail über Berlin informiert und auf alles Denkbare vorbereitet – nur nicht auf das, was wirklich geschehen wird.
In Moskau treffen sich vom 3. bis zum 5. August 1961 die Ersten Sekretäre der „Zentralkomitees der Kommunistischen Parteien der Mitgliedsländer des Warschauer Paktes” und ihre Berater. Erst Jahre später werden im Westen Einzelheiten bekannt. Walter Ulbricht, der Staatsratsvorsitzende der DDR, ist bei dieser Zusammenkunft Angeschuldigter und Ankläger zugleich. Angeschuldigt, weil er es nicht geschafft hat, die Lebensverhältnisse in der DDR und die Umerziehung der Menschen zum Kommunismus so voranzubringen, daß sie nicht massenweise in den Westen fliehen. Seit Chruschtschows Berlin-Ultimatum vom November 58 sind in den vergangenen 20 Monaten weitere 430 000 DDR-Bewohner in die Bundesrepublik abgewandert – die meisten von ihnen wieder über Westberlin. Ulbricht seinerseits beklagt sich gegenüber Chruschtschow und den anderen im Kreml versammelten Partei-Chefs über mangelnde Solidarität. Sie hätten ihn und die DDR im Stich gelassen und die Lösung des Berlin-Problems immer weiter hinausgezögert – zum Schaden der DDR-Volkswirtschaft und zum Schaden des gesamten Kommunismus. Ulbricht fordert entschiedene Maßnahmen gegen das „Agenten- und Spionagenest Westberlin, in dem Menschenhändler und Kopfjäger labile Elemente aus der DDR abwerben”.
Einer der Konferenzteilnehmer, der Parteisekretär im Verteidigungsministerium der Tschechoslowakei, Jan Sejna, ist Jahre später in den Westen geflüchtet. Er hat gegenüber westlichen Geheimdiensten ausgepackt. Seine Aussagen sind nicht unumstritten. Der Überläufer berichtet vom Moskauer Geheimtreffen der Warschauer-Pakt-Staaten Anfang August 1961: „Ulbricht hat damals eine Übernahme von ganz Westberlin und die Kontrolle über die Luftkorridore gefordert.” Das sei abgelehnt worden, und man habe eine weniger radikale Lösung zur Unterbindung des Flüchtlingsstromes beschlossen. Sejna erzählt: „Ulbricht sagte schließlich: ‚Danke, Genosse Chruschtsschow, ohne Ihre Hilfe können wir dieses schreckliche Problem nicht lösen.’” Und Chruschtschow habe den DDR-Staatsratsvorsitzenden noch einmal in seine Grenzen verwiesen: „Ja, ich bin einverstanden – aber keinen Millimeter weiter ...!” An den Tagen nach dem Geheimtreffen der kommunistischen Regierungschefs geschehen zwischen Moskau und Ostberlin und in den beiden Teilen Deutschlands Dinge, die sich später wie Teile eines politischen Puzzles zusammenfügen lassen.
In Moskau wird die geglückte Landung des zweiten bemannten Raumschiffes „Wostok II” gefeiert. Bei einem Empfang des Kosmonauten German Titow prahlt Chruschtschow mit der technologischen Überlegenheit der Sowjetunion – er berichtet von einer neuen einsatzfähigen Superbombe mit der Sprengkraft von 900 Tonnen TNT. Am nächsten Tag beginnen gemeinsame Manöver sowjetischer und ostdeutscher Truppen in der Nähe von Berlin. Die Nationale Volksarmee wird aufgerufen, die Ausbildung „gefechtsnah zu gestalten und die Schießergebnisse zu verbessern”. Die Devise lautet: „Soldaten entscheiden durch Taten im Kampf gegen den Imperialismus.”
Am 7. August trifft Marschall Iwan S. Konjew in Ostberlin ein. Der glatzköpfige, vierschrötige Konjew ist ein gefeierter Held des Zweiten Weltkrieges und Spezialist für Städtekampf. Man nennt ihn den „Eroberer von Prag und Dresden. Er übernimmt im Auftrage von Chruschtschow den Oberbefehl der in der DDR stationierten sowjetischen Truppen. Er wird sogleich von Walter Ulbricht empfangen.
Das „Neue Deutschland”, Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), berichtet, daß in „zahlreichen Betrieben Komitees gegen den aus Westberlin betriebenen Menschenhandel und Kopfjägerei” gebildet worden sind. Die 53 000 Grenzgänger müssen sich registrieren lassen und sich verpflichten, ab Mitte September Arbeitsplätze in der DDR zu suchen. Walter Ulbricht sagt: „Wenn gewisse Leute befürchten, daß ihnen das Hintertürchen verschlossen wird, durch das sie bisher ihre Konterbande – Spionage, Sabotage und Menschenhandel – in die Deutsche Demokratische Republik einschmuggeln konnten, dann besteht diese Furcht zu recht.”
Am selben Tag berichtet die Westberliner Zeitung „BZ”: „Verzweifelte Menschen fliehen aus der Hoffnungslosigkeit.” – „Gestern kamen 2000 Flüchtlinge.” – „Es gibt in der Zone kein Halten mehr. Die Leute rennen, retten, flüchten!” – „Die ganze Zone ist von Unruhe erfüllt!”
Die Frage in diesen Tagen ist: „Wird ganz Berlin dichtgemacht?” („BZ”). DDR-Bewohner, die bisher nur mit dem Gedanken gespielt haben, vielleicht irgendwann einmal in den Westen zu gehen, packen nun hastig und unauffällig ihre sieben Sachen und fliehen durch immer stärker werdende Kontrollen aus der DDR zunächst nach Ostberlin und dann weiter mit der S-Bahn oder zu Fuß in den Westteil der Stadt. Tag für Tag werden neue Flüchtlingsrekorde gemeldet. 4. August: 1155 Flüchtlinge. – 5. August: 1283 Flüchtlinge. – Wochenende vom 7. zum 8. August: 3628 Flüchtlinge.
Am 9. August fliehen 1926 Menschen aus der DDR in den Westen. An diesem Tag trifft sich das oberste Führungsgremium der Deutschen Demokratischen Republik, das SED-Politbüro, zu einer Notstandssitzung auf dem von der Außenwelt völlig abgeschirmten Landsitz das Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht. Das Haus in der Schorfheide, 60 Kilometer nordöstlich von Berlin, wird von einem tiefgestaffelten Sicherheitskordon von Polizei und Armee gesichert. Die schwarzen Wolga-Limousinen mit den Ministern der DDR-Regierung passieren die Kontrollen. Der Minister für Staatssicherheit Erich Mielke ist dabei; Justizministerin Hilde Benjamin; der Innenminister Karl Maron und Erich Honecker, der frühere FDJ-Führer und von Ulbricht ernannte Sekretär für Nationale Sicherheitsfragen. Das einzige Thema der DDR-Machthaber: Wie kann der für die DDR zur Existenzgefährdung gewordene Strom der Republikflüchtlinge gestoppt werden. Gastgeber Walter Ulbricht informiert die Spitzengenossen von den Beschlüssen der Warschauer-Pakt-Staaten in Moskau zur „Regelung der Grenzfragen in Berlin”.
Trotz aller vergangenen Querelen und Diadochenkämpfe ist Walter Ulbricht, jetzt 68 Jahre alt, nach wie vor unumstritten der mächtigste Mann der Deutschen Demokratischen Republik. Er ist gleichzeitig Vorsitzender des Staatsrates und Parteichef der SED. Ulbricht, Sohn eines sächsischen Schneidermeisters und gelernter Tischler, begann seinen politischen Aufstieg 1919 als Mitbegründer der „Kommunistischen Partei Deutschlands” (KPD) in Leipzig. Er wird Mitglied des sächsischen Landtages und 1928 Reichstagsabgeordneter für den Wahlkreis Westfalen-Süd. Von den Nazis verfolgt, leitete er nach 1933 im Untergrund die Arbeit der verbotenen KPD. Dann flüchtet er nach Brüssel, nach Paris und nach Madrid. Von 1938 bis zum Kriegsende lebt er in der Sowjetunion. Hier gründet Ulbricht das „Nationalkomitee Freies Deutschland”. Im April 1945 kam er als prominenter moskautreuer Kommunist und als Leiter der sogenannten „Gruppe Ulbricht” nach Berlin zurück. Zusammen mit Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl gründet er aus Teilen der SPD und der Kommunistischen Partei die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Von den Sowjets gefördert, wird Ulbricht 1950 Generalsekretär der Partei und 1953 Erster Sekretär des Zentralkomitees. Mit Hartnäckigkeit, Arbeitseifer und Überzeugungskraft, aber auch durch geschicktes Intrigenspiel gewinnt Ulbricht mehr Einfluß auf die DDR-Politik als der damalige Staatsratsvorsitzende Wilhelm Pieck.
Ulbricht wird zum eigentlichen Gegenspieler des westdeutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Wie Adenauer die Bundesrepublik Deutschland mit den Vereinigten Staaten verbündet und in die westliche Verteidigungsallianz Nato integriert, so bindet Ulbricht die DDR eng an die Sowjetunion und gliedert sie in das Militärbündnis der Warschauer-Pakt-Staaten ein. Ulbricht erreicht jedoch in der DDR nie die Volkstümlichkeit, die Konrad Adenauer in der Bundesrepublik genießt. Adenauers großväterlichem Charme und seinem rheinischen Witz und seiner Verschlagenheit hat Ulbricht wenig entgegenzusetzen. Klein und gedrungen von Statur, mit Spitzbart und hoher, sächsischer Fistelstimme wird er im Westen zur Lieblingsfigur von Karikaturisten und Kabarettisten.
In der Bundesrepublik wird Walter Ulbricht als „Statthalter Moskaus”, als „Menschenfeind” und als „Unterdrücker des Volkes” dämonisiert und verhöhnt: „Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht Volkes Wille.” – „Es hat alles keinen Zweck, der Spitzbart, der muß weg.”
In der DDR dagegen wird derselbe Mann von linientreuen Dichtern zur Übergröße hochstilisiert. Ein Max Zinnering schreibt: „Die Klasse gibt uns Kraft und Mut und Richtung die Partei – mit Walter Ulbricht kämpft sich’s gut – voran, die Straße frei!” Und ein Horst Solomon sieht weit voraus: „Ein Tag wird kommen, Genosse Ulbricht, da wirst du in Hamburg auf unserem Parteitag sprechen; der Sozialismus marschiert in der Howaldtswerft, in Bayern und in den Bochumer Zechen ...”
Doch in diesem August 1961 kämpft Ulbricht dagegen, daß nicht noch mehr DDR-Werktätige zu den Hamburger Howaldtswerken, nach Bayern und in die Bochumer Zechen flüchten. Und dabei ist ihm kein politischer Trick zu schade. Noch am 15. Juni 1961 kommt es bei einer internationalen Pressekonferenz in Ostberlin zu einem denkwürdigen Dialog zwischen der Korrespondentin der „Frankfurter Rundschau”, Annamarie Doherr, und dem DDR-Staatsratsvorsitzenden. Annamarie Doherr fragt: „Würde die Bildung einer freien Stadt Berlin bedeuten, daß die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird?” Walter Ulbricht antwortet: „Ich verstehe Ihre Frage so, daß es in Westdeutschland Menschen gibt, die wünschen, daß wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR dazu mobilisieren, eine Mauer aufzurichten. Mir ist nicht bekannt, daß eine solche Absicht besteht. Die Bauarbeiter unserer Hauptstadt beschäftigen sich hauptsächlich mit Wohnungsbau, und ihre Arbeitskraft wird dafür voll eingesetzt. – Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!”
Genau das jedoch wird am Ende der geheimen Politbüro-Sitzung am Abend des 9. August auf dem Landsitz von Walter Ulbricht in der Schorfheide außerhalb von Berlin beschlossen. Schon in der Nacht zum 10. August beginnen die Vorbereitungen. Kasernierte Bereitschaftseinheiten des Ministeriums für Staatssicherheit riegeln gegen ein Uhr morgens das SSD-Ministerium in der Ostberliner Normannenstraße hermetisch ab. Von hier aus überwachen in den nächsten Tagen Mitglieder des Politbüros die „Maßnahmen zur Grenzsicherung”.
Im Ostberliner Stadtzentrum im Polizeipräsidium unweit vom Alexanderplatz, wird der eigentliche Einsatzstab der Operation Grenzsicherung einquartiert. Die Leitung der Operation übernimmt ein gewisser Erich Honecker.
Funk- und Telefonverbindungen werden zu allen Büros des Staatssicherheitsdienstes in allen Teilen der DDR geschaltet, ebenso zu den Kasernen der Nationalen Volksarmee. Zum Hauptquartier des Chefs der Sowjettruppen, Marschall Konjew, wird eine abhörsichere Direktleitung gelegt. Generale und Vertrauensleute der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen der DDR und der Betriebskampfgruppen werden angewiesen, sich einsatzbereit zu halten.
Während die Westberliner bei schönem Sommerwetter im Wannsee baden, bereiten sich Politiker und Militärs im Westen auf ein ruhiges Wochenende vor, das ihnen Wetterdienste und Geheimdienste vorhergesagt haben.
Während der Bonner Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen, Ernst Lemmer, in einer Fernsehrede den „Brüdern und Schwestern in der Zone” versichert, daß „der freie Zugang von Ost- nach Westberlin erhalten bleibt”, schreibt das SED-Zentralorgan „Neues Deutschland”: „Das Maß ist voll. Die Regierung und die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik werden sich gegen westliche Agenten, Menschenhändler und Provokateure zu schützen wissen.”
Während der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kiel vor 7000 Zuhörern „als Gegenmaßnahmen gegen die erpresserische Berlin-Politik der Sowjetunion und der Sowjetzone Wirtschaftssanktionen” ankündigt, macht der Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht, einen groß angekündigten Besuch im Ostberliner Kabelwerk Oberspree. Der Anlaß: Eine Abteilung des Kabelwerkes – mit 5000 Werktätigen eines der größten Industrieunternehmen der DDR – hat einen Brief an den Staatsratsvorsitzenden geschrieben. Darin fordert die „Brigade Otto Krahmann” alle Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik auf, „genau wie wir selber besondere Anstrengungen für den Frieden zu machen, die westdeutschen Militaristen mit Taten in der sozialistischen Produktion zu schlagen und den aus Westberlin gesteuerten Menschenhandel wirksam zu unterbinden”. Der Appell wird in allen DDR-Zeitungen nachgedruckt. Walter Ulbricht lobt öffentlich den „kämpferischen Elan und die Einsatzbereitschaft” der Kabelwerker. Nun will er sich mit einer großen Rede bedanken.
An diesem Donnerstag, dem 10. August, um 14.00 Uhr, fällt die stattlich gebaute Genossin Margarethe Giersch im Kabelwerk Oberspree dem Staatsratsvorsitzenden um den Hals, drückt ihm erst einen schmatzenden Kuß auf die Wange und dann einen Blumenstrauß in die Hand und sagt: „Nun freuen wir uns besonders, daß Genosse Ulbricht uns heute auf unseren Brief und auf manch andere Fragen Antwort geben will.” Das Empfangskomitee des Betriebes klatscht Beifall. Ulbricht antwortet: „Eure Brigade hat verstanden, was die Glocke geschlagen hat.” Dann schreitet er, geschützt von einem Kordon von Leibwächtern, begleitet von jubelnden Parteigenossen, in die große Werkshalle ein. Ein Rednerpodium ist aufgebaut. Spruchbänder künden vom unaufhaltsamen Fortschritt des Sozialismus:
„Vorwärts, Seite an Seite mit unserem sowjetischen Brudervolk!” Fernsehkameras laufen. 3000 Kabelwerker sind in die Halle beordert worden. Die meisten stehen auf dem Steinboden. Ganz vorne sitzen auf zwölf aufgebauten Stuhlreihen die Funktionäre des Betriebes und Mitglieder des Zentralkomitees der Partei.
Ganz hinten auf einer fünf Meter hohen Kabelrolle hockt Kurt Wismach, 32 Jahre alt, blond, breitschultrig, 1,85 Meter groß. Ein Klotz von einem Mann. Als Drahtzieher an der großen Walzstraße, auf der glühendheiße Metallbänder zu Eisen-, Kupfer- und Aluminiumkabel dünngezogen werden, gehört er mit 1000 Mark im Monat zu den Spitzenverdienern des Betriebes. Heute hat Kurt Wismach Mittagsschicht. Er ist zusammen mit den 25 Kollegen seiner Abteilung froh über die willkommene Arbeitsunterbrechung. Er erzählt: „Keiner von uns wußte genau, was das ganze Staats-Theater in der Werkshalle eigentlich sollte. Natürlich haben wir seit Monaten schon über die Flüchtlingswelle gesprochen. Das war das Thema Nummer eins im ganzen Betrieb. Denn jeden Tag fehlten irgendwo wieder Leute, die in den Westen abgehauen waren. Viele spürten auch, daß sich politisch irgend etwas zusammenbraute. Denn so konnte es nicht weitergehen. Immer häufiger kam es zu Produktions- und Lieferschwierigkeiten.”
Auch Kurt Wismachs Bruder Günter ist schon in den Westen gegangen. Er schreibt jetzt Ansichtskarten aus Duisburg. „Ich war unentschlossen, ob ich ihm in den Westen folgen sollte; drüben lockten manche Freiheiten, die wir nicht hatten: Dort konnte man hinfahren, wohin man wollte, und man konnte sagen, was man dachte. Andererseits war Berlin meine Heimat. Ich war in der DDR und mit der DDR aufgewachsen. Ich verdiente gut und wollte hier meine Verlobte Helga heiraten.” Kurt Wismach sagt, daß er manchmal auch „sauer” gewesen ist auf die Flüchtlinge, die nicht nur den Staat, die Wirtschaft, sondern auch Freunde und Kollegen über Nacht im Stich gelassen hätten. „Besonders die Grenzgänger waren bei uns überall sehr unbeliebt. Die kassierten in Westberlin Westgeld, tauschten das zum Kurs von 1:4 ein und markierten bei uns im Osten den dicken Maxe. Im Westen drückten sie die Löhne, und bei uns kauften sie die Läden leer.”
Kurt Wismach ist kein SED-Mitglied, aber er ist auch kein fanatischer Gegner des Systems. Er ist ein kritischer, manchmal auch aufsässiger junger Mann. Als 24jähriger hat er beim Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 zusammen mit zwei Freunden die rote Sowjetfahne vom Mast geholt – mitten auf dem Ostberliner Alexanderplatz. „Wir haben für mehr Demokratie demonstriert und immer wieder ‚Freie Wahlen, Freie Wahlen’ gerufen.” Nachdem damals der Aufstand von sowjetischen Panzern und DDR-Soldaten zerschlagen worden ist, mußte er sich wie andere Demonstranten zehn Tage lang vor der Polizei und dem Staatssicherheitsdienst verstecken. Erst als die Regierung eine offizielle Amnestie verkündete, kam er aus seinem Unterschlupf und arbeitete weiter.
Walter Ulbricht hat er vorher nicht persönlich gesehen. „Ich kannte ihn aus dem Radio und vom Fernsehen. Er war mir nicht sehr sympathisch, vor allem wegen seiner piepsigen sächsischen Stimme.”
Während Kurt Wismach von seiner hohen Warte auf der Kabeltrommel aus auf die Massenversammlung in der Werkshalle des Kabelwerks Oberspree herabblickt, spricht der Mann mit dieser Stimme ins Mikrofon. Ulbricht sagt: „Liebe Freunde, ich möchte zunächst den Werktätigen des KWO die freundschaftlichen Grüße des Zentralkomitees unserer Partei, des Staatsrates und der Regierung überbringen.” Dann lobt er die „mutige Brigade Otto Krahmann”, feiert den Raumflug des sowjetischen Kosmonauten Titow als Zeichen für die Überlegenheit des Kommunismus gegenüber dem Westen und würdigt die Erklärung des Genossen Chruschtschow zur Berlin-Frage. Dann kommt Walter Ulbricht zum Thema, auf das alle gewartet haben. Er spricht über die Republikflüchtigen, die „die Zeichen der Zeit nicht verstanden” hätten, die „labile Elemente” seien, „willige Opfer für die Verlockungen von westlichen Menschenhändlern”. Ulbricht sagt: „Niemand kann den Sozialismus aufhalten, und niemand kann ihm davonlaufen!” (Das Protokoll vermerkt hier: „Starker Beifall!”) „Auch diejenigen nicht, die unsere Republik verlassen und sich nach dem westdeutschen Staat der Militaristen und des Klerikalismus begeben haben, in der Hoffnung, dort ihr Glück zu finden. Eines Tages werden sie sich sagen: Was war ich für ein Esel, daß ich vor dem Sozialismus davongelaufen und in die Hände der Nato gerannt bin.” („Stürmischer Beifall!”)
Kurt Wismach auf der Kabeltrommel rührt keine Hand.
Walter Ulbricht plädiert eine Stunde lang für den Abschluß des von Chruschtschow vorgeschlagenen separaten Friedensvertrages zwischen der DDR und der Sowjetunion. Er schimpft auf „die Bonner Militaristen und Revanchisten, die wieder einen Krieg gegen die sozialistischen Länder planten”, und wettert gegen die „über Westberlin betriebene Ausplünderung der Deutschen Demokratischen Republik”. Er rechnet vor, „daß uns die offene Grenze nach Westberlin jährlich eine Milliarde Mark und der Menschenraub, der betrieben wird, jährlich 2,5 Milliarden Mark kosten”. Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik müsse ihm zustimmen, daß mit diesen Zuständen endlich Schluß gemacht werden muß.