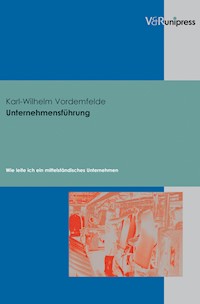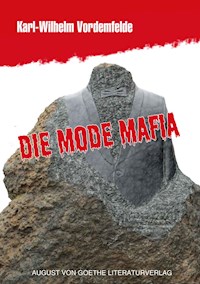
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Literaturverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Wo früher in Deutschland die Nähmaschinen ratterten, befinden sich heute nur noch leere Hallen. Die Welt der Bekleidung und Mode hat sich drastisch verändert, ist zu einem knallharten Geschäft mit mafiösen Strukturen geworden. Und Kleidungsstücke haben sich von einem wertvollen Gut zu einem Wegwerfartikel entwickelt. In den Nachkriegsjahren kam mit dem Neuanfang ein Aufwärtstrend. Das Wirtschaftswunder brachte die Sehnsucht nach schöner Bekleidung zurück. Doch dann folgte die Krise. Aus dem armen, zerstörten Deutschland war ein Industrieland mit gehobener Lohnstruktur geworden. Billige Arbeitskräfte aus dem Ausland mussten angeheuert, die Produktion ins Ausland verlagert werden. Der Exodus führte bis hin nach Fernost. Und das Ende der Spirale ist nicht abzusehen. Haben Bekleidung und Mode noch eine gute Zukunft?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Exodus
Neuanfang
Das Wirtschaftswunder
Spanische Näherinnen in Deutschland
August Vordemfelde
Mäntel aus Italien
Hosen aus Portugal
Anzüge aus Polen
Herrenbekleidung vom Balkan
Kinderbekleidung aus Hongkong
Anzüge aus Ningbo – China als Nähstube der Welt
Bekleidung aus der Türkei
Hemden aus Vietnam
Hemden aus Kambodscha
Shirts aus Bangladesch
Epilog
Karl-Wilhelm Vordemfelde
Die Mode Mafia
Wie Bekleidung von einem begehrten
Produkt zu einem Wegwerfartikel wurde
AUGUST VON GOETHE LITERATURVERLAG
FRANKFURT A.M. • LONDON • NEW YORK
Die neue Literatur, die – in Erinnerung an die Zusammenarbeit Heinrich Heines und Annette von Droste-Hülshoffs mit der Herausgeberin Elise von Hohenhausen – ein Wagnis ist, steht im Mittelpunkt der Verlagsarbeit.Das Lektorat nimmt daher Manuskripte an, um deren Einsendung das gebildete Publikum gebeten wird.
©2021 FRANKFURTER LITERATURVERLAG
Ein Unternehmen der
FRANKFURTER VERLAGSGRUPPE GMBH
Mainstraße 143
D-63065 Offenbach
Tel. 069-40-894-0 ▪ Fax 069-40-894-194
E-Mail [email protected]
Medien- und Buchverlage
DR. VON HÄNSEL-HOHENHAUSEN
seit 1987
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.d-nb.de.
Websites der Verlagshäuser der
Frankfurter Verlagsgruppe:
www.frankfurter-verlagsgruppe.de
www.frankfurter-literaturverlag.de
www.frankfurter-taschenbuchverlag.de
www.public-book-media.de
www.august-goethe-von-literaturverlag.de
www.fouque-verlag.de
www.weimarer-schiller-presse.de
www.deutsche-hochschulschriften.de
www.prinz-von-hohenzollern-emden.de
Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, Speicherung, Sendung und Vervielfältigung in jeder Form, insbesondere Kopieren, Digitalisieren, Smoothing, Komprimierung, Konvertierung in andere Formate, Farbverfremdung sowie Bearbeitung und Übertragung des Werkes oder von Teilen desselben in andere Medien und Speicher sind ohne vorgehende schriftliche Zustimmung des Verlags unzulässig und werden auch strafrechtlich verfolgt.
Lektorat: Dr. Annette Debold
ISBN 978-3-8372-2543-3
Vorwort
Die Welt der Beschaffung von Bekleidung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten drastisch verändert. Gab es früher eine klare Aufgabenverteilung zwischen Industrie und Handel – die eine Seite war für Entwicklung und Produktion zuständig, die andere für den Verkauf an den Verbraucher –, so sind die Grenzen jetzt deutlich verwischt.
Diese Veränderung erleben die Hauptakteure meines Romans, die Mitglieder der Familie Vordemfelde, Elisabeth Brinkmeier und Franz Becker, aus nächster Nähe mit. Sie reisen dabei mit der Bekleidung und Mode um die Welt. Von Deutschland geht es nach Italien und Portugal, von dort aus nach Slowenien und in die Türkei. Schließlich nach Fernost, China, Vietnam, Kambodscha und Bangladesch. Es gibt dabei vieles zu erleben, Schönes und auch weniger Schönes. Die Beschaffung von Bekleidung wird zum knallharten Geschäft mit mafiösen Strukturen, unter denen viele Menschen leiden. Aber der Hunger nach preiswerter Bekleidung ist groß.
In den Roman fließt meine langjährige Erfahrung als Leiter eines mittelständischen Bekleidungsunternehmens ein. Vieles beruht auf erlebten Tatsachen und entspricht in seiner Härte der Wirklichkeit. Andere Teile der Geschichte sind reelle Tatsachen des Geschehens in der Bekleidungsbranche. Eine Reihe der Akteure sind Personen der Zeitgeschichte, andere wiederum von mir erfunden. Insbesondere sind die Dialoge von mir frei erdacht und den Akteuren in den Mund gelegt.
Der Roman soll zum Nachdenken anregen, ob der Kommerz mit Bekleidung und Mode auf dem richtigen Wege ist. Menge und Preis können nicht die einzigen Kriterien bei der Beschaffung von Bekleidung sein. Das Menschliche darf dabei nicht verloren gehen. Die Schönheit und Wertigkeit des Produktes sollte im Vordergrund stehen und uns immer wieder begehrlich machen nach neuen Modeideen.
Ich danke meiner Frau Sabine Vordemfelde, auch Fachfrau aus der Bekleidungsbranche, für die Hilfe beim Schreiben des Romans. Sie war für mich Ratgeberin und Lektorin zugleich und hat die Geschichte aktiv begleitet. Ich danke aber auch den Mitgliedern der Familie Vordemfelde, die mir das Rüstzeug für diesen schönen Beruf gegeben haben. Dank geht ebenso an Berthold Bunge, der mich in das Wissen des Einzelhandels eingeführt hat.
Karl-Wilhelm Vordemfelde
Exodus
„Nein, Lina, den Alten Fritz können wir nicht mitnehmen. Er stand zwar zwanzig Jahre auf meinem Schreibtisch, aber wir haben keinen Platz in unserem Auto für diese große Porzellanfigur. Ich bin jetzt schon traurig, wenn der Alte Fritz nicht mehr bei uns ist. Er war immer ein großes Vorbild für mich, ein echter Herr und vorausschauender Herrscher. Beeile dich bitte jetzt. Der Kanonendonner auf der anderen Seite der Oder wird immer stärker. Wenn wir nicht schnell packen und losfahren, dann überrollt uns der Russe noch. Ob wir das dann überleben, das weiß nur der Herrgott.“
Wilhelm Vordemfelde befand sich mit seiner sechs Jahre jüngeren Schwester Karoline, genannt Lina, in der Dürerstraße in Stettin in seinem schönen Wohnhaus. Er wohnte seit 1916 mit seiner Schwester zusammen in Stettin, die ihm seitdem den Haushalt führte. Beide verband schon seit ihrer Jugend eine innige Geschwisterliebe. Sie waren aufgewachsen mit sechs weiteren Geschwistern, zwei Schwestern und vier Brüdern, in Westerhausen in der Nähe von Osnabrück und hatten ihre Eltern leider früh verloren. Deshalb mussten die Geschwister eng zusammenhalten und sich gegenseitig helfen und erziehen. Für Lina war es selbstverständlich, ihrem Bruder Wilhelm nach Stettin zu folgen und ihm dort den Haushalt zu führen. Beide blieben ihr Leben lang unverheiratet und waren inniglich miteinander verbunden.
Wilhelm hatte das Geschäft mit Textilien bei einem Textileinzelhändler in Düren in Westfalen gelernt. Die Ausbildung dauerte vier Jahre und war eine harte Zeit für ihn. Er wohnte im Haushalt des Unternehmers oben in einer kleinen Stube unter dem Dach, die nicht geheizt war, und aß am Esstisch der Familie mit. Dafür erhielt er andererseits keine Ausbildungsvergütung und musste mit dem wenigen, was er von zu Hause bekam, durchkommen. Aber Wilhelm war intelligent und zäh. Auch verstand er die kaufmännischen Belange dieses Berufes sehr gut, sodass er für seinen Lehrherrn bald ein unverzichtbarer guter Verkäufer war. Bekleidung war sein Leben, und er pflegte auch einen sehr ordentlichen Bekleidungsstil. Seine Anzüge und Hosen waren immer picobello gereinigt und gebügelt. Da er vom Wuchs recht klein war, hängte er sich manchmal wie zu einem Klimmzug an den Schrank, um durch das Hängen etwas an Größe zu gewinnen. Das klappte leider nicht, er blieb klein, wurde aber später ein großer Unternehmer.
Nach seiner Ausbildung im Einzelhandel war er viele Jahre als selbstständiger Handelsvertreter auf Reise gewesen und hatte an jeden, der sie haben wollte, Anzüge verkauft. Die industrielle Herstellung von Anzügen war Anfang des Jahrhunderts erfunden worden. Vorher ging man zum Schneider und ließ sich dort einen Anzug anmessen und schneidern. Wilhelm Vordemfelde verkaufte diese neue Konfektion an den Einzelhandel mit viel Erfolg. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 war er Reisender für eine Firma aus Stettin. Zu seinem zunächst Unglück, dann aber Glück starb sein Chef zwei Jahre später im Jahr 1916 an einem Schlaganfall. Um nicht arbeitslos zu werden, kaufte Wilhelm der Witwe die Firma ab und hatte damit sein eigenes Geschäft. Er nannte die Firma Wilvorst als Abkürzung seines Namens und der Stadt, in der er wohnte, Wilhelm Vordemfelde, Stettin.
Da sein Bruder August Vordemfelde bereits vier Jahre vorher eine Firma in Aschaffenburg eröffnet hatte, telegrafierte er seinem Bruder nach dem Kauf der Firma: „Hallo August, jetzt habe ich auch eine Firma für die Herstellung von Anzügen. Ich mache Dir jetzt Konkurrenz. Meine Anzüge werden besser sein als Deine, darauf kannst du wetten.“ In den kommenden neunundzwanzig Jahren baute Wilhelm dann aus kleinen Anfängen einen großen Betrieb in Stettin auf mit mehr als 1250 Beschäftigten und wurde einer der größten Konfektionäre für Anzüge in ganz Deutschland.
Lina war immer an seiner Seite und unterstützte ihn nicht nur im Haushalt, sondern auch bei allen wichtigen Entscheidungen, die während ihrer Zeit in Stettin getroffen werden mussten. Ein Meilenstein der Jahre in Stettin war für Wilhelm der Bau seiner eigenen Fabrik im Jahre 1930. Der Betrieb war nach damaliger Vorstellung der modernste Fertigungsbetrieb für Herrenbekleidung in Deutschland, und von dort aus wurden Anzüge nach ganz Deutschland und in alle Welt verkauft.
Bis dahin hatte man einen sogenannten Verlegerbetrieb. Man entwarf zwar die Kollektionen und verkaufte Anzüge und Sakkos an seine Kunden. Nach dem Zuschnitt wurde die Rohware mit den notwendigen Zutaten aber an Zwischenmeister weitergereicht, die die eigentliche Produktion vornahmen. Wenn die Ware fertig war, kam sie zurück, wurde kontrolliert und an die Kunden versandt. Jetzt hatte Wilhelm jedoch seinen eigenen Betrieb und die Produktion damit unter eigener Kontrolle. Es wurde zugeschnitten, genäht und gebügelt in den eigenen Räumlichkeiten. Dadurch wurde die Qualität wesentlich besser, denn sie wurde von erfahrenen Meistern kontrolliert, die ihrerseits dem Chef berichteten. Man konnte auch schneller auf kurzfristige Marktentwicklungen reagieren und rasch neue modische Trends aufgreifen.
Lina riet Wilhelm auch, das schöne Wohnhaus in der Dürerstraße zu bauen, in dem sie und Wilhelm viele Jahre sehr glücklich waren. Sie waren Geschwister, aber sie lebten zusammen wie Eheleute und liebten sich sehr. Sie pflegten auch einen gediegenen Haushalt und hatten viele Gäste aus der Kaufmannschaft und auch der Politik. Wilhelm war aber ein sehr gläubiger Mensch und pflegte gerade zu den Kirchen von Stettin einen überaus intensiven Kontakt. Jeden Sonntag gingen Lina und Wilhelm in den Gottesdienst, und Wilhelm stiftete auch ein großes, buntes Fenster für die Stadtkirche in Stettin.
Jetzt Ende Februar 1945 war aber alles anders. Adolf Hitler hatte 1939 Deutschland und die Deutschen in einen großen vaterländischen Krieg geführt. Nach anfänglichen Erfolgen in Polen und Frankreich wurde der Krieg immer mehr zu einer Materialschlacht und einem mörderischen Unterfangen. Viele redliche Menschen, die zu Anfang des Krieges noch zu Adolf Hitler hielten, verloren in den Kriegsgeschehen ihr Hab und Gut und viele Soldaten und Zivilisten auch ihr Leben. Das Kriegsglück wendete sich zuungunsten Deutschlands, und im Frühjahr 1945 war der Krieg nahezu verloren. Die Russen standen mit ihrer Artillerie und Panzern vor Stettin auf der anderen Seite der Oder und wollten demnächst übersetzen, um Stettin und später Berlin einzunehmen.
Wilhelm und Lina standen in ihrem Wohnzimmer im Haus in der Dürerstraße und hatten entschieden, dass sie Stettin so schnell wie möglich verlassen wollten. Alles, was sie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten aufgebaut hatten, würde verloren sein. Der schöne Betrieb würde zerstört werden oder an andere Eigentümer übergehen, und sie beide, wie auch die vielen Mitarbeiter von Wilvorst, hatten keine Zukunftsperspektive.
Glücklicherweise hatte Wilhelm trotz der Kriegsjahre sich als Unternehmer seinen Dienstwagen erhalten können. Der Horch stand vor der Tür und sollte vom getreuen Fahrer Tiefenbach gefahren werden und sie beide, Wilhelm und Lina, in den Westen bringen. Mit ihnen wollten viele Mitarbeiter des Unternehmens ebenfalls in den Westen flüchten. Alle hatten Angst vor den Russen, die schon bei ihrem Einmarsch in Ostpreußen und später in Ostpommern viele schreckliche Dinge begangen hatten. Keine Frau fühlte sich mehr sicher, und schaurige Geschichten wurden von Mund zu Mund weitergetragen.
Was konnten Wilhelm und Lina von ihrem Hausstand in der Dürerstraße in dem kleinen Auto mitnehmen? Der Alte Fritz war es jedenfalls nicht. Die Porzellanfigur war fast einen Dreiviertelmeter groß und würde die gefahrvolle, lange Reise in den Westen sicher nicht heil überstehen. Man nahm das Nötigste mit, insbesondere warme Winterbekleidung, Mäntel, Pullover und gestrickte Socken. Alles, was warm hielt, wurde mitgenommen, denn der Winter 1945 war kalt und abweisend. Es gab viel Schnee, und die Straßen waren vereist. Wilhelm nahm aber auch die wichtigsten Unterlagen aus der Firma mit, wie den Handelsregister-Auszug und die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre und alle wichtigen Verträge, die man eventuell auch später wieder gebrauchen könnte. Korrekt wie er war, hatte er auch alle Türen der Firma sorgfältig verschlossen. Das Schlüsselbund nahm er mit als Andenken an seine Firma. Dass die Russen dann jede Tür aufbrechen würden, war ihm offensichtlich egal.
Und dann war es so weit. Tiefenbach ließ den Motor des guten Horch an. Wilhelm und Lina nahmen auf der Rücksitzbank Platz, guckten ein letztes Mal zu ihrem schönen Haus in der Dürerstraße und fuhren los. Es ging zunächst zur Firma in die Turnerstraße. Dort warteten fast fünfzig Mitarbeiter teilweise mit Autos und Motorrädern, aber zum großen Teil mit Pferdefuhrwerken auf ihren Chef, und nachdem man sich über die Route geeinigt hatte, fuhr der große Treck der Wilvorster aus der Stadt hinaus gen Westen. Ein Wiedersehen in Stettin sollte es für alle nicht mehr geben.
Die Fahrt war gefahrvoll. Der Winter 1945 war hart, kalt und unerbittlich. Die Straßen waren verschneit und schlecht zu befahren. Außerdem waren nicht nur die Wilvorster unterwegs, sondern Hunderttausende versuchten mit Hab und Gut aus dem Osten Deutschlands in den Westen zu gelangen. Viele waren schon aus dem fernen Ostpreußen wochenlang unterwegs und hatten teilweise schlimme Erfahrungen machen müssen. Viele Menschen und gerade Kinder litten sehr unter der Kälte, hatten wenig zu essen, und überall an den Wegen lagen verhungerte Leichen – niemand kümmerte sich darum, sie wegzubringen und zu begraben. Der Feind hatte außerdem die absolute Lufthoheit. Immer wieder flogen Jagdflugzeuge der Russen und später auch der Amerikaner über sie hinweg und beschossen mit ihren Bordkanonen die armen Menschen, die über die kalten Straßen in den Westen flüchteten.
Wilhelm und Lina kamen aber dennoch ganz gut voran und waren nach drei Tagen in Malchow in Mecklenburg angekommen. Dort wurde Zwischenstation gemacht und der Treck neu geordnet. Sehr intensiv kümmerten sich die Prokuristen Wels und Hecker um die armen Mitarbeiter, die teilweise zu Fuß den beschwerlichen Weg machen mussten. Glücklicherweise hatten sie kaum Verluste in diesen Tagen gehabt, und auch die Versorgungssituation mit Lebensmitteln war dank guter Planung in Ordnung. Keiner musste hungern, und warme Kleidung war in ausreichender Menge vorhanden.
Nach einigen Tagen brach man dann wieder auf und versuchte, in einer weiteren Etappe die Elbe zu erreichen. Man erreichte diesen großen deutschen Fluss nach fünf Tagen und setzte über die noch vorhandene Brücke auf die Westseite der Elbe über. Dort fühlte man sich vor den Russen sicher. Man hatte gehört, dass der Westen von den Amerikanern gehalten werden sollte und die Russen nur bis zur Elbe vorrücken sollten. Man baute sich in einem verlassenen Bauernhof ein eigenes Wilvorster Camp auf und schickte den Prokuristen Hecker mit dem Fahrrad auf Erkundungssuche.
Wilhelm hatte in Northeim in Südniedersachsen einen langjährigen Freund. Dem hatte er in den letzten Kriegsmonaten Rohware und Maschinen zugeschickt. Hecker hatte den Auftrag, diese Ware und die Maschinen aufzuspüren. Nach mehreren Tagen auf dem Fahrrad erreichte Hecker Northeim und fand tatsächlich die Rohware und die Maschinen in einem guten Zustand bei der Firma Streichert wieder. Die deutsche Reichsbahn hatte Anfang 1945 noch erstaunlich gut funktioniert, und die Waggons waren unbeschadet angekommen.
Damit konnte man wieder anfangen. Hecker schickte Wilhelm eine Depesche an die Elbe mit der Bitte, baldmöglichst nach Northeim zu kommen. Wilhelm und Lina erhielten freudig diese Nachricht, und der gesamte Wilvorsttreck machte sich auf, so schnell wie möglich nach Northeim in das südliche Niedersachsen zu gelangen.
Der Treck erreichte Northeim erst nach einigen Wochen. Die Reise verzögerte sich, weil zwischenzeitlich die letzten Kriegshandlungen zwischen den verbliebenen deutschen Truppen und den Alliierten erbittert geführt wurden. Überall wurde geschossen und ausdauernd gekämpft. Gerade die letzten SS-Kampfverbände wollten nicht aufgeben und kämpften bis zur letzten Patrone, denn sie hatten in Gefangenschaft nichts Gutes zu erwarten. Viele von ihnen wurden nach Kriegsende von den Alliierten ohne Verfahren standrechtlich erschossen. Sie hatten alle ihre Blutgruppe als Tattoo in der Achselhöhle und waren deshalb sofort zu erkennen.
Dann war man aber in Northeim angekommen, und Wilhelm konnte in Verhandlungen mit der neuen Stadtverwaltung, die Nazis waren inzwischen verschwunden, erreichen, dass seine Wilvorst-Mannschaft bei dem Einzelhändler Denzler untergebracht wurde. Die Firma Denzler kannte Wilhelm Vordemfelde schon aus der Vorkriegszeit. Sie war über viele Jahre Kunde von Wilvorst gewesen. Denzler hatte sein Geschäft in der Breiten Straße im Zentrum von Northeim. Im hinteren Teil des Gebäudes befand sich ein Saal, in dem die Leute von Wilvorst die zwischenzeitlich angekommenen Maschinen aufbauen konnten. Weil man ja nichts anderes zu tun hatte, fing man wieder an zu nähen und zu bügeln. Das konnte man gut, und Arbeit brachte die Leute auf andere Gedanken.
Der Beginn in Northeim war schwierig. Vor der Währungsreform 1948 waren es Jahre des Mangels. Man hatte eigentlich von allem zu wenig. Es waren zu wenig Stoffe vorhanden, die Zutaten fehlten. Teilweise wurden für neue Anzüge und Mäntel Wehrmachtsstoffe verwendet, die man von irgendwoher aus dubiosen Quellen erstanden hatte. Manchmal wendete man auch einen alten Mantel und machte daraus ein neues Stück. Aber auch andere Dinge des täglichen Lebens machten die Arbeit in diesen Jahren schwer. Sowar es in der Produktionshalle von Denzler im Winter einfach zu kalt. Es wurde geheizt mit Kohlen, die man für teure Tauschware auf dem Schwarzmarkt erkungeln musste. Jedes Ei und jede Kartoffel musste irgendwie erkungelt werden, und Wilhelm brauchte viel Zeit, um für sich und seine Leute das Nötigste zu beschaffen.
Aber alle bissen die Zähne zusammen und waren froh, dem Russen entkommen zu sein. Stettin war verloren, doch hier war man wenigstens mit seinen Kollegen in Sicherheit angekommen. Wilhelm und Lina waren weit über sechzig Jahre alt, Wilhelm sogar schon siebenundsechzig, und hatten keine Altersversorgung. Sie hatten gar keine andere Möglichkeit, als weiterzumachen und sich um das Wohl ihrer treuen Mitarbeiter zu kümmern. Die dankten ihnen das aber auch von ganzem Herzen und lobten ihren guten Chef immer wieder.
Das Kapital von Wilhelm war sein Wissen und seine Beziehungen zu den Kunden in ganz Deutschland. Geld hingegen war Mangelware. Von Stettin aus hatte man vor dem Krieg Anzüge nach ganz Deutschland, insbesondere in das Rheinland und das Ruhrgebiet verkauft und hatte dort viele gute Kunden, die jetzt nach Ende des Krieges auch versuchten aus den Ruinen wiederaufzuerstehen. Auf diese Weise schlug sich Wilhelm mit seiner treuen Mannschaft durch und entwickelte neue Kollektionen und verkaufte sie dank seiner guten Beziehungen an die alten treuen Kunden. Der Bedarf an guter Bekleidung war groß. Im Krieg war doch vieles kaputtgegangen und musste ersetzt werden. Aber es herrschte überall ein großer Mangel, insbesondere jedoch war die alte Reichsmark nach dem verlorenen Krieg nichts mehr wert.
Neuanfang
„Ich danke dem Herrgott, wenn wir dieses Darlehen bekommen. Damit können wir wieder anfangen, und es geht wieder bergauf.“
Wilhelm Vordemfelde fuhr mit seinem Neffen Friedrich-Wilhelm Vordemfelde mit dem Horch, den er schon in Stettin hatte, auf der Bundesstraße drei, die Autobahn nach Hannover gab es noch nicht, um sich dort bei der Norddeutschen Landesbank um ein Darlehen für den Neubau seines Betriebes in Northeim zu bewerben. Es sollte neu gebaut werden, und dafür brauchte er ein Darlehen in Höhe von 250.000,– DM. Die Währungsreform war im Juni 1948 gerade durchgeführt worden, und das Geld war wieder werthaltig. Mit diesem Geld konnte er ein modernes Firmengebäude bauen, zwar nicht so groß wie in Stettin, aber ausreichend für immerhin dreihundert bis fünfhundert Mitarbeiter, die er in den nächsten Monaten und Jahren einstellen wollte.
Wilhelm war mittlerweile siebzig Jahre alt und lebte auch in Northeim mit seiner Schwester Karoline, die fünf Jahre jünger war als er, zusammen. Er war asketisch und agil und hatte Mut und Kraft, um trotz seines fortgeschrittenen Alters wieder durchzustarten. An seiner Seite stand jetzt sein fünfundzwanzig Jahre alter Neffe Friedrich-Wilhelm Vordemfelde, der als Soldat vier Jahre im Krieg an allen Fronten gekämpft hatte und nach dem Ausscheiden aus der Wehrmacht glücklicherweise keine Gefangenschaft erleben musste. In den Jahren 1945–48 hatte Friedrich-Wilhelm eine Ausbildung zum Bekleidungstechniker in Mönchengladbach gemacht und im Einzelhandel verkaufen gelernt.
Beide fuhren mit großer Sorge nach Hannover, denn die Vergabe des Darlehens war in keinem Falle sicher. Wilhelm hatte zwar einen guten Namen und auch gute Beziehungen, aber sein Vermögen hatte er in Stettin gelassen, und davon war durch die Flucht nichts übrig geblieben. Im Gegenteil, einen Lastenausgleich hatte es noch nicht gegeben, und für das Verlorene gab der Staat ihm kein Geld. In Hannover wurden sie dann vorstellig bei der Norddeutschen Landesbank, die sich drei Jahre nach dem Krieg bereits etabliert hatte. Die Banker, gekleidet in dunkelblaue, eleganteAnzüge, als hätte es den Krieg nie gegeben, empfingen sie mit großer Zurückhaltung und machten ihnen zunächst die Hölle heiß. „Herr Vordemfelde, haben Sie keine Sicherheiten? Auf Ihren guten Namen allein können wir Ihnen kein Geld geben.“ Aber Wilhelm argumentierte mit Engelszungen, verwies auf seine vielfältigen Kontakte zu den Kunden in ganz Deutschland und erwähnte insbesondere auch die Mitarbeiter in Northeim, die ihm anvertraut waren. Außerdem machte der Junior einen guten Eindruck als durch den Krieg erfahrener junger Mann mit viel Mut und Kraft für die Zukunft.
Das machte bei den honorigen Bankern einen überzeugenden Eindruck, und am Ende des langen Gespräches erhielt Wilhelm sein Darlehen Höhe von 250.000,– DM. Damit konnte er in Northeim das Betriebsgebäude von Wilvorst neu errichten. Er fing schon in der nächsten Woche mit den Architekten an zu planen, und das Firmengebäude mit Verwaltung und großer Produktionshalle für Zuschnitt, Näherei und Bügelei sollte nach kurzer Bauzeit innerhalb von neun Monaten bereits fertig sein. Im Juni 1949 feierten sie mit großer Freude das Richtfest. Wilhelm war mit einem Kran auf das Dach gehoben worden und sprach von dort aus eine denkwürdige Ansprache zu diesem besonderen Anlass.
„Wir haben das Dritte Reich überstanden, und wir haben auch den Krieg hinter uns gelassen. Leider ist Stettin verloren, doch wir sind hier in Northeim in Südniedersachsen von der Bevölkerung und den Honoratioren der Stadt herzlich aufgenommen worden. Die Mitarbeiter von Wilvorst, meine Schwester Karoline und ich danken allen, die uns bei dem Neubeginn geholfen haben. Wie ich es auf der Fahrt nach Hannover zur Norddeutschen Landesbank gelobt habe, danke ich dem Herrgott ganz herzlich für seine Hilfe bei der Flucht und für das Darlehen, das uns ermöglicht, den Betrieb hier in Northeim wiederaufzubauen. Nach der schweren Zeit wünsche ich uns allen einen langen Frieden und viel Erfolg in den neuen Räumlichkeiten von Wilvorst.“ Und dann schmetterte er sein Schnapsglas, das mit dem guten Korn vom benachbarten Hardenberg gefühlt war, nach einem kräftigen Zug in die Baustelle, und alle Anwesenden brachen in Jubel aus. Es war ein ausgelassener, fröhlicher Tag nach all den Schwierigkeiten der vergangenen Jahre.
Wilvorst entwickelte sich am Standort Northeim gut, und schon nach wenigen Jahren war der Name Wilvorst wieder in ganz Deutschland mit hochwertigen Produkten, Anzügen, Sakkos und Mänteln, bekannt und begehrt. Viele namhafte Einzelhandelsgeschäfte führten das Produkt, und es ging aufwärts. Bereits 1955 hatte Wilvorst wieder fünfhundert Mitarbeiter, die fleißig Anzüge, Sakkos und Mäntel produzierten. Maßgeblich für den Erfolg war die Ruhe und Gelassenheit des Seniors Wilhelm Vordemfelde, der bereits über vierzig Jahre Erfahrung als Unternehmer verfügte und alle notwendigen Entscheidungen sicher traf. Wichtig war auch seine Bekanntheit im Kollegenkreis und bei den vielen Einzelhändlern. Der gute Name und die gute Qualität brachten immer wieder gute Verkäufe und neue Aufträge.
Ganz wichtig für den Erfolg in dieser Nachkriegszeit war aber auch das Engagement des Juniors Friedrich-Wilhelm Vordemfelde. Als Soldat zuletzt im Rang eines Leutnants, hatte er schon an allen Fronten seinen Mann gestanden und krempelte jetzt als Jungunternehmer die Ärmel hoch; er trieb alles aktiv voran mit vielen neuen Ideen und mit außergewöhnlich hohem Engagement. Sie waren ein gutes Team, Wilhelm als Senior und erfahrener Unternehmer und Friedrich-Wilhelm als aktiver frischer Junior mit Saft und Kraft, obwohl Friedrich-Wilhelm im letzten Kriegsjahr schwer verwundet wurde und durch eine Handgranate seinen rechten Lungenflügel verloren hatte.
Wichtig überdies war aber, dass die Produktion in Deutschland durch niedrige Lohnkosten nach dem verlorenen Weltkrieg auch preislich sehr konkurrenzfähig war. Die Arbeiter in den Fabriken hatten den Krieg erlebt und häufig viele schreckliche Erlebnisse gehabt. Sie waren froh, Arbeit zu haben von einem Unternehmer, der wusste, was er tat, und sie waren fleißig, arbeitsam und wollten die Vergangenheit vergessen. Ein ausgelernter Bügler bekam 1950 ein Stundenlohn von 1,30 DM und musste fünfundvierzig Stunden in der Woche arbeiten. Einen Betriebsrat gab es nicht, und das Wirtschaftswunder war noch weit entfernt.
Und dann kam ich ins Spiel, der erste und einzige Sohn von Friedrich-Wilhelm und seiner Frau Elisabeth, Karl-Wilhelm Vordemfelde. Sie hatten schon 1948 geheiratet, aber Kinder wollten partout nicht kommen. Erst 1952, am 29. Februar, dem Schalttag, wurde die Tochter Karin geboren, und dann genau ein Jahr später, am 28. Februar 1953, ich, Karl-Wilhelm, als der ersehnte Stammhalter. Damit erblickte die nächste Generation der Vordemfeldes das Licht der Welt, und die Reihe der Konfektionäre aus dieser Familie sollte damit fortgesetzt werden. Das dauerte aber dann noch viele Jahre, bis es so weit war.
Das Wirtschaftswunder
Nicht nur Wilvorst entwickelte sich in diesen ersten Nachkriegsjahren gut. Die ganze deutsche Wirtschaft in den drei Westzonen hatte eine rasante Entwicklung nach oben. In allen Wirtschaftsbereichen herrschte ein enormer Nachholbedarf. Aber auch in der Bekleidungsbranche war Aufbruchstimmung. Im Krieg und auch schon in der Vorkriegszeit mussten viele Menschen mit knappen Mitteln auskommen und hatten nicht so viel Geld für Bekleidung. Nach den 20er-Jahren, in denen schon eine gute modische Entwicklung vorhanden gewesen, war jetzt wieder eine Sehnsucht vorhanden nach schöner Bekleidung.
Die Innenstädte waren wiederbelebt. Man konnte mit der neuen Deutschen Mark gute Ware kaufen, und die Einzelhändler eröffneten an allen Straßen und Ecken in den Städten ihre Geschäfte. Und die Ware wurde von deutschen Herstellern produziert und in die Geschäfte geliefert. Das galt sowohl für die Damenmode wie auch für den Bereich der Herrenmode. Nicht nur in Northeim bei Wilvorst, sondern überall in der neuen deutschen Republik wurden Betriebe für Bekleidungsherstellung gegründet, und schon nach wenigen Jahren gab es allein in der Herrenmodebranche Hunderte Betriebe mit Hunderttausenden Beschäftigten.