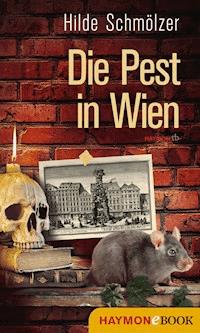
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
DIE PEST: EINE SPANNENDE KULTURGESCHICHTE Mit "Die Pest in Wien" liefert Hilde Schmölzer eine spannende Kulturgeschichte zum Staunen und Kopfschütteln: Fundiert und fesselnd erzählt sie von den großen Pestzeiten in Wien vom Mittelalter bis zur Neuzeit und erinnert an die katastrophalen Auswirkungen, die die Seuche auf Österreich und ganz Europa hatte. Zeugnis bieten die schriftlichen Aufzeichnungen von Mönchen, Schriftstellern und Gelehrten, die eindrucksvoll den Schrecken und die Angst der Menschen vor der unheilbringenden Krankheit dokumentieren: Der "Schwarze Tod" war in ihrer Vorstellung ein böser Mann auf wildem Pferd, auf schauerlichem Schiff oder auf gespenstischer Barke. ABERGLAUBE UND RELIGIÖSER FANATISMUS HATTEN HOCHKONJUNKTUR Dieser Aberglaube kam nicht von ungefähr, standen doch auch die Ärzte der Seuche mehr oder weniger hilflos gegenüber und konnten der Pest keinen Einhalt gebieten. So wurden der Zorn Gottes und die Konstellation der Gestirne für die Pest verantwortlich gemacht und als sicherstes Gegenmittel die Flucht empfohlen. Den einzigen Trost bot lediglich der Glaube, und ein religiöser Fanatismus führte zu Geißlerzügen. Die Judenverfolgungen, die im Gefolge der Pest, aber auch unabhängig davon auftraten, gehören zu den düstersten Kapiteln nicht nur des Mittelalters. FATALISMUS UND LEICHTSINN ALS TÖDLICHE LEBENSEINSTELLUNG Die Zustände blieben bis ins neuzeitliche Wien mittelalterlich: Unter Leopold I. wurden zwar rauschende Feste gefeiert, aber unter Seide und Taft nisteten die für die Übertragung der Krankheit hauptsächlich verantwortlichen Flöhe. Und während Hofprediger Abraham a Sancta Clara noch immer frommen Lebenswandel als beste Vorbeugung empfahl, war ausreichende Hygiene selbst bei den Reichen und erst recht bei den Armen unbekannt. Auch Fatalismus und Leichtsinn, wie sie dem Wiener seit den Tagen des lieben Augustin zugeschrieben werden, haben wenig zur Entschärfung der Zustände beigetragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hilde Schmölzer
Die Pest in Wien
Hilde Schmölzer
Die Pest in Wien
Der Schwarze Tod
Der »Schwarze Tod« war ein böser Mann auf wildem Pferd, auf unheildrohendem Schiff, auf gespenstischer Barke. Dann wurde er zum bleichen Pestmännlein, das schnell und leise seine schreckliche Arbeit verrichtete, zur Pestjungfrau, aus deren Händen das Gift rieselte, zum umherschleichenden blinden Weib und zur bläulichen Flamme, die sich von den Lippen der Sterbenden und Toten aus entwickelte, um auf verderblichem Flug das Land zu verseuchen.
Der fantastischen Vorstellungskraft des Mittelalters waren keine Grenzen gesetzt, alles schien möglich, alles schien wahrhaft zu sein. Die Menschheit, durch den Ausbruch der Seuche verängstigt und verwirrt und der furchtbaren Krankheit hilflos ausgeliefert, suchte Erklärungen im Wunder- und Mysterienglauben, im geheimnisvollen Walten der Natur, im unerbittlichen Strafgericht Gottes. Himmelserscheinungen kündigten das Übel an: Ein Komet von furchterregender Schwärze soll die Pest des 14. Jahrhunderts angezeigt haben, eine unheilbringende Konjunktion von Saturn, Jupiter und Mars unter dem 14. Grad des Wassermannes vorangegangen sein. Es wird von einer feurigen Kugel berichtet, die drohend über der Stadt geschwebt haben soll, bis ein glücklicherweise gerade zu diesem Zeitpunkt anwesender Bischof sie mittels Gebet zur Auflösung brachte. Aber weitere böse Vorzeichen sorgten für Angst und Schrecken: Schwarze, große Falter, riesige Spinnen, Schlangen, Mäuse, Würmer und Käfer begannen in ungeheurer Vielfalt und Zahl die Erde zu bevölkern, Vögel wurden unruhig, Leichenbegängnisse zeigten sich in den Wolken, sogar Blutstropfen und blutige Kreuze fielen vom Himmel und schwangere Weiber kamen mit Missgeburten nieder.
Tatsächlich war das 14. Jahrhundert reich an Katastrophen jeder Art. Mehrmals fielen in den Jahren vor der großen Pest riesige Schwärme von Wanderheuschrecken aus dem Osten ein, eine Tagebuchaufzeichnung Karls IV. beschreibt die Verwüstungen, die sie in Pulkau angerichtet haben, und die Zwettler Chronik meint, dass die Sonne von ihnen verdunkelt worden sei. Sie sollen fünf Zentimeter lang gewesen sein, sechs Flügel gehabt haben und Zähne, »die da glänzten wie Edelsteine«. Bei Tagesanbruch erhoben sie sich, fielen um etwa neun Uhr auf die Felder und fraßen alles kahl. Häufig wird von dem ungeheuren Gestank berichtet, der von den oft fußhoch auf den Feldern liegenden toten und verwesenden Tieren ausging. Die Ursache der Pest, so glaubten viele Ärzte, sei in diesem Gestank zu suchen.
Rund ein Jahrzehnt später, 1348, verheerten Erdbeben ganz Europa; in Österreich fanden sie einen Höhepunkt mit dem Sturz der Villacher Alpe, die tausend Tote unter sich begrub: »nach weynachten geschah ain grösser erdpidem in carnten in ainer stadt hayst villach, die zerfiel ueber all, die ringmauer leit noch heut des tags im graben, es geschah an pauli bekherung (25. Jänner) und was ain schöner tag, es zerfielen sich auch 10 gueter vesten, sich zerriss ein perg von einander und fiel in ein tieffen see (Bergrutsch in den Ossiacher See), es ertrencht der see wol 7 dörfer …«, heißt es in der Klosterneuburger Chronik. In dem nun folgenden, von Missernten und Hungersnöten begleiteten Chaos machte die Pest unter den geschwächten Menschen leichte Beute.
Es war nicht das erste Mal, dass sie Europa heimsuchte. Zwar dürfte es sich bei der »Pest des Thukydides«, der bereits 430 v. Chr. Perikles mit Tausenden von Athenern zum Opfer fiel, um eine Pockenepidemie gehandelt haben. Ebenso werden hinter der »Pest des Antonin« 200 n. Chr. Flecktyphus oder Pocken vermutet. Hingegen hat es sich bei der »Pest des Justinian«, die im sechsten nachchristlichen Jahrhundert das gesamte Abendland verwüstete, zweifellos um eine echte Pestepidemie gehandelt. Ob es von diesem Zeitpunkt bis zum »Schwarzen Tod« des 14. Jahrhunderts Pestepidemien in Europa gegeben hat, bleibt umstritten. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Seuche des Jahres 1187 die Pest gewesen. Als bewiesen gilt auch eine Pestepidemie in den Jahren 1329–32 in Italien, aus der uns die Legende des Pestheiligen Rochus überliefert ist. Bei den übrigen, mehrmals aufflackernden Seuchen hat es sich jedoch wahrscheinlich um andere Krankheiten gehandelt. Sicher ist, dass keine der vorangegangenen Epidemien das Ausmaß jener der Jahre 1348 bis 1350 erreicht hat, in der selbst nach jüngeren Schätzungen etwa 25 Millionen Menschen, das ist etwa ein Viertel der damaligen Bevölkerung Europas, den Tod gefunden haben.
Sie war durch genuesische Schiffe von der Stadt Feodosia auf der Krim, einem genuesischen und venezianischen Handelsstützpunkt, nach Italien eingeschleppt worden. Und zwar waren die italienischen Handelsherrn – wie so oft in der Geschichte der Pest – von den Völkern des Ostens, in diesem Fall Tataren und Sarazenen, angesteckt worden, die ihre Stadt belagerten. Nach bereits dreijähriger Belagerung und kurz vor der Kapitulation brach die Seuche im feindlichen Heer aus und trieb die Tataren in die Flucht. Aber auch die Italiener flohen panikartig in ihr Heimatland, nachdem sich die ersten Opfer innerhalb der Mauern der Stadt gezeigt hatten. Doch der Schwarze Tod fuhr mit auf ihren Schiffen und verseuchte, von Italien ausgehend, ganz Europa.
Von Venedig drang er entlang der Handelsstraße nach Trient und über den Brenner ins Inntal. 1348/49 wütete er in der Steiermark und in Kärnten. Konrad von Megenberg, der Ende 1348 in Regensburg sein »Buch der Natur« geschrieben hat, die älteste in deutscher Sprache verfasste Naturgeschichte, erwähnt die Pest für 1348 in Südfrankreich, Italien und Tirol, »es stürben auch der selben jars (1348) gar vil laut in dem geperg (Tirol) und hie anzen (vor dem Gebirge in Bayern) in etsleichen steten, aber gar vil volkes starb in den nächsten jar danach in der stat ze Wienne in Oesterreich.«
Nach Wien und Niederösterreich ist die Pest zweifellos von Ungarn eingeschleppt worden, wo sie bereits im Jänner und Februar 1349 bezeugt ist. Von Ostern bis Michaelis (Ende September) wütete sie dann in Wien. »… an unser frawen tag zu der Liechtmess, do wart der sterb in allem Oesterreich gar gross, und doch besunder da ze Wienn, also daz man alle leut, arm und reich, muest legen in den gotsakker ze Sand Cholman. Und stürben so viel leut, an einem tag zweliff hundert leich …« Noch heute steigt Schrecken aus diesem Bericht in einer vergessenen Sprache auf, steigt wie eine ferne Berührung mittelalterlicher Denkweise herauf über die Jahrhunderte, lässt fragen nach dem Wie, dem Woher.
Wie war es damals, in der mittelalterlichen Stadt »ze Wienne«, über die uns spärlich, aber dennoch Chroniken, Aufzeichnungen, Erlässe und nicht zuletzt wunderbare Kunstschätze Auskunft geben? Was hat sich damals abgespielt in dieser Stadt an der Schwelle zum Spätmittelalter, als die Gotik ihre ersten bedeutenden Denkmäler schuf und Wien eine beachtete Handelsstadt geworden war?
Die »stat ze Wienne«
Schmal war das Gassengewirr vor über 600 Jahren, eng und dunkel war die Stadt. Nichts von den prächtigen Palästen der Barockzeit, nicht einmal jene stattlichen Häuser aus Stein mit Glasfenstern, Malereien und eisernen Türen, die Aeneas Silvius de Piccolomini, Kanzleisekretär Kaiser Friedrichs III. und späterer Papst Pius II., rund ein Jahrhundert danach so lobend erwähnt, werden damals allzu häufig gewesen sein. Die Häuser waren vielfach noch ebenerdig, klein, zumeist aus Holz, mit Stroh oder Schindeln gedeckt. Bei einstöckigen Häusern sprang das obere Stockwerk oft vor, um die Wohnfläche zu vergrößern, was dazu beitrug, die dumpfen, lichtlosen Gassen noch mehr zu verengen. Die Einrichtung war selbst bei Wohlhabenden gegen Mitte des 14. Jahrhunderts eher spärlich, Gerät und Ausstattung dürftig, die Räume schmucklos – erst etliche Jahrzehnte später wurden sie mit Kalkfarben ausgemalt. Der Kamin begann erst gegen Ende des Jahrhunderts eine Attraktion zu werden, die Einraumhäuser wurden meist immer noch mittels offener Feuerstelle in der »Stube« beheizt, wobei der Rauch nicht nur durch Dach- und Fensterluken, sondern auch durch die Ritzen in den Wänden entweichen musste, was insofern gut möglich war, als die Bauweise genügend Gelegenheit dazu bot. Glasfenster hat es höchstens in den Kirchen gegeben, Bürger und auch Adelige halfen sich mit Leinen und Papier zur Bespannung, die man in einem umständlichen Verfahren zu präparieren wusste. Eine weitere Möglichkeit bestand darin, die Fensteröffnungen mit einer dünn gegerbten Haut, dem »sliem«, zu verschließen.
Auch von einer Straßenpflasterung war damals noch nicht viel zu bemerken. Die Wagen fuhren in so tiefen Gleisen, dass kaum einer dem anderen ausweichen konnte. Der Spaziergänger jedoch, sofern er das abenteuerliche Erlebnis eines Stadtbummels auf sich nehmen wollte, versank knöcheltief in Schlamm und Kot – die erste Pflasterrechnung geht auf das Jahr 1368 zurück. Um seine modischen Schnabelschuhe zu schützen, zog er daher zum Einkaufen auf dem Markt hölzerne Überschuhe, sogenannte »Trippen«, an. Viel lieber allerdings blieb er in seinem Haus, das vor allem in frühen Zeiten die Funktion einer Festung zu erfüllen hatte und mitsamt den Schuppen der Arbeitsleute, Stallungen und Scheunen mit einer Mauer oder Umplankung versehen war – wobei jeder Hausfriedensbruch streng geahndet wurde. Ausflüge im Stadtbereich waren jedoch nicht nur unbequem, sie waren häufig auch mit allerhand Gefahren verbunden. Raufhändel waren an der Tagesordnung, festliche Zusammenkünfte von Totschlag und Mord begleitet. Über die Gefährdungen im Mittelalter geben die Testamentbücher Auskunft, in denen die Rüstungen verzeichnet sind, die zum Inventar eines jeden ordentlichen Wiener Bürgers gehörten. Es war ein wildes Leben in jener Zeit, das ständige Tragen von Waffen nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig. Grausam waren auch die Gerichtsverfahren, geradezu bestialisch die Foltermethoden.
Und zu diesen tatsächlichen Gefahren kamen noch die irrealen. Zahlreiche Hexen und Zauberer trieben ein gefürchtetes Unwesen, vor dem man sich nur mittels genau einzuhaltender magischer Beschwörungsformeln schützen konnte. Teufel und Tod waren allgegenwärtig, Beelzebub nirgends auszutreiben – auch nicht durch fleischabtötende Askese, die nur wieder dazu angetan war, umso heftigere Sinnenlust hervorzurufen. Es ist jene eigentümliche Gegensätzlichkeit, die den mittelalterlichen Menschen prägt: die Allgegenwart des Bösen, die Teufelsfratze auch im sakralen, im kirchlichen Bereich und gleichzeitig jene tiefe Sehnsucht nach Reinheit und verinnerlichter Mystik, wie sie aus den süßen Gesichtern der Madonnen spricht, die auf zierlichen Konsolen die Kirchen bevölkern. Diese Sehnsucht nach göttlicher Transzendenz, nach emporstrebender Vereinigung mit dem Himmlischen, erfüllt die hoch gewölbten Kirchen der Gotik, die zierlichen Bögen und Säulen, mit denen die dumpfe, erdhafte Verbundenheit der Romanik durchbrochen wird.
Denn schon beginnt im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts in Wien die Gotik ihre kostbaren Blüten zu treiben, der »Albertinische Chor« von St. Stephan wird in Angriff genommen, ebenso die Deutschordenskirche und die Minoritenkirche, der Chor von St. Michael und von Maria am Gestade. Langsam ist auch jenes Winkelwerk von großen und kleinen Häusern im Entstehen, von Erkern und Türmen, bald weit vorspringend, bald tief zurückweichend, wie es für eine gotische Stadt charakteristisch war. Wer es sich leisten konnte, begann gegen Mitte des Jahrhunderts allmählich in Stein zu bauen – und das war auch bitter nötig, wurden doch die eng aneinanderstehenden Holzhäuser regelmäßig von verheerenden Bränden zerstört. Vergegenwärtigt man sich die damaligen Löschmethoden, kann das Ausmaß der Feuersbrünste keinesfalls verwundern. Vorausgesetzt, es gab Wasser in unmittelbarer Nähe – was gar nicht so sicher war, denn vor allem in den ärmeren Stadtteilen waren Brunnen in ungenügender Menge vorhanden –, so wurde dieses mit kleinen Handeimern aus Holz oder Leder in die Glut geschüttet. Daneben versuchte man mit eisernen Haken, den sogenannten Feuerhaken, die Gebäude niederzureißen, um so das Feuer einzugrenzen.
Und in diese mittelalterliche Welt, in der hygienische Vorsichtsmaßnahmen praktisch unbekannt waren, in der sich die Heilkunst der Ärzte hauptsächlich auf den Aderlass und harmlose Kräutermittel beschränkte und in der es um das gesamte Kranken- und Spitalswesen äußerst dürftig bestellt war, drang nun mit schrecklicher und verheerender Wucht – die Pest!
Wie mag es gewesen sein, als der erste Pestkranke in einer jener elenden Hütten, in irgendeinem Winkel zwischen Unrat und Kot oder gar mitten auf der Gasse unter qualvollen Schmerzen starb? Denn sicherlich wird er den untersten Volksschichten angehört haben, wo Schmutz und Gestank am ärgsten waren und wo sich die Pest schon immer am ehesten und gründlichsten eingenistet hat. Vielleicht war es ein Bettler, ein Tagelöhner, ein Gelegenheitsarbeiter oder einer jener Weingartenknechte, die bei der Bestellung der Weingärten halfen, die nicht nur außerhalb der Stadt große Flächen bedeckten, sondern auch innerhalb der Mauern anzutreffen waren. Wahrscheinlich wird von diesem Sterben gar kein so besonderes Aufheben gemacht worden sein, Krankheiten und Seuchen gab es ständig und überall, und die Menschen traf der Tod oft auf offener Straße. Aber vielleicht ist es diesmal doch etwas anderes gewesen, sicherlich wusste man von dem furchtbaren Wüten der Seuche im Süden, Westen und Osten – wenngleich es zweifelhaft ist, dass die Krankheit sogleich als solche erkannt worden ist. Hatten doch sogar die Ärzte Schwierigkeiten, bei der Vielzahl von Erscheinungsformen, in denen der Schwarze Tod aufzutreten pflegte, die richtige Diagnose zu stellen.
Vielleicht hatte aber die Angst schon den Blick geschärft, und so hat man diesen ersten Pesttoten schnell und heimlich irgendwo verscharrt, auch noch den zweiten, dritten und vierten. Bis die Gewissheit nicht mehr zu verschleiern war: Die Pest in Wien, jetzt auch in Wien! Gott hat wieder einmal befunden, die sündige Menschheit zu strafen, sein Zorn war durch nichts zu beschwichtigen, nicht durch die Geißelung, nicht durch das inbrünstige Gebet und auch nicht durch die zahlreichen Vermögen, die von bußeifrigen Reichen der Kirche vermacht wurden. Er war ein unbarmherziger Gott, sein Strafgericht musste vollendet werden, ein großer Teil der Wiener Bevölkerung musste dran glauben. Über die Zahl der Toten gehen die Angaben sehr weit auseinander. Die Mattseer Annalen und die Salzburger Chronik berichten von 200 bis 300 Personen pro Tag, an einem Tag sollen sogar 960 gestorben sein. Die Zwettler Chronik schreibt von 500 Leichenbegängnissen und der Chronist von Leoben gar von 1.200 Begräbnissen an einem Tag. Alle diese Zahlen dürften jedoch maßlos übertrieben sein, Genaues wird man hier nie erfahren, ebenso wenig wie über die späteren Epidemien – denn die Pest kehrte immer wieder. Sie sollte bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts in Mitteleuropa eine ständige Seuche werden.
Wir können uns nicht in diese Zeit zurückversetzen, wir können diese Verhältnisse nicht mehr nachempfinden – zu sehr hat sich unsere Welt von jener des Mittelalters entfernt. Wir können uns lediglich ein Bild malen, mit dem überlieferten historischen Anschauungsmaterial und aus der Distanz des 21. Jahrhunderts. Wir können versuchen, uns vorzustellen, wie der Ausbruch dieser großen Seuche das damalige Wien verändert hat, wie das lebhafte Treiben auf Gassen und Plätzen plötzlich verstummt ist, die Märkte sich leerten, die Handwerker ihren Betrieb einstellten. Wie niemand mehr den Sängern, Spielleuten und Spaßmachern zuhören wollte, denen ihrerseits das Lustigsein längst vergangen war. Wie die tausenderlei für eine mittelalterliche Stadt charakteristischen Geräusche abnahmen, die Rufe der Marktschreier und Bader, der Händler, Trödler und Bauernweiber, die ihre Waren anpriesen. Wie die fröhliche Musik der Stadtpfeifer, Stadttrompeter, gassatim gehenden Studenten und Hausmusik treibenden Kaufleute einem lähmenden Schweigen wich, in dem nur die Trommler und Ausrufer irgendwelche Verlautbarungen des Stadtrates verkündeten, die dem Eindämmen der Seuche dienen sollten und doch so wenig bewirkten.
Die feinen Damen und Herren in ihren engen, mit Seidenstickereien geschmückten Kleidern waren sicherlich schon längst ihrem Herzog Albrecht II. gefolgt und hatten die Stadt verlassen, hoch zu Ross und in warme Pelze gehüllt, denn es war ja erst Osterzeit und zuweilen noch ziemlich kalt. Vielleicht wird auch so mancher wohlhabende Bürger geflohen sein, wenngleich es noch nicht die vielen Land- und Lusthäuser außerhalb der Stadt wie in den späteren Jahrhunderten gegeben hat und der Wienerwald gefährlich mit Wölfen und Bären drohte. Geblieben war das arme Volk, nicht nur die Bettler, Soldknechte, Dirnen und Gelegenheitsarbeiter, sondern wahrscheinlich auch die Sohlschneider und Schuhflicker in der Rothgasse und Ravellucke, die Schneider im Schultergässchen im Norden des Hohen Marktes und die Seidensticker, Perlenhefter und Federnschmücker, die sich am Rand des entstehenden Herrenviertels niedergelassen hatten.
Es sind Berichte über die brutale Herrschaft der Pestknechte überliefert, die damals schon häufig freigelassene Verbrecher waren, raubend und plündernd durch die Straßen zogen und Kranke, Kinder und Wehrlose misshandelten. Wie groß die Furcht vor ihnen gewesen sein muss, zeigen jene zahllosen Geschichten, in denen sie der absichtlichen Verbreitung der Seuche beschuldigt werden. So wie in Italien werden sicherlich auch in Wien die Kranken zusammen mit den Gesunden in den Häusern vernagelt oder eingemauert worden sein, wo sie allesamt elendiglich umkamen. Und auch hier werden die verwesenden Leichen nach Öffnung der Häuser für eine weitere Verbreitung der Seuche gesorgt haben. Es ist auch kein Zufall, dass Boccaccio, dem wir sicherlich die beste Beschreibung der Pest dieser Zeit verdanken, in seinem »Decamerone« von den zahlreichen Leichen berichtet, die vor allem morgens auf den Straßen gelegen haben. Denn viele haben ihre Toten in dunkler Nacht heimlich irgendwo in den Rinnstein gelegt, um nicht zusammen mit ihnen eingeschlossen zu werden.
Die Krankenanstalten im mittelalterlichen Wien waren durch den Ausbruch der Seuche völlig überfordert. Die Aufgaben der Spitäler waren ja noch undifferenziert und umfassten das gesamte Angebot an sozialen Leistungen wie: Heilung der Kranken, Versorgung und Betreuung der Alten und Hilfe für die Waisen.
Neben dem Spital zum heiligen Geist, das von Meister Gerhard, Kaplan und Leibarzt Herzog Leopolds VI., nach dem Vorbild des Heiligengeistspitals in Rom jenseits des Wienflusses gegründet worden war, gab es noch zwei kleinere Spitäler, nämlich St. Johann vor dem Werdertor und das Martinsspital vor dem Widmertor. Letzteres war von Otto, dem Bruder Albrechts des Lahmen, gegründet, aber bereits 1529 von den Verteidigern Wiens vor der Türkenbelagerung niedergerissen worden. Außerdem wurde irgendwann in der Mitte des 13. Jahrhunderts bei der Brücke vor dem Kärntnertor von der Wiener Bürgerschaft das »Burger-Spital« gegründet, das dann später nach seiner Zerstörung durch die erste Türkenbelagerung in die Stadt hineinverlegt wurde und dort eine beachtliche Ausdehnung erfuhr.
Leute, die an ansteckenden Krankheiten litten, waren jedoch in »Sondersiechenhäusern« untergebracht, die außerhalb der Stadt lagen und deren Insassen ebenso wie ihre Pfleger von der übrigen Bevölkerung abgesondert leben mussten. Weil die Angaben über Entstehung und Entwicklung dieser Siechenhäuser unter den Historikern zum Teil stark differieren und um hier eine einheitliche Linie einzuhalten, wollen wir uns im Folgenden an »Das große Groner Wien Lexikon« von Felix Czeike halten. Darin ist vor allem von vier Siechenhäusern die Rede. Zunächst vom Aussätzigenspital »Zum Klagbaum«, vom Pfarrer und Arzt Meister Gerhard (der allerdings nicht mit dem vorhin Erwähnten identisch sein dürfte) 1267 gegründet, das 1529 mitsamt der Kirche »Zum hl. Job« abbrannte, 1581 mit einer Kirche »zu Mariä Heimsuchung« wiederhergestellt, 1683 verwüstet und 1686 auf Kosten des Bürgerspitals erneut aufgebaut worden war. Es handelte sich dabei um ein düsteres, ebenerdiges Gebäude, das bis 1785 bestand und dessen sonderbarer Name auf zweierlei Art erklärt wird. Entweder durch einen in der Nähe befindlichen sagenumwobenen »Klagbaum«, in dem es zeitweise ganz seltsam geklagt und gejammert haben soll, oder aber von einem Kreuz mit Heiland und weinenden Frauen. Außer diesem Spital wird es dann noch das Lazarett zum heiligen Johann in der Währingerstraße gegeben haben, ein sehr altes, in seinem Ursprung nicht genau erfassbares Siechenhaus zu St. Lazar, das 1529 von den Türken zerstört und nach deren Abzug teilweise wieder aufgebaut worden war. Dass es sich dabei um ein Pestspital gehandelt haben mag, wird durch die Tatsache erhärtet, dass der Hochaltar des dazugehörenden Kirchleins ursprünglich mit einem Bild der Pestpatrone Rochus und Sebastian geschmückt war, die später allerdings von einer Darstellung Johannes des Täufers abgelöst wurden. Ab 1717 stand das Lazarett leer, 1766 wurde es in ein Militärspital umgewandelt, 1784 dem Allgemeinen Krankenhaus zur Benützung überlassen und 1857 demoliert und an seiner Stelle das Bürgerversorgungshaus errichtet. Weiters wird möglicherweise ein halb legendäres Spital zu St. Johann in der Siechenals Pestkranke aufgenommen haben, das 1298 erstmals erwähnt wird. Sein Name nimmt allerdings nicht auf ein Siechenhaus Bezug, sondern auf den »siech«, das heißt träge fließenden Lauf des Baches Als. Es befand sich jenseits der Als im Bereich der Pfarre Währing und wurde samt dem Dorf St. Johann 1529 durch die Türken zerstört. Die Ruinen dienten noch bis 1541, als das Lazarett diesseits der Als als Pestspital genannt wird, Pestkranken als notdürftiger Unterstand. Und schließlich wird noch das Spital zu St. Marx Anfang des 14. Jahrhunderts als Siechenhaus genannt. Die darin befindliche Kapelle wurde um 1370 dem hl. Markus (St. Marx) geweiht, 1440 zur Kirche umgebaut, 1529 verwüstet und bald darauf mit Hilfe frommer Stiftungen wiederhergestellt. Eine 1562 errichtete neue gotische Kirche wurde 1683 zerstört, und weil sich das Spital insgesamt von der Verwüstung durch die Türken nicht mehr erholen konnte, wurde es 1706 dem Bürgerspital einverleibt und auf dessen Kosten wesentlich erweitert und vergrößert. 1784 übersiedelten dann sämtliche Kranke aus St. Marx in das neue allgemeine Spital in der Alservorstadt, wohingegen im darauffolgenden Jahr die gebrechlichen Bürger aus dem Bürgerspital am Schweinemarkt nach St. Marx transferiert wurden. Von diesem Zeitpunkt an war St. Marx das Versorgungshaus für Wiener Bürger, das es bis 1861 auch blieb. Dann übersiedelten die Insassen in das neu erbaute Bürgerversorgungshaus in der Währingerstraße. Die Reste des Gebäudes wurden im 2. Weltkrieg beschädigt und durch Neubauten ersetzt.
Obwohl es also wahrscheinlich Spitäler für Pestkranke gegeben hat, wird die Unterbringung höchst mangelhaft und unzureichend gewesen sein. Die Menschen waren zum großen Teil sich selbst überlassen, und um dem Tod zu entgehen, wurden verzweifelte und sinnlose Mittel angewendet, die häufig die Situation noch verschlimmerten. Als letzte Zufluchtsstätte blieben oft nur die Gotteshäuser, in denen die Menschen Trost und Schutz suchten. »Vanitas, vanitum, vanitas«, alles (Menschenwerk) ist eitel, lautete ein Grundsatz des mittelalterlichen Menschen, der ihn in seinem Denken und Fühlen bestimmte. »Universalia sunt realia«, nur die Ideen sind wirklich, war der zweite Pfeiler, auf dem das mittelalterliche Denkgebäude ruhte. Real, wirklich, ist nur die jenseitige Welt, jene Gottes, aber auch jene des Teufels, der dem Menschen mindestens ebenso mächtig, manchmal sogar mächtiger erschien. Dieser heroische Sprung aus den Unvollkommenheiten des Alltags in die Höhen des Geistes, dem das Mittelalter seine eigentliche Leuchtkraft verdankt, bot für die Bekämpfung der Seuchen eine äußerst ungünstige Grundlage. Die fatalistische Haltung, die sich daraus ergab, wurde erst mit dem Beginn der Neuzeit überwunden, als der Mensch in einer ungeheuren Geisteskrise begann, sich aus der absoluten Allmacht Gottes herauszuschälen und sich als eigenständiges Individuum zu begreifen.
Die Kloaken stanken zum Himmel
An vorbeugenden Maßnahmen ist uns wenig oder nichts bekannt. Die für spätere Jahrhunderte beispielgebenden Verordnungen der italienischen und südfranzösischen Städte werden damals sicherlich noch nicht bis Wien gedrungen sein. In Venedig, das durch seinen Seehandel besonders für die Einschleppung der Seuche prädestiniert war, soll bereits im März 1348 ein Gesundheitsrat, bestehend aus drei Adeligen, gebildet worden sein. Die Einrichtungen und Maßnahmen, die er in den folgenden Jahrzehnten ausgearbeitet hat, haben allen übrigen europäischen Staaten als Muster gedient. Man quartierte dort die Pestkranken auf einer Insel ein, die – wahrscheinlich nach der auf ihr befindlichen Kirche Santa Maria von Nazareth – Nazarethum genannt wurde, woraus sich dann durch Verballhornung das Wort Lazarett gebildet haben mag. Schiffe, die aus dem Orient kamen, mussten sich dort samt ihren Waren einer vierzigtägigen Quarantäne unterziehen.
Die Zahl vierzig hatte seit alters her eine magische Bedeutung. Der vierzigste Tag galt als der letzte der hitzigen und chronischen Krankheiten, Wöchnerinnen wurden vierzig Tage einer genauen Aufsicht unterworfen, Alchemisten erwarteten wichtige Umwandlungen in vierzig Tagen und nannten diese Zeit den philosophischen Monat. Vor allem aber waren hier religiöse Gründe maßgebend: Vierzig Tage lang hatte die Sintflut gedauert, vierzig Tage hielt sich Moses auf dem Berg Sinai auf und vierzig Tage fastete Christus in der Wüste.
Venedig hatte auch ein besonderes Bestattungssystem ausgearbeitet. Auf den Laguneninseln wurden separierte Pestfriedhöfe angelegt, zu denen eigens hierfür bestimmte Schiffer die Leichen führen und in fünf Fuß tiefen Gräbern begraben mussten.
Im Jahre 1383 wurde dann in Marseille die erste Quarantänestation errichtet, wo nach einer scharfen Schiffskontrolle Menschen und Waren von verpesteten und verdächtigen Schiffen für vierzig Tage abgesondert und die Waren gelüftet wurden. Verseuchte Schiffsladungen durften nicht verkauft oder versteigert werden. Eine der ersten Pestordnungen jedoch ist sicherlich jene des Visconte Bernabo zu Reggio aus dem Jahre 1374, der den menschenfreundlichen Befehl erließ, dass jeder Pestkranke aus der Stadt auf das Feld gebracht werden solle, um dort entweder zu sterben oder zu genesen. Jene, die ihn pflegten, mussten zehn Tage abgesondert bleiben. Priester, die den Kranken untersuchten, hatten ihn unverzüglich den Behörden anzuzeigen, widrigenfalls drohte ihnen der Scheiterhaufen. Außerdem durfte außer den dazu bestimmten Personen niemand den Pestkranken beistehen, bei Todesstrafe und Verlust des Vermögens.
Hier sind also bereits Ansätze jener Verordnungen zu bemerken, die in den folgenden Jahrhunderten immer weiter ausgebaut und verbessert wurden, ohne dass jedoch ein Ausbreiten der Seuche damit wirksam verhindert worden wäre.
In Wien war man nicht so weit wie im fortschrittlichen Italien. Von hier ist lediglich die Verordnung Albrechts II. überliefert, nach der Pesttote nicht in der Stadt begraben werden durften – eine Verfügung, die allerdings häufig übergangen wurde. Der Herzog selbst floh mit seinem Hof nach Purkersdorf und blieb dort von der Pest verschont. Doch wurden diesmal auch abgelegene Gebiete von der Seuche erfasst: Im Stift Heiligenkreuz im Wienerwald starben dreiundfünfzig Zisterzienser.
Es hat in jenen fernen Tagen keine Bestimmungen zur Reinigung der Straßen, Verbrennung von Betten und Kleidern gegeben, wie sie später üblich waren. Die Toten haben sicherlich noch sehr viel länger als in den folgenden Jahrhunderten unbeerdigt auf den Gassen gelegen, der Gestank muss entsetzlich gewesen sein.
Er war es auch in normalen Zeiten. Und sicherlich liegt eine der Hauptursachen für die rasche Verbreitung der Seuche in den katastrophalen sanitären Zuständen. So etwa waren damals noch keinesfalls in allen Bürgerhäusern Abtritte vorhanden, manchmal benutzten die Bewohner zweier Häuser ein sogenanntes »privet« gemeinsam. Eine frühe Einrichtung einer derartigen sanitären Anlage ist für das Jahr 1303 aus der Stadt Villach, von 1345 für Wien bekannt. Klagen über mangelhaft eingerichtete »heimliche Gemächer« und den daraus resultierenden unerträglichen Gestank wurden häufig vorgebracht. Die Augustiner etwa hatten große Schwierigkeiten mit ihren Abtritten, bis ihnen 1354 gestattet wurde, solche an einem an der Ringmauer zu erbauenden Turm unterzubringen. Fast ein Jahrhundert später, nämlich 1445, klagte ein Hans Velber, dass das »Secret« des Veit Schattauer »in tamphloch« habe, »daraus ruche im der unflat und pos gesmachen in sein kamer«. Die geschworenen Werkleute, die vom Rat der Stadt zur Klärung der Frage bestellt worden waren, entschieden, dass Veit Schattauer eine Art Rauchfang errichten musste, um die Geruchsbelästigung zu verhindern.
Auch Thomas Ebendorfer, Historiker und Professor an der Wiener Universität, musste Beschwerde führen, dass man unterhalb seiner Wohnungsfenster einen Abtritt angelegt habe und dass der Gestank unzumutbar sei.
An und für sich waren die Hauseigentümer für das Räumen ihrer »Secrets« verantwortlich, doch dürfte dies sehr unzureichend und mangelhaft durchgeführt worden sein. Die Fäkalien wurden in die im Tiefen Graben und der Rotenturmstraße als Kloaken dienenden Bäche geleitet, die schließlich in den Donauarm mündeten. Aber erst seit 1388 begann man, diese Rinnsale zu Kanälen (Mörungen) einzuwölben.
Zur Zeit der großen Pest des Jahres 1349 war von derartigen Einrichtungen sicherlich noch keine Rede, vor den Häusern lagen Unrat und Kot, in dem zahlreiche Schweine wühlten. Denn es gab im gesamten Mittelalter in der Stadt noch Gehöfte und Stallungen, es wurde Nutzvieh gehalten und die Tiere liefen auf den Straßen herum. Gründlich gesäubert wurden die Gassen lediglich zu besonderen Festlichkeiten, wie etwa zum Einzug eines Fürsten oder Gesandten. Zwar gab es sogenannte Mistrichter, die vor allem auf den Marktplätzen für Reinlichkeit zu sorgen hatten, doch schienen sie nicht allzu erfolgreich gewesen zu sein.
Auch die Wasserversorgung im mittelalterlichen Wien war mangelhaft. Die Brunnen auf den Straßen und Plätzen, aber auch auf privaten Grundstücken reichten meist nicht aus, den allgemeinen Bedarf zu decken. Außerdem waren sie häufig durch Sickerwasser verseucht. Später wurde Frischwasser durch Messingrohrleitungen zugeführt, die von den Gelbgießern hergestellt wurden.
Besser als um die Säuberung der Straßen schien es um die Reinhaltung des Körpers bestellt gewesen zu sein. Das Baden in öffentlichen Badstuben war das ganze Mittelalter hindurch große Mode. Auch hier zeigen sich allerdings die für diese Zeit typischen Gegensätzlichkeiten: Während auf der einen Seite jede mittlere Stadt etliche Badstuben aufzuweisen hatte, die eifrig und gern besucht wurden, galt auf der anderen Seite Unsauberkeit als ausgesprochen gottgefällig – die heilige Agnes war kanonisiert worden, weil sie sich aus Frömmigkeit jedes Bad versagte.
Im sündigen Wien jedoch soll es in dieser Zeit an die dreißig Bäder gegeben haben, wobei das Bad nicht nur der Reinigung diente, sondern auch der Gesundheit und dem Vergnügen. In den Badstuben wurde der Kopf geschoren, der Körper gewaschen, massiert, es wurde geschröpft und zur Ader gelassen, teilweise von den Badern selbst, teilweise von den angestellten Barbieren. Woraus sich dann später die Bezeichnung »Bader« für einen Arzt der unteren Kategorien entwickelte. Für das Vergnügen sorgten schöne Frauen, die auch Speis und Trank kredenzten.
Und wie aus diesem Grund nicht anders möglich, ist häufig von der Sittenlosigkeit die Rede, die in den Bädern geherrscht haben soll – sie werden »Fress-, Sauf- und Luderhäuser« genannt, vor allem auch, weil es üblich war, dass Mann und Frau gemeinsam in das Wasserschaff stiegen. Erst ab dem 16. Jahrhundert nahm die Zahl der Bäder sprunghaft ab, wegen drohender Ansteckung durch Syphilis vor allem, die ja durch die Badstuben verbreitet wurde.





























