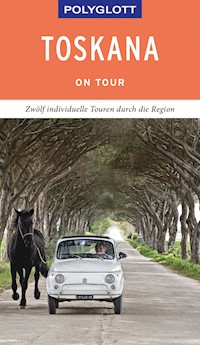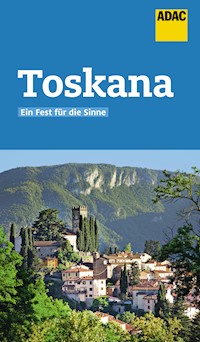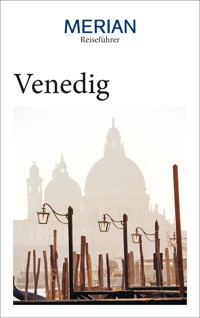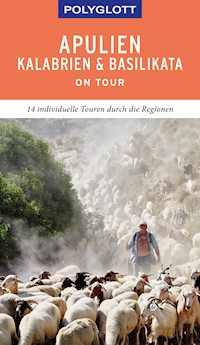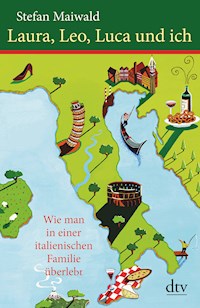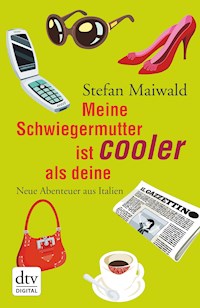Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Thalmeyer-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Kampf um die Familie, ein Fall von Spionage, das Wirtschaftswunder und eine erbitterte Fehde zwischen Rivalen – die Geschichte einer Familiendynastie in der neuen Bundesrepublik. Selb in den 50er Jahren: Marie Thalmeyer hat es geschafft, das Sorgerecht für ihre Tochter zurückzuerlangen, doch die Freude hält nicht lange. Die Porzellanmanufaktur steht nach einem Betrug kurz vor dem Ruin und die DDR öffnet die Grenzen für das Meißner Porzellan. Die Preise sind im freien Fall. Maries Bruder Joachim lebt währenddessen immer offener seine Homosexualität aus. Er versucht mit Hilfe der Musik, die Narben des Krieges verblassen zu lassen und wird erfolgreicher Manager der Stars. Doch auch in der Welt der Reichen und Schönen lauern Gefahren … Als der Erzfeind der Familie, der Papierfabrikant Karl Metsch, aus der Haft entlassen wird, flammt die Fehde erneut auf. Können Marie und Sophie Thalmeyer wieder alles zum Guten wenden? Der zweite Teil der großen Thalmeyer-Trilogie – ein detaillierter Einblick in die 50er Jahre und die Geschichte einer ganzen Generation!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Maiwald
DIE PORZELLANMANUFAKTUR Zerbrechliche Hoffnung
Roman
Über das Buch
Der Kampf um die Familie, ein Fall von Spionage, das Wirtschaftswunder und eine erbitterte Fehde zwischen Rivalen – die Geschichte einer Familiendynastie in der neuen Bundesrepublik.
»Manchmal bedurfte es eben eines gewissen Risikos, um etwas völlig Neues zu erschaffen.«
Selb in den 50er Jahren: Marie Thalmeyer hat es geschafft, das Sorgerecht für ihre Tochter zurückzuerlangen, doch die Freude hält nicht lange. Die Porzellanmanufaktur steht nach einem Betrug kurz vor dem Ruin und die DDR öffnet die Grenzen für das Meißner Porzellan. Die Preise sind im freien Fall.
Maries Bruder Joachim lebt währenddessen immer offener seine Homosexualität aus. Er versucht mit Hilfe der Musik, die Narben des Krieges verblassen zu lassen und wird erfolgreicher Manager der Stars. Doch auch in der Welt der Reichen und Schönen lauern Gefahren …
Als der Erzfeind der Familie, der Papierfabrikant Karl Metsch, aus der Haft entlassen wird, flammt die Fehde erneut auf. Können Marie und Sophie Thalmeyer wieder alles zum Guten wenden?
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright © 2024 by Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
1. Auflage 2024
Lektorat: Dr. Rainer Schöttle
Korrektorat: Angelika Wiedmaier
Satz/Layout: Alin Mattfeldt
Umschlaggestaltung: Alin Mattfeldt
Umschlagmotiv: © Pao Laroid / Shutterstock, foto_shabrova / Shutterstock, Creaturart Images / Shutterstock
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: CPI books GmbH
Made in Germany
ISBN: 978-3-98679-028-8
Inhalt
Über das Buch
Impressum
Widmung
1952
1. Kapitel
Klar zum Entern
2. Kapitel
Der Klau
3. Kapitel
Die Bar
4. Kapitel
Stalingrad
5. Kapitel
Die Entlassung
6. Kapitel
Die Pasta
7. Kapitel
Püppchen
8. Kapitel
Im Wald
9. Kapitel
Die Zelle
10. Kapitel
Die Schläge
11. Kapitel
Der Besuch
12. Kapitel
Die Krämertochter
13. Kapitel
Billiges Holz
14. Kapitel
Der Spaziergang
15. Kapitel
Adi hilft
16. Kapitel
Der Bauplan
17. Kapitel
Die Teilhabe
18. Kapitel
Versicherungen
19. Kapitel
Die Kandidatin
20. Kapitel
Glamour
21. Kapitel
Importprobleme
22. Kapitel
Der Journalist
23. Kapitel
Der Schlag
24. Kapitel
Erholung
25. Kapitel
Die Dienste der Schneiderin
26. Kapitel
Elternzeit
27. Kapitel
Dauerregen
28. Kapitel
Rache
29. Kapitel
Der Journalist
30. Kapitel
Die Anfrage
31. Kapitel
Gustav greift ein
32. Kapitel
Kraftsport
33. Kapitel
Die Bitte
34. Kapitel
Nachwirkungen
35. Kapitel
Gerüchte
36. Kapitel
Die Rettung
37. Kapitel
Die Enthüllung
38. Kapitel
Erstes Training
39. Kapitel
Der Artikel
40. Kapitel
Jürgens Rache
41. Kapitel
Der Verweis
1953
42. Kapitel
Erstkontakt
43. Kapitel
Susanna spricht
44. Kapitel
Was bin ich?
45. Kapitel
Untreue
46. Kapitel
Der Aufstand
47. Kapitel
Die Ankündigung
48. Kapitel
Der Besuch
49. Kapitel
Die letzte Fahrt
50. Kapitel
Im Krankenhaus
51. Kapitel
Langsame Genesung
52. Kapitel
Bad Kissingen
53. Kapitel
Übersee
54. Kapitel
Beim Sender
55. Kapitel
Der Mentor
56. Kapitel
Düsternis
57. Kapitel
Gewisse Sympathien
58. Kapitel
Die Entlassung
59. Kapitel
Die Besichtigung
60. Kapitel
Die Ballade von Limmys Geld
61. Kapitel
Besuch aus der hohen Politik
62. Kapitel
Krimiidee
63. Kapitel
Abels Antennen
64. Kapitel
Nachfrage von drüben
65. Kapitel
Die Fälschung
66. Kapitel
Der Zuschlag
67. Kapitel
Das Testament
68. Kapitel
Adi lässt es schleifen
69. Kapitel
Gespräche
70. Kapitel
Ziemlich beste Freunde
71. Kapitel
Verhandlungen
72. Kapitel
Zerschnittene Nudeln
73. Kapitel
Der Überfallplan
74. Kapitel
Empfangskomitee
75. Kapitel
Casting
76. Kapitel
Die Zwickmühle
77. Kapitel
Der angekündigte Besuch
78. Kapitel
Ausbaldowern
79. Kapitel
Er kommt
80. Kapitel
Der Einbruch
Stefan Maiwald: Die Porzellan-Manufaktur – EXKLUSIVE LESEPROBE Band 3
1966 1. Kapitel
Grenzübertritt
2. Kapitel
Backfisch
Der Autor Stefan Maiwald
Der Auftakt:
Der dritte Band:
Weitere historische Romane im Verlag
ALLSBERG
Band 2 unserer Allsberg-Trilogie:
Band 3 unserer Allsberg-Trilogie:
Widmung
Für Lilly und Bea
1952
1. Kapitel
Klar zum Entern
Die Karnevalsfeier, zu der Harry Kruskopp und Sophie Thalmeyer im Februar 1952 luden, sollte niemand so schnell vergessen. Sie stand unter dem Motto »Piraten und Klabautermänner«, was ja auch perfekt zu Harrys norddeutscher Herkunft passte. Schon Tage vorher sprach der Ort von kaum etwas anderem, und einige der Frauen hatten sich beim Schneidern ihrer Kleider Hilfe von Frau Helgard gesucht.
Die Männer, die an diesem regnerischen Abend in den Festsaal des Bayerischen Hofs strömten, hatten sich als Piraten zurechtgemacht, wie sie es aus den Filmen mit Douglas Fairbanks und Errol Flynn kannten: Augenklappe, Halstuch, weißes Hemd, Reitstiefel, Degen. Die Damen hatten sich – weil es ja nun mal recht wenige Piratinnen gab – in spanisch anmutende Vamps mit rotem Kleid und noch roterem Lippenstift verwandelt. Oder sie hatten sich, was besonders lasziv wirkte, einfach Männerkleidung angezogen und sich sogar einen Schnauzbart aufgemalt. Das hatte einen gewissen erotischen Effekt; einige der anwesenden Herren mussten schlucken.
Auch Marie und Joachim erschienen auf der Feier. Marie hatte sich lange geweigert und musste von ihrer kleinen Schwester überredet werden.
»Es wird Zeit, dass du dich nicht nur ums Porzellan kümmerst, sondern endlich auch um dich selbst«, hatte Sophie gesagt.
»Und eine Karnevalsfeier bedeutet, dass ich mich endlich um mich selbst kümmere?«
»Es bedeutet, dass du endlich mal Spaß hast!«
»Aber wenn doch Spaß nicht mein Ziel im Leben ist?«
Marie hatte sich sehr dezent verkleidet, mit einem feuerroten Foulard, aber sie stach dennoch heraus. Sie musste gar nicht viel dafür tun, es war ihr Gang, es war ihre hell schimmernde Haut, es war ihre ganze aristokratische Erscheinung. »Sie ist die Gouverneurs-Gattin der Karibik«, rief Armin Füllhorn, der Wirt des Bayerischen Hofs – denn auch eine solche Frau kam in den Errol-Flynn-Filmen ja häufig vor. Maries Bruder Joachim war an ihrer Seite, kam also ohne eigene Begleitung. Längst hatte er sich daran gewöhnt, dass in Selb über ihn gemunkelt wurde, aber er sagte sich: Was soll’s? Ich habe Russland überstanden, dagegen ist Ortsklatsch doch ein Klacks.
Gisela Rappenhuth, die Frau des Dorfarztes, hatte sich einen Stoffpapagei auf ihre Schultern drapiert, was für viel Gelächter sorgte. Holzgroßhändler Müllerschön kam als Kapitän Schwarzbart, inklusive brennender Zündschnüre an seinem Bart, was eine fantastische Idee war und angesichts seiner sonst recht braven Existenz umso verblüffender wirkte. Doch die Gastgeber, die zuletzt in den Saal traten, übertrafen alle. Harry erschien als Klaus Störtebeker, inklusive einem Pappmaché-Modell seines eigenen abgeschlagenen Kopfes unter dem Arm, während Sophie Thalmeyer den Scharfrichter Rosenfeld aus Buxtehude mimte, samt schwarzer Kapuze und Holzfälleraxt. Es gab Applaus und Hurra-Rufe.
Die Legende Störtebekers war in Oberfranken gut bekannt, viele hatten noch den Stummfilm gesehen, der 1919 in die Kinos gekommen war. Aber nach dem kalt-warmen Buffet ließ Harry es sich nicht nehmen, die dramatische Geschichte von Störtebeker und seinen Vitalienbrüdern nachzuerzählen – die Schlacht zwischen dem Piratenschiff »Toller Hund« und der Hansekogge »Bunte Kuh«, die speziell für die Jagd auf die Seeräuber ausgerüstet worden war, dem Verrat an Störtebeker, als jemand mit flüssigem Blei das Ruder blockierte, und der Hinrichtungsszene auf dem Grasbrook am Hamburger Hafen, als er sich mit zweiundsiebzig Gefährten, darunter Gödeke Michels, in einer Reihe aufstellen musste, um geköpft zu werden. Dem Bürgermeister Kersten Miles bot er im Fall einer Begnadigung eine goldene Kette an, die einmal um die Stadttore reichen würde, doch der lehnte ab. Er rang dem Bürgermeister das Versprechen ab, alle Männer zu begnadigen, an denen er nach seiner Enthauptung vorbeigehen würde, doch als der kopflose Pirat tatsächlich die Reihen abschritt und beim elften Mann angelangt war, stellte ihm der Scharfrichter ein Bein, und der Bürgermeister brach sein Versprechen. Harry imitierte bei seiner kleinen Szene sogar die Dialekte, wenngleich die Oberfranken diese Feinheiten kaum unterscheiden konnten: das Mecklenburgische des in Wismar geborenen Störtebeker, das feine Hanseatisch der Hamburger Kaufleute und des Bürgermeisters, das grobe Hafenplatt des Henkers.
Und Harry war in seinem Element. Was er doch für eine Rampensau war! Er erzählte weiter, und alle Gäste hingen an seinen Lippen: Als Rosenfeld fertig war, lobte ihn der Bürgermeister, wie sauber er alle dreiundsiebzig Hinrichtungen durchgeführt habe. Darauf erwiderte der Henker allzu keck, dass er noch frisch genug sei, um auch den gesamten Rat zu köpfen. Daraufhin ließ ihn der Bürgermeister festsetzen und vom jüngsten Ratsmitglied enthaupten.
»Likedeeler waren die Piraten«, erklärte Harry, »und das heißt in unserem Dialekt, dass die Beute zu gleichen Teilen aufgeteilt wurde, ob Kapitän oder Smutje.«
»Kommunisten also«, rief Wirt Armin Füllhorn bierselig in den Saal, und alle lachten.
Harry lachte mit und erhob sein Glas. »Aber ausnahmsweise trinken wir auf die Roten: Ein Hoch auf Störtebeker!«, und alle stimmten ein.
Und dann begann der gemütliche Teil. Die Dorfkapelle um Volkmar Raudinger, dem im Krieg der Schienbeinknochen weggeschossen worden war, Hanno Möllendorf, der das linke Auge eingebüßt hatte, und Paukist Eberhard, der wegen eines Granatsplitters im Hirn etwas wirr im Kopf war, spielte gefällige Tanzmusik, und die Piraten und Señoritas näherten sich einander an. Noch züchtig, später immer enger bewegten sich die Paare durch den Saal, und schließlich ging es in den Boogie Woogie und die Jüngeren zeigten die wilden Tanzschritte. Joachim stürmte auf die Tanzfläche, in Begleitung der kichernden Kriegswitwe Bosch, die schon seit Jahren eine Affäre mit Metzger Habenicht hatte. Sie versuchten sich im Swing, was sie respektabel hinbekamen. Alles war gut, niemand tratschte. Denn schließlich war Karneval. Die Älteren blieben am Rand stehen und lächelten erst, dann machten sie nach und nach mit. Es war wie eine Befreiung.
Harry wies Gastwirt Füllhorn an, ordentlich Rum nachzuschenken. Die Franken mochten erfahrene Biertrinker sein, aber dieses hochprozentige Getränk, das sie nicht kannten und auch nicht einschätzen konnten, verfehlte seine Wirkung nicht. Es gab die ersten Ausfälle, Damen gerieten ins Wanken, hier und da landete eine männliche Hand dorthin, wo sie ganz sicher nicht hingehörte.
Harry organisierte unterdessen ein Trinkspiel und rief in bester Hamburger-Hafen-Manier zur Teilnahme auf.
Er zauberte zwei Würfel hervor, und angesichts des fortgeschrittenen Abends konnte es nur eine Gaudi werden: Er stellte ein Bierglas mit Schnaps in die Mitte und gab zwei Personen, die sich gegenüberstanden, die Würfel. Die Personen mussten so lange würfeln, bis die Sechs erschien, dann gaben sie den Würfel im Uhrzeigersinn an die Person nebenan weiter. Klar, dass irgendwann ein Würfel den anderen einholte – und der, bei dem sich die Würfel trafen, musste das Bierglas auf ex leeren.
Gastwirt Füllhorn traf es gleich zu Beginn des Spiels zweimal. Er tat seine Pflicht, hob die Hand, wankte nach draußen und übergab sich. Wann hatte man das je von einem Gastwirt gesehen? Müllerschön erwischte es nur einmal, Harry selbst ebenfalls, Rappenhuth war das Sechserglück hold, auch Sophie, die mitspielte, musste nie ansetzen. Und als der junge Bernd, ein stämmiger Speditionslehrling, der das zweite Glas zu leeren hatte, dies zwar schaffte, aber danach einfach umfiel, wusste selbst Harry, dass man nun wohl besser aufhören sollte.
Die Band machte eine Pause, man zog sich zu Gesprächen und einem Bissen vom Buffet zurück. Holzgroßhändler Müllerschön hatte schon etwas Schlagseite, hielt sich aber ebenso tapfer wie Doktor Rappenhuth, der mit fettigem Essen vorgesorgt hatte und in den Trinkpausen reichlich Mineralwasser zu sich nahm. Beide hingen ermattet in den Stühlen und aßen Brote mit Aufschnitt.
»Störtebeker, das passt ja zu Harry.«
»Wie meinst du das, Doktor?«
»Na, der Name kommt von Stürz den Becher, weil er so viel vertragen konnte. Wussten Sie das nicht?«
Die Band spielte nun wieder Musik, und all jene, die nicht am Trinkspiel teilgenommen hatten, bevölkerten rasch die Tanzfläche, erneut bereit für sinnliche Abenteuer.
Harry geriet zum ersten Mal, seit er unter doch recht rätselhaften Umständen hier in Selb erschienen war, in ernste Schwierigkeiten. Er verlor fast den Halt, als er die Tanzfläche durchquerte und dabei ein paar Swing-Schritte imitierte; der Alkohol hatte seiner Koordinationsfähigkeit arg zugesetzt.
Und dann kam es zu einem Tumult. Wer zuerst wen herumschubste, ließ sich später nicht mehr klären. Offenbar hatte einer der Kellner, ein Sudetendeutscher, einem der Saalmädchen ein anzügliches Angebot gemacht und war möglicherweise auch aufdringlich geworden, doch das Saalmädchen war die Nichte des Paukisten Eberhard, der daraufhin einschritt und den Lüstling zurechtwies. Wegen des Granatsplitters stotterte er ein wenig, aber der Faustschlag kam ohne Verzögerung. Jedenfalls artete alles in eine zünftige Wirtshausschlägerei aus, wie man sie, versicherte der allmählich wieder zu Kräften kommende Gastwirt Armin Füllhorn, seit dem Jahr 1932 nicht mehr gesehen hatte, als seinerzeit Braunhemden eine Versammlung im Festsaal abhielten, die von Bayreuther Kommunisten gestürmt wurde. Niemand verletzte sich, denn wie jeder wusste, haben Betrunkene – und damit praktisch alle Gäste – einen Schutzengel.
Alle waren sich einig, als sie am nächsten Morgen aufwachten, fast alle verkatert, einige sogar mit einem blauen Auge und Abschürfungen an den Knöcheln: Was für ein schönes Fest das gewesen war!
2. Kapitel
Der Klau
Die ersten Monate des Jahres 1952 waren in Franken mild und feucht gewesen, und in den Alpen hielten sich die Schneemengen in Grenzen, nicht so wie im Jahr davor, als der »Lawinenwinter« in die Geschichte einging: Fast dreihundert Menschen verloren nach wochenlangen heftigen Schneefällen und fatalen Abgängen ihr Leben, ganze Ortschaften wurden von meterhohen Schneelawinen regelrecht plattgemacht. Im Februar 1952 fanden die Olympischen Winterspiele in Oslo statt, bei denen erstmals wieder deutsche Athleten antraten und prompt drei Goldmedaillen gewannen – im Paarlauf mit den Eheleuten Ria und Paul Falk, im Zweierbob und im Viererbob. Die Deutschen machten sich eine Regellücke zunutze und schickten ausschließlich übergewichtige Athleten (Durchschnittsgewicht: 117 Kilogramm) in die Eisbahn, was einen enormen Geschwindigkeitsvorteil verschaffte; nach Oslo sollte das Internationale Olympische Komitee eine Gewichtsbegrenzung für Bobfahrer einführen. Geschichte schrieb auch der griechische Slalomfahrer Antoin Miliordos, der achtzehnmal fiel, aber sich immer wieder aufrappelte, dann aber die Nase voll hatte, sich schmollend ein paar Augenblicke auf die Piste setzte und die Ziellinie schließlich rückwärtsfahrend überquerte.
Der März wurde dann außergewöhnlich warm, beinahe frühsommerlich, und wer es sich leisten konnte, verbrachte die Wochenenden beim Flanieren auf den Waldwegen oder an den Seen des Fichtelgebirges. Im Vorstandsbüro der Porzellanmanufaktur Thalmeyer schwebten Staubteilchen in der trägen Luft, es roch nach vertrocknetem Gras, nach der frisch geteerten Auffahrt zur Thalmeyerschen Villa. In der eigenartigen, sicher nur provisorischen Bundeshauptstadt Bonn regierte ein greiser Kanzler namens Adenauer, die letzten Lebensmittelmarken – für Zucker – waren gerade abgeschafft, die Briten gaben Helgoland an Deutschland zurück, und Marie Thalmeyer, die am Schreibtisch saß, spürte ihre Tochter unter sich. Denn Jana spielte zu ihren Füßen mit der Puppe, die schon die Thalmeyer-Schwestern in ihrem Bettchen gehabt hatten und schlicht »Püppchen« nannten; Lina, die Haushälterin, hatte der Puppe ein fesches Dirndl genäht. Die Sache mit der richtigen Platzierung der Schleife wusste Jana noch nicht, und als Sophie, Maries jüngere Schwester, ihrer Nichte erklären wollte, dass die unschuldige Puppe die Schleife rechts für vergeben, links für ledig und zentral für Jungfrau tragen sollte, zischelte Marie ihr etwas Entschiedenes zu, und auch Lina schüttelte stumm den Kopf. Ja, die Thalmeyer-Schwestern waren eben unterschiedlich geraten.
Der bittere Rechtsstreit um Jana lag erst wenige Monate zurück. Das Jugendamt hatte sie Marie weggenommen, nach einem Gesetz aus der Weimarer Republik, das dem Staat gestattete, unehelich geborene Kinder unter seine Obhut zu nehmen. Das Gesetz sollte eigentlich unterprivilegierte Kinder schützen, um sie aus prekären Verhältnissen herausholen zu können, und ohnehin war es kaum mehr angewandt worden, nicht einmal von den Nazis. Dass ausgerechnet Marie Thalmeyer um ihre Tochter kämpfen musste, hatte sie der Familie Metsch zu verdanken, was sie nicht wusste, aber ahnte. Glücklicherweise war ihr Alma Weinzierl zur Seite gestanden, ausgerechnet jene Frau, wegen der Karl Metsch nun in Haft saß. Alma Weinzierl war Bereichsleiterin der »Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes«, einer mächtigen Organisation, die 1947 gegründet wurde und der sogar Kanzler Adenauer angehörte. Sie hatte einen Rechtsanwalt beauftragt, und nach zwei langen, nein – endlosen Wochen war der Albtraum vorbei gewesen.
Während Marie ihren Kopf über die Bücher der Manufaktur beugte, war Sophie mit der neuen Porzellankollektion unterwegs und bereiste die Kaufhäuser in ganz Bayern. Sie machte ihre Sache fabelhaft, und die älteren Herren gerieten jedes Mal in Verzückung, wenn die junge Thalmeyer vorbeikam. Eigentlich hieß sie ja seit ihrer Hochzeit Kruskopp, aber für den Reklameeffekt hatte sie nichts dagegen, immer noch Thalmeyer genannt zu werden. Sie war doch eine ganz andere Erscheinung als die Vertreter für Bürsten, Staubsauger, Teppiche oder Hundefutter – mit Letzteren erlaubten sich übrigens manche Großeinkäufer den diabolischen Spaß, ihnen das Hundefutter selbst zum Verkosten vorzusetzen, um zu prüfen, ob es wirklich von der versprochenen Qualität war. Sophies Mann Harry, der neue Teilhaber der Porzellanmanufaktur, hielt sich im Geschäftlichen völlig zurück und kümmerte sich ausschließlich um seine beiden Apotheken in Selb und Hof.
Insgesamt hatte das Jahr recht erfreulich begonnen; die Nachfrage nach gutem Porzellan schnellte in die Höhe, das Kaolin, dieser wichtige Werkstoff, kam von ihrer eigenen Grube problemlos heran, und Marie konnte die Zinsen für die Kredite, die sie aufgenommen hatte, pünktlich bezahlen.
Die Buchführung war immer noch nicht Maries Lieblingsbeschäftigung, aber sie musste eben sein. In regelmäßigen Abständen ließ sie sich die Unterlagen von Buchhalter Walter Willemsen bringen. Normalerweise fiel es ihr leicht, die Zahlen und Kolonnen waren letztlich nichts anderes als eine Art Sprache, mit festen Regeln der Rechtschreibung und Grammatik. So hatte sie sich diese Welt erschlossen. Weil sie es nach dem Tod ihres Vaters tun musste.
Doch heute blieb sie an zwei Spalten hängen. Wieder und wieder versuchte sie, den Zahlen, die dort standen, einen Sinn zu geben, aber es wollte ihr nicht gelingen.
Sie stand auf, blickte aus dem Fenster auf die Linde, deren herzförmige Blätter bereits vorzeitig die Krone schmückten. Dann ging sie ins Nebenzimmer zu ihrer Sekretärin.
»Können Sie Schöffel zu mir kommen lassen?«
Sekretärin Margot Hennemann, eine adrette, unscheinbare Person, nickte und hob den Telefonhörer ab, um unten in der Brennerei anzurufen.
* * *
Marie Thalmeyer zeigte Brennmeister Hans Schöffel, dem treuen Begleiter der Schwestern, die eigenartigen Zahlen aus der Buchhaltung der Manufaktur, als da waren:
Reparatur Fuhrpark, außerplanmäßig: 250 Mark.
Sonderposten Reinigung Brennofen: 310 Mark.
Ausgabe Reklame sonstige: 173 Mark.
Sport Unterstützung SV Selb: 94 Mark.
»Und das ist nur aus dem letzten Monat«, wunderte sich Marie. Schöffel runzelte die Stirn und beugte sich noch ein wenig tiefer über die Zahlen, die von der Buchhaltung, also von Walter Willemsen, auf liniertem Papier in gleichmäßiger, aber sehr kleiner Schrift niedergeschrieben waren.
»Was die Reklame angeht, spreche ich mit Sophie«, sagte Marie. »Die Unterstützung des SV Selb kann nur ein Fehler sein, ich hatte fünfzig Mark zugesagt. Aber was hat es mit der Reparatur auf sich, und was mit der Reinigung?«
Hans Schöffel stützte sich auf seine kräftigen Unterarme, die Muskeln zuckten. Seine Nase berührte beinahe die Seiten, denn er war kurzsichtig, ohne es sich eingestehen zu wollen. Er ahnte, was hinter diesen rätselhaften Zahlen steckte. Dann richtete er sich auf und atmete tief ein und aus.
»Lassen Sie es mich bis morgen rausfinden, Frau Thalmeyer.«
3. Kapitel
Die Bar
Die Musik der Jazzband aus Fürth stoppte, und Joachim Thalmeyer stellte das schmale Glas ab, in dem der Sekt schon warm war. Applaus schwappte durch den Zigarettenrauch, der so dicht im Saal stand, dass den meisten Besuchern die Augen tränten. Der Applaus war nichts Enthusiastisches, aber immerhin. Hier war das Publikum anspruchsvoll und scheute sich auch nicht zu pfeifen, wenn seine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Niemand von den Jugendlichen wollte Dixieland oder Swing hören, sie verlangten Latin Jazz und vor allem den schnellen Bebop, zu dem sie tanzen konnten, statt höflich auf ihren Plätzen sitzen zu müssen. »Je entarteter, desto besser«, scherzte der Clubbesitzer – ein recht später Mittelfinger gegen die Kunstauffassung der Nazis. Denn dieser Clubbesitzer, etwa so alt wie das Jahrhundert, dessen Bierbauch trotz Entbehrungen sowohl Krieg als auch Nachkriegszeit wohlig überstanden hatte, hatte mit ebenso großer Überzeugung die letzten Liederabende mit guter deutscher Musik bis ins Frühjahr 1945 zu arrangieren gewusst.
Neben Joachim am Tisch auf der Empore saß Bernhard, sein Jugendfreund, der inzwischen mehr als ein Kumpel war. Die beiden musizierten gemeinsam, spielten einander die neuesten Platten vor und hielten dort, wo sie es durften, Händchen. Ein Paar waren sie offiziell nicht, das war noch viel zu gefährlich im Jahr 1952, und das, so befürchtete Joachim, würde sich wohl nie ändern.
Im Nürnberger Jazzclub in der ehemaligen Gaststätte Augsburger Hof traten örtlich bekannte Bands auf, und manchmal spielte auch Joachim auf dem Klavier. Weil er so viel über die neue Musik wusste, kamen die Leute zu ihm und fragten ihn um Rat; im Club war er eine echte Autorität. Zumal er es verlässlich schaffte, den Club voll zu bekommen, wenn auswärtige Bands auftraten; diese Sache mit der Reklame verstand er einfach. Auch wenn er lieber als Musiker berühmt geworden wäre, erkannte er immer mehr: Vielleicht lag seine Begabung ganz woanders. Das Separee auf der Empore jedenfalls war Joachims Stammplatz geworden, auf den sich niemand anderer zu setzen wagte. Es schien, als kämen jeden Abend mehr Menschen zu ihm, grüßten ihn, wollten seine Nähe. Das schmeichelte ihm sehr. So musste er an die Schrecken des Kriegs an der Ostfront nicht mehr alle zehn Sekunden denken, sondern nur noch alle zwei oder drei Minuten.
Seit ein paar Wochen moderierte Joachim zudem jeden Freitag eine Radiosendung im wiederaufgebauten Funkhaus zu Nürnberg. Noch durften die Deutschen keine Mittelwellensendungen ausstrahlen, also sendete man auf UKW. Die Reichweite war geringer, aber dafür war das Signal besser, was all jenen zugute kam, die keine Reden oder Verlautbarungen mehr hören wollten, sondern Musik. Die Sendung hieß Heiße Scheibe, und die Betreiber konnten Joachim nicht bezahlen, aber er bekam früher als alle anderen Zugriff auf Plattenveröffentlichungen, sogar aus erster Pressung, und auch die großen Musikhäuser aus Übersee belieferten gern deutsche Radiostationen, wussten sie doch um die lukrativen Käufe im Land der blühenden Konjunktur, das zudem großen Nachholbedarf hatte. Joachim machte seine Sache gut, legte die Platten auf, erzählte mit angenehm voller Radiostimme ein paar Sätze zu der Sängerin oder dem Sänger. Die Vorkriegstechnik setzte öfter mal aus, aber nie so oft, dass die Hörer am Regler herumfummelten und einen anderen Sender suchten.
Nun trat eine Sängerin auf die kleine Bühne des Clubs. Der Clubbesitzer hatte Joachim davon erzählt, aber nicht sehr euphorisch geklungen. Sie war bildhübsch, mit großen runden Augen und einer knabenhaften Figur, und sie trug ihr dunkles Haar ganz kurz. Sie wirkte exotisch, aber nicht fremd, sondern anziehend. Wie eigenartig! Joachim beugte sich vor, das Publikum johlte. Mit gesenktem Blick und schüchtern – oder war das nur gespielt? – nestelte sie am Ständer, bis sie das Mikrofon befreit hatte. Sie ging, immer noch mit gesenktem Blick, ganz vorn zur Bühne. Noch einen Schritt weiter, und sie wäre auf die Tische der ersten Reihe gefallen.
Dann begann sie zu singen. Nur ein Klavierspieler begleitete sie. Sie sang erst italienische, dann französische Lieder. Ihre Stimme war betörend und weich und fest und durchdringend zugleich. Die Lieder hatten überhaupt nichts mit Jazz zu tun, aber auch nicht mit den deutschen Schlagern, die gerade so in Mode waren – Pack die Badehose ein der siebenjährigen Sängerin Conny Froboess war derzeit auf Platz eins der deutschen Hitparade.
Die Dame, die mit ihren schönen großen Augen kaum einmal aufblickte, sang also auf Italienisch und auf Französisch, beide schienen ihre Muttersprachen zu sein. Es waren süße Melodien, angenehm, zwar ohne den Kick, den alle Anwesenden im Jazz suchten, doch das Publikum verstand gut, dass hier etwas Besonderes vor sich ging. Niemand tanzte, alle blieben auf ihren Sitzen und blickten auf diese junge Dame. Es war wie eine Hypnose.
Nach sechs Liedern verabschiedete sie sich mit einem hilflosen Winken. Doch das Publikum, das bislang saß, stand auf und gab Applaus, der nicht enden wollte.
»Was war das denn?«, fragte Bernhard. Es klang ein bisschen spöttisch, aber auch ein bisschen fassungslos.
»Lass uns mal sofort was machen«, erwiderte Joachim. Joachim Thalmeyer hatte seinen ersten Star gesehen.
4. Kapitel
Stalingrad
Viele Soldaten sollten später behaupten, sie hätten in der letzten Maschine gesessen, die aus dem mörderischen Kessel von Stalingrad gen Westen gestartet sei. Doch bei Hans Schöffel war es tatsächlich so. Nur, dass er nie darüber sprechen würde, wie es ihm gelungen war, die Ju 52 zu besteigen.
Der Brennmeister der Thalmeyerschen Porzellanmanufaktur war im Juli 1941 eingezogen und sogleich an die Ostfront geschickt worden. Ein Antrag, ihn als Angehörigen eines kriegswichtigen Berufs vom Kriegsdienst zurückzustellen – die Manufaktur hatte bereits begonnen, Isolatoren herzustellen –, wurde abgelehnt. Möglicherweise hatte das mit der sozialdemokratischen Vergangenheit des Brennmeisters zu tun, die im Wehramt in einer Aktennotiz vermerkt war.
Er kam zur Sechsten Armee, XI. Korps, Infanterie, das kurz zuvor von der Westfront abgezogen worden war, schon hundert Kilometer tief in Russland stand und bis zu den Ölfeldern im Kaukasus vordringen sollte.
Es ging munter und ohne größeren Widerstand voran, der Sommer war heiß, die Luft schwirrte vor lauter Mücken, an manchen Nachmittagen verdunkelten die Biester die Sonne. Über ihren Köpfen flogen die He-111-Bomber und Stukas hinweg.
Ein paar Nähmaschinen kreisten in der Ferne, alte russische Doppeldecker, aber sie richteten keinen großen Schaden an und verschwanden bald ganz. Der Lärm der Front, ein stetes Donnergrollen, war weit weg. Schöffel ließ sich einen Bart wachsen, weil das alle machten. »Weihnachten sind wir wieder zu Hause«, sagte ein Kamerad. Schöffel war skeptisch. Das hatten, wusste er, die Soldaten im Ersten Weltkrieg auch geglaubt. Aber sie hatten damals ja keine Luftwaffe gehabt, die ihnen offenbar die gröbste Arbeit abnahm. Und es war ja auch eine Pracht, wie die Tiefflieger über ihre Köpfe hinwegfegten! Ja, vielleicht war das alles tatsächlich bald vorbei, und er wäre bald schon wieder in Selb, vielleicht mit einem Orden.
Dann wurden die Zeiten rauer, der erste Winter setzte ein, die Offensive der Wehrmacht kam zum Stehen. In requirierten Quartieren rund um Charkow machte man es sich gemütlich, während der Schnee sich meterhoch türmte. Schöffel teilte einen Dachboden der Kate eines Gutshofs mit sechs Kameraden. Für einen Krieg, dachte er, ging es eigentlich, trotz der Mäuse, die nachts zwischen ihnen hin- und herhuschten. Kamerad Unold hatte eine junge Fichte gehackt und mit aus Dosenblech ausgeschnittenen Sternen zum Weihnachtsbaum geschmückt. Vor Moskau wurde noch erbittert gekämpft, die Wehrmacht könne schon, so hieß es, die Zwiebeltürme des Roten Platzes sehen. Na, der Stalin würde sicher ein heißes Weihnachten erleben, die Dicken Berthas standen bestimmt schon in Position, um ihm ein hübsches Feuerchen zu entfachen!
Dann hieß es plötzlich, der Russe hätte zum Gegenschlag ausgeholt, mit ganz frischen sibirischen Einheiten. Die Wehrmacht – ja war das denn möglich? – war sogar zurückgeworfen worden!
Hier unten im Süden war jedenfalls alles ruhig. Aber Hans Schöffel resümierte: Weihnachten war man nicht zu Hause.
Im neuen Jahr rückte das Grollen und Brummen der Front immer näher, nun ging es überhaupt nicht mehr flott voran. Der Frühling war verregnet, im Sommer wurden sie von Jak-Tieffliegern angegriffen, von der Luftwaffe war kaum noch etwas zu sehen. »Überdehnte Linien«, erklärte der Oberleutnant auf der Latrine, als würde die Militärsprache alles besser machen. »Unsere Flughäfen sind zu weit von der Front entfernt.« Die Verluste stiegen. Der Herbst war warm und regenreich, die schweren Wagen kamen weder vor noch zurück. Mitte November fielen die Temperaturen ganz plötzlich, und der schneelose Frost verwandelte die verschlammten Wege zu buckligem, eisenharten Asphalt. Die Fahrzeuge kamen besser voran, aber das galt auch für die Rote Armee. Und dann passierte das Undenkbare: Der Russe war ihnen in den Rücken gefallen!
Und das war noch nicht alles: Aus dem OKW kam der Befehl, sich nach Osten zurückzuziehen, in Richtung Stalingrad. Sie sollten sich freiwillig in einen Kessel begeben!
Ein Irrsinn, fanden auch die Generäle.
Die Sechste Armee wird aus der Luft versorgt, versprach Göring.
In Gewaltmärschen rückten sie auf die Stadt an der Wolga zu, in der sich der Russe eingeigelt hatte und auf sie wartete. Es begann ein Kampf um jedes Haus, jeden Graben, jedes Kellerloch.
Und dann geraten sie in die Reichweite der Artillerie, das Unwetter bricht los. Urplötzlich steht da ein Wald von Flammen auf der Erde, Splitterhagel prasselt pfeifend auf sie ein, beißender Qualm wälzt sich über die eisige Fläche. Wände von Erdfontänen schießen empor, rücken immer näher heran. Die deutschen Divisionen schmelzen dahin, werden zerfetzt, erfrieren oder verhungern.
Oberst Wartberg schnappt sich Schöffel, er braucht einen Fahrer, Schöffels technische Expertise hat sich herumgesprochen. Wartberg, das Schwein, das bei Barbukin die Höhe 124,5 fünfmal am Tag nehmen ließ und ebenso oft aufgeben musste. Vierzig Prozent Verluste hat die Kampfgruppe allein auf diesem Hügel erlitten.
Wartberg trägt den Arm in der Schlinge, eine Splitterwunde.
»Wohin fahren wir?«
»Zum Flugplatz Stalingrazkij.«
Es ist der letzte Flugplatz, der der Sechsten Arme nach dem Fall von Ptomnik und Gumrak noch zur Verfügung steht. An einem Bunker kurz vor der Rollbahn hängt das Schild »Flugleitung«. So muss die Hölle aussehen: Vor dem Bunker drängen sich Verwundete und Verzweifelte, schreien und jammern und fluchen. Jeglicher Anstand, jegliche Menschlichkeit ist aus ihren Gesichtern gewichen, es geht ums nackte Überleben. Überall blutige Verbände, notdürftige Krücken, jede Menge Tragen, auf denen in der bitteren Kälte stöhnende Sterbende liegen. Oberst Wartberg bahnt sich mit Schöffels Hilfe einen Weg, winkt mit dem Wundzettel, jenem Karton mit dem roten Rand und dem Bändchen, das zum Ausfliegen berechtigt. Für einen Augenblick verstummt die Menge angesichts des Rangs des Obersts – ein allerletzter Überrest militärischen Drills. Doch dann regt sich Unmut, wird schnell zur Wut, zur Raserei: »Die hohen Tiere haben’s uns doch erst eingebrockt«, ruft einer, dessen Gesicht fast komplett verbunden ist. »Und jetzt will sich das Schwein schön ausfliegen lassen«, brüllt ein anderer mit sich überschlagender Stimme. Es wird geschubst und gestoßen, der Oberst stürzt zu Boden.
Und plötzlich hält Schöffel den Wundzettel in der Hand.
Jemand reißt ihn mit sich. »Los, los!« Sie rennen über das Rollfeld zur Ju mit den laufenden Motoren, vorbei an den beiden bewaffneten Offizieren, die noch für einen allerletzten Rest von Ordnung gesorgt haben, nun aber ihre Pistolen entsichern und auf die Menge zulaufen, um ihrem Offizierskameraden zu helfen. Schöffel springt in den Gepäckraum der Ju. Dort liegen die Verwundeten und halb Erfrorenen übereinander gestapelt, der Gestank ist kaum zu ertragen. Und doch: Er ist beinahe in Sicherheit, der Hölle fast entkommen. Die Ju hebt dröhnend ab, völlig überladen, doch allmählich klettert sie in die Höhe und dreht eine Kurve gen Westen. Aus dem Fenster sieht Schöffel, der am ganzen Körper zittert, wie die zweite Ju 52 startet, doch sie kann keine Höhe gewinnen; die linke Tragfläche streift die Piste, das Fahrgestell knickt ein, der Rumpf bohrt sich in den Schnee. Bruchlandung. Aus!
* * *
Niemand sollte ihn je fragen, wie er an Bord gekommen war. Bei der Landung in Isjum half er beim Ausladen der Verwundeten, und angesichts der Knappheit war er schnell wieder Soldat. Der Krieg sollte ihn bald wieder haben, aber nach den Erlebnissen von Stalingrad verfiel er in eine völlige Apathie, die ihn auch im schlimmsten Granatfeuer an der Front und im Hunger nach dem Krieg beinahe gelassen wirken ließ.
Die Schuld, ganz unberechtigt und unverdient dem sicheren Tod entkommen zu sein, lastete tonnenschwer auf ihm. Es war ein bedrückendes Erbe, das ihn nie mehr loslassen würde. Nach dem Krieg achtete er bei Spaziergängen darauf, kein Insekt zu zertreten, und selbst Mücken fing er in der Nacht mit einem Glas ein und ließ sie aus dem Fenster. Auch gegenüber seinen Mitmenschen empfand er so: Nie wieder wollte er einem anderen Wesen Leid antun.
Und deswegen stand er jetzt vor einem Dilemma.
Denn wie er es auch betrachtete: Die Abrechnungen stimmten nicht, das sagten die Papiere, in denen er alles kontrolliert hatte, ganz eindeutig aus. Und das konnte nur die Schuld eines einzigen Menschen sein: Willemsen, der sich ganz offenbar munter bedient hatte. Was tun? Schöffel musste einen Entschluss fassen.
Schließlich erhob er sich, ging von seinem Verschlag nicht weit von den Brennöfen in den ersten Stock und klopfte an Maries Bürotür.
Marie wusste sofort, dass da etwas nicht stimmte, denn Schöffels Gesicht war lang und sorgenvoll, ein seltener Anblick. Er hielt einen Stoß Papiere in beiden Händen und weit vor seinem Körper, als wären sie giftgetränkt.
5. Kapitel
Die Entlassung
Manchmal träumte sich Marie zurück in die Vergangenheit. Es waren nicht immer angenehme Träume, aber die Vergangenheit hatte den Vorteil, dass sie immer ein gutes Ende offerierte, denn schließlich war man ja hier, gesund und munter.
Doch nun hatte sie die Realität hart erwischt. Vor ihr lag das Bilanzbuch, aufgeschlagen. Im Büro staute sich die viel zu heiße Frühjahrsluft, von der tief stehenden Sonne zusätzlich aufgeheizt; sogar auf Brennmeister Schöffels Oberlippe bildeten sich Schweißperlen. Schöffel stand neben dem Schreibtisch, auch Fräulein Hennemanns fesche Kurzhaarfrisur klebte am Nacken. Sie saß auf einem der Besucherstühle, mit gezücktem Stenoblock. Joachim, Sophie und Harry standen neben Maries Schreibtisch, als Willemsen erschien. Alle vier Gesellschafter waren vor ihm versammelt.
Er hielt das Kinn emporgereckt und schien sich seiner Sache sicher. Marie wies ihm einen Platz am Schreibtisch zu und sah ihn lange an. Willemsen hielt dem Blick zunächst stand.
»Sie wissen, warum Sie hier sind?«, fragte Marie.
»Nein.«
»Nein?«
»Nein.« Willemsen sah etwas ratlos erst zu den dreien auf, dann zu Fräulein Hennemann, die das Gespräch fleißig mitstenografierte.
»Es geht um die Finanzen der Manufaktur.«
»Mit denen doch alles in Ordnung ist.«
Marie zog ein paar Blätter unter dem Bilanzbuch hervor und reichte eines davon Willemsen. Auch die drei Gesellschafter und Schöffel bekamen je ein Blatt.
Willemsen ließ das Papier sinken. Auf diesem Papier waren alle Entnahmen aufgelistet, die sich der Buchhalter gegönnt hatte – unter allerlei Fantasieangaben, die Schöffel und Marie nachgeprüft und widerlegt hatten.
»Fast zehntausend Mark in den letzten beiden Jahren.« Maries Stimme war kalt und leise. »Wo ist das Geld?«
Nur das Kritzeln des Stifts auf dem Stenoblock war zu hören. Doch auch dieses Geräusch verstummte bald. Es schien, als wartete die ganze Welt auf Willemsens Antwort.
Willemsen sammelte sich. »Das sind nur kurzfristige Entnahmen, völlig üblich.«
»Was soll das heißen, völlig üblich?«, rief Sophie nun empört.
»Ihr Vater hat mir immer vertraut.« Willemsen hielt sich an Marie, sackte aber zusehends zusammen.
»Wir haben Ihnen auch vertraut. Wo ist das Geld?«
»Nun, äh, ich hatte in der letzten Zeit ein wenig Pech, aber …«
»Fußballwetten, richtig?« Harry hatte es mit seinen Kontakten rasch herausgefunden.
»Ja, die Zeiten werden auch wieder besser, am Ende gleicht sich doch alles …«
»Sie werden sich schriftlich dazu verpflichten, das Geld in den nächsten zwölf Monaten zurückzuzahlen, und wir verzichten auf eine Anzeige«, erklärte Marie.
»Ich werde mein Möglichstes tun.« Willemsen bekam Oberwasser, vielleicht würde alles ja doch noch einigermaßen glimpflich ablaufen.
»Und wir vier sind uns einig, dass wir Sie entlassen müssen.« Es brodelte in Marie, doch sie blieb kühl und sachlich. Sophie, die vor Wut zitterte, konnte ihre große Schwester nur bewundern.
Ein Ruck erfasste Willemsens Körper, er saß nun ganz senkrecht vor Marie, sein Gesicht verzerrte sich.
»Das können Sie nicht tun«, flüsterte er leise. Dann, lauter: »Das können Sie nicht tun!«
»Danken Sie uns, dass wir nicht die Polizei rufen!« Joachim hatte für den Rest seines Lebens genug von allen kleinkriminellen Schlawinern und Vorteilssuchern.
Nun sprang Willemsen auf und haute auf den Tisch. Die Geste missglückte ihm gründlich, die Faust rutschte von einem Stapel Papier ab, und das machte ihn nur noch wütender.
»Ohne mich würde es diese Manufaktur schon längst nicht mehr geben!«, schrie er. »Ich habe diese Manufaktur mit Ihrem Vater durch den Weltkrieg gebracht! Das Geld stand mir zu! Es war genauso gut meines wie eures!«
»Sie überschätzen sich maßlos«, sagte Harry, legte ihm die Hand auf die Schulter und drückte auf einen neuralgischen Punkt unterhalb des Schlüsselbeins. Willemsen fiel in den Sitz zurück.
»Haben wir uns wieder im Griff?«, flüsterte er Willemsen ins Ohr. Der stöhnte vor Schmerz und nickte.
»Bringen wir es hinter uns«, sagte Marie. »Hier ist die Vereinbarung mit der Verpflichtung zur Rückzahlung des Geldes. Seien Sie doch so freundlich und unterschreiben Sie hier und auch hier.«
Willemsen knurrte und unterschrieb.
Marie holte ein weiteres Papier hervor. »Und hier ist Ihre Entlassung. Begründung: betriebsbedingt. Das ist unser Entgegenkommen. Somit bekommen Sie Geld von der Arbeitslosenversicherung.«
»Ihr Entgegenkommen kann mich mal. Sie werden …«
Harry trat einen entschlossenen Schritt auf Willemsen zu, der sofort verstummte.
»Die Kündigung gilt ab sofort«, teilte Marie ihrem langjährigen Buchhalter mit. »Ihr Büro ist abgeschlossen, Jacke und Aktentasche liegen unten am Eingang.«
»Das wird Folgen haben! Schwere Konsequenzen!« Sein Schimpfen war noch zu hören, bis er die Eingangstür zur Manufaktur mit voller Wucht zuschlug.
Nur Fräulein Hennemann blickte ihm sehnsuchtsvoll nach, doch das sah Willemsen nicht mehr.
»Wir konnten nicht anders«, sagte Marie zu den anderen. Aber sie sagte es vor allem zu sich selbst.
6. Kapitel
Die Pasta
Sie war klein und zerbrechlich, noch viel kleiner und zerbrechlicher, als sie auf der Bühne gewirkt hatte, und der Teller mit den Nudeln schien viel zu groß für sie. Doch sie nahm einen heroischen Kampf auf, wickelte die Nudeln mit großem Geschick auf die Gabel und aß mit erstaunlichem Appetit. Und wie schon im Club war Joachim Thalmeyer von der ungeheuren Energie dieser zierlichen Person überrascht.
Joachim, Bernhard und Caterina, die junge Sängerin aus dem Nürnberger Club, hatten sich in Giuseppe Espositos Bella Venezia in Selb getroffen.
»Du hast alles, was es braucht«, sagte Joachim.
Caterina tupfte sich mit der Serviette die Mundwinkel ab. »Danke, aber gut singen können viele.«
»Nicht wie du. Es müssen nur vernünftige Songs her. Die in die Zeit passen.«
»Ich habe doch meine Songs.«
Joachim schüttelte den Kopf. »Die reichen nicht. Du musst moderner werden. Die Leute wollten neue Themen.«
»Fernweh, Italien, Frankreich«, ergänzte Bernhard.
»Und an deinen Namen müssen wir ran«, sagte Joachim. »Caterina Innocenti, das kann doch keiner aussprechen. Wie wäre es mit Caterina Bravo? So ein Name bleibt beim Publikum hängen.«
»Brava, nicht Bravo«, verbesserte Esposito, der den Hauptgang brachte, köstlich duftendes Saltimbocca.
»Caterina Brava also. Gefällt dir das?«
»Wenn ihr meint. Aber Caterina Bravo ist besser.« Sie blickte keck auf. Joachim merkte, dass sie ein taffes Mädchen war.
Ein Stoß frischer Luft fegte durch den Raum, im Hintergrund rumorte es. Harry Kruskopp und seine Frau Sophie, gebürtige Thalmeyer, betraten das Bella Venezia, und sie wurden von jedem Tisch freudig begrüßt – und natürlich auch vom Wirtspaar und ihrem Sohn.
Joachim sprang auf und winkte die beiden herbei.
»Was für eine Überraschung«, freute sich Maries kleine Schwester und gab Joachim einen dicken Kuss auf die Wange, der einen Lippenstiftabdruck hinterließ. Zwei Stühle wurden herangerückt, und Bepi, wie Giuseppe sich gern nennen ließ, stellte eine Flasche Chianti-Wein auf den Tisch – er kannte Harry, seinen allerliebsten Stammgast.
Joachim stellte dem Paar die Sängerin vor, und schon bald waren sie in ein munteres Gespräch vertieft, das sich vor allem darum drehte, wie sie aus der jungen Caterina, einer gebürtigen Italienerin, die aber in Frankreich aufgewachsen war, einen Star machen würden. Nur Caterina blieb still, hörte aber mit großen Augen zu.
»Und du«, sagte Caterina plötzlich zu Joachim, »bist ab jetzt mein Agent?«
Joachim war irritiert, diese Direktheit war er nicht gewohnt. Aber er nickte.
»Und was willst du dafür?«
Fantastisch, diese filigrane Frau.
»Fünfzehn Prozent.«
»Von allem?«
»Von allem.«
Caterina kaute wie nachdenklich auf ihrem letzten Stück Saltimbocca und nahm danach einen Schluck Chianti. Sie verstand es, zu verhandeln.
»Zehn Prozent«, sagte sie schließlich.
Joachim räusperte sich. »Fünfzehn Prozent in den ersten zwei Jahren, danach zehn Prozent.«
»Fünfzehn Prozent im ersten Jahr, danach zehn Prozent. Laufzeit zwei Jahre. Ich muss ja wissen, ob du abile bist.«
Joachim blickte in grinsende Gesichter. Caterina Innocenti, die seit ein paar Minuten Caterina Bravo hieß, schob ihre schmale Hand über den Tisch, Joachim ergriff sie. Und es gab Applaus, sogar von den Nachbartischen, die gar nicht wussten, worum es ging. Und Harry orderte eine Flasche Champagner. Die war teuer. Aber Bepi spendierte sie. Er ahnte, dass sich hier etwas Großes anbahnte.
7. Kapitel
Püppchen
Das Jahr ließ sich weiterhin gut an, die Auftragsbücher waren voll, die Menschen gesund, die Weltlage schien sich zu normalisieren, und an den Russen hatte man sich gewöhnt. Manches Mal musste Marie sich kneifen.
Am Samstag zu Abend und am Sonntag zu Mittag aßen sie alle gemeinsam, das wollte die Familientradition so. Und die Möglichkeit, alles zu essen, was man wollte, und so viel zu essen, wie man wollte, war immer noch faszinierend, beinahe unglaublich. Marie war ein Kind gewesen, als die Nazis an die Macht kamen, und eine Jugendliche, als der Krieg ausbrach. Hungern mussten sie bei den Thalmeyers nie, aber manches Mal gab es über Wochen nur dünne Suppen mit kraftlosem Gemüse drin, kaum genug für alle.
Doch jetzt: frisches Brot, warm und duftend aus dem Ofen. Eine Käse- und Aufschnittplatte. Eine Schüssel aus bestem Thalmeyerschen Porzellan mit dampfenden Kartoffeln, bestreut mit Petersilie. Hühnerkeulchen mit Paprika auf einem Bett aus Röstzwiebeln, Gulasch mit Majoran, Rinderbraten in tiefbraun glänzendem Fond. Kalbsmedaillons in Madeira-Sauce oder Kaninchenragout mit Wacholderbeeren oder Lammkeule mit Knoblauch und brauner Butter. Köstlich knackige grüne Bohnen, Erbsen und Karotten, Champignons mit fein gehackten Schalotten und Zitronensaft. Eierkuchen und Obstsalate mit exotischen Früchten wie Bananen. Nie würde Marie Linas verstörten Blick vergessen, als Harry ihr zum ersten Mal eine Ananas vom Markt mitbrachte. Zu dritt rückten sie der Frucht mit allerlei Küchenutensilien zu Leibe.
Und heute saßen die Schwestern Marie und Sophie mit Sophies Mann Harry und Maries kleiner Tochter Jana am Tisch, während Lina aus der Küche die Köstlichkeiten heranbrachte. Es war ein Traum, ein Schlaraffenland, und Marie hütete sich davor, dies als Selbstverständlichkeit zu betrachten. Nicht, solange der Russe in nur zwei Kilometern Entfernung stand.
Lina hatte sich sogar an ein Risotto als Beilage gewagt, denn sie verband ja mit Giuseppe eine ungewöhnliche kulinarische Freundschaft. Sie lernte von ihm diese rätselhaften italienischen Spezialitäten kennen, und er bekam von ihr Nachhilfe bei all den traditionellen fränkischen Gerichten, etwa dem Schäufele, jenem Schulterstück vom Schwein, das mit Knochen und Fettschwarte gebraten wird. »Im Knochen ist der wahre Geschmack«, pflegte Lina zu sagen. Das Schäufele war so beliebt, dass Giuseppe es auch im Bella Venezia jeden Sonntag auf die Karte setzte, allerdings mit Bandnudeln statt Kartoffeln. »Un tocco d’Italianità«, scherzte er.
Doch hier und heute, beim Abendessen am Samstag in der Thalmeyerschen Villa außerhalb des berühmten Porzellanortes Selb, gab es kein Schäufele, sondern zum ersten Mal Risotto zu einem Hammelschaschlik. Dazu hatte Lina Zwiebelwürfel in einer Kasserolle in Butter angeschwitzt und den trockenen Reis zehn Minuten lang mitgeröstet, dann anderthalb Liter Rinderbrühe hinzugegeben und alles auf ganz kleiner Flamme fünfundzwanzig Minuten ziehen lassen. Kurz vor Schluss gab sie einige Safranfäden hinzu, die, obwohl es doch nur verschwindend wenige waren, das ganze Risotto sofort rötlich färbten. Zum Ende noch ein Stück Butter und Reibekäse hinzu – ah, das Risotto schmeckte köstlich, den Hammel wollte keiner mehr. Bloß Jana, die ansonsten eine gute Esserin war (»una buona forchetta« nannte Giuseppe sie, wenn sie bei ihm aßen) hatte keinen Hunger, da halfen auch keine Ermunterungen.
»Sie wird geschnitten«, erklärte Marie, die erst am Vortag mit den Kindergärtnerinnen gesprochen hatte.
Sophie zog die Augenbrauen zusammen. »Im Kindergarten?«
»Ja.«
»Von den anderen Kindern oder auch von den …?«
»Ja, auch von denen.« Marie und Sophie sprachen von den Kindergärtnerinnen. Auch die wollten mit dem unehelich geborenen Kind offenbar nichts zu tun haben.
Sophie beugte sich zu Jana vor, die in ihrem Risotto herumstocherte. »Wer ist gemein zu dir?«, fragte sie mitfühlend. Jana ließ die Gabel sinken und blickte ins Leere.
»Ich werd’s denen schon zeigen«, bemühte Harry sich um Humor, während er die zweite Flasche Wein entkorkte.
»Alle«, murmelte Jana kleinlaut.
»Hast du keine Freundin?«
Jana schüttelte den Kopf.
»Mach dir nichts draus. Ganz bald wirst du eine Freundin finden«, versprach ihr Sophie. »Eine richtig gute Freundin, mit der du viel erleben wirst.«
»Und du hast ja noch Püppchen«, tröstete Marie sie.
Da begann Jana heftig zu schluchzen, und Marie krampfte es den Magen zusammen. Ja, wo war Püppchen? Sie saß nicht auf Janas Schoß, wie bei jeder Mahlzeit. Zwischen all den herzzerreißenden Schluchzern stellte sich heraus, dass ein anderes Kind ihr Püppchen weggenommen hatte, und die Kindergärtnerinnen hatten nicht eingegriffen.
»Morgen werde ich mit der Leiterin sprechen«, beschloss Marie.
»Warum willst du das tun?«, fragte Sophie scheinbar unschuldig, beugte sich zu Jana und nahm sie bei den Schultern. Jana weinte nicht mehr. »Wehr dich, setz dich durch. Hol dir Püppchen wieder. Du bist stärker als die anderen, das weiß ich!«
»Sie ist vier«, fuhr Marie ihre kleine Schwester an.
»Wann soll sie es denn lernen? Mit vierundzwanzig?« zischte Sophie zurück.
* * *
Am nächsten Tag brachte Marie ihre Tochter zum Kindergarten, doch die Leiterin hatte sich krank gemeldet. Aber schon am Tag darauf kam Jana mit Püppchen heim. Püppchen sah etwas zerrupft aus. Lina richtete das mit Nadel und Faden rasch wieder.
Es sollte sich nie ganz aufklären, wie Jana Püppchen zurückbekommen hatte. Hatte sie sich durchgesetzt? Hatte eine der Kindergärtnerinnen ein Einsehen gehabt? Sosehr Marie auch insistierte, bekam sie die wahre Geschichte nie heraus.
Die wahre Geschichte lautete nämlich folgendermaßen: Die Leiterin des Kindergartens, die sich krank gemeldet hatte, tauchte in Harrys Apotheke auf und bat um Aspirin, dieses neue Wundermittel, das doch so schwer zu bekommen war. Und Harry zeigte sein breitestes Lächeln mit den vielen Zahnlücken und angelte ihr »das allerletzte« Päckchen, das »eigentlich schon reserviert« war. Dafür bat er die Leiterin mit gespielter Verlegenheit um einen kleinen Gefallen, welcher sich um eine alte Puppe in schicker Tracht drehte.
8. Kapitel
Im Wald
»Nun lass ihn schon los!«
»Nein!«
»Zier dich nicht!«
»Vater hat gesagt …«
»Ach, Vater!«
Marie und Sophie waren mit Wolfi unterwegs. Wolfi war keine fünf Monate alt, ein lustiger Pelzball mit großen Pfoten, die nicht recht wussten, wohin sie tapsten. Er tollte herum, trank aus Bächen, biss in den Löwenzahn und spuckte ihn wieder aus. Marie und Sophie hatten ihn an einer ledernen Leine, denn er war noch längst nicht ausgewachsen, und schon gar nicht erzogen. Immer wieder wurde er im Sprung gebremst und schaute die beiden vorwurfsvoll an.
Und Sophie wollte ihn bei diesem Spaziergang durch den Selber Forst unbedingt losbinden. Marie war zwölf, Sophie noch keine neun. Sie hatten den Wunsiedler Weiher schon passiert und waren fast zwei Kilometer südlich von Selb angelangt – ein langer frühsommerlicher Spaziergang. Der Krieg war noch fern. Joachim hatte eigentlich mitgehen sollen, doch der hörte lieber seine Platten mit der komischen Musik, mit der Marie und Sophie noch nichts anzufangen wussten.
Marie blickte sich um und seufzte. Spaziergänger waren auf dem schmalen, von Fichten gesäumten Weg nirgends zu sehen. »Also schön.«
Sophie beugte sich zu Wolfi und löste die Schlaufe des Halsbandes. Und Wolfi konnte seine plötzlich gewonnene Freiheit kaum glauben, testete sie ein paar Schritte lang, sprang dann verzückt an den Beinen der beiden empor, der Schwanz wedelte unaufhörlich. Doch dann verhärtete sich seine Positur, er richtete die Ohren auf und spähte in den Wald.
Und dann spurtete er los, wie wild, mitten durch die wilden Büsche am Wegesrand, die sich hinter ihm schlossen.
»Wolfi! Wolfi!!«
Die Schwestern blickten einander erschrocken an und stürzten hinterher.
In den dicht stehenden Fichten neben den Wegen war es dunkel, nahezu das gesamte Sonnenlicht verschwand urplötzlich. Da hinten, ein Schatten – das musste Wolfi sein! Sie riefen und liefen ihm hinterher, Äste schlugen ihnen ins Gesicht, Brennnesseln zerstachen ihnen die Beine. »Wolfi!«
Nach ein paar Minuten blieben sie erschöpft stehen und holten Luft.
»Wir hätten ihn nicht …«
»Jaja, du weißt ja immer alles vorher!«
Marie sah erneut etwas im Unterholz. Sie zerrte ihre Schwester mit sich. »Wolfi!« Sie gerieten an eine kleine Lichtung. »Wolfi!«
Doch Wolfi blieb verschwunden. Immer wieder hörten sie Geraschel und irrten mal hierhin, mal dorthin, bestimmt eine halbe Stunde lang. Die wenigen Sonnenstrahlen, die durch die Nadelkronen brachen, waren nahezu waagerecht – bald würde es Nacht werden.
»Wir müssen zurück und Joachim und Vater Bescheid sagen«, entschied Marie. Ihre Füße schmerzten.
Sophie nickte. »Wo geht es zurück?«
Marie blickte sich um. »Dort.« Und sie hoffte, dass sie entschlossener klang, als ihr zumute war.