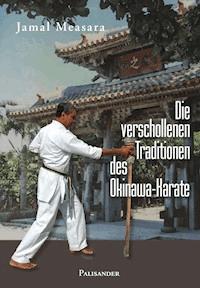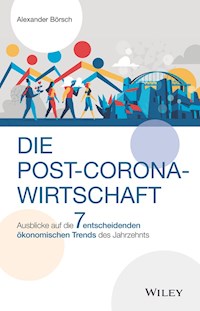
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Welche wirtschaftlichen Trends werden die 2020er-Jahre nach der Corona-Pandemie prägen? Mit welchen Veränderungen müssen wir rechnen und was wissen wir über den kommenden Wandel? Alexander Börsch gibt mit seinem Buch einen kompakten und gut verständlichen Ausblick auf die kommenden ökonomischen Trends, auf die sich Unternehmen, Arbeitnehmer, Investoren und die Politik vorbereiten müssen. Der Wandel, der uns bevorsteht, wird von drei Kräften angetrieben. Die demographische Entwicklung führt zu einem nie dagewesenen Generationen-Mix, neue digitale Technologien wie die Künstliche Intelligenz treiben die Transformation der Wirtschaft voran, während die Politik wichtige Spielregeln neu definiert. Diese Kräfte prägen wirtschaftliche Trends in ganz unterschiedlichen Bereichen. Eine neue Phase der Globalisierung bricht an, die Dienstleistungsökonomie transformiert sich und die Erfolgsfaktoren von Standorten wandeln sich. Gleichzeitig verändern sich Arbeits- und Konsumentenmärkte, ebenso wie Unternehmen, die neue Erwartungen in Sachen Nachhaltigkeit und Transparenz erfüllen müssen. Damit werden auf persönlicher, unternehmerischer und internationaler Ebene die Karten für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit neu verteilt. Ohne die Unsicherheiten zu vernachlässigen, analysiert Alexander Börsch, welche ökonomischen Trends sich gegenwärtig entfalten, woher sie ihre Dynamik beziehen und wie sich in den 2020er-Jahren voraussichtlich weiterentwickeln werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Ähnliche
Alle Bücher von WILEY-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
© 2022 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Print ISBN: 978-3-527-51093-1ePub ISBN: 978-3-527-83648-2
Umschlaggestaltung: Susan Bauer, HeppenheimCoverbild: Hurca! - stock.adobe.com
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Vorwort
Einleitung: Auf dem Weg zur Post-Corona-Wirtschaft
Was ökonomische Trends für Unternehmen bedeuten
Von Mega- zu Makrotrends
Die Treiber des Wandels
Unsicherheiten und schwarze Schwäne versus Trends
Die 7 Trends der Post-Corona-Wirtschaft
Anmerkungen
1 Die neue digitale Dienstleistungsökonomie
Die historische Transformation Richtung Dienstleistungen
Dienstleistungen als Beschäftigungsmotor
Die analoge und digitale Produktivität von Violinquartetten
Die verschwimmenden Grenzen zwischen Industrie und Dienstleistungen
Alles als Service
Sicherheiten und Unsicherheiten für die Dienstleistungsökonomie 2030
Anmerkungen
2 Die nächste Phase der Globalisierung
Vom Dampfschiff zur Hyperglobalisierung und zur Stagnation
Die Dienstleistungs-Globalisierung
Die künftigen Wachstumssektoren
Corona und die Globalisierung
Die Handelskonflikte der 2020er-Jahre
Sicherheiten und Unsicherheiten für die Globalisierung 2030
Anmerkungen
3 Die neuen Dimensionen der Wettbewerbsfähigkeit und die Produktivitätsherausforderung
Analoge Wettbewerbsfähigkeit
Die neue digitale Innovationslandschaft
Die digital führenden Länder
Das Produktivitätsrätsel
Demographie meets Produktivität
Die digitale Spaltung der Unternehmenslandschaft
Konturen der nächsten digitalen Wirtschaft
Sicherheiten und Unsicherheiten für die Wettbewerbsfähigkeit 2030
Anmerkungen
4 Städte und der neue Standortwettbewerb
Cluster, Ökosysteme und das gesellige Unternehmen
Magnetische Städte
Wo digitale Multis investieren und sich ansiedeln
Wo liegt das deutsche Silicon Valley?
Neue Tech Hubs in den 2020er-Jahren
Das Ende der Tech Hubs durch Corona?
Sicherheiten und Unsicherheiten für die Tech Hubs 2030
Anmerkungen
5 Der kommende Wandel auf dem Arbeitsmarkt
Ein Blick zurück: die letzte digitale Revolution
Strukturwandel in Aktion
Automatisierung bringt Wohlstand – und Unruhe
Die demographische Zukunft des Arbeitsmarktes
Weniger Arbeitskräfte, mehr Inflation?
Y, W, Z – Der neue Generationenmix
Erwartungen der Generation Z: anders als gedacht
Gig Economy for Grannies
Die technologische Zukunft des Arbeitsmarktes
Der lange Weg von der Innovation zum Arbeitsmarkt
Die unvollkommene Automatisierung
Der menschliche Wettbewerbsvorteil
Automatisierung und Nachfrageänderungen im Zusammenspiel
Die Jobs der Zukunft
Sicherheiten und Unsicherheiten für die Arbeitsmärkte 2030
Anmerkungen
6 Die neuen Konsumenten
Disruption durch Alterung
Der neue Alters-Mix
Die globale Silver Economy
Generational Economics
Generational Business
Makroökonomische Verschiebungen: Das asiatische Jahrzehnt
China als Wirtschaftsmacht Nummer 1
Die neue Mittelklasse
Die nächste Phase der Urbanisierung
Die Vermehrung der Mega-Cities
Städte als Konsumentenmärkte
Corona und die Urbanisierung
Sicherheiten und Unsicherheiten für die Konsumentenmärkte 2030
Anmerkungen
7 Die Nachhaltigkeits-Transformation und die neuen Erwartungen an Unternehmen
Die neuen gesellschaftlichen Erwartungen
Die neuen Erwartungen von Finanzmärkten und Investoren
Die Entwicklung nachhaltiger Investments
Die neuen politischen Rahmenbedingungen
Nachhaltigkeit und die künftige Handelspolitik
Nachhaltigkeit, Produktion und die zirkuläre Wirtschaft
Ein neues Transparenzlevel
Das gläserne ESG-Unternehmen
Von Shareholdern zu Stakeholder-Systemen?
Neue Formen von Stakeholder-Systemen
Sicherheiten und Unsicherheiten für die nachhaltige Wirtschaft 2030
Anmerkungen
Implikationen: Bereit für die 2020er-Jahre
Das Paradox langfristiger Trends und die Verhaltensökonomie
Die unternehmerischen Herausforderungen der 2020er-Jahre
Die politischen Herausforderungen der 2020er-Jahre
Corona und die Produktivität
Die neuen Roaring 20s?
Anmerkungen
Über den Autor
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Illustrationsverzeichnis
Einleitung
Abbildung E.1: Die 7 Trends der Post-Corona-Wirtschaft
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Beschäftigungszuwachs in Deutschland 2010 bi...
Abbildung 1.2: Investitionsabsichten deutscher Großunterneh...
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Entwicklung der weltweiten Exporte im Güterh...
Abbildung 2.2: Weltweite Güter- und Dienstleistungsexporte ...
Abbildung 2.3: Stilisierte Phasen der Globalisierung in der Nach...
Abbildung 2.4: Wachstum der globalen Exporte von Dienstleistunge...
Abbildung 2.5: Entwicklung der weltweit generierten Datenmenge v...
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Unternehmen mit den höchsten Forschungs- und...
Abbildung 3.2: Ranking der digitalen Wettbewerbsfähigkeit d...
Abbildung 3.3: Wachstum der Arbeitsproduktivität in OECD L...
Abbildung 3.4: Produktivitätsentwicklung von Unternehmen na...
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Zusammenhang Wohlstand und Technologieberufe in deut...
Abbildung 4.2: Ranking deutscher Tech Hubs nach Status und Potenz...
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Entwicklung der globalen Wirtschaftsleistung in de...
Abbildung 5.2: Entwicklung der Arbeitsbevölkerung (20-65 Ja...
Abbildung 5.3: Größe der einzelnen Generationen in Deu...
Abbildung 5.4: Nachfrage nach Berufen bis 2035 und Ersetzbarkeit...
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen (...
Abbildung 6.2: Prognose des realen Wirtschaftswachstums in den 2...
Abbildung 6.3: Prognose der Konsumausgaben für ausgewä...
Abbildung 6.4: Entwicklung der städtischen Bevölkerung...
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Entwicklung der Einstellungen zum Klimawandel in ...
Abbildung 7.2: Sorgen der Generation Z und der Millenials, Daten...
Abbildung 7.3: Einschätzung von europäischen CFOs zum ...
Abbildung 7.4: Treibende Akteure für die Klima-Entscheidung...
Implikationen
Abbildung I.1: Entwicklung des Unsicherheitsindex seit 1997...
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung: Auf dem Weg zur Post-Corona-Wirtschaft
Fangen Sie an zu lesen
Implikationen: Bereit für die 2020er-Jahre
Über den Autor
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
233
234
235
236
237
238
239
Gender-Hinweis:
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung alle Geschlechter, auch wenn aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet wird.
Vorwort
Ohne Herrmann Hesse zu nahe treten zu wollen, nicht jedem Anfang wohnt ein Zauber inne: Letzteres trifft eindeutig auf den Beginn der 2020er-Jahre zu! Noch während rund um den Globus das neue Jahrzehnt begrüßt wurde, breitete sich erst schleichend, dann explosionsartig SARS-COV-2 aus; die Pandemie veränderte unser Leben schlagartig und einschneidend. Der Wandel, der durch Corona ausgelöst wurde, ist weitreichend, aber er ist weit davon entfernt, der einzige Treiber der Veränderung in dem vor uns liegenden Jahrzehnt zu sein. Die neue Dekade hält noch ganz andere Veränderungen für uns bereit – als Konsumenten, als Arbeitnehmer, als Unternehmer und als Investoren.
Diese Veränderungen sind das Thema dieses Buches: Was treibt sie an, was verändert sich und was wissen wir über den kommenden Wandel? Anders gefragt, was sind die längerfristigen ökonomischen Trends, die die Wirtschaft und ihre Rahmenbedingungen im neuen Jahrzehnt prägen werden? Wie Bill Gates einmal sagte, überschätzen wir oft den Wandel in den nächsten zwei Jahren und unterschätzen den in den nächsten zehn Jahren.
Angetrieben wird der Wandel, der uns bevorsteht, von drei Kräften.
Erstens schlägt der demographische Wandel im neuen Jahrzehnt voll durch und wird das erste Mal unmittelbar spürbar. Die Auswirkungen sind kaum zu überschätzen. In der bisherigen Menschheitsgeschichte gab es immer sehr viel mehr Junge als Alte, die Geschichte kennt nur junge Gesellschaften. Jetzt aber dreht sich dieses Verhältnis in vielen Teilen der Welt um: Im Jahr 2018 lebten erstmals mehr Senioren als Kinder unter sechs Jahren auf dem Planeten. Damit bewegen wir uns in weiten Teilen der Welt unaufhaltsam auf einen nie dagewesenen Generationen-Mix zu. Dieser Mix bestimmt maßgeblich, welche Jobs, welche Produkte und welche Dienstleistungen gefragt sein werden.
Die zweite treibende Kraft bleibt die Technologie. Kunden kaufen per Sprachbefehl im Internet ein, Unternehmen optimieren computergestützt die Wartung ihrer Maschinen, Städte den Lebensraum ihrer Bürger – alles mit Hilfe von Algorithmen. Neue digitale Technologien wie die Künstliche Intelligenz treiben die Transformation der Wirtschaft voran. Allerdings, wie immer, wenn Technologie den Charakter der Wirtschaft beeinflusst, gibt es Gewinner und Verlierer. Auf persönlicher, unternehmerischer und internationaler Ebene werden die Karten für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit neu verteilt.
Die dritte Kraft ist die Politik, die wichtige Spielregeln neu definieren wird. Auch wenn politische Entscheidungen kaum vorherzusehen sind, eine Tendenz ist klar und findet aktuell den Weg ins Gesetzbuch, nämlich die Nachhaltigkeit. Das nahende Ende des Verbrennungsmotors ist ein Beispiel dafür, aber Nachhaltigkeit wird auch die Produktion, die Geldanlage und sogar den internationalen Handel verändern.
All diese Entwicklungen werden uns persönlich betreffen und unser Leben im neuen Jahrzehnt prägen. Ist mein Job sicher? Oder kann ihn auch die Künstliche Intelligenz erledigen? Ist mein Unternehmen bereit dafür, sich auch unter neuen Bedingungen im Wettbewerb zu behaupten? Oder hat es seine besten Jahre hinter sich? Ist mein Land zukunftsfähig? Oder wird es in der Liga der führenden Wirtschaftsnationen nach unten durchgereicht?
Bei genauerem Hinschauen ist das Bild nicht schwarz-weiß. Weder blinder Optimismus noch Untergangsstimmung sind angebracht. Die 2020er-Jahre sind das, was wir daraus machen. Wir haben es selbst in der Hand, die Entwicklung zu formen – und dafür müssen wir sie zuerst einmal genauer verstehen. Dabei gibt es eine gute Nachricht: Wir können mehr über die Zukunft wissen, als wir vielleicht glauben. Das Ziel dieses Buchs ist es daher, einen kompakten und gut verständlichen Überblick über die wichtigsten ökonomischen Entwicklungen zu geben, die auf den politischen und unternehmerischen Radar gehören.
Erzählen diese Trends die ganze Geschichte der nächsten Jahre? Mit Sicherheit nicht. Zum einen legt das Buch einen Fokus auf ökonomische Trends, was notwendigerweise kulturelle oder soziale Entwicklungen außer Acht lässt. Zum anderen werden viele Unsicherheiten auftreten. Das können Ereignisse wie die berühmten schwarzen Schwäne sein, die unwahrscheinlich sind, aber große Auswirkungen haben können – genauso wie Ereignisse und politische Entscheidungen, die völlig unabsehbar sind. Trotzdem: Das Verständnis von Trends gibt uns Orientierung in der Unsicherheit. In diesem Sinne können Trends wie ein Kompass verstanden werden, der die grobe Richtung angibt, aber nicht den Blick auf den Weg vor unseren Füßen ersetzt.
Manche Leser mögen einwenden, dass Prognosen in derart stürmischen Zeiten ein Ding der Unmöglichkeit sind. Genau deshalb geht es hier auch nicht um Prognosen. Niemand kann prophezeien, wo der Dax am Ende des Jahrzehnts stehen wird oder welches Start-up sich zum Tech-Giganten von morgen entwickeln wird. Wir wissen aber durchaus, welche Trends sich auf der makroökonomischen Ebene gegenwärtig entfalten, woher sie ihre Dynamik beziehen und wie sie sich voraussichtlich weiterentwickeln. In diesem Rahmen und auf diesem Spielfeld bewegt sich das Buch.
In der Einleitung erhalten Sie einen Überblick darüber, in welcher Weise ökonomische Trends Unternehmen beeinflussen, wie Trends und Unsicherheiten zusammenwirken und warum das Buch sich auf Makrotrends konzentriert. Die folgenden Kapitel widmen jedem Makrotrend eine eigene, in sich abgeschlossene Analyse. Eilige Leser können also auch Kapitel überspringen oder sich auf die Themen konzentrieren, die sie am meisten interessieren.
Die ersten vier Kapitel beschäftigen sich mit dem Wandel der Dienstleistungsökonomie und der Globalisierung, sowie der nationalen und städtischen Wettbewerbsfähigkeit. Die verbindende Klammer dieser Trends ist der strukturelle Wandel, ausgelöst durch digitale Technologien und digitale Wettbewerbsfähigkeit. Die nächsten beiden Kapitel analysieren, wie sich Märkte ändern, nämlich die Arbeitsmärkte und die Konsumentenmärkte, getrieben sowohl durch technologischen wie auch demographischen Wandel. Das letzte Kapitel befasst sich mit dem politisch angestoßenen Wandel im Nachhaltigkeitsbereich und der Frage, wie dies nicht nur das Unternehmensumfeld ändert, sondern auch die Unternehmen selbst: durch höhere Transparenz, durch den Einfluss neuer Anspruchsgruppen und neue Ziele.
Ein großes Privileg als Chefökonom von Deloitte ist es, sich mit ökonomischen Trends hauptberuflich beschäftigen zu können und sie mit vielen spannenden Menschen und Organisationen zu diskutieren. Das Buch baut damit auf einer Vielzahl von Deloitte-Research-Studien auf, ebenso auf Kolumnen, Blogs, Podcasts, Vorträgen und Diskussionen der letzten Jahre. Mein Dank gilt allen Kollegen, die an zugrundeliegenden Studien beteiligt waren, die dafür quantitative Modelle aufgesetzt und Umfragen durchgeführt haben, vor allem Mark Bommer, Dr. Michela Coppola und Julius Elting.
Für äußerst hilfreiche Anmerkungen zu dem Buchmanuskript, die dabei geholfen haben, es weiterzuentwickeln und sehr viel klarer zu machen, danke ich herzlich Nicolai Andersen, Sandy Becker, Mark Bommer, Julius Elting, Ralf Esser, Dr. Wolfgang Fengler, Dr. Michael Grampp, Alexander Schauer und Andreas Spannbauer. Für die Diskussion, in der die allererste Idee für das Buch im Sommer 2020 geboren wurde, danke ich Christopher Nürk und Dr. Thomas Schiller. Mein Lektor bei Wiley-VCH, Markus Wester, hat sich des Projekts von Anfang an mit großem Enthusiasmus angenommen und sehr dabei geholfen, es auch über die Ziellinie zu bringen. Widmen möchte ich das Buch meiner Frau Alexandra Börsch und unseren Kindern Lara, Sophia und Simon, die es klaglos hingenommen haben, dass ich für das Buch den Corona-Lockdown noch durch einen persönlichen »Lockdown« am Schreibtisch erweitert habe.
Einleitung: Auf dem Weg zur Post-Corona-Wirtschaft
Die Corona-Krise war eine Art Pause-Taste am Anfang des neuen Jahrzehnts. Die Welt war angesichts der Pandemie, der tiefen Rezession und der Lockdowns im fortgesetzten Krisenmodus. Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie werden uns ohne Zweifel im weiteren Verlauf der 2020er-Jahre begleiten. Allerdings werden die Corona-Krise und ihre Folgen nicht alleine und wahrscheinlich nicht einmal vorrangig die wirtschaftliche Entwicklung und die Rahmenbedingungen im neuen Jahrzehnt prägen. Die wirtschaftliche Entwicklung des letzten Jahrzehnts war durchaus von den Nachwirkungen der Finanzkrise beeinflusst, aber mindestens genauso vom Siegeszug der sozialen Medien, dem Aufstieg der Internet-Giganten, den neuen Konsummustern der Millenials oder den Entwicklungen auf den Immobilienmärkten.
Das neue Jahrzehnt wird wirtschaftlich von längerfristigen Trends geprägt werden, die die Struktur der Volkswirtschaften verändern und Unternehmen vor neue Herausforderungen stellen. Diese Trends, die sich am Anfang der Dekade abzeichnen, haben ihre Wurzeln in technologischen, demographischen und politischen Treibern. Zu ihnen gehören eine neue Phase der Globalisierung, ein tiefgreifender Wandel der wirtschaftlichen Strukturen, der Arbeitsmärkte und der Konsumentenmärkte genauso wie der Aufstieg des Nachhaltigkeitsgedankens. Diese Trends werden das Unternehmensumfeld prägen und den Kontext, in dem sich Unternehmen bewegen, verändern. Genauso beeinflussen sie die wirtschaftlichen Aussichten von Städten und Ländern, die sich in einem technologischen Standortwettbewerb mit neuen Rahmenbedingungen und Anforderungen wiederfinden.
Es geht allerdings nicht nur um Anpassung an neue Rahmenbedingungen. Neue Trends bringen genauso neue Chancen für Unternehmen und Standorte mit sich. Es kommt darauf an, was man aus diesen Trends macht. Ob nach der Corona-Krise wirtschaftlich die »Roaring Twenties« des 21. Jahrhunderts anbrechen, ist ungewiss, aber immerhin möglich. Wir wissen nicht, wie wir am Ende des Jahrzehnts auf die Dekade zurückblicken und welchen Namen wir ihr verleihen werden. Wir können aber abschätzen, in welchem Rahmen sich Erfolg oder Misserfolg abspielen wird.
In diesem Sinne hat das Buch zum Ziel, einen Ausblick auf die Trends zu geben, die in ökonomischer Hinsicht eine entscheidende Rolle in den nächsten Jahren spielen werden. Die Absicht ist nicht, punktgenaue Prognosen zu machen, die über einen so langen Zeitraum in den allermeisten Fällen zum Scheitern verurteilt sind. Es geht vielmehr um die ökonomischen Trends, die von strukturellen Faktoren angetrieben werden und deswegen schwer umkehrbar sind. In der kommenden Dekade werden diese strukturellen Faktoren vor allem das Voranschreiten der Digitalisierung und demographische Trends sein, die Wandel in den wirtschaftlichen Strukturen und Märkten auslösen werden. Mit anderen Worten: Es geht um die langfristige Trendlinie hinter den kurzfristigen konjunkturellen Schwankungen. Diese langfristige Trendlinie kann uns verlässliche und wichtige Aufschlüsse über die Entwicklungen am Horizont geben, was die Wirtschaft prägen wird, und wie sie am Ende des Jahrzehnts aussehen könnte.
Natürlich gibt es bei einem Ausblick auf die 2020er-Jahre jede Menge Unsicherheiten. Am Anfang des letzten Jahrzehnts haben sehr wenige den Brexit vorhergesehen, den Aufstieg von Social Media, oder dass Deutschland nach der Finanzkrise einen wahren Beschäftigungsboom erleben würde. Der Ausblick auf die langfristigen Trends bedeutet nicht, dass es keine Überraschungen, unerwartete Ereignisse und Disruptionen geben wird. Der Ausblick ähnelt eher der Navigation hinter einer Milchglasscheibe, in der die Konturen des Wegs erkennbar sind, aber nicht, was genau auf dem Weg passieren wird. Das Buch beschäftigt sich deshalb mit den Trends, die die Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung im neuen Jahrzehnt sein werden, und von denen wir uns ziemlich sicher sein können, dass sie eintreten oder sich fortsetzen werden.
Die Corona-Krise spielt für die Post-Corona-Wirtschaft und die wirtschaftlichen Trends, die sie prägen werden, eine unterschiedlich starke Rolle. Sie setzte manche Trends wie Remote Working erst so richtig in Gang und beschleunigt sie. Sie stellt andere Trends in Frage, wie den Zuzug in die Städte. Sie verändert aber nicht die grundlegende Entwicklungsrichtung, die bei den meisten Trends durch Digitalisierung und Demographie bestimmt wird. Für die Gestalt der künftigen Arbeitsmärkte sind beispielsweise die Automatisierung, aber auch die künftige Nachfrage nach Berufen, die wiederum durch demographische Entwicklungen geprägt wird, die entscheidenden Faktoren. Auf den Konsumentenmärkten verstärkt die Krise den Aufstieg Asiens, weil die asiatischen Volkswirtschaften besser durch die Pandemie gekommen sind als die westliche Welt. Allerdings sind auch hier sozio-ökonomische Entwicklungen wie die Alterung der Gesellschaft der fundamentale Treiber, der die Entwicklung der Konsumentenmärkte bestimmt.
Was ökonomische Trends für Unternehmen bedeuten
Die Trends im Unternehmensumfeld prägen die Chancen und Risiken für Unternehmen und Industrien. Sie können Rücken- oder Gegenwind sein, aber auch neue Innovationsfelder aufzeigen. So gibt es nachhaltige oder ethische Geldanlagen schon seit Jahrzehnten, aber in den Anfängen waren sie fast ausschließlich für religiös orientierte Anleger gedacht. Erst das steigende Umweltbewusstsein in Verbindung mit neuen Investment-Ansätzen ließ sie zu einem enorm dynamischen Segment der Finanzwelt werden, das erfolgreiche Start-ups hervorbrachte und auch traditionelle Vermögensverwalter in großer Zahl anzog. In ähnlicher Weise bietet die Transformation der Wirtschaft Chancen für neue Innovationen und Geschäftsmodelle – und das nicht nur in den offensichtlichen Bereichen. Die zunehmenden Qualifikationsanforderungen der Arbeitswelt führen beispielsweise dazu, dass Hochschulen boomen, die sich auf die Aus- und Weiterbildung von Berufstätigen konzentrieren.
Der Wandel in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat unmittelbare Konsequenzen auf Unternehmen, die darauf strategisch reagieren müssen – am besten in seiner frühen Phase. Die Harvard-Managementprofessoren Mayo und Nohria haben untersucht, welche die wichtigsten Manager, Unternehmer und Innovatoren in den USA im 20. Jahrhundert waren, und haben für jedes Jahrzehnt einzeln die erfolgreichsten Unternehmen sowie Veränderungen im Unternehmensumfeld analysiert. Eines ihrer Kernergebnisse ist, dass sich der Erfolg nicht mit Persönlichkeitsmerkmalen oder der vermeintlichen Genialität der Unternehmenslenker erklären lässt. Die »contextual intelligence« von Unternehmenslenkern und Unternehmern, also das Verständnis und die Aufmerksamkeit für die Makro-Faktoren, war zentraler Bestandteil dieser Erfolgsgeschichten. Wie sich Unternehmen in den Wandel im demographischen, technologischen, politischen und sozialen Umfeld einfügten, war einer der Hauptfaktoren für die Erfolgs- und Wachstumsaussichten.
Dies galt beispielsweise für die Strategie von General Motors (GM) in den 1920er-Jahren, verschiedene Autovarianten in verschiedenen Farben statt des dominierenden, von Ford produzierten und einheitlich schwarz lackierten T-Modells anzubieten. Damit rückte General Motors Individualität und Konsumentenorientierung in den Mittelpunkt, was dem gesellschaftlichen Zeitgeist entsprach. GM konnte durch diese Innovation Ford überrunden und zum größten Autohersteller des Jahrzehnts werden. In den 1980er- Jahren schufen die Revolution in der Finanzwelt, durch neue Finanzierungsformen wie Private Equity, und der Beginn des Computer-Zeitalters ebenso völlig neue Chancen für Unternehmen und Innovatoren.1 In diesem Sinne kann ein Verständnis der entstehenden Trends der 2020er-Jahre dabei helfen, Unternehmensstrategien in die Richtung auszurichten, aus der Rückenwind kommen wird.
Von Mega- zu Makrotrends
Trends sind Veränderungen und Strömungen in Wirtschaft und Gesellschaft, die eine bestimmte Entwicklungsrichtung haben. Dank dieser Entwicklungsrichtung können Trends in die Zukunft fortgeschrieben werden. Trends haben dabei die Angewohnheit, eine Verbindung mit griechischen Begriffen für Maßeinheiten einzugehen, Megatrends, Mikrotrends oder gar Meta- und Gigatrends sind Beispiele. Diese Trendkategorien sind nicht einheitlich definiert und unterscheiden sich im Zeithorizont, ihrer Reichweite und Veränderungskraft. Mikrotrends sind beispielsweise erste kleinere Anzeichen von neuen Trends, die sich oft in neuen Produkten oder Start-ups zeigen. Vegane Burger sind ein Beispiel oder auch Mode aus recyceltem Plastik.
Am einflussreichsten und weitverbreitetsten sind die Megatrends geworden. Mit dem Begriff bezeichnete der Zukunftsforscher John Naisbitt Anfang der 1980er-Jahre strukturelle Verschiebungen und gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die über lange Zeiträume wirken – wie der Übergang zur Informationsgesellschaft, die Individualisierung oder eine stärker partizipatorische Demokratie.2 Megatrends wirken dabei sehr langfristig über mehrere Jahrzehnte. Meistens wird ihnen eine Dauer von mindestens 25 Jahren zugeschrieben. Sie haben globale Auswirkungen und betreffen alle oder fast alle Lebensbereiche. Megatrends wie Konnektivität oder Individualisierung sind insofern die ganz großen Strömungen, die die Welt bewegen. Sie können sich aus vielen Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und Ökologie entwickeln.
Im Rahmen dieses Buches soll es etwas bescheidener um die Makrotrends gehen; also die Trends, die eine Ebene tiefer angesiedelt sind und die konkret die Volkswirtschaft und Unternehmen in den 2020er-Jahren beeinflussen. Der Zeithorizont ist damit kürzer als bei den Megatrends und liegt bei fünf bis zehn Jahren. Der Fokus liegt auf den Trends aus dem technologischen, demographischen und politischen Bereich, die die Gesamtwirtschaft und das Unternehmensumfeld prägen werden. Die Makrotrends liegen damit zeitlich zwischen der Dauer eines Konjunkturzyklus, der vier bis fünf Jahre beträgt und von vielen kurzfristigen Faktoren beeinflusst wird, und den sehr langfristigen Megatrends. Sie sind die strukturellen Änderungen und Entwicklungen des wirtschaftlichen Rahmens, die bereits begonnen haben und deren Fortgang absehbar ist.
Die Facetten der Globalisierung sind ein Beispiel für den Unterschied zwischen Mega- und Makrotrends. Globalisierung ist sicherlich einer der ganz großen Megatrends der letzten Jahrzehnte, der sich seit den 1970er-Jahren entfaltet hat. Aus der Perspektive der Makrotrends geht es weniger um den Globalisierungstrend an sich in all seinen Dimensionen, sondern darum, welche Dimensionen in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen, welche neuen Entwicklungen sich abzeichnen und wie sich damit die Globalisierung wandelt. Seit den 1990er-Jahren hat sich beispielsweise eine neue Phase der Globalisierung entwickelt, in der sie durch globale Wertschöpfungsketten angetrieben wurde. In den 2020er-Jahren ist eine neue Phase angebrochen, die sich um Dienstleistungen, Daten und Informationsflüsse dreht. Der sehr umfassende Megatrend Globalisierung spaltet sich damit in verschiedene Trends und Phasen auf, die im Fokus der Makrotrends stehen.
Die Treiber des Wandels
Die Anstöße, die die Makrotrends auslösen und die Veränderungen im Unternehmensumfeld auslösen, kommen dabei aus verschiedenen Bereichen – der Technologie, der Demographie und der Politik.
Technologie
Der offensichtlichste Treiber ist der Wandel durch digitale Technologien. Sie haben in den letzten Jahren den Strukturwandel in der Wirtschaft vorangetrieben und werden dies weiterhin tun. Technologische Revolutionen in der Wirtschaft beruhen auf neuen Querschnittstechnologien. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie branchenübergreifend in vielen Anwendungsfeldern eingesetzt werden und Grundlage für weitere Innovationen sind. Die Dampfmaschine, Elektrizität und der Computer sind klassische Beispiele für Querschnittstechnologien. Ihre wirtschaftliche Bedeutung liegt darin, dass sie in entwickelten Volkswirtschaften Grundlage des Wachstums sind und neue Wachstumszyklen einläuten können, aber auch die Struktur der Wirtschaft ändern. Voraussetzung dafür ist, dass sie entweder neue Produkte und Dienstleistungen hervorbringen oder die Produktivität in den Unternehmen steigern.
Die letzte Dekade hat eine Vielzahl von digitalen Innovationen gesehen, die in unser Leben getreten sind. Der Siegeszug des Smartphones und der Apps ist die sichtbarste Innovation, aber genauso haben Cloud-Computing oder Big Data die Unternehmenswelt geprägt. Gleichzeitig haben digitale Plattformen, von Amazon bis AirBnB und Alibaba, die Art, wie wir einkaufen, revolutioniert. An Kandidaten für neue digitale Innovationen in den 2020er-Jahren herrscht kein Mangel. Der prominenteste ist sicherlich die Künstliche Intelligenz mit ihrem Potenzial, neue Querschnittstechnologie zu werden. Aber auch die Robotik, getrieben wiederum von Künstlicher Intelligenz, macht enorme Fortschritte, genauso wie der 3D-Druck, das Internet der Dinge, autonomes Fahren oder Quantum Computing.
Diese digitalen Technologien werden die Erfolgsfaktoren von Unternehmen, Industrien und Standorten verändern. Innovationen und neue Prozesse werden die Folge sein, wirtschaftliche Aktivitäten werden sich weiter digitalisieren. Dadurch ändern sich Innovationsmuster, aber auch die Art, wie und in was Unternehmen investieren. Ein wichtiger Bereich ist die Entstehung einer neuen Dienstleistungsökonomie, aber auch die mögliche Automatisierung von Jobs. Die Gefahr der Automatisierung für die Arbeitsmärkte wird schon seit Längerem beschworen. Allerdings waren die Effekte eher begrenzt. Die 2010er-Jahre waren zumindest in Deutschland, aber auch in vielen anderen Industrieländern, geprägt von rekordverdächtigen Beschäftigungszahlen. Die neuen Technologien werden künftig allerdings noch einmal neue Formen der Automatisierung und der Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine ermöglichen. Der technologische Wandel prägt insgesamt die Angebotsseite der Wirtschaft – also wie Güter und Dienstleistungen hergestellt werden und an welchen Standorten.
Demographie
Der zweite zentrale Treiber des Wandels in den 2020er-Jahren werden demographische Trends sein. Dabei geht es nicht so sehr um die Frage, ob die Bevölkerung schrumpft, sondern vor allem um die Veränderungen der Altersstruktur. Die Alterung der Gesellschaft und die Verschiebung zwischen den Generationen waren schon seit Langem absehbar, aber sie werden wegen ihrer mangelnden Tagesaktualität oft unterschätzt.
Demographische Trends werden oft durch völlig gegensätzliche Begriffe beschrieben. Sie werden wegen ihrer Langfristigkeit mit den Bewegungen von Gletschern verglichen oder, um ihre Auswirkungen zu dramatisieren, mit Tsunamis oder Erdbeben. Beides sind schiefe Bilder. Passender für demographische Trends ist der Begriff, den der Vater des modernen Managements, Peter Drucker, prägte, nämlich als »future that has already happened«. Die Verschiebungen der Bevölkerungsgröße und der Altersstruktur sind sehr viel besser prognostizierbar als viele andere Trends, einfach deshalb weil es um Menschen geht, die zum allergrößten Teil schon geboren sind. Insofern ist die demographische Zukunft ziemlich klar.
Demographische Trends umfassen aber mehr als Altersstruktur. Es geht genauso um die Verhältnisse zwischen Generationen sowie deren unterschiedliche Bedürfnisse, Werte und Konsumgewohnheiten. Oft vernachlässigt wird auch die geographische Dimension, die darüber entscheidet, wo bestimmte Alters- und Berufsgruppen leben wollen und was dies für Städte und Volkswirtschaften bedeutet. Damit sind demographische Trends weniger wie Gletscher, Erdbeben oder Tsunamis, sondern eher wie Unterströmungen unter der Wasseroberfläche, die Gesellschaft und Märkte beeinflussen und formen.
Das Neue in diesem Jahrzehnt wird sein, dass die Änderung der Altersstruktur das erste Mal tiefgreifende und wirtschaftlich sehr spürbare Effekte haben wird. Sie werden von einem abstrakten Zukunftsszenario zur Realität. So wird Europa am Ende des Jahrzehnts 10 Millionen weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter, also zwischen 20 und 65, aufweisen als am Anfang; Deutschland ist davon mit einem Rückgang von gut vier Millionen und damit knapp 10 Prozent seines Arbeitskräftepotenzials besonders betroffen. Die Altersstruktur wird sich aber nicht nur auf dem alten Kontinent fundamental verändern. Generell wird im neuen Jahrzehnt die Geschwindigkeit der Alterung in Asien am höchsten sein, auch China altert sehr rasant. Die Zahl der über 65-Jährigen in China nimmt in den 2020er-Jahren um über 110 Millionen Menschen zu.
Global verschiebt sich in den 2020er-Jahren damit das erste Mal in der Geschichte der Menschheit der Schwerpunkt vieler Gesellschaften von den Jüngeren zu den Älteren. Dies wird eine unabsehbare Vielzahl von sozialen, kulturellen und politischen Folgen haben. In wirtschaftlicher Hinsicht sind die Auswirkungen in zwei Bereichen zentral: zum einen die Verschiebungen auf der Nachfrageseite, also welche Produkte und Dienstleistungen in einer älteren Gesellschaft gefragt sein werden. Zum anderen die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, dem weniger und deutlich ältere Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden.
Politik
Neben den ökonomischen Trends wirkt natürlich auch die Politik auf Wirtschaft und Unternehmen ein. Die meisten politischen Strömungen für die 2020er-Jahre sind nicht abzusehen und damit keine Trends, sondern Unsicherheiten. Wie sich die Beziehungen zwischen den USA und China nach den Konflikten des vergangenen Jahrzehnts entwickeln, ist völlig ungewiss. Genauso ungewiss ist, ob die Corona-Krise zu mehr Staat in der Wirtschaft führen oder ob sich der Staat wegen der neuen Dimension der Schuldenberge durch die Corona-Krise verschlanken wird. Ein politisch getriebener Trend ist allerdings abzusehen. Die Transformation der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit wird das Jahrzehnt mit hoher Sicherheit prägen und die Rahmenbedingungen, aber auch die Wirtschaft selbst umgestalten. Dies vor allem deshalb, weil Nachhaltigkeit am Anfang des Jahrzehnts zunehmend in ganz unterschiedlichen Teilbereichen der Wirtschaft politisch verankert oder von Unternehmen aktiv vorangetrieben wird. Die Spannbreite reicht von nachhaltiger Geldanlage bis zur zirkulären Wirtschaft. Gleichzeitig hat die Corona-Krise diese Verankerung sowie den Nachhaltigkeits-Trend generell beschleunigt. Der Fokus der enormen staatlichen Konjunkturprogramme auf Nachhaltigkeit in der Folge der Corona-Krise wird die wirtschaftlichen Strukturen genauso prägen wie die regulatorischen Neuerungen.
Unsicherheiten und schwarze Schwäne versus Trends
Technologie, Demographie und Politik stecken damit hinter den Makrotrends, die in diesem Buch behandelt werden. Sie haben eine klare Entwicklungsrichtung, die nicht leicht umzukehren ist. Allerdings sind Trends nur eine Seite der Medaille, Unsicherheiten sind die andere. Trends können die grundsätzliche Entwicklungsrichtung vorgeben, aber sie treten immer zusammen mit Unsicherheiten auf. Wenn dies nicht so wäre, ließe sich die Zukunft sehr viel leichter vorhersagen. Unsicherheiten haben ein negatives Image, aber positiv gesehen wäre das Leben ohne sie eher langweilig. Wenn klar wäre, wer die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnt und wie der nächste Urlaub sein wird, würde beides sehr viel weniger interessant sein. Unsicherheiten sind dabei etwas anderes als Risiken. Risiken sind Abweichungen vom Trend, die ihn nach oben oder unten bewegen. Unsicherheiten sind dagegen unvorhersehbare Ereignisse, die neue Trends hervorbringen oder bestehende ändern.
Unsicherheiten treten in mehreren Erscheinungsformen auf. Manche Entwicklungen sind völlig außerhalb der menschlichen Vorstellungswelt. Dass das Rad erfunden werden könnte, war für die Sumerer, die es schließlich erfunden haben, und für ihre Zeitgenossen unvorstellbar. Der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hat dafür den Begriff der »unknown unknowns« geprägt, Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Bevor es da war, lag das Rad außerhalb des menschlichen Vorstellungshorizonts.
Ebenfalls mit großer Unsicherheit behaftet und für die normale Risikoanalyse nicht fassbar sind Ereignisse, die unter der Metapher der schwarzen Schwäne bekannt geworden sind. Im Kern geht es dabei um Ereignisse oder Entwicklungen, die für unmöglich oder sehr unwahrscheinlich gehalten werden, aber doch eintreten – ähnlich wie die für die europäischen Entdecker Ende des 17. Jahrhunderts ziemlich überraschende Beobachtung, dass in Australien nicht nur weiße Schwäne vorkommen, sondern auch schwarze. Etwas weiter gefasst geht es um Ereignisse, die höchst unwahrscheinlich sind und selten auftreten. Sie sind im Nachhinein erklärbar, aber kaum vorherzusagen, und haben große Auswirkungen, wenn sie denn tatsächlich eintreten.3 Beispiele für schwarze Schwäne sind die Anschläge vom 11. September, die Finanzkrise oder die Entwicklung des Internets.
Die Grenzen sind dabei fließend. Ob die Corona-Krise ein schwarzer Schwan ist oder eigentlich eine Sicherheit, die irgendwann eintreten und mit der man rechnen musste, lässt sich kaum sagen. Nicolas Taleb, der Autor des Buches des schwarzen Schwans, sieht die Corona-Pandemie als weißen Schwan, da sie ein Ereignis ist, das irgendwann mit Gewissheit eintreten musste.4