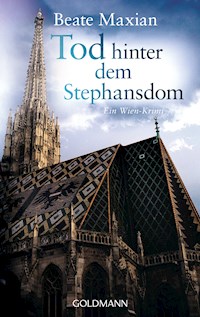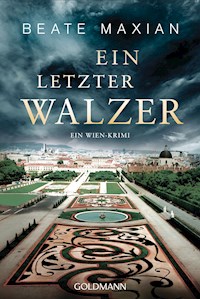8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Sarah-Pauli-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Auf einem ihrer Streifzüge durch den Prater beobachtet die Fotografin Lucie Viktor ein Gespräch zwischen einem bekannten Wiener Geschäftsmann und einer Obdachlosen. Kurz darauf versucht man, sie zum Schweigen zu bringen. Unterdessen schreibt Journalistin Sarah Pauli an einer Reportage zum bevorstehenden Prater-Jubiläum. Dabei entdeckt sie ein erschütterndes Muster: Bereits drei Obdachlose starben unweit des Riesenrads einen qualvollen und einsamen Tod. Sarah will herausfinden, was wirklich geschah, und stößt auf Lucies Schicksal. Doch wie gefährlich der Fall ist, merkt sie erst, als es fast zu spät ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Ähnliche
Buch
Das Wien abseits der Postkartenmotive! Die Fotografin Lucie Viktor hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ungesehenen Seiten der Donaumetropole einzufangen. Auf einem ihrer Streifzüge beobachtet sie ein Gespräch zwischen einem bekannten Wiener Geschäftsmann und einer Obdachlosen und hält die Szene spontan mit ihrer Kamera fest. Noch ahnt sie nicht, wie nah die Aufnahme sie dem Tod bringen soll …
Unterdessen ist Journalistin Sarah Pauli voller Tatendrang. Nachdem sie mit ihrer Kolumne über Aberglauben stets einen feinen Spürsinn für explosive Storys bewiesen hat, schreibt sie nun auch fest für das Chronik-Ressort des Wiener Boten. Ihr erster Artikel: eine groß angelegte Reportage anlässlich des 250-jährigen Jubiläums des Praters. Bei ihren Recherchen über Wiens berühmt-berüchtigtes Wahrzeichen stößt Sarah dann aber auf eine Meldung, die ihr sehr nahegeht. Unweit des Riesenrads wurde ein Obdachloser tot aufgefunden, offenbar starb der Mann einsam und qualvoll an einem Herzanfall. Das Seltsame: Vor einiger Zeit kamen am Prater bereits zwei andere Obdachlose auf gleiche Weise zu Tode. Sarah will herausfinden, was wirklich geschah, und stößt auf Lucies Schicksal. Wie gefährlich der Fall wirklich ist, merkt sie erst, als es fast zu spät ist …
Weitere Informationen zu Beate Maxian
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Beate Maxian
Die Prater-Morde
Der siebte Fall für Sarah Pauli Ein Wien-Krimi
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Beate Maxian
Copyright © dieser Ausgabe 2017
by Wilhelm Goldmann Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: FinePic®, München
Redaktion: Karin Ballauff
KS · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-18361-5V004
www.goldmann-verlag.de
Über die Armut braucht man sich nicht zu schämen, da gibt’s viel mehr Leut’, die sich über ihren Reichtum schämen sollten.
Johann Nepomuk Nestroy
1
Sterben? Wie ist das?«
Der Mann, der laut darüber nachdachte, reichte dem Penner an seiner Seite eine Flasche Schnaps.
Der Alte griff mit schmutzigen Fingern danach, stülpte seinen Mund mit den verfaulten Zähnen über den Flaschenhals und trank in gierigen Schlucken. Das erkannte der Gönner an dem hervorstehenden Adamsapfel, der sich unentwegt auf und ab bewegte. Er selbst hatte keine Lust auf das scharfe Getränk. Er fixierte neugierig den Hals des Trinkenden und überlegte, ihn zu erdrosseln. Wie lange dauerte das Sterben, wenn einem die Luft wegblieb?
Irgendwo hatte er einmal gelesen, dass man im Falle unheilbarer Krankheiten fünf Phasen durchlief, bis man starb. Er bekam nicht mehr alle zusammen. Nur Zorn, Verhandeln und Depression waren ihm in Erinnerung geblieben. Der Säufer neben ihm würde diese Phasen nicht durchlaufen.
»Ich mache mir schon lange keine Gedanken mehr über die Menschen als solche, nur über den Tod denke ich nach. Manchmal«, sagte der Schnapsspender wie zu sich selbst.
Von dem Trinker kam keine Reaktion. Ihn interessierte das Gerede nicht. Er soff weiter.
Währenddessen grub der andere tief in seinem Inneren nach einer Emotion. Trauer? Mitleid? Hilfsbereitschaft? Zwecklos. Noch nie hatte er so etwas wie Empathie empfunden. Dazu war er nicht in der Lage. Er verspürte nicht einmal Gleichgültigkeit gegenüber seinen Opfern.
Der edle Schnapsspender war ein schlanker Mann Mitte vierzig. Wenn er nicht die beige Baseballmütze getragen hätte, hätte man seinen gepflegten Haarschnitt erkennen können.
Aber genau sah sowieso niemand hin. Für die wenigen Leute, die um diese Uhrzeit unterwegs waren, bot sich das Bild zweier Obdachloser auf einer Parkbank.
Kein unübliches Bild.
Kurzer Blick.
Wieder wegschauen.
Es war bereits später Abend. Dunkle Wolken bedeckten den Himmel. Es regnete, und ein eisiger Wind peitschte die Temperatur gegen null Grad. Ein paar Schneeflocken mischten sich unter das feuchtkalte Nass.
Unverbesserliche Jogger liefen an ihnen vorbei, ihre Körper durch spezielle Jacken geschützt, auf dem Kopf Laufmützen. Hundebesitzer standen in dicken Regenjacken fröstelnd in der Hundezone, sehnsüchtig darauf wartend, dass ihre vierbeinigen Lieblinge einen Haufen produzierten, den sie dann in ein eigens ausgewiesenes »Sackerl fürs Gackerl« aus dem »Hundekotsackerlspender« des Parks schaufelten und im nächsten Mülleimer entsorgten.
Die anderen Obdachlosen, die sich hier regelmäßig einfanden, hatten bereits in ihren Unterkünften Zuflucht gesucht, entweder in U-Bahn-Stationen oder in Unterführungen.
Nur er war hier. Ein typischer Einzelgänger, dem es nichts auszumachen schien, dass ihm der Regen ins Gesicht schlug.
Ihn hatte er auserwählt. Schon vor langer Zeit. Ihn, dessen Name nach seinem Tod verschwinden würde. Ausradiert. Gestrichen. Weg. Er wurde »Greißler« genannt, weil ihm ein Verkaufsstand auf dem Meidlinger Markt gehört hatte. Pferdefleischerei. Das war in seinem früheren Leben gewesen und interessierte heute niemanden mehr. Klaus war sein Vorname, der Nachname war wie seine Würde von der Festplatte gelöscht. Manchmal machte es den Eindruck, als würde er etwas Bestimmtes suchen oder als wäre er gar ein Spion, der sich auffällig unauffällig in der Gegend umsah. Doch der Schein trog. Säufer wie er nahmen ihre Umgebung kaum noch wahr.
Der Schnapsspender hatte ihn beobachtet, wie er am späten Abend den verrosteten Einkaufswagen mit seinen Habseligkeiten durch den Park geschoben hatte. Er hatte sich von Abfalleimer zu Abfalleimer geschleppt und darin herumgewühlt, auf der Suche nach Essensresten und Müll, der noch verwertbar war. Immer wieder war er stehen geblieben und hatte gehustet. Irgendwann hatte er sich auf dieser Parkbank niedergelassen. Müde und erschöpft. Sein Körper geschwächt vom Alkohol.
Auf diesen Moment hatte der Schnapsspender gewartet. Er war wie zufällig zu ihm hingegangen. Als er sich neben ihn setzen wollte, hatte der Greißler protestiert. Nein, er hätte heute nichts für ihn, schimpfte er. So als wäre der Schnapsspender ein unliebsamer Kunde. Der Schnapsspender hatte ihm die Flasche unter die Nase gehalten und versichert, dass er nichts von ihm wollte.
»Gehst heut Nacht eh nicht in die Gruft?«, fragte er den Obdachlosen.
In der »Gruft«, einer Einrichtung der Caritas für Obdachlose, galt striktes Alkoholverbot. Dafür konnte man dort duschen, bekam saubere Kleidung, ein warmes Essen und einen Platz zum Schlafen.
Der Penner reagierte jedoch nicht.
»Wennst willst, schenk ich dir eine zweite Flasche. Dann ist dir nicht so kalt. Aber denk dran«, er deutete auf die Schnapsflasche, »in die Gruft darfst die nicht mitnehmen.«
»Bleib eh da«, brummte sein Sitznachbar. »Bin eh nie in der Gruft.«
Der Gönner drückte ihm eine Plastiktasche in die Hand, stand auf und ging. Seine Arbeit war getan.
Er wusste, was danach passieren würde, und diese Vorstellung zauberte ein zufriedenes Lächeln auf seine Lippen.
Keine zehn Schritte weiter hatte er den alten Mann schon vergessen.
Der Regen ließ nach.
Freitag, 18. März
2
Als der Greißler am frühen Morgen aufwachte, war er wie gerädert. Ihm war schlecht, und er fühlte sich fiebrig.
Der Morgen dämmerte. Die ersten Hunde rannten in ihrer Zone herum und bellten so laut, dass ihm der Schädel fast explodierte. Als plötzlich die Nase eines Jagdhundes vor seinem Gesicht auftauchte, erhob er sich von der Bank, rollte den zerschlissenen Schlafsack zusammen und warf ihn in den verbeulten Einkaufswagen. Er fasste sich an die Brust und tastete nach dem schmalen Plastikmäppchen, das er um den Hals trug. Er zog es hervor und betrachtete sein wertvollstes Gut. Jeden Morgen kontrollierte er, ob sich das Foto noch an seinem Platz befand, direkt unter seinem Herzen. Es zeigte seine Frau und seinen Sohn vor ihrem Verkaufsstand und war kurz vor der Eröffnung aufgenommen worden. Damals war die Welt noch in Ordnung gewesen. Er küsste das Bild und steckte es wieder in das Mäppchen. Der schönste Moment des Tages war damit vorbei. Aus einem Plastiksack zog er eine abgewetzte Fleecejacke, die einzige, die er besaß. Dann erschrak er zutiefst. Das Schulheft war weg. Jemand hatte es ihm gestohlen.
Der Kerl mit den zwei Flaschen Schnaps von gestern Abend war verschwunden. Oder hatte er sich nur eingebildet, dass er da gewesen war? Nein, die leere Flasche am Boden bezeugte es. Ruckartig öffnete er die Plastiktasche. Die zweite Flasche war noch ungeöffnet. Er kramte in seinem Gedächtnis. Musste er ihm dafür einen Gefallen tun? Im nächsten Moment erinnerte er sich daran, wem er das Heft gegeben hatte. Erleichtert raffte er den alten Pullover und das T-Shirt zusammen, die ihm als Polster gedient hatten, und suchte das Weite.
Ein Wunder, dass er diese Nacht nicht von den anderen behelligt worden war. Noch ein größeres Wunder, dass ihm niemand die volle Flasche Schnaps gestohlen hatte. Die würde er im Laufe des Tages ganz alleine leeren. Er teilte nicht, er musste nur einen weiten Bogen um den Praterstern machen. Diese verdammten Schmarotzer, die sich dort herumtrieben, kannte er nur zu gut. Die soffen ihm das Zeug im Nullkommanichts weg. Auch die Hauptallee mied er. Dort begegneten ihm zu viele Menschen.
Ein Hustenanfall ließ ihn plötzlich straucheln, und er begann zu würgen. Eine Mischung aus Alkohol und Halbverdautem ergoss sich in immer kürzeren Abständen über die Straße. Eine kleine Gruppe Hundebesitzer starrte ihn angewidert an. Er ignorierte sie. An verächtliche Blicke hatte er sich gewöhnt. Sein Gesicht war schweißbedeckt. Er fasste sich an die Stirn. Kalter Schweiß, und das Fieber stieg. Darauf konnte er keine Rücksicht nehmen. Er musste sich um seinen Alltag kümmern und etwas Essbares auftreiben. Mit ein paar Bissen im Bauch würde er sich sicher besser fühlen. Das Gehen fiel ihm schwer. Die Distanzen zwischen den Abfallkörben, in denen er herumwühlte, erschienen ihm endlos. Sein Herz raste, seine Hände zitterten, und seine Eingeweide brannten vor Schmerzen. Kolikartige Bauchkrämpfe quetschten ihn zu einer jämmerlichen Figur zusammen. Die wenigen Menschen, die ihm entgegenkamen, machten einen großen Bogen um ihn.
Er presste eine Hand auf seinen Bauch. Es kam ihm vor, als würden sich seine Gedärme auflösen. Mit der anderen Hand hielt er die Griffstange des Einkaufswagens fest umklammert. Nur wenn er stehen blieb und nach der zweiten Flasche griff, die der Fremde ihm geschenkt hatte, ließ er den Wagen los. Er trank in großen Schlucken. Das wärmte und ließ ihn die Schmerzen für einen Moment vergessen. Er schleppte sich bis zur Jesuitenwiese und weiter in den bewaldeten Teil. Dort im Verborgenen rollte er sich zusammen. Schlafen. Er wollte nur noch schlafen. Krank sein konnte man sich auf der Straße nicht leisten. Hier war er einigermaßen geschützt. Er würde liegen bleiben und warten, bis sich sein Zustand besserte. Schließlich war das nicht seine erste Grippe.
Schemenhaft nahm er zwei Gestalten wahr. Sie kamen näher und blieben dann vor ihm stehen. Dunkle Schuhe in Augenhöhe. Wie am Morgen die Hundeschnauze. Diebe. Er wollte sich aufsetzen, um sie zu vertreiben. Diese Aasgeier gierten garantiert nach der Flasche in seiner Hand. Nicht mit ihm. Er schlug nach ihnen. Doch er war viel zu schwach. Ein jäher Schmerz durchfuhr ihn wie ein Blitz. Er hielt die Luft an, bevor sein Körper sich wieder zusammenkrümmte. Er fühlte, wie sein Darm sich entleerte. Mit letzter Kraft presste er die Flasche fest an seine Bauchmitte. Was hätte er jetzt für ein Bett gegeben. Ein stinknormales Bett. So wie früher, als noch alles gut war.
3
Lucie Viktor befand sich auf der Suche nach Dreck.
Menschlichem Dreck. Abschaum. Absonderungen.
Die 36-Jährige hatte einen Blick für Dinge, die andere ausblendeten oder bewusst übersahen. Obdachlose. Drogensüchtige. Verlierer. Lucie sah sie alle. Ihr spezieller Blick. Lucie war Kunstfotografin.
Ihr Freund Kai nannte das ein gefährliches Talent. Manchmal anstrengend, weil Lucie dazu neigte, derart in ihrer Arbeit aufzugehen, dass sie alles andere vergaß. Auch dass man die Miete und andere Rechnungen bezahlen musste.
Kai ahnte nicht, dass Lucie solche Rechnungen absichtlich übersah, wenn sie wieder einmal pleite war.
Kai war noch keine dreißig, jedoch vernünftig, als gäbe es dafür einen Preis zu gewinnen oder Pluspunkte, die man im Rentenalter einlösen konnte. Das lag an seinem Job, meinte Lucie. Kai arbeitete als Sachbearbeiter in einer Versicherung. Das ließ keinen Hauch Kreativität zu.
Lucie konzentrierte sich aufs Konzentrieren. Sie suchte nach dem Hässlichen im Schönen und nach dem Schönen im Hässlichen. So lautete der Arbeitstitel des Bildbandes, für den sie die Extreme suchte. Extreme – mit diesem Begriff versuchte sie, Kai ihre Schöpfung zu erklären. Er verstand den Sinn dahinter nicht.
»Ein Buch, in dem die hässlichen Seiten der Stadt abgebildet sind, wird doch niemand kaufen«, hatte er gemeint und dann einen Vortrag über den Wiener Prater gehalten, dessen 250-jähriges Jubiläum man in diesem Jahr feierte. Über die Geschichte der Institution und dass die bessere Gesellschaft dort früher in Fiakern vorfuhr.
»Das wollen die Leute sehen.«
Sie hatte mit den Achseln gezuckt.
»Ich bin Fotokünstlerin, keine Auftragsfotografin des Tourismusverbandes«, hatte sie erwidert.
»Du solltest aber endlich mal Geld damit verdienen«, hatte der alte, vernünftige Mann in Kai geknurrt.
Lucie strafte den greisen Kai mit Ignoranz. Ihr Jagdrevier war seit Wochen der Prater. In erster Linie der Wurstelprater. Sie kannte den Vergnügungspark in all seinen Facetten.
Walzerklänge begleiteten sie entlang des Gabor-Steiner-Weges. »Wiener Blut« von Johann Strauss’ Sohn, wenn sie nicht irrte. Die Musik diente der Einstimmung auf dem Weg zum neu gestalteten Riesenradplatz.
»Prater Herrrreinspaziert« stand in gelben Großbuchstaben auf einem grünen Schild, das das großzügige Entree markierte. Es erinnerte Lucie ein wenig an ein modernes Einkaufszentrum, das nostalgisch erscheinen wollte. Das Riesenrad dahinter drehte sich langsam. Rechts von ihr war die Kaiserwiese, links, hinter Buschwerk versteckt, eine Tankstelle.
Sie sah sich den Boden unter ihren Füßen eingehend an. Grauer schmutziger Asphalt. Zigarettenstummel, Kaugummi und eine Bierlache bildeten eine trostlose Dreieinigkeit. Perfekt. Nach solchen Motiven hielt sie Ausschau. Sie nahm ihre Panasonic aus der Umhängetasche. Eine DMC-FZ1000. Sie wog zwar relativ schwer, lag jedoch gut in der Hand und war ideal für ihr Projekt. Sie wählte den Ausschnitt des Bildes so, dass man ihre Schuhspitzen darin sehen konnte. Das unterstrich die Aussage, dass diese Art Schmutz ausschließlich von Menschen produziert wurde. Fand sie. Sie drückte ab.
Dann hielt sie die Panasonic hoch über ihren Kopf, drehte sich ein paarmal herum und schoss dabei willkürlich Bilder. Als Vorbild für diese Art des Fotografierens diente ihr David Bradford, ein US-amerikanischer Taxifahrer, der New York aus der Lenkradperspektive porträtierte, indem er aus dem fahrenden Auto fotografierte. Daraufhin war die New York Times aufmerksam auf ihn geworden. Mittlerweile war er als Fotokünstler etabliert.
Lucie hoffte, auf ähnliche Weise als Künstlerin zu arrivieren, doch bisher pflasterten vor allem Stolpersteine ihre Karriere.
Sie ging weiter.
Immer mehr Menschen drängten gut gelaunt durch den Torbogen in den Wurstelprater. Hinter einem Schaufenster lächelte Amadeus Mozart ihnen als Pappkamerad entgegen und bewarb sich selbst als Süßigkeit in Kugelform mit Marzipankern. Der Prater, ein Magnet für Familien mit Kindern, Jugendliche, Touristen aus aller Welt. Und Kriminelle. Auch im März. Der Regen des Vortages war vergessen. Die Sonne schien. Es war warm geworden, um die 15 Grad. Der Frühling nahte, und das spürte man hier besonders deutlich.
Lucie blendete die Menschen aus, fokussierte Details.
Ein Motiv tauchte vor ihr auf. Schmuddelige Jacke, ungepflegter Kerl mit herunterhängenden Jeans, die Arschritze darbietend. Neben ihm eine Frau. Schweiß auf der Stirn. Übergewicht, Speckfalten, Tattoos wie eine Kriegsbemalung. Ausgekotzte Pizza am Boden. Diese Details waren es, die sie faszinierten und die sie mit der Kamera einfing. Weil sie in krasser Opposition zur rosaroten Werbeprospekthülle standen, in die der Prater gebettet worden war.
Die Saison hatte begonnen, und einige Fahrgeschäfte hatten jetzt schon bis nach Mitternacht geöffnet. Wetterabhängig.
Lucie wollte am späteren Abend zu dem Fest im Kuba gehen. Das Szenelokal in der Nähe der Prater Hauptallee feierte sein 20-jähriges Bestehen. Sie ging ganz gern in diese Bar. Dort trafen sich einflussreiche Leute aus dem Kunstbetrieb, die ihr möglicherweise nützten.
In der Luft hing eine Geruchsmischung aus Popcorn, Bier und Lángos. Lucie positionierte sich breitbeinig direkt vor dem Riesenrad und blickte nach oben. Ein 65 Meter hohes Stahlkonstrukt beförderte in gemächlichem Tempo jährlich Zehntausende Besucher. Tag für Tag drehte sich Wiens geliebtes Wahrzeichen. Seit 1897. Das hatte sie mal irgendwo gelesen und sich, aus welchem Grund auch immer, gemerkt.
Sie stellte sich in die Schlange vor der Kasse. Beobachtete, wie Leute aus- und wieder einstiegen. Einige der Waggons waren bereits neu.
Die Gondeln wurden seit Jahresbeginn kontinuierlich ausgetauscht. Ersetzt durch moderne Exemplare mit Heizung und Klimaanlage, aber gebaut nach den Originalplänen von damals. Im Juni sollten die Bauarbeiten abgeschlossen und alle Waggons erneuert sein.
Lucie stieg in eine alte Gondel ein und stellte sich ans halb offene Schiebefenster. Menschen hinterließen überall Spuren. Fettflecken. Schmutzränder. Schlieren und Abdrücke auf den Fenstern. Das war ihr Glück. Sie zielte mit ihrer Panasonic im schrägen Winkel auf die Glasscheibe. Der Himmel dahinter hatte milchige Flecken.
Wien von oben.
Dann bewegte die Gondel sich langsam wieder nach unten.
Lucie scannte die Umgebung. Selektiv. Auf der Suche nach Motiven.
Bei ihrem letzten Praterbesuch war sie Zeugin eines Streits geworden. Zwei Männer. Der eine grob, böse, laut brüllend. Der andere schwach und ergeben wie ein Hund seinem Herrn. Die Mimik wütender Menschen glich einer Offenbarung. Lucie hatte die Augen des brüllenden Mannes herangezoomt, seinen Blick voller Hass eingefangen. Dann eine Aufnahme in der totalen Einstellung. Ein Tattoo am Unterarm. Baseballschläger.
Sie hoffte, heute ähnlich interessante Motive für ihre Fotoserie zu entdecken.
Als sie den Waggon verließ, glaubte sie, Clara am Riesenrad vorbeigehen zu sehen, den alten Rucksack fest unter den Arm geklemmt. Zerzaustes Haar. Der mottenzerfressene Mantel hing wie ein lästiges Anhängsel an ihrem ausgezehrten Körper.
Clara war erst Ende dreißig. Sie hatte einen schweren Lebensweg hinter sich.
Die Trafik, die sie mit ihrem Mann zusammen geführt hatte, war pleitegegangen. Von einem Tag auf den anderen standen sie ohne Geld da. Die Rücklagen waren aufgebraucht. Der Teufelskreis begann. Erfolglose Jobsuche. Alkohol. Langzeitarbeitslosigkeit. Alkohol. Schließlich verloren sie ihre Wohnung. Ihr Mann zerbrach daran, nahm sich das Leben. Sein Tod hatte Clara endgültig aus der Bahn geworfen. Seitdem lebte sie auf der Straße.
Lucie hatte sie vor einiger Zeit für ihre Serie fotografieren dürfen und ihr 50 Euro dafür gegeben. Hinter Claras müdem Blick und ihrer Verbitterung hatte Lucie erkannt, wie schön diese Frau einst gewesen war.
Menschen verstellten Lucie die Sicht. Sie reckte den Hals. Doch die Frau, die sie an Clara erinnert hatte, war verschwunden.
Lucie konzentrierte sich wieder auf ihre Arbeit. Zwei Männer zogen ihre Aufmerksamkeit auf sich. Der eine spindeldürr, der andere wohlbeleibt. Nein. Fett. Sie richtete das Objektiv diskret auf die wild gestikulierenden Hände der Männer. Dann wechselte plötzlich etwas von einer Handfläche in die andere. Ein kleiner Plastikbeutel mit bräunlichem Inhalt. Drogen. Perfekt.
Bisher hatte sie lediglich Auswirkungen von Rauschgift vor die Linse bekommen. Kaputte junge und weniger junge Leute, verstörte Gesichter, zerstörte Leben. Aber einen Deal zu fotografieren, das war ihr noch nie gelungen.
»Hey, du!«, rief der Dicke da auf einmal.
Sie war den beiden zu nahe gekommen. Sofort ließ sie die Arme sinken.
»Was machst du da?«
»Gib die Kamera her«, forderte der andere sie auf.
Er setzte sich in Bewegung. Der Dicke folgte ihm auf dem Fuß. Sie kamen näher.
»Ich habe nur das Tai-Fun fotografiert.«
Sie gab ihrer Stimme einen unschuldigen und zugleich scharfen Klang.
Die Männer drehten sich unwillkürlich zu dem Karussell um. Eines, in dem man in fest montierten Sitzen hin- und hergeschleudert wurde, während man gleichzeitig nicht nur im Kreis gedreht, sondern auch hinauf- und hinuntergeschwenkt wurde. Eine Licht- und Soundshow vermittelte zumindest optisch den Effekt der Zentrifugalkraft. Hauptsächlich Jugendliche und Kinder drehten gerade kreischend darin ihre Runden.
Lucie nutzte die Gelegenheit und rannte weg, so schnell sie konnte. Sie tauchte in der Menge unter, flüchtete Richtung Pratersauna, rannte weiter, ohne zurückzublicken, bis zu dem Parkplatz in der Waldsteingartenstraße. Außer Atem hielt sie an, um zu verschnaufen. Sie hatte Seitenstechen.
Von den Männern war jedenfalls nichts mehr zu sehen.
»Ja, ja, ja!«, keuchte sie stolz.
Sie hatte den Drogendeal festgehalten! Was für ein großartiges Foto für ihr Buch!
Sie sah sich auf dem Parkplatz um und erspähte auf einmal die Frau von vorhin. Es war tatsächlich Clara. Sie sprach mit dem Fahrer eines schwarzen SUV. Lucie konnte ihn nicht genau sehen. Sie fragte sich, was Clara mit so jemandem zu schaffen hatte. Clara prostituierte sich nicht, um an Geld zu kommen, das hatte sie Lucie erzählt.
Sie hob die Kamera und drückte mehrmals auf den Auslöser. Das Bild verdeutlichte auf groteske Weise die gesellschaftlichen Unterschiede.
Der SUV-Fahrer mit Mercedesstern auf der Kühlerhaube im Gespräch mit der Sandlerin: eine ungewöhnliche, ja, bizarre Szene, fand Lucie.
In dem Moment gab der Fahrer Gas, und Clara konnte gerade noch zurückweichen. Lucie sah dem Wagen nach. Als sie sich umdrehte, war Clara verschwunden, wahrscheinlich schon auf dem Weg zurück zum Praterstern, einem der zentralen Treffpunkte der Obdachlosen. Und nicht nur der Obdachlosen. Möglich, dass auch der Drogendealer sich jetzt dort herumtrieb. Der Platz galt als eines der gefährlichsten Pflaster der Stadt und Hotspot für Bandenkriminalität.
Ein Ort, der Lucie magisch anzog.
4
So.«
Diese Erklärung und Simons Geste, die besagte, dass Sarahs Computer nun betriebsbereit war, mussten reichen. Simon Friedmann war kein Mann der großen Worte, aber ein exzellenter Computerfachmann und Fotograf. Sarah mochte ihren jungen Kollegen in Skaterklamotten trotz seiner Wortkargheit.
»So«, wiederholte Sarah, um Simon kundzutun, dass sie begriffen hatte. Sie raffte mit einer geübten Handbewegung ihre Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen und ließ sich auf den Stuhl vor ihrem neuen Schreibtisch fallen. Der Umzug aus ihrem alten Büro ins Gemeinschaftsbüro hatte dank der Mithilfe einiger Kollegen nur einen halben Tag gedauert.
Sarah Pauli arbeitete seit ein paar Wochen im Ressort Chronik. Hier berichtete man über gesellschaftsrelevante Themen wie Gesundheit, Integration, Bildung, aber auch über Kriminalität und Gewalt. Diese Bandbreite ließ Sarah viel Raum. Der Ressortleiter Günther Stepan hatte sie in die Redaktion geholt. Und Sarah wollte nicht mehr vom Rest der Redaktion abgeschottet in ihrem Kämmerchen arbeiten, sondern im Team, in einem größeren Raum. Außerordentliche Besprechungen, spontane Ideenfindungen und Problemlösungen waren folglich schneller möglich. Das Kernteam dieser Abteilung bestand aus drei Leuten: Patricia Franz, Günther Stepan und ihr, Sarah. Der Schreibtisch des Ressortleiters stand hinter einer Glasfassade mit Jalousien davor, die sein Büro von ihrem Großraumbüro abtrennte. Also blieben Patricia und sie übrig. Immer noch besser als allein.
Ihre Kolumne über Aberglauben und mystische Facetten der Stadt Wien in der Wochenendbeilage des Wiener Boten war ihr selbstverständlich erhalten geblieben.
Sie stellte ihr Glücksschwein Amy und den Amethyst neben dem PC ab. Die beiden Glücksbringer, Geschenke ihres Bruders Chris, durften auf ihrem neuen Schreibtisch nicht fehlen. Die restlichen okkulten Utensilien, die sie im Laufe der Zeit von begeisterten Lesern und Leserinnen ihrer Kolumne erhalten hatte, landeten in Kartons. David hatte versprochen, sie in ihre Wohnung bringen zu lassen.
In Gedanken hörte sie Chris bereits fluchen, sobald er die Kartons im Vorraum entdecken würde. Marie würde sich auf den ersten leeren stürzen und darin abtauchen. Sarah wollte schon längst einmal eruieren, warum Katzen es sich in Kartons und Kisten, egal welcher Größe, gemütlich zu machen beliebten. Ihre schwarze Halbangora quetschte sich auch in Schachteln, die eigentlich viel zu klein für sie waren.
Zwei Bücherregale waren neben ihrem Schreibtisch an die Wand montiert worden. Sarahs Bücher, ihre Kleinodien, standen in Kisten verstaut davor. Sie wollte sie später noch auspacken und ins Regal einsortieren.
»Willkommen!«, tönte der Ressortleiter und überreichte ihr einen kleinen Korb. »Alkohol ist während der Arbeitszeit leider verboten.«
Sarah nahm das Geschenk entgegen.
»Schön, bei euch zu sein. Was ist das? Salz und Brot?«, fragte sie, obwohl das offensichtlich war.
»Das schenkt man jemandem, der neu einzieht. Weiß ich aus deiner Kolumne«, antwortete Stepan.
»Ich bin echt beeindruckt. Du liest meine Kolumne?«
»Natürlich!«, sagte er.
»Dann hast du sicher auch gelesen, dass man es schenkt, wenn jemand in ein Haus oder eine Wohnung neu einzieht.«
Stepan zuckte belustigt mit den Schultern.
»Egal. Wenn ich mich richtig erinnere, wünscht man damit Wohlstand, Gesundheit und eine gute Gemeinschaft. Das passt doch hier perfekt. Immerhin zieht die Hokuspokus-Tante in die bescheidenen Gemächer der Chronik ein.«
Er machte eine Verbeugung.
»Ihr ergebenster Diener.«
Sie lachten und stießen mit ihren Kaffeetassen an.
»Außerdem freue ich mich darauf, diese Chili-Dinger ab jetzt jeden Tag zu sehen«, spielte er auf ihre Ohrringe und den Korallenschmuck in Form eines kleinen Horns an ihrer Halskette an. Vor allem in Neapel, wo Sarahs Großmutter herstammte, schützte man sich damit noch heutzutage vor dem »bösen Blick«. Corni gab es in vielen unterschiedlichen Formen und Größen. Sarah trug sie fast täglich. Nur ab und zu durften eine Bernsteinkette oder goldene Kreolen die Schutzfunktion übernehmen. Schutzlos ging Sarah nie aus dem Haus.
Dann klatschte Stepan in die Hände.
»Auf, auf, die Party ist vorbei«, rief er fröhlich, obwohl nur Sarah und er feierten.
Patricia saß mit ihrem Kaffee schon wieder am Schreibtisch.
»Die Arbeit macht sich nicht von allein.«
Stepan grinste und verschwand in sein Büro.
Sarah lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und ließ zufrieden den Blick durch den Raum schweifen. Hier war also ab sofort ihr Arbeitsplatz. Durch die breite Fensterfront fiel an sich genügend Tageslicht, dennoch war die Deckenbeleuchtung an. Insgesamt gab es vier Schreibtische. Sarahs stand dem ihrer Kollegin Patricia Franz gegenüber. An den beiden anderen saß niemand. Sie dienten als Abstellflächen und quollen über von Papier und Tageszeitungen.
»Freut mich, dass du jetzt fix im Team bist«, sagte Patricia und lächelte.
»Danke.«
Die junge Journalistin arbeitete nicht gerne in der Chronik. Sie hoffte, in die Lifestyle-Redaktion wechseln zu können, sobald dort eine Stelle frei würde. Inzwischen schob sie Innendienst in der Chronik, beschaffte Hintergrundinfos, übernahm Telefonate und arbeitete Sarah zu.
»Dann fang ich halt mal an«, meinte Sarah und griff nach den Unterlagen auf ihrem Schreibtisch.
Sie wollte einen Artikel über das Suchtverhalten der Menschen hierzulande schreiben. Das Anton Proksch Institut in Kalksburg, eine Suchtklinik im Süden Wiens, hatte vor Kurzem aktuelle Daten veröffentlicht. Demnach lag Österreich im EU-Spitzenfeld, was Alkoholerkrankungen anging. Das Verhältnis Männer/Frauen lag bei 4 zu 1. Insgesamt waren über 300 000 Personen in Österreich alkoholabhängig, rund 1,5 Millionen nikotinsüchtig, und Suchterkrankungen nahmen generell zu.
Sarah war froh, dass David, Herausgeber des Wiener Boten und ihr Lebensgefährte, bereits vor Jahren die Redaktionsräume zur rauchfreien Zone erklärt hatte.
Die Menschen und ihre Sucht, dachte sie. Seit Jahrtausenden konsumierten sie Alkoholika und andere Drogen, in früheren Zeiten natürlich vor allem auch zwecks Schmerzstillung und Heilung. Eine der ältesten Pflanzen in diesem Zusammenhang war zum Beispiel Mohn.
Sarah erhob sich und suchte aus einer Bücherkiste Band 6 ihrer Lexika über Aberglauben heraus. Die Idee, ihre Kolumne mit dem Beitrag über Sucht für die Chronik zu verbinden, war ihr soeben gekommen. Auf zwei Seiten fand sie die Information, die sie für ihre Kolumne suchte.
»Hör dir das an, Patricia!« Sarah kicherte.
Ihre Kollegin hob den Kopf.
»Junge Frauen, die wissen möchten, aus welcher Himmelsrichtung ihr Bräutigam kommt, sollen ihrem Hund am Heiligen Abend ein Stück Mohnstriezel zu fressen geben und ihn anschließend nach draußen lassen. Aus der Richtung, in die der Hund läuft, kommt dann der Bräutigam.« Sie klappte das Buch zu. »Mohn hat also nicht nur eine berauschende, sondern auch eine hellseherische Wirkung.«
Patricia warf ihr rotblondes Haar in den Nacken und lachte.
»Steht auch dabei, wie hoch die Trefferquote war?«, fragte sie.
Sarah setzte sich wieder.
»Ich werde die Leser bitten, eine Statistik zu erstellen und uns Bericht zu erstatten.«
»Ja, das geben wir dann als wissenschaftliche Studie aus und suchen um Fördergelder an«, schlug Patricia amüsiert vor.
Sie blödelten noch eine Weile herum, dann fragte Patricia: »Darf ich dir auch kurz etwas vorlesen?«
»Klar, schieß los.«
Patricia schrieb an einer Rohfassung über das Praterjubiläum. Umzüge, Ausstellungen und vieles mehr waren geplant, ein Ereignis, das sich die Stadt Wien einiges kosten ließ.
»Kaiser Joseph II. öffnete am 7. April 1799 das kaiserliche Jagdgebiet für das gemeine Volk. Der Adel zeigte sich damals alles andere als begeistert«, las sie. »Was meinst, geht das so?«
»Okay«, antwortete Sarah. Die Berichterstattung lag in ihrem Verantwortungsbereich. »Und im Hauptteil spannst du den Bogen bis heute. Kannst ruhig dazusagen, wie stolz die Wiener auf ihren Prater sind.«
Sarah hatte einen Plan erarbeitet, der vorgab, wann welcher Artikel erscheinen sollte. Es gab viele Themen. Eines lautete »Sozialer Brennpunkt Praterstern«.
Zwei Stunden später stand Sarah auf, reckte sich und massierte ihren Nacken. Sie hatte den Bericht über Suchterkrankungen fertig und den Rohentwurf für ihre Kolumne verfasst. Ihr Blick wanderte zu Patricia hinüber. Ihre junge Kollegin starrte wie gebannt mit zusammengekniffenen Augen auf den Bildschirm.
»Ist etwas passiert?«, fragte Sarah.
Patricia reagierte verzögert. Sie hob nur langsam den Kopf und sah Sarah ernst an.
»Ich habe gerade die Polizeimeldungen am Schirm. Sie haben im Prater einen toten Obdachlosen gefunden.«
»Am Praterstern?«, fragte Sarah.
Dort kam es häufig zu tätlichen Auseinandersetzungen, bei denen es durchaus auch Tote gab.
»Nein. In dem Wald bei der Jesuitenwiese.«
»Natürlicher Tod? Selbstmord? Unfall? Totschlag? Mord?«, zählte Sarah auf, was ihr spontan einfiel.
»Das geht aus der Meldung nicht hervor«, antwortete Patricia. »Das hier liest sich, als ob alles möglich wäre, warte …«
Sie drehte den Bildschirm so, dass Sarah von ihrem Platz aus mitlesen konnte.
»…Obduktion soll Todesursache klären.«
»Ist das interessant für uns?«, fragte Patricia.
»Hm. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten.«
Sarah war endgültig in der Chronikabteilung angekommen.
5
Die Wohnungstür war nicht abgeschlossen. Lucie ahnte, warum. Und sie hatte recht. Kais Jacke hing an der Garderobe.
Ihr Freund hatte es sich mit einem Bier auf dem Sofa im Wohnzimmer bequem gemacht und sah fern. Seine hellblonden Haare standen wie Stroh vom Kopf ab, was ihn noch jünger aussehen ließ, als er war.
»Wo warst du?«, fragte er.
»Unterwegs.«
Lucie hasste solche Fragen. In ihren Ohren klang das nach Misstrauen. Sie legte ihre Kamera auf dem Schreibtisch ab.
»Und was führt dich hierher?«, fragte sie ihn. »Waren wir verabredet?«
Sie mochte es auch nicht, wenn Kai unangemeldet bei ihr auftauchte. Sie führten seit eineinhalb Jahren eine einigermaßen harmonische Beziehung, gerade weil sie nicht zusammenwohnten, sondern Verabredungen trafen, wenn sie sich sehen wollten. Das hier war wie gewöhnliches Beziehungsleben, wie Pantoffeln und stille Vorwürfe …
Nicht ihr Ding.
Es war ein Fehler gewesen, Kai die Zweitschlüssel zu überlassen.
»Ich hatte einfach Lust, dich zu sehen.«
Kai drückte auf den roten Knopf der Fernbedienung. Der Bildschirm erlosch augenblicklich.
»Ich habe auch etwas zu essen mitgebracht.«
Es klang wie eine Rechtfertigung. Er stand auf, ging in die Küche und kam mit zwei Pizzaschachteln zurück.
»Echt? Du hast für uns gekocht?«, spottete Lucie und legte ihre Hand aufs Herz. »Wie süß von dir. Kann man dich auch als Nacktkoch buchen?«
»Ist leider schon kalt.« Er ignorierte ihren Sarkasmus. »Ich wusste ja nicht, wann du nach Hause kommst.«
Das klang jetzt eindeutig vorwurfsvoll. Lucie sah ihn genervt an. Er verstand sofort und sah genervt zurück.
»Ich weiß, du magst nicht, wenn ich ohne Absprache bei dir auftauche.«
»Warum tust du’s dann?«
Kai machte sekundenlang ein so betroffenes Gesicht, dass sie sich wie eine ungerechte Beißzange vorkam und rasch sagte: »Ruf an, wenn du dich mit mir treffen möchtest!«
Dann startete sie demonstrativ ihren Computer, um zu signalisieren, dass das Gespräch damit zu Ende war.
»Ich wärme die Pizza im Backofen. Schmeckt dann wie frisch gemacht.«
Kai verschwand in der Küche.
Zurück blieb sein Duft. Nach Shampoo und Duschgel.
Lucie musste lächeln. Sie mochte Kai wirklich, obwohl er in ihren Augen ein Weichei war. Dennoch schätzte sie die warmherzige Fürsorglichkeit, mit der er sie umgab. Er ertrug ihre Launen und ihre Sprunghaftigkeit, hatte schöne blaue Augen, und sie stand auf ihn. Und manchmal langweilte er sie.
Während sie die Fotos von ihrer Panasonic auf den Computer lud, fiel ihr Clara wieder ein und deren Unterredung mit dem SUV-Fahrer. Eine eigenartige Szene. Lucie speicherte die Fotos im Ordner »Prater« ab. Später würde sie sie bearbeiten und mit der Auswahl für den Bildband beginnen.
Kai kam mit den auf zwei Tellern angerichteten Pizzen zurück. Essen aus der Pappe kam für ihn nicht infrage. Auch Servietten legte er bereit. Sie setzten sich aufs Sofa, aßen Pizza und tranken Bier dazu. Wenigstens eine Bruchstelle. Das fühlte sich gut an.
Nach dem Essen brauchte es nicht viel, um Kai ins Bett zu bekommen. Das brauchte es nie. Noch eine Eigenschaft, die sie an ihm mochte. Auch den Sex mit ihm mochte sie. Er entspannte sie.
Nachdem sie miteinander geschlafen hatten, stand Lucie auf und zog sich etwas an. Wenn Kai da war, vermied sie es, nackt durch die Wohnung zu laufen. Sie war zwar schlank, aber nicht trainiert. Und sie war acht Jahre älter als er. Das wurde ihr in solchen Momenten bewusst.
Sie setzte sich wieder an ihren Schreibtisch.
Der SUV-Fahrer ging ihr nicht aus dem Kopf. Sie hatte das dumpfe Gefühl, dem Kerl schon einmal begegnet zu sein, dabei hatte sie ihn nicht einmal richtig gesehen.
Kai blieb im Bett liegen. Er döste.
Bevor sie ins Kuba aufbrach, würden sie noch einmal miteinander schlafen. Danach würde sie ihn nach Hause schicken.
Sie öffnete den Ordner mit den aktuellen Bildern und nahm sich zuerst das Foto mit dem Drogendealer und seinem Kunden vor. Sie intensivierte die Farbe des Päckchens. Das sollte den Mittelpunkt des Bildes bilden.
»Hoffnungslos«, titulierte sie es.
»Das solltest du der Polizei schicken«, hörte sie Kais Stimme hinter sich.
»Warum?«
»Weil da doch ganz offensichtlich gedealt wird.«
»Hm«, brummte Lucie. »Das weiß die Polizei auch, dass im Prater gedealt wird. Die brauchen sicher keine Miss Marple.«
»Ich würd’s tun.«
Natürlich würdest du das…
»Ich denk drüber nach.«
Das nächste Foto zeigte Clara vor dem SUV.
Kai ging ins Badezimmer.
Sie vergrößerte den Ausschnitt, auf dem der Fahrer zu sehen war. In ihrem Hinterkopf regte sich etwas. Das Gesicht? Hatte sie den Mann nicht schon einmal gesehen? Nur wann? Und wo?
»Wer bist du?«, murmelte sie und kramte in ihrem Gedächtnis.
Niemand aus ihrem Bekanntenkreis fuhr einen dunklen Benz.
Doch dann fiel ihr ein, wer der Kerl war.
6
Keine andere Frau zog ihre Strumpfhose dermaßen anmutig über die Beine wie sie. In einer fließenden, nahezu bedächtigen Bewegung, als gelte es, den perfekten Pinselstrich auf eine Leinwand zu setzen, wanderte das Nylon wohlgeformte Waden und Oberschenkel hinauf bis zum Schritt. Auf diese Weise riss sie keine Laufmasche. Dieses unwichtige Detail hatte sie einmal erwähnt.
»Die perfekte Art, sich Strumpfhosen anzuziehen«, hatte sie gesagt.
Lotte schien in vielerlei Hinsicht perfekt zu sein.
Das machte ihn aggressiv.
Linus Freibach lag in engen Boxershorts auf dem Bett und beobachtete seine Frau beim Ankleiden. Erotische Fantasien rief das bei ihm nicht hervor. Nicht bei Lotte. Gelangweilt ließ er die beiden blauen Würfel zwischen seinen Fingern hin- und hergleiten. Seit er sie auf dem Boden einer Wodkaflasche gefunden hatte – ein Werbegag des Spirituosenherstellers –, ließen sie ihn nicht mehr los. Zuerst waren es nur harmlose Fingerübungen, die ihn beruhigten. Er glaubte nicht daran, dass Würfel weissagen oder Entscheidungen beeinflussen konnten. Aber es machte ihm immer mehr Spaß, sich die verschiedensten Fragen zu stellen und die Würfel sprechen zu lassen. Er zog Schlüsse aus den Ergebnissen, wiewohl ihm klar war, dass es sich um Zufallszahlen handelte.
Mit der Zeit war sein Würfelspiel zum Tick geworden. Im Moment fragte er sich, welche Gefühle er für Lotte hegte.
Er hatte es nie lange mit ein und derselben Frau ausgehalten. Seine früheren Beziehungen dauerten nie länger als zwei Jahre. Dass er mit Lotte schon vier Jahre liiert war, lag daran, dass sie ihm nutzte. Ihr Potenzial hatte er sofort erkannt, als er ihr zum ersten Mal begegnete. Sie war ihm bei einem Empfang des Wirtschaftsbundes vorgestellt worden. Lotte Müller, so hieß sie damals noch. Müller. Was für ein gewöhnlicher Name für eine bekannte Galeristin! Er hatte sie gesehen und gewusst, dass er sie heiraten würde. Mit Zuneigung oder gar Liebe hatte das nichts zu tun. Er war Geschäftsmann. Ihre renommierte Galerie würde ihm als Plattform und Drehscheibe dienen. Er plante damals schon seinen Einstieg in die Politik. Mit einer erfolgreichen und attraktiven Frau an seiner Seite würde er einen guten Eindruck machen. Er würde seriös wirken, kunst- und kulturaffin, und damit Weltoffenheit repräsentieren.
Vor zehn Jahren hatte er seine erste Steuerberatungskanzlei eröffnet. Mittlerweile verdiente er ein kleines Vermögen, weil er den Ehrgeiz besaß, mindestens ein Drittel der lukrativen Unternehmer Österreichs seine Kunden zu nennen. Sein Imperium umfasste inzwischen fünfzehn Steuerberatungsbüros an unterschiedlichen Standorten in Österreich. In der Regel übernahm er bestehende Kanzleien von Kollegen, die in Pension gingen, inklusive Klientel.
In der Hochzeitsnacht hatte er Lotte zum ersten Mal betrogen. Mit einer Kellnerin, an deren Aussehen er sich nicht mehr genau erinnerte. Er wusste nur noch, dass sie blond war.
Es passierte, nachdem die Hochzeitsgäste gegangen waren und Lotte schon schlief. Er war noch einmal in den Saal des Schlosshotels zurückgegangen, in dem die Feier stattgefunden hatte. Die Kleine wischte die Tische ab. Er hatte sie angesprochen und sie gebeten, mit ihm auf das Leben anzustoßen. Der Rest war Routine. Linus Freibach sah gut aus, und er hatte das Selbstbewusstsein eines brünstigen Stiers.
Seit er als Quereinsteiger im politischen Geschehen mitmischte, verwaltete die Vorsicht seine Abenteuer. Immerhin war er der Kopf der Partei, die er selbst gegründet hatte. Das zwang ihn dazu. Keine Kellnerinnen oder Sekretärinnen, die sich als Geliebte outeten. Er hielt sich jetzt an gut verheiratete Frauen. Die hielten den Mund, weil sie ebenfalls etwas zu verlieren hatten. Selbst vor den Partnerinnen seiner Freunde machte er keinen Halt. Aktuell schlief er mit Kubaneks Frau.
Er ließ die Würfel auf das weiße Bettlaken gleiten. Eine Vier und eine Zwei. Sechs Punkte also. Das war gar nicht schlecht. Er empfand freundschaftliche Gefühle für Lotte. Mehr als er für die meisten Menschen empfand. Wobei das Wort Empfindung zu anspruchsvoll für einen Mann wie ihn war. Er empfand nicht. Vielmehr kopierte er Gefühlsregungen.
So war er nun einmal.
Während Lotte das dunkelblaue ärmellose Seidenkleid überstreifte, das ihn fast 600 Euro gekostet hatte, lächelte sie ihn fröhlich an. Sie liebte ihn, so viel war klar.
Er lächelte zurück.
»Willst du dich nicht auch langsam anziehen?«
Ihre glockenhelle Stimme passte zur Umgebung. Ihr Schlafzimmer hätte in einem Werbeprospekt von Laura Ashley abgebildet sein können. Kissen mit Blumenmotiven, altrosa Vorhänge, weiße Bettwäsche mit zartrosa Röschen.
Er hasste es.
Früher waren Bettlaken dunkelblau und Bettwäsche grau.
Ihr Zeigefinger fuhr aufreizend über seinen Unterschenkel.
Sein Handy vibrierte. Während er sich vom Bett schob, warf er einen Blick aufs Display. Toni.
»Ja«, sagte er, ging aus dem Schlafzimmer und zog die Tür hinter sich zu.
»Ich habe herausgefunden, wer sie ist. War gar nicht so schwer.«
»Schwafle nicht herum. Sag mir, was du weißt!«
Linus Freibach ging die breite Treppe in den Wohnbereich hinunter.
»Sie heißt Lucie Viktor und ist Kunstfotografin. Frag mich aber nicht, ob sie davon leben kann. Sie wohnt in der Förstergasse, das ist im zweiten Bezirk.«
»Ich weiß, wo die Förstergasse ist«, knurrte Freibach.
Mit dem Ellbogen öffnete er die Tür zu seinem Arbeitszimmer, ging hinein und stieß sie hinter sich mit dem Fuß wieder zu. Er hatte gesehen, dass sie ihn fotografiert hatte. Dachte an eine Paparazza. Seit er das Gesicht seiner Partei war, musste er jederzeit und überall mit Skandalfotografen rechnen. Er war einfach weggefahren und hatte sofort Toni angerufen. Der hatte seine Männer losgeschickt, die die Frau aufgrund Freibachs genauer Beschreibung ausfindig gemacht hatten. Warum eine Kunstfotografin ihn abgelichtet hatte, blieb eine offene Frage.
»Jetzt kommt’s. Sie hängt öfter im Kuba ab. Und das Beste ist, sie wird heute Abend dort sein«, sagte Toni. »Sie steht auf der Gästeliste.«
Eine Stammkundin also. Linus Freibach grinste.
Aus der Tasche seines Sakkos, der über der Stuhllehne hing, fingerte er einen Schlüssel, schloss die mittlere Schublade seines Schreibtisches auf und klappte den Deckel eines dunklen Kästchens aus Tropenholz nach oben. Dann leckte er an seinem kleinen Finger und tauchte ihn in das weiße Pulver, das in der Schatulle war.
»Dann macht mir das Fest heute Abend sicher noch mal so viel Spaß.«
Er rieb sich das Zahnfleisch mit Kokain ein.
»Was willst du von ihr?«
Freibach schwieg, und Toni interpretierte.
»Dein nächster Fick?«
7
Du hast es gut, Marie.«
Sarah Pauli stand vor dem Spiegel im Badezimmer und trug Wimperntusche auf.
»Liegst im Regal, verteilst deine schwarzen Haare auf den frisch gewaschenen Handtüchern. Und niemand ist dir deswegen böse.«
Die Katze schnurrte, öffnete ihre Augen zu schmalen Schlitzen und schloss sie wieder.
»Aber ich muss zu einem Szenefest … Und du weißt, wie mich diese Art von Partys nervt.«
Sarah hielt mit dem Auftragen der Mascara inne, zog ihrem Spiegelbild eine Grimasse und sagte mit übertrieben schriller Stimme: »Hallo! Wie schön, dich zu sehen, Sarah. Was machst du denn jetzt beim Wiener Boten … Echt, du arbeitest für die Chronik? Und taugt’s dir da? Du beschäftigst dich doch sonst eigentlich mit Hexen und Geistern …«
Hahaha.
Es störte sie ja nicht, gefragt zu werden, und sie unterhielt sich gerne mit anderen Leuten über ihre Arbeit. Was sie jedoch gar nicht leiden konnte, war die Oberflächlichkeit der Unterhaltungen bei solchen Events. Niemand interessierte sich wirklich dafür, was man tat. Wichtig war nur das Sehen und Gesehenwerden. Und das war einfach nicht ihr Ding.
Sarah steckte die Wimpernbürste in das Fläschchen zurück und drehte es zu.
»Und wem habe ich das Vergnügen heute Abend zu verdanken?«
Marie schnurrte mit geschlossenen Augen. Sie streichelte der Katze über den Kopf.
»Richtig, David Gruber. Signore Herausgeber ist nämlich hochoffiziell zum Jubiläumsfest ins Kuba eingeladen worden, weißt du? Mit Begleitung. Die bin ich.« Sie tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Brust. »Derweil könnten wir beide so gemütlich auf dem Sofa kuscheln, gell, Marie?«
Die Katze drückte sich schnurrend gegen ihre Hand.