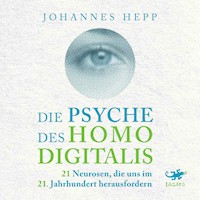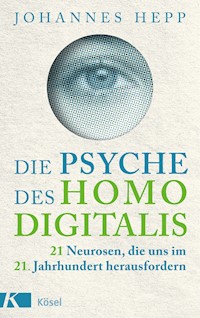
16,99 €
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
„Ein tolles Buch!“
Markus Lanz in: Podcast LANZ & PRECHT, 11.11.22
Der Psychologe und Psychotherapeut Johannes Hepp zeigt, was uns im Zuge der rasant voranschreitenden Digitalisierung neurotischer werden lässt, welche Gründe dafür verantwortlich sind, wie wir uns dieser Entwicklung bewusst werden und wie wir selbstbestimmt und selbstwirksam gegensteuern können.
Unterteilt in Liebe, Arbeit und Sinn stellt Hepp dazu 21 Neurosen des 21. Jahrhunderts vor. Er spannt dabei einen Bogen von Internet- und Online-Sexsucht, Beziehungsängsten und wachsender Einsamkeit (trotz globaler Vernetzung), von der Dating- und Profilneurose über Erziehungswettstreit und krank machenden Perfektionismus, Selbstoptimierungs- und Einzigartigkeitszwängen bis hin zu den Ewigkeitsversprechen der Altersforschung und neuen Datenreligion.
Damit wir zu diesen schwindelig machenden Prozessen ein gesundes Verhältnis entwickeln können, liefert der Autor für unsere Turbozeit aus Bits und Bytes eine scharfsinnige, aber auch hoffnungsfrohe und humorvolle Auseinandersetzung. Durch konkrete Hinweise, persönliche Erfahrungen und Beispiele aus der psychotherapeutischen Praxis hilft Hepp dabei, unsere psychische Widerstandskraft zu stärken und heil durch den digitalen Dschungel zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Ähnliche
Das Buch
Der Münchner Psychologe und Psychotherapeut Johannes Hepp zeigt in seiner fundierten Analyse, was uns im Zuge der rasant voranschreitenden Digitalisierung neurotischer werden lässt, wie wir uns dieser Entwicklung bewusst werden und gegensteuern können. In den drei Teilen Liebe, Arbeit und Sinn stellt Hepp dazu 21 Neurosen des 21. Jahrhunderts vor. Er spannt dabei einen weiten Bogen von Internet- und Online-Sexsucht, Beziehungsängsten und wachsender Einsamkeit (trotz globaler Vernetzung), von der Dating- und Profilneurose über Erziehungswettstreit und krank machenden Perfektionismus, Selbstoptimierungs- und Einzigartigkeitszwängen bis hin zu Ewigkeitsversprechen der Altersforschung und neuen Datenreligion.
Damit wir diesen schwindelig machenden Tendenzen entgegenwirken können, liefert der Autor mit diesem wichtigen Buch für unsere Turbozeit aus Bits und Bytes eine scharfsinnige, aber auch hoffnungsfrohe und humorvolle Auseinandersetzung. Durch konkrete Hinweise, persönliche Erfahrungen und Beispiele aus der psychotherapeutischen Praxis hilft Hepp dabei, unsere psychische Widerstandskraft gegenüber den automatisierten Manipulationen in Internet, Smartphone und Co. zu stärken und heil durch den digitalen Dschungel zu finden.
Der Autor
Johannes Hepp, geboren 1969 und Vater von zwei Söhnen, arbeitet als Psychologe, systemischer Paar- und Familientherapeut und Psychoanalytiker in eigener Praxis in München. Er studierte Philosophie im Kongo, lernte von Otto Kernberg in New York, studierte das Leben als freier Künstler in Buenos Aires, interessierte sich als Fotojournalist und scharfer Beobachter für die Abgründe des Lebens und war als psychologischer Sachverständiger für Familienrecht in Bayern tätig – und verlor dennoch nie seinen Humor.
www.johanneshepppraxis.com
JOHANNES HEPP
DIE PSYCHE DES HOMO DIGITALIS
21 Neurosen, die uns im 21. Jahrhundert herausfordern
Kösel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Abgesehen von allgemein bekannten Persönlichkeiten wurden die im Buch genannten Personen zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts verfremdet. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig und in keiner Weise beabsichtigt.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei der Nennung von Personen, Patient*innen und Berufsbezeichnungen auf eine durchgängige Differenzierung der Geschlechter verzichtet. Wo dies nicht geschieht, sind dennoch immer alle Geschlechtsformen gleichermaßen gemeint.
Copyright © 2022 Kösel-Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Cover: Weiss Werkstatt München
Covermotiv: © stock.adobe.com (АнтонПухов; paladin1212)
Redaktion: Angelika Holdau, München
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-29459-5V004
www.koesel.de
Für meine Eltern,
für meine Tine und
für Hugo und Henri
ODE AN DIE NEUROSE
Neurose ist die Angst,
die ohne Grund kommt und geht.
Neurose ist die Freude ohne Grund
oder die Trauer ohne Boden.
Neurose ist der Zwang,
ohne dass jemand oder etwas
eine oder einen zwänge.
Neurose ist die Sucht,
die Erlösung sucht,
doch mehr Durst findet.
Neurose ist der blinde Glaube
an etwas, das man wissen könnte.
Neurose ist unser blinder Fleck
im Sehfeld der Erkenntnis.
Neurose ist die Verzweiflung
mit dem rettenden Ufer zum Greifen nah.
Neurose ist die Neugier
als unersättliche Gier
nach Neuem und nach mehr.
Neurosen bekommen nicht selten
Orden und hysterischen Applaus,
doch was machen sie daraus?
Neurose ist die Wut,
die Unrecht gebiert, gerade weil
sie die Gerechtigkeit erzwingen will.
Neurose ist das Selbstmitleid,
das leider zu beschäftigt ist,
um für andere noch mitzuleiden.
Neurosen sind Parasiten,
und wir Menschen sind ihr Wirt,
eine uralte Symbiose.
Neurosen wollen gefüttert werden
mit unseren hysterischen Beschwerden.
Doch tun wir es nicht,
dann bricht der Bann.
Und dann können wir beginnen,
in unsere Sinne und unser Ansinnen
neuerliches Vertrauen zu gewinnen.
Nicht auf die Rüstung der Neurosen,
sondern auf uns selber zu bauen,
ehrlich nackt und ohne Posen.
Und wir sollten mehr
lebenserprobten Realismus wagen,
weniger tun und häufiger sein.
Einfach hier bei mir,
einfach hier bei dir,
mit etwas gestern,
sehr viel jetzt und
ein wenig morgen.
INHALT
EINLEITUNG // NETZNEUROSEN
TEIL 1 // LIEBE 4.0
AM ENDE GEHT ES UM LIEBE UND WERTSCHÄTZUNG
1 // NUTZER
INTERNETSUCHT // DIE CYBER-DEPENDENTE NEUROSE
2 // ANGEBEN
GELTUNGSSUCHT // DIE PROFILNEUROSE
3 // LIEBEN
DAUERVERLIEBTSEIN // DIE DATING-NEUROSE
4 // BEGEGNUNG
VEREINSAMUNG TROTZ VERNETZUNG // DIE ISOLATIONS-NEUROSE
5 // SEX
MASCHINENLIEBE // DIE AGALMATOPHILE NEUROSE
6 // MARKTWERT
BEWERTUNGSZWÄNGE // DIE EXHIBITIONISTISCHE NEUROSE
7 // ERZIEHUNG
ERZIEHUNGSWETTSTREIT // DIE PERFEKTIONISTISCHE NEUROSE
TEIL 2 // ARBEIT 4.0
AM ENDE GEHT ES UM ARBEIT UND WÜRDE
8 // ARBEITEN
SELBST-AUSBEUTUNG // DIE EXKLUSIONS-NEUROSE
9 // HASS
KOMPROMISSLOSIGKEIT // DIE EXTREMISTISCHE NEUROSE
10 // NEUGIER
ERFAHRUNGSGIER // DIE IMMODERATE NEUROSE
11 // RANKING
STEIGERUNGSLOGIK // DIE METRISCHE NEUROSE
12 // RUHM
EINZIGARTIGKEITSZWÄNGE // DIE SINGULARISTISCHE NEUROSE
13 // DOPING
VOLLKOMMENHEITSSTREBEN // DIE OMNIPOTENTE NEUROSE
14 // AUSSTEIGEN
WELTFLÜCHTE UND SEHNSÜCHTE // DIE CYBER-FUGITIVE NEUROSE
TEIL 3 // SINN 4.0
AM ENDE GEHT ES UM SINN UND HOFFNUNG
15 // LÜGE
HALBWAHRHEITSLIEBE // DIE PSEUDOLOGISCHE NEUROSE
16 // VERSCHWÖRUNG
VERTEUFELUNGEN // DIE PARANOID-KONSPIRATIVE NEUROSE
17 // HILFLOSIGKEIT
ZUKUNFTSÄNGSTE // DIE FATALISTISCHE NEUROSE
18 // GEWISSEN
DIE PERFEKTION DER MACHT // DIE EXOMORALISCHE NEUROSE
19 // HELDEN
ENTMENSCHLICHUNGEN // DIE TRANSHUMANISTISCHE NEUROSE
20 // ALTERN
VERBITTERUNG // DIE DESINTEGRATIVE NEUROSE
21 // GLAUBE
EWIGKEITSVERSPRECHEN // DIE KOMPULSIV-KOMMUNIKATIVE NEUROSE
ANHANG
NACHWORT
DANK
WEITERFÜHRENDE LITERATUR
ANMERKUNGEN
SACHREGISTER
EINLEITUNG // NETZNEUROSEN
Vor zehn Jahren kam ein verzweifelter 35-jähriger IT-Spezialist in meine psychotherapeutische Praxis, nachdem er sich aus Eifersucht das Leben hatte nehmen wollen. In letzter Sekunde hatte er beschlossen, nicht abzudrücken, sondern therapeutische Hilfe zu suchen. So kam ich zu meinem ersten Patienten, der mich auf die neuen Neurosen des Homo Digitalis aufmerksam machte.
Er wohnte mit seiner Lebenspartnerin seit zehn Jahren gemeinsam in einem Einfamilienhaus mit Garten und seit einigen Jahren in einem Smart Home, das er eigenhändig mit Sensoren und den neusten Technologien ausgestattet hatte. Als er begann, von den vermuteten Seitensprüngen seiner Partnerin zu erzählen, und ich wissen wollte, weshalb er sich denn so sicher sei, betrogen worden zu sein, streckte er mir sein Smartphone entgegen und sagte: »Hier drin habe ich alles schwarz auf weiß.«
Dann zeigte er mir Diagramme, Zahlen und Kurven und begann zu erzählen: Als er vor zwei Monaten auf Dienstreise gewesen sei, sei die Schlafzimmertemperatur zwischen zehn und elf Uhr vormittags um vier Grad Celsius angestiegen und das, obwohl um elf Uhr der Rollladen mit der Fernbedienung runtergefahren und die Heizung nicht hochgeregelt worden sei. Er schaute mich mit großen Augen erwartungsvoll an, aber ich stand noch auf dem Schlauch.
Seine Freundin habe behauptet, jenen Dienstag wie gewöhnlich im Büro verbracht zu haben. Doch ihr Auto sei den ganzen Vormittag vor dem Haus geparkt geblieben, was er mir mit einem Video einer Überwachungskamera belegen wollte, was ich dankend ablehnte. Des Weiteren sei um 10:17 Uhr und um 12:34 Uhr die Haustüre geöffnet und ungewöhnlich lange nicht geschlossen worden, was er sich mit Küssen im Türrahmen erklärte. Seit Wochen schaffe er es nicht mehr, sich um seine Firma zu kümmern, starre ständig auf sein Smartphone, gehe zwar noch in die Firma, aber nur damit seine Freundin nicht Verdacht schöpfe, dass er ihr weiterhin nachspioniere.
Nach ein paar Wochen kam seine Lebenspartnerin zu einer gemeinsamen Sitzung mit in die Praxis, setzte sich und verkündete ohne Umschweife: »An jenem Dienstag hatte ich ihn noch nicht betrogen, aber als ich erfuhr, dass er unser Haus mit dem ganzen Spionagekram verwanzt hat, habe ich es getan. Das ist kein Smart Home, das ist eine beschissene Stasi-Zentrale! Hier will ich heute nur noch sagen, dass ich mich trennen werde.« Dann stand sie auf und ging.
Wir verbrachten noch viele Stunden mit der Aufarbeitung dieses kurzen Auftritts, und letztlich konnte ich seine paranoide Eifersuchtsneurose innerhalb eines Jahres erfolgreich behandeln. Natürlich war diese das eigentliche Problem, und die ganze Überwachungstechnik verstärkte nur eine psychische Störung, die schon zuvor angelegt war. Krankhafte Eifersucht ist eigentlich immer ein Ausdruck von abgewehrten Minderwertigkeitskomplexen, entweder gegenüber der Partnerin oder dem Partner oder gegenüber einer (potenziellen) Konkurrentin oder einem (mutmaßlichen) Nebenbuhler. Dennoch trugen die technischen Spionagemöglichkeiten entscheidend dazu bei, dass sich mein Patient nicht mehr entspannen konnte und sich immer weiter in seinen Eifersuchtswahn hineinsteigerte, bis er sogar kurz davor gewesen war, sich zu erschießen – nur aufgrund verdächtiger Daten, erzeugt von Smartphone-Apps.
WAS INDUSTRIE 4.0 UND NEUROSE 4.0 GEMEINSAM HABEN
Das war meine erste Neurose 4.0, die ich behandelte, und es sollten jedes Jahr mehr werden. Neurosen, die selbst zwar nicht neu sind, aber ihre Auslöser sind neu und die (meist digitalen) Mechanismen, die sie immer weiter befeuern, ebenfalls. Mit der Bezeichnung »4.0« soll das Ziel zum Ausdruck gebracht werden, eine vierte (industrielle und gesellschaftliche) Revolution einzuleiten.
Die erste industrielle Revolution bestand in der Mechanisierung mittels Wasser- und Dampfkraft. Darauf folgte die zweite industrielle Revolution, geprägt durch Massenfertigung mit Hilfe von Fließbändern und elektrischer Energie. Und daran schloss sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die dritte industrielle Revolution oder digitale Revolution an mit Einsatz von Elektronik und IT zur Automatisierung.
Die vierte Revolution beginnt im neuen Jahrtausend mit selbstlernender künstlicher Intelligenz über Feedbackschleifen und über einen Austausch der Systeme untereinander, sogenanntes »maschinelles Lernen« oder »Data Mining«. Roboter – aber auch Kühlschränke neuer Bauart, oder Alexa von Amazon – perfektionieren mittlerweile ihre Sprache, je öfter und länger wir mit ihnen sprechen (Feedbackschleife), sie beobachten unser Verhalten und stellen sich immer besser auf uns ein, sie können zunehmend unsere Bedürfnisse erahnen. Das Internet der Dinge (IoT: Internet of Things) breitet sich aus. Das Smart Home wird aus vielen selbstlernenden künstlichen Intelligenzen bestehen, die sich fortwährend weiter perfektionieren. Immer mehr Dinge werden miteinander vernetzt sein, die dadurch ihre Lernerfolge miteinander teilen können – ganz so, wie wir Menschen auch voneinander lernen. Vielleicht können bald all die klugen Geräte im Haushalt eine Vorwarnung versenden, wann mit einer Wahrscheinlichkeit von 93 Prozent und innerhalb der nächsten 24 Stunden mit einem Ehebruch zu rechnen ist. Dazu müsste nur ein entsprechender Algorithmus mit sämtlichen Datenpunkten der Ehepartner trainiert werden. Algorithmische Wahrscheinlichkeitsberechnungen könnten auf dem Handy graphisch aufbereitet werden – mit noch gravierenderen Folgen, als im Eingangsbeispiel beschrieben. Denn eine Liebesbeziehung gibt es ohne Vertrauen nicht, da hilft auch keine App.
Smart Cities werden aus vielen Smart Homes und Smart Apartments bestehen, die alle miteinander vernetzt sein werden, und am Ende werden sogar Smart Cities ihre Daten miteinander austauschen und vergleichen können. Ein Wettstreit um die höchste Energieeffizienz wird entbrennen, um weniger Straftaten und höhere Aufklärungsraten, um die beste Luftqualität und die geringsten Kosten, vielleicht aber auch um die geringste Rate an Ehebrechern und Fremdgeherinnen. Vielleicht werden wir schon bald nicht mehr Werbeschilder lesen wie »Sachsen, Land der Frühaufsteher«, sondern »Hainan, Insel der Treue«, und alle möchten mit krankhaften Verlustängsten auf die südchinesische High-Tech-Insel ziehen.
Mit dem Ausdruck »4.0« wird Bezug genommen auf die bei Software-Produkten übliche Versionsnummerierung. Bei tiefgreifenden Änderungen einer Software spricht man von einer neuen Version, wobei die erste Ziffer der Versionsnummer um eins erhöht und gleichzeitig die zweite Ziffer auf null zurückgesetzt wird.
Wir stehen erst am Anfang dieser tiefgreifenden vierten Umwälzung nicht nur technischer, sondern auch psychischer Art. Und wir sind insgesamt in unserem Selbstverständnis als Menschen herausgefordert. Es ist erst der Anfang dieser vierten und letzten technologischen Revolution, doch wir können schon erahnen, wie grundlegend sich die neuen Technologien und die neuen Verhaltensweisen des Homo Digitalis auf seine Psyche auswirken werden. Manche Kapitel im Buch sind in dieser Hinsicht etwas mehr Zukunftsmusik als andere. Mit manchen Themen hingegen werde ich schon heute täglich in meiner Praxis konfrontiert.
DIE LETZTE UND UMFASSENDSTE KRÄNKUNG DER MENSCHHEIT
Sigmund Freud sprach von den drei großen Kränkungen der Menschheit. Die erste sei durch Nikolaus Kopernikus (1473–1543) erfolgt: mit seiner Entdeckung, dass nicht wir Menschen auf der Erde, sondern die Sonne das Zentrum unseres Universums bilde (Heliozentrisches Weltbild). Danach sei Charles Darwin (1809–1882) mit seiner Evolutionstheorie gekommen, und der Mensch sei in der Folge als höher entwickelter Affe und nicht mehr als Krone der Schöpfung gesehen worden. Und schließlich sei er selbst auf den Plan der Geschichte getreten: Sigmund Freud (1856–1939), der uns in aller Unbescheidenheit bewusst gemacht habe, dass wir noch nie »Herren im eigenen Haus« gewesen seien. Sprich: Wir bildeten uns nur ein, vernünftig und rational zu handeln. In Wahrheit bestimmten unbewusste Triebe, Gefühle und Wünsche unser Tun, Fühlen und Denken. Eher selten machten wir tatsächlich auch, was wir uns bewusst, rational und willentlich irgendwann vorgenommen hätten. Thesen, vor über hundert Jahren postuliert, die heute von den Neurowissenschaften längst bestätigt worden sind.1 Die Macht des Rationalen, der Verstand, werde über- und die Macht der Gefühle und Begierden unterschätzt. Freud war der Meinung, dass die Welt nach seinen Entdeckungen unumkehrbar eine andere geworden sei.
Die Macht unbewusster Wünsche und Begierden haben die Big-Data-Konzerne im Silicon Valley längst für sich entdeckt. So könnte man heute noch eine vierte Kränkung der Menschheit hinzufügen: diejenige durch Steve Jobs (1955–2011), Mark Zuckerberg oder Bill Gates. Denn unser Smartphone kann mehr als wir, und Apple oder Facebook kennen uns besser als unsere Mütter (was für eine Kränkung), ja, besser als wir uns selbst kennen. Das belegen sogar wissenschaftliche Studien, von denen wir noch sprechen werden. Denn die großen Datenmonopolisten kennen inzwischen sogar unsere unbewussten Triebe, Wünsche und Gefühle.
Hätte ich zu Sigmund Freud in seinem Büro in der Wiener Berggasse gesagt: »In hundert Jahren werden Maschinen bis hinters Komma das unbewusste Seelenleben eines jeden Bürgers berechnen können, um ihnen zu sagen, was sie wollen und was sie in einer Stunde wollen werden, ja selbst, was sie tun und was sie lassen sollen. Niemand wird sich dafür noch auf Ihre Couch legen müssen. Die nötigen Kenntnisse, sogenannte ›Datenpunkte‹, sammelt und liefert eine Maschine namens ›Smartphone‹. Es ist ein unfassbar schlaues Telefon, das so gut wie alle Menschen auf diesem Planeten in jeder erdenklichen Lebenslage und obendrein auch noch freiwillig mit sich rumtragen werden. Und die so gewonnenen Daten verraten die dunkelsten Begierden und selbst die sexuellen Fantasien aller Bürger. Und wer dafür bezahlt, kann sie sogar mieten und für seine Zwecke nach Belieben nutzen!«
Ich vermute, Sigmund Freud hätte sich eine Weile durch seinen weißen Rauschebart gestrichen, vielleicht noch eine halbe Zigarre geraucht, um mich anschließend aus der Psychoanalytischen Gesellschaft auszuschließen.
BIG FIVE: DIE FÜNF DIMENSIONEN, DIE UNS ALLE UNTERSCHEIDEN
Algorithmen geben die Kriterien vor, nach denen die Daten kategorisiert werden sollen. Sie sind also vorgegebene, programmierte Entscheidungsmuster. Nun ist es wichtig, auch den Menschen mit seinen unterschiedlichen Persönlichkeiten und Eigenheiten zu kategorisieren, um Muster in seinem Verhalten errechnen zu können. Zumindest ist das für alle wichtig, welche die Psyche des Homo Digitalis mit irgendeiner Absicht beeinflussen möchten. Die meisten größeren Akteure im Internet haben so ein Ansinnen, wie wir noch sehen werden.
Für künstliche Intelligenzen (KI) zur Gesichtserkennung beispielsweise hat man die Mustererkennung mit unzähligen Porträtfotos aus dem Netz trainiert, die im Internet kostenlos verfügbar waren. In der Persönlichkeitspsychologie nahm man Adjektive, die konnte man ebenfalls kostenlos in Wörterbüchern finden.
Die Grundannahmen bezüglich der Dimensionen unserer Persönlichkeit, die (fast) allen KI-Projekten zugrunde liegen, entsprechen seit einigen Jahrzehnten dem Modell der »Big Five«, das sich international immer mehr durchgesetzt hat und inzwischen (fast) ausschließlich angewandt wird. Diese fünf grundlegenden Dimensionen unserer Persönlichkeit wurden innerhalb der letzten dreißig Jahre in über 3000 Studien wissenschaftlich belegt und gelten heute international als das universelle Standardmodell in der Persönlichkeitsforschung.2
Die Big Five dienen auch fast ausschließlich als theoretisches Model zur Erstellung der Psychogramme von Milliarden Internetnutzern. Also aller User, die ausreichend viele Spuren, sogenannte »Datenpunkte«, im Netz hinterlassen haben. Das sind also alle Menschen dieser Erde mit Internetanschluss, die schon mal Suchbegriffe eingegeben haben oder online etwas gebucht oder bestellt haben. Alle mit einem Social-Media-Account sowieso. Also klar die überwiegende Mehrheit der Menschheit.
Die Entwicklung der Big Five begann bereits in den 1930er-Jahren mit dem lexikalischen Ansatz, den Louis Thurstone und Gordon Allport verfolgten.3 Diesem liegt die Auffassung zugrunde, dass sich sämtliche Persönlichkeitsmerkmale, die uns ausmachen und voneinander unterscheiden, in unseren Sprachen niederschlagen; das heißt, es wird angenommen, dass alle wesentlichen Unterschiede zwischen Personen bereits im Wörterbuch durch entsprechende Begriffe – vor allem Adjektive – repräsentiert sind. Es wäre ja auch seltsam, wenn unsere Sprachen über Jahrtausende keine Wörter für die Unterschiede zwischen uns und unseren Nachbarn und Familienangehörigen gefunden hätten. Andere Menschen und Völker zu verstehen und die Unterschiede in Worte fassen zu können, war sicherlich eine entscheidende Motivation, unsere Sprachen ständig weiterzuentwickeln.
Über ein statistisches Verfahren, die sogenannte »Faktorenanalyse«, suchte man auf der Basis von Listen mit über 18 000 Begriffen – also Persönlichkeitsmerkmalen – nach Überschneidungen und fand dafür Oberbegriffe. Am Ende blieben fünf sehr stabile, unabhängige und weitgehend kulturübergreifende Faktoren bestehen, die uns alle in jeweils unterschiedlicher Ausprägung charakterisieren: die Big Five, angelehnt an die fünf größten und wichtigsten Tierarten in der Savanne Afrikas.
NEO-PI-R nennt sich der daraus entwickelte Fragebogen und ist mit 240 Items ein sehr umfassender Test. Darin werden die fünf Faktoren noch jeweils in sechs Unterskalen – auch »Facetten« genannt – unterteilt:
Extraversion: Herzlichkeit, Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Aktivität, Erlebnishunger und Frohsinn
Offenheit: jeweils Offenheit für Fantasie, Ästhetik, Gefühle, Handlungen, Ideen und bezüglich des Normen- und Wertesystems
Gewissenhaftigkeit: Kompetenz, Ordentlichkeit, Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben, Selbstdisziplin und Besonnenheit
Verträglichkeit: Vertrauen, Freimütigkeit, Altruismus, Entgegenkommen, Bescheidenheit und Gutherzigkeit
Und schließlich Neurotizismus: Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Depression, soziale Befangenheit, Impulsivität und Verletzlichkeit
NEUROTIZISMUS ALS HAUPTDIMENSION DER PERSÖNLICHKEIT
Ausgerechnet der Neurotizismus blieb also als kulturübergreifendes Kernmerkmal unserer Persönlichkeit bestehen – nach unzähligen faktorenanalytischen Durchgängen, destilliert aus tausenden Adjektiven verschiedener Sprachen. Hoch neurotisch oder eben gänzlich unneurotisch sind zwei Pole einer Dimension. Seltsamerweise spricht in Diagnosehandbüchern und Arztpraxen, bei Verhaltenstherapeuten oder Beratungsstellen kaum mehr jemand von der alten – und zu häufig als veraltet befundenen – Neurose. Die Computerwissenschaften jedoch tun es mehr denn je und die Algorithmen der Big-Tech-Unternehmen ebenfalls.
Der neurotische Faktor spiegele individuelle Unterschiede im Erleben von negativen Emotionen wider und wird von einigen Autoren auch als emotionale Labilität bezeichnet.4 Der Gegenpol – zu finden beim maximal unneurotischen User – wird auch als emotionale Stabilität, Zufriedenheit oder Ich-Stärke benannt. Ich-Stärke ist ebenfalls ein Begriff psychoanalytischen Ursprungs. Personen mit einer hohen Ausprägung von Neurotizismus erlebten häufiger Angst, Nervosität, Anspannung, Trauer, Unsicherheit und Verlegenheit.5 Zudem blieben diese Empfindungen bei ihnen länger bestehen und würden leichter ausgelöst. Sie tendierten zu mehr Sorgen um ihre Gesundheit, neigten zu unrealistischen Ideen und hätten Schwierigkeiten, in Stresssituationen angemessen zu reagieren. Personen mit niedrigen Neurotizismuswerten seien eher ruhig, zufrieden, stabil, entspannt und sicher. Sie erlebten seltener negative Gefühle.6
Die Bestimmung der individuellen Persönlichkeitsausprägung aller User durch das Auswerten unserer Spuren im Netz ist folglich ein gigantischer Persönlichkeitstest auf der Basis der Big Five von nie dagewesenen Ausmaßen. Die wenigen Datenmonopolisten in den USA und China wissen also heute längst erschreckend präzise, wer von uns wie neurotisch ist und welcher Persönlichkeitstyp mit welcher Wahrscheinlichkeit wodurch noch neurotischer werden könnte.
JEDER MENSCH IST EIN UNIVERSUM
Erst gezieltes Ausspionieren und Anwenden der persönlichen Informationen (gegen uns) hat in den Bereich des Möglichen gerückt, neurotisierte Massen leichter lenken zu können, um erst unser Fühlen und Denken, dann unser Verhalten nach Wunsch zu beeinflussen. Keine Gehirnwäsche des KGB, keine Marketing-Kampagnen des modernen Kapitalismus, keine Coaching-Seminare von Psycho-Gurus, keine analoge Propaganda hatten dies bisher auch nur annähernd vermocht.
Doch sollte diese Manipulation in Zukunft tatsächlich gelingen, werden Verhaltensvorhersagen präziser werden als Wettervorhersagen. Wenn wir erst mehrheitlich beginnen, unsere Häuser freiwillig zu verwanzen, unsere Apartments zu Smart Homes aufzurüsten, wenn alles im superschlauen Heim Augen, Ohren und Nasen bekommen hat, die uns rund um die Uhr belauschen, überall herumschnüffeln und auf Schritt und Tritt beobachten, dann werden Verhaltensvorhersagen immer genauer zutreffen. Laufen die Datenunmengen dann nur noch an wenigen Stellen zusammen und werden missbraucht, ist das Werk einer Diktatur 4.0 vollbracht. Eine sich selbstständig und vollautomatisiert weiter perfektionierende, vierte Entwicklungsstufe der Diktatur in der Weltgeschichte würde möglich werden – und ist es zu Teilen in der Volksrepublik China schon – , wie wir im dritten Teil des Buches sehen werden.
Solange wir uns nicht (grundlegend) verändern, bleibt die beste Vorhersage für zukünftiges Verhalten unser Verhalten in der Vergangenheit. Denn wenn wir immer Ähnlicheres konsumieren, tun und ersehnen, werden wir Ähnliches tun und uns mit der Zeit immer mehr aneinander angleichen. Also brauchen wir mehr Mut zu eigenständiger Veränderung und die Entschlossenheit, eigene Erlebnisse und Erfahrungen zu suchen und in die Persönlichkeit zu integrieren. Hierzu werde ich immer wieder ermutigen.
Ich setze auf die einzigartigen – häufig unbewussten – Kräfte, die den Menschen ausmachen: Träume, Gefühle, Schmerzen, eine eigene Wahrnehmung und Idee von sich, Vernunft, Moral, Mut zu Veränderung, eine stetige Entwicklung, die Tagesform, (seelische) Narben und vieles mehr. So hat der Homo sapiens sein einzigartiges Erleben in Milliarden von einzigartigen Lebensgeschichten und Beziehungsgeflechten geformt – ein unglaublicher Erlebensreichtum. Wenn wir überleben wollen, dann als diese Menschen. Einen Wettstreit mit einer selbstlernenden KI werden wir sicher verlieren und vielleicht nicht überleben. Schon jetzt ist zu beobachten, dass wir uns zunehmend als suboptimale Mängelwesen erleben. Wenn wir versuchen wollten, in einem Spiel zu punkten, in dem uns die Roboter und künstliche Intelligenz schon jetzt überlegen sind, welcher Trostpreis wird uns bleiben?
Wir sollten schätzen, was uns ausmacht, denn jede und jeder von uns besitzt eine eigene Welt, ein Universum in sich. Algorithmen sind ewig gleiche Rechenmuster, egal von welchem Roboter oder Computer ausgeführt. Sie entscheiden unter gleichen Bedingungen immer gleich. Und welche Bedingungen das sind, können nur wir Menschen festlegen. Wir hingegen sind die Summe des bisher Erlebten, unserer bisherigen Beziehungserfahrungen bei unterschiedlicher Begabung und einzigartiger Genetik.
Und wir sind immer im Fluss. Dadurch integriert jeder Mensch eine neue Information oder Erfahrung einzigartig. Und morgen, nachdem ich die halbe Nacht wegen einer Techno-Party beim Homo Digitalis nebenan nicht schlafen konnte, vielleicht ganz anders. Oder aber ein Homo sapiens in der Wohnung über mir hielt mich wach, weil sie gerne Beethovens Mondscheinsonate des nachts am Flügel übt. In der Folge könnte ich (unbewusst) klassische Musik insgesamt ablehnen, sie fortan anders hören und wahrnehmen. Unsere Erfahrungen und die damit verbundenen Gefühle formen also unsere Wahrnehmung, und diese unterliegt hierdurch einer ständigen Veränderung.
Nein, wir sind nicht ein paar Roboter genormter Bautypen mit unterschiedlichen Softwarevarianten und persönlichen Konfigurationen, sondern bald acht Milliarden einzelne und unverwechselbare Systeme mit einer unverwechselbaren Beziehungsgeschichte, die unsere Wahrnehmung prägt und uns als Menschen formt.
WAS EIN HUND AUS RUSSLAND MIT VERKAUFSSTRATEGIEN AUS DEM SILICON VALLEY ZU TUN HAT
Der Behaviorismus des letzten Jahrhunderts ist die theoretische Grundlage für die Verhaltensmanipulationen des digitalen Überwachungskapitalismus. Vor etwas mehr als hundert Jahren entdeckte Iwan Petrowitsch Pawlow (1849–1936) an seinem Hund, dass er auch dann sabberte, wenn nur die Glocke schellte und er nicht mehr zeitgleich ein Schnitzel zu fressen bekam. Die klassische Konditionierung war geboren. Das war 1905. Zwanzig Jahre später entdeckte jener Nobelpreisträger aus Russland auch noch den Placeboeffekt, indem er einem anderen Hund diesmal kein Schnitzel brachte, sondern Morphium injizierte. Das arme Tier musste sich immer übergeben, auch dann noch, wenn der russische Tierquäler im Dienste der Wissenschaft ausnahmsweise harmlose Kochsalzlösung gespritzt hatte.
Danach begann der Siegeszug der Verhaltenstechniken und der Verhaltenstherapie über den gesamten Globus. Und ein psychoanalytisches Verständnis des Menschen, das sich nicht auf messbare Reize und Reaktionen reduzieren ließ, trat immer mehr in den Hintergrund und galt lange als nicht in harten Zahlen zu verifizieren und deshalb als nicht mehr zeitgemäß. Auch der aufkommende Kommunismus förderte weltweit ausschließlich Forschungen zur Verhaltenslenkung und hielt selbstredend nicht viel von der Bearbeitung unbewusster und ungelöster Konflikte und Traumata. Denn nicht selten war ja das kommunistische System selbst das Trauma der Hilfesuchenden.
So heißt konsequenterweise Psychologie (griech. Seelenlehre) im Silicon Valley »Human Engineering«. Eigentlich ein Begriff für Fachleute auf dem Gebiet der Technik, soll er hier wohl psychologische Techniken zur Verhaltensbeeinflussung von Menschen beschreiben. Es geht um Zahlen, Daten, Mustererkennung und Verhaltensbeeinflussung, nicht um Unterstützung für ein individuelles Streben nach einem erfüllteren Leben.
Diese Ingenieurskunst wird so gut wie nie zur Löschung von konditionierten Verhaltenssüchten eingesetzt, sondern zur vollautomatisierten Verstärkung neurotischen und süchtigen Verhaltens, Denkens und Fühlens. Es ist ein Kampf um unser Unbewusstes, denn dort werden die meisten unserer Entscheidungen bezüglich Konsumverhalten, Präsidenten- oder Partnerwahl und dergleichen mehr getroffen.
Antonio Damasio legt dies in seinem Buch Am Anfang war das Gefühl. Der biologische Ursprung menschlicher Kultur evolutionsbiologisch und neurowissenschaftlich dar: Die kapitalistische Goldgrube ist nicht unser Verstand oder die Vernunft, sondern unser unbewusstes Fühlen und Sehnen. Mit deren Manipulation wird das große Geld gemacht. Und seitdem Algorithmen auf der Basis von immer stärker personalisierten und detaillierteren sowie stetig perfektionierten Psychogrammen jeden einzelnen Internetnutzer auf dieser Welt kennen und theoretisch vollautomatisiert manipulieren könnten, sind nur noch wenige Human Engineers und Programmierer nötig, um jede Frau, jeden Mann und jedes Kind durch die Anwendung von Big Data in die gewünschte Richtung zu verändern, so der Glaube und das ausgerufene Ziel.
Eine vollautomatisierte Konditionierung der Massen wird heute schon in China über einen Social Score, ein soziales Bonitäts-System, angewandt und perfektioniert, das die Konsumenten bewertet, wie wir in Kapitel 18 sehen werden. Nicht die Bürger bewerten hier Produkte oder Dienstleistungen. Nein, der Staat bewertet seine Bürger: Persönlichkeitsrankings und Charakterpunktwerte als Munition im absoluten Wettstreit aller Untertanen gegeneinander, alle mit einer einzigen Motivation: dem Big Other7, der Matrix, dem System, der Partei zu gefallen, indem man sich den Erwartungen konform verhalte, möglichst in seiner Bubble bleibe – einer Echokammer, in der man hört, was man so ähnlich selber schon gesagt hat, sodass man in der Blase Gleichgesinnter mit der Zeit immer gleicher gesinnt wird.
So mussten wir zu Beginn der russischen Invasion in die Ukraine ungläubig feststellen, dass die Mehrheit der Russen tatsächlich glaubte, es handle sich lediglich um eine auf den Osten und einen Regierungswechsel begrenzte »spezielle Operation« und nicht um einen heimtückischen Angriffskrieg mit menschenverachtenden Kriegsverbrechen und hohen Opferzahlen, wie wir in Kapitel 15 noch sehen werden.
Umso mehr sich unser Horizont verengt, umso vorhersehbarer werden wir. So sollen wir mehr konsumieren, was die höchsten Gewinnmargen bringt, häufiger liken, was uns gefallen sollte, mehr wählen, was wir wählen sollen, und das verdrängen (zum Beispiel den Klimawandel oder den Krieg), was uns daran hindern könnte, ungestört weiterhin zu konsumieren. Mehr Konsum, der uns nur in seltenen Fällen psychisch guttut, aber häufig von Produkten oder Dienstleistungen abhängiger macht. Denn die induzierte Konsumsucht bringt den höchsten Profit. Maximale Kundenbindung wird mit dem süchtigen und neurotischen User erreicht. Der bezahlt auch dann noch, wenn er sich hierfür verschulden muss.
Eine Befreiung von dieser Form der Beeinflussung kann nicht über Verhaltens-Coaching erfolgen, sondern nur über die Bewusstwerdung der neuen Manipulationsmöglichkeiten, um anschließend konsequent handeln zu können. Denn wer nicht weiß wohin, dem hilft auch Galoppieren nichts, soll Kurt Tucholsky einmal gesagt haben. Die Quellen unbewusster und unerwünschter Manipulationen müssen zunächst erkannt werden, um sich hernach beispielsweise durch das Löschen von Social-Media-Accounts etwas mehr Autonomie zurückzuerobern. Aus gelenkter Aufmerksamkeit wird eine bewusste und selbstgewählte Aufmerksamkeit. Dann beginnen wir zu entscheiden, wem oder was wir sie schenken.
DIE ABWEHR DER WIRKLICHKEIT
In einer Zeit, in der sich immer mehr um Verhaltensbeeinflussung, Verhaltensoptimierung und Verhaltensänderung dreht, halte ich das psychoanalytische Verständnis des Menschen mehr denn je für hilfreich. Die unbewussten Wünsche, Motivationen, Triebe und Sehnsüchte des Homo sapiens, seine Neigung zu Unvernunft und zur Jagd nach den intensivsten (auch destruktiven) Gefühlen sollen normiert werden, um sie besser kontrollieren zu können und uns noch konsumfreudiger und beeinflussbarer werden zu lassen. Was vor 15 Jahren noch unvorstellbar erschien, ist heute schon weit fortgeschritten.
Wir alle verdrängen und projizieren oder idealisieren täglich. Anders würde uns die Flut der Eindrücke völlig überfordern und lähmen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, verdrängen wir den Rest. Richte ich meine Aufmerksamkeit beinahe ausschließlich auf Immigranten, wird meine gefühlte Wahrheit bald sein, dass sie in der Überzahl sind. Die vielfach beschworene gefühlte Wahrheit ist hier also Ergebnis einer hass- oder angstgetriebenen Verengung der Aufmerksamkeit. Die Dosis macht das Gift, und eine Überdosis könnte sich zu einer xenophoben Neurose oder gar einer Soziopathie auswachsen, wenn ich meine Paranoia ausagiere, indem ich Asylantenheime anstecke oder einen Kassierer erschieße, der lediglich auf die allgemeine Maskenpflicht hingewiesen hat.
Je mehr wir die Wirklichkeit des Lebens und Erlebens von einer bewussten Wahrnehmung fernhalten müssen, desto neurotischer werden wir. Solche Abwehrmechanismen stehlen unsere Zeit, die wir für das Leben und für seine Lösungen bräuchten. Abwehrmechanismen halten die Realität von uns fern, die wir aber benötigen, um konkret etwas zu verändern. Abwehrmechanismen rackern rund um die Uhr, damit wir innere und äußere Konflikte nicht erkennen, angehen und lösen müssen. Sie helfen vielmehr, diese nicht bewusst wahrzunehmen. Konflikte werden tabuisiert, um sie auszusitzen. Sie werden geleugnet, um sie ignorieren zu können. Das Umschiffen der Konflikte sorgt dafür, dass wir uns nicht entwickeln, sondern in der Stagnation einrichten und diesen Zustand einigermaßen – und häufig erstaunlich lange – aushalten.
Doch dann gibt es mehr und mehr Lebensbereiche, die immer großräumiger gemieden werden müssen, Themen, bei denen wir um den heißen Brei herumreden, immer häufigere Situationen, denen wir mit Scheuklappen begegnen, oder wir flippen sofort aus, wenn auch nur ein bestimmtes Stichwort fällt. Begegnungen oder Themen, die wir nicht differenziert oder in ihrer Widersprüchlichkeit zulassen können, häufen sich. Die unvoreingenommene Offenheit schwindet. Wir werden immer neurotischer und damit unflexibler, verspannter, schneller gereizt und weniger gelassen. Eigentlich haben wir in diesen Fällen meist unterschwellig oder offen Angst, sind auf der Hut, in dauerhafter Habtachtstellung. Denn wir rechnen unbewusst immer häufiger damit, dass etwas aufpoppen oder unvermittelt aufbrechen könnte, was der Abwehr entwischte, was sich nicht vorhersehen, kontrollieren oder wegorganisieren ließ.
Wir reagieren immer seltener unvoreingenommen, nehmen die Welt nicht, wie sie ist, sondern biegen sie uns zurecht. Was uns nicht passt, wird passend gemacht, ausgeblendet, hartnäckig ignoriert oder verdrängt. Reicht das nicht: bekämpft. Erst passiv aggressiv, indem wir uns etwa durch Überhören und Nicht-Antworten verweigern. Ich spreche dann von »psychischer Sitzblockade«. Reicht das immer noch nicht, wird offen feindselig – oder gewalttätig – mundtot gemacht. Unsere Neurose will immer mehr im Voraus wissen, planen und kontrollieren, und der Tunnelblick verengt sich weiter, was immer verspannter, weniger spontan, unnachgiebiger und sturer macht.
Lässt sich Überraschendes dennoch nicht ganz verhindern, gibt es entweder die Möglichkeit der noch neurotischeren Reaktion und der neuerlichen Verstärkung der Abwehr durch Aufrüsten mit neuen Abwehrmechanismen. Oder wir beginnen langsam, die Abwehr zu lockern und uns ehrlicher und offener den Anforderungen und Konflikten des Lebens zu stellen. Das geht nicht ohne schmerzliche Selbsterkenntnis und -kritik. Besser noch wäre Selbstkritik gepaart mit Selbstironie, denn Humor lindert den Schmerz. Beides kennt eine chronifizierte Neurose nicht. Nein, die Neurose findet das alles gar nicht zum Lachen.
Es ist wichtig, über den Verstand und die Vernunft die Verbundenheit miteinander nicht zu verlieren. Und es wird immer wichtiger werden, eine Verbundenheit miteinander über den Verstand und die Vernunft zurückzuerlangen – da, wo sie schon verloren wurde oder die Gräben schon unüberbrückbar geworden zu sein scheinen. Wird Herdenimmunität über Herdenvernunft erlangt? Nur der Verstand und die Vernunft schaffen einen nötigen Konsens über Grenzen und Kulturen hinweg. Oder folgen wir kolportierten Falschmeldungen von selbsternannten Pseudo-Experten aus dem Netz? Bekommen wir Angst vor der Rettung und folgen der Gefahr? Das wäre eine kollektive Angstneurose und Massenhysterie: mehr Angst vor der Rettung zu haben als vor einer Gefahr, die Tod und Elend über unsere Welt bringen könnte. Hören wir auf einen Donald Trump, wie die meisten seiner über achtzig Millionen (Ex-)Follower auf Twitter, oder auf einen Epidemiologen Doctor Anthony Fauci mit den rettenden Fakten im Gepäck, die er unermüdlich wiederholt, der aber nur vier Follower hat?
DER HOMO DIGITALIS ALS PRODUKT
Der Homo Digitalis denkt, er konsumiere kostenlose Produkte. Doch er ist das Produkt. Das Perfide daran ist, dass die Manipulierten sogar meinen, sie träfen freiere Entscheidungen als früher, ihre Reichweiten und Verfügbarkeiten seien größer denn je. So gut wie niemand kann noch behaupten, nicht betroffen zu sein. Er müsste schon auf einer Insel im Funkloch wohnen und arbeiten, wie Eingeborene ohne Kontakt zur Außenwelt.
Denn ohne die Reichweite und Verfügbarkeiten selbstbestimmt ausloten zu können, bleiben wir Spielbälle von Tech-Konzernen mit ihren top-bezahlten Suchtexperten auf der Suche nach dem größten Suchtfaktor und Profit. Und von Machtpolitikern, um die Tech-Lobbyisten wie Schmeißfliegen kreisen. Jaron Lanier nennt sie »die neue Kaste der Arschloch-Herrscher« und Donald Trump den »ersten smartphonesüchtigen Präsidenten der Geschichte«.8
Wir werden nicht in einem goldenen Käfig gefangen gehalten, doch von einem filigranen, glamourösen Gitternetz auf Schritt und Tritt umfangen. Es ist weniger Zwang als vielmehr ein stetiges unsichtbares Zupfen und Schubsen. Im Marketing-Jargon heißt das natürlich nicht »Zupfen«, sondern »Nudging«.
So mögen wir zwar sicherer und begüterter sein, sind aber auch gefangener und befangener. Trotz mehr Wissen, Bewegung und Reichweite bewirken immer seltener werdende zwischenleibliche Begegnungen und weniger Berührungen mit emotionaler Rührung, dass wir immer weniger Verständnis und Gespür füreinander aufbringen, wie wir in Kapitel 6 sehen werden. Die Erde ist kein Cyberspace, wir müssen unseren Platz auf ihr finden, und Beziehungen müssen wir anfassen können, wollen wir uns gesund entwickeln. Davon wird in Kapitel 4 die Rede sein.
In einer Zeit, die mehr bewusstes Erleben braucht und weniger reines Ausführen unbewusst wirkender, manipulativer Algorithmen, ist es mehr denn je vonnöten, als Homo sapiens wieder aufrechter und selbstbestimmter über diesen Planeten zu ziehen. Den Kopf zu heben und die Umwelt eigenständig und bewusst zu erkunden. Immer schon im Rudel, mit viel Körperkontakt, Fürsorge und Sorgen, Weitblick und Engstirnigkeit – zwischen Eroberungsdrang und Sicherheitsbedürfnis hin- und hergerissen.
Der Homo Digitalis ist auch nur ein Homo sapiens. So viel ist sicher. Und dass seine Weisheit mehr denn je in Gefahr ist. Stimmen und Bilder ohne Körper manipulieren seinen jahrtausendealten Orientierungssinn, seinen mentalen Kompass, seine Intuition und Wertmaßstäbe, seinen Dopamin-Haushalt und vieles mehr, von dem wir noch gar nichts wissen. Und es geht alles viel zu schnell, immer schneller viel zu schnell. Die exponentiell sich beschleunigenden Prozesse sind zu schnell für unsere jahrtausendealten Anlagen und genetischen Anpassungsprozesse.
Wir alle sind angeblich längst zu einem einzigen Rudel vernetzt worden und ein globales Dorf geworden. Doch wenn wir uns umschauen, kämpft jeder gegen jeden. Jede und jeder muss im digitalen Kapitalismus des neuen Jahrtausends schauen, wo sie und er bleibt – will heißen, wie man noch irgendwie aus der Masse an Daten herauszustechen vermag.
UND TÄGLICH BLÄST DER SHITSTORM
Das Internet ist augenscheinlich enttabuisiert, gibt vor, wir dürften sein und uns geben, wie es uns gefällt. Doch es gibt einen unsichtbaren und unbewussten Verhaltens- und Meinungskodex, den es einzuhalten gilt. Und wer ihn nicht beachtet, den bringt ein Shitstorm der Empörung schnell zum Schweigen, häufig mit traumatischen Folgen für die Betroffenen. Die Diffamierungen hinterlassen depressive und gebrochene Menschen mit Gefühlen der Wertlosigkeit.
Wollen wir es zulassen, kollektiv zu einem Volk von Neurotikern zu werden, das zumeist das Gegenteil von dem tut, was angebracht und dringend geboten wäre? Nur um von anonymen Teilnehmern im Netz gemocht und akzeptiert zu werden? Sei es auch nur, um in Ruhe gelassen zu werden?
Oder machen und fühlen wir das Gegenteil dessen, was angebracht wäre? Verspüren beispielsweise Schadenfreude oder Hass statt Mitgefühl? Neid statt Stolz? Zynismus statt Hilfsbereitschaft und Langmut? Beginnen, das Gegenteil dessen zu bedenken, worüber nachzudenken angezeigt wäre? Sinnieren wir zum Beispiel über noch bequemere Möglichkeiten oder Schlupflöcher im System, anstatt uns über Lösungsvorschläge den Kopf zu zerbrechen? Die Pandemie ist hier der Testlauf für die ungleich größere Herausforderung: die Klimakrise.
Stattdessen sollten wir über Wege nachdenken, wie wir zurück zu mehr Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit finden können; darüber, welchen Manipulationsversuchen wir uns wie entziehen sollten. Ja, Neurosen und Neurotiker gab es immer. Doch noch nie gab es Kommunikationsformen, die designt wurden, um uns zu abhängigeren Neurotikern zu machen, und die täglich weiter perfektioniert werden: vollautomatisiertes Zuckerbrot und algorithmische Peitsche, Erleichterung und Erschwerung, Belohnung und Beschimpfung, Applaus oder Shitstorm, ausgegrenzt oder gehypt, erst himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt, vollautomatisierte Liebe und vollautomatisierter Hass. Dem Homo sapiens wird schwindelig.
Denn es gibt sie erst seit etwa 15 Jahren: die vollautomatisierten Manipulationsmaschinen – für den Homo sapiens noch nicht mal ein Schritt in seiner Entwicklungsgeschichte, auch wenn er sich mittlerweile Homo Digitalis nennt. Und zu Beginn waren sie noch lange harmlos. Nur die nach der Jahrtausendwende Geborenen der Generation Z sind damit groß geworden. Doch der gewaltige Umbruch der letzten Jahre betrifft uns alle. Er ist vielleicht nur noch mit dem Ersetzen der menschlichen Muskelkraft durch Verbrennungsmotoren und Dampfmaschinen gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts zu vergleichen, als die Industrialisierung und Moderne mit voller Wucht die Breite der Gesellschaft erreichte und in einem ersten Weltkrieg gipfelte. Die Spanische Grippe zeigte dann die Schattenseiten der neu gewonnenen Mobilität auf.
Gerade werden nicht unsere Muskeln, sondern unsere Gehirne ersetzt. Es beginnt die Schlacht um unsere letzte Bastion. Wir müssen und dürfen es miterleben. Dürfen, da große Veränderungen in der Menschheitsgeschichte immer auch spannend waren. Und nur wir, die wir in diesen turbulenten Zeiten leben, können sie gestalten.
Der große deutsche Soziologe Andreas Reckwitz beschreibt die Nähe seiner Sozialanalysen zum psychoanalytischen Menschenverständnis wie folgt: »Die Psychoanalyse kann sich hier durchaus mit der Sozialanalyse verbünden, welche die gesellschaftliche Bedingtheit mancher Paradoxien herausarbeitet und so dem Individuum ein umfassendes Verständnis seiner Situation ermöglicht.«9 Mit dieser Sozialanalyse verbünde ich mich sehr gerne und hoffe ebenfalls, mit der Lektüre dieses Buches dem Individuum – durch eine psychologische Sozialanalyse sozusagen – ein umfassenderes Verständnis seiner Situation zu ermöglichen. Auch glaube ich, dass hier die dringend benötigte Verjüngungskur für eine häufig nostalgisch verstaubte Psychonanalyse zu suchen ist.
DIE ANALYSE DES HOMO DIGITALIS
Wenn Andreas Reckwitz in seinen Sozialanalysen von »bestimmten Versionen der Psychoanalyse« spricht, meint er nicht die klassische Psychoanalyse der Freudianer alter Schule, sondern neuere, sogenannte »tiefenpsychologisch fundierte« Psychotherapieformen mit Sitzungen, die nicht mehr im Liegen auf einer Couch oder einem Kanapee abgehalten werden, ohne Sichtkontakt zwischen Patienten und Therapeut und mit mehreren Sitzungen pro Woche. Ursprünglich sollte diese räumliche Anordnung freies Assoziieren für die Patientinnen und Patienten erleichtern. Verständlich, dass Ängste und Scham vor einer völlig neuen Behandlungsmethode – und ihren möglichen unerwünschten Nebenwirkungen – noch stärker den therapeutischen Prozess behinderten als heute, über hundert Jahre später.10
Wie diese kurzen Ausflüge zu den Anfängen von Freuds Psychoanalyse bereits zeigen, leben wir heute in einer völlig anderen Welt mit anderen Ängsten, Zwängen und Süchten. So scheint mir denn auch der vertrauliche Blickkontakt unverzichtbarer denn je zu sein. In einer Zeit, in der wir immer weniger Gesprächspartner auch zu Gesicht bekommen. Denn heute geht es vielmehr um eine spürbare Berührung und emotionale Rührung, um eine vertrauensvolle und heilsame Begegnung und nicht zuletzt um eine therapeutische Beziehungsarbeit, die traumatische Erfahrungen korrigieren, also innerlich lösen kann. Es geht in heutigen Therapien vor allem um die Erfahrung, verstanden und angenommen zu werden.
In diesem Sinne geht es – zumindest, was meine Patientinnen und Patienten angeht – nur noch selten darum, alte vergessene oder verdrängte Konflikte überhaupt erst einmal zu erinnern oder ins Bewusstsein zu rufen, sondern immer häufiger geht es um Abhängigkeiten, Süchte, Beziehungsängste, Kontrollzwänge, verzerrte Körperbilder, tägliches (Cyber)Mobbing, die Einsamkeit in der Pandemie, Depressionen, die »Burn-out« genannt werden wollen, sexuelle Frustrationen, spielsüchtige Kinder, ein krankmachendes Leistungsdenken, Sorgerechtsstreitigkeiten, Schulden, Schönheits-OPs bei Minderjährigen, Selbsthass sowie mannigfache, aber durchaus bewusste Ängste und Zwänge, die mit Einschränkungen des Alltags und einem Verlust innerer Freiheitsgrade einhergehen. Und es gibt noch viele andere Gegenwartsneurosen, wie wir im Verlauf des Buches noch sehen werden.
Auch werde ich – über die Kapitel verteilt – immer wieder auf verschiedene Psychoanalytiker verweisen, die meine Art, psychodynamisch und tiefenpsychologisch zu arbeiten, inspiriert und geprägt haben. Aber auch die Integration verhaltenstherapeutischer Behandlungstechniken ist – beispielsweise bei der Behandlung von Süchten – geradezu zwingend geboten.
WAS HEISST HIER NEUROSE?
Darüber hinaus ist mir bewusst, dass mein Umgang mit dem Neurosebegriff sehr frei ist und nicht klassischen Definitionen entspricht. Ich bezeichne hier verschiedene pathogene psychische Ausprägungsformen als Neurosen, die nicht unter die Kategorie der Psychosen fallen. Manches müsste streng genommen auch eher als Persönlichkeitsstörung – Freud sprach von »Charakterneurose« – denn als Neurose betitelt werden. Insbesondere bei extremer Ausprägung, wenn (fast) alle Lebensbereiche betroffen sind oder wenn die Störungen schon über viele Jahre andauern.
Außerdem war mir wichtig aufzuzeigen, wie unsere Resilienz – also die Widerstandsfähigkeit der Psyche des Homo Digitalis gegenüber den neuen Einflüssen – gestärkt werden kann und wie Wege aus den neuartigen Süchten und Netzneurosen gelingen können. In diesem Sinne gebe ich auch einen Ausblick, wie sich die Entwicklungen und neuen Manipulationsformen auf unsere Gesundheit und auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirken könnten, wenn wir uns ihrer nicht bewusst werden und rechtzeitig gegensteuern.
Des Weiteren war es mir ein Anliegen, ein Buch über die Psyche des Homo Digitalis und über die wichtigsten Gegenwartsneurosen im digitalen Zeitalter des 21. Jahrhunderts zu schreiben, das von Usern und von Kollegen gleichermaßen gewinnbringend gelesen werden kann. Mein Panorama möchte die zentralen Herausforderungen und die daraus resultierenden Belastungen, Überforderungen und Gefahren sowohl für jeden Einzelnen von uns als auch für die Gesellschaft als Ganzes ergründen.
Ich möchte mich an alle Erwachsenen wenden, insbesondere Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, jugendliche User, die verstehen wollen, warum sie immer süchtiger, selbstunsicherer und depressiver werden, sowie Großeltern, die ihre Enkel und deren Sprache und Nöte noch verstehen lernen wollen, aber auch an Fachleute wie Psychiater, Psychotherapeuten, Pädagogen und alle, die beruflich mit den gewaltigen Umwälzungen konfrontiert sind. Da die digitale Revolution immer mehr Lebensbereiche durchdringt und wir zukünftig immer mehr Zeit vor Displays verbringen dürften, werden immer mehr Menschen von neuen Süchten und Neurosen betroffen sein, und eine reflektierte Auseinandersetzung wird immer dringlicher geboten sein.
In meinem Lieblingsfilm Forrest Gump sagt der kleine Forrest immer, wenn er mal wieder im Schulbus gehänselt wird, den Spruch seiner Mutter auf: »Dumm ist, wer Dummes tut!« Ganz im Sinne von Mrs. Gump könnte man also sagen: »Neurotisch ist, wer neurotisch bleibt!« Nicht jede oder jeder konnte verhindern zu werden, wer sie bzw. er ist, aber niemand ist gezwungen zu bleiben, wer sie bzw. er ist. Nicht jede oder jeder konnte etwas dagegen tun, aber jede oder jeder kann fortan die Dinge anders machen. Und immer müssen Worten auch Taten folgen. Meine Sicht auf 21 neurotische Aspekte und meine Einschätzungen der Entwicklungen sollen zu eigenen Ansichten ermutigen, nicht zwangsläufig zu übereinstimmenden, hoffentlich aber schon zu bewussteren und reflektierteren Ansichten, die etwas in Gang setzen.
Und noch etwas: Ich möchte ausdrücklich dazu einladen, mit dem Kapitel im Buch zu beginnen, das Sie als Erstes anspringt. Ihr Unbewusstes weiß meist schon vor Ihnen, was Sie dringend lesen sollten. Machen Sie das dann ruhig und lesen nicht – wie sozial erwünscht, also Ihrem Über-Ich gemäß – sklavisch von Anfang bis Ende. Da ich versucht habe, die 21 Kapitel und Neurosen jeweils in sich geschlossen darzustellen, ist dies gut möglich.
Und schließlich möchte ich das psychoanalytische Denken und Menschenverständnis mit den Auswüchsen unserer Zeit konfrontieren, versuchen, es in Einklang zu bringen, wo es geht, und ich hoffe, dass diese digitale Turbozeit von einer solchen Betrachtungsweise profitieren kann. Angeregt durch Gedanken, die aus den gemächlicheren Zeiten der K.-u.-k.-Monarchie stammen, aus einem Wien der Kutscher, mit Brieftauben am Himmel über der Berggasse.
DIE DREI TEILE: LIEBE // ARBEIT // SINN
Es gibt meines Erachtens vier Faktoren, die das dritte Jahrtausend maßgeblich prägen und noch mehr prägen werden. Wir stehen erst ganz am Anfang dieser vier Entwicklungen, die uns alle psychologisch, ökonomisch und soziologisch entscheidend verändern werden:
vermehrt auftretende Seuchen als Folge der Globalisierung, einer vermehrten Mobilität und des Bevölkerungswachstumsimmer häufigere extreme Wetterereignisse und andere Folgen der menschengemachten Erderwärmungum sich greifende soziale Verwerfungen und Kriege durch verführerische – und gezielt potenzierte – Falschinformationen oder durch die Unterdrückung von korrekten Informationenund schließlich die Folgen rasant fortschreitender selbstlernender künstlicher Intelligenzen und ihrer immer lückenloseren Vernetzung miteinander. Immer mehr Roboter und vernetzte KI-Systeme werden immer weniger menschenwürdige Arbeit übrig lassen.Alle vier Faktoren werden die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern weiten – zwischen denen, die Informationen haben, und denen ohne oder mit falschen Informationen, zwischen denen in sicheren und intakten Regionen und den Entwurzelten in Flüchtlingscamps, zwischen Kriegsflüchtlingen und Kriegstreibern, zwischen den Mittellosen und Krisengewinnern, zwischen Aktivisten und Opportunisten. Vermehrte Depressionen und Aggressionen, Verzweiflung und Auflehnung, Trauer und Wut, Selbsthass und Hass sind jeweils zwei Seiten derselben Medaille dieses neuen Jahrtausends.
Alle vier Faktoren werden immer mehr Einfluss auf unsere Psyche, unser Denken und unsere Gefühle erlangen. Unser Verhalten und unsere Beziehungen werden sie grundlegend verändern und formen. Gut zwanzig Jahre liegen erst hinter uns, über 970 noch vor uns. Doch schon zu Beginn dieses neuen Jahrtausends kann man erahnen, wie sehr beispielsweise das neuartige Coronavirus unsere zwischenleiblichen Begegnungen dauerhaft reduzieren wird. Unsere Zeit vor Displays wird weiterhin jährlich mehr werden, ebenfalls durch alle vier Faktoren angetrieben. Fake News dürften mehr werden, die Arbeitslosenzahlen steigen und Regionen, die ein sicheres, gelungenes und gesundes Leben noch ermöglichen, seltener werden.
Es ist zu befürchten, dass jüngere Generationen nicht mehr unbeschwert und sorglos die Welt entdecken und erkunden können werden. Der Wert des Reisens und Erkundens ist für die Persönlichkeitsentwicklung nicht zu unterschätzen. Werden Franzosen sich in zehn Jahren noch dreimal zur Begrüßung küssen? Oder werden wir weltweit nur noch eine asiatische Verbeugung aus sicherer Entfernung machen, wie ich mir das während der Pandemie in der Praxis angewöhnt habe? Wird die Generation Greta noch fremde Kontinente und Kulturen kennenlernen? Wie viele Umschulungen werden sie durchlaufen müssen, wenn sie Arbeit finden wollen? Und wie viele Demonstrationen werden noch friedlich verlaufen und genehmigt werden? Bei wem wird noch Trinkwasser aus dem Wasserhahn kommen, und wer wird noch regelmäßig Sex mit echten Menschen haben? Wer wird sich noch als glücklich und zufrieden beschreiben? Wer als selbstbestimmt und selbstwirksam? Wer wird genug zum Leben haben? Wie viel ist mir genug? Wann reicht es? Sehr viele Fragen, auf die der Homo Digitalis dringend eine Antwort braucht.
Körperkontakt, die Leichtigkeit des Seins, sichere und unbefristete Arbeitsverhältnisse, ein gelassenes Vertrauen in die Medien und in die Regierenden, in Eliten und in die Wissenschaft werden seltener beziehungsweise gefährlicher werden. Ich fürchte, Einsamkeit, Zukunftsängste, Misstrauen und unterschiedlichste Formen von Terror und Aufruhr werden uns gesellschaftlich wie psychisch zunehmend prägen und begleiten.
Resilienz aufzubauen, also die Stärkung unserer psychischen wie gesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen disruptiven und krank machenden Wirkfaktoren, wird immer dringlicher werden. Zur Stärkung möchte ich einen Beitrag leisten, vor allem durch Erkenntnis und Ermutigung. Blindes Vertrauen werden wir uns immer weniger leisten können, doch wohl überlegtes, wählerisches und gut informiertes Vertrauen wird immer lebenswichtiger werden. Denn ohne Vertrauen gibt es keine Gemeinschaft und keine psychische wie körperliche Gesundheit.
Nur wir sind bei vollem Bewusstsein auf diesem Planeten, und darum können nur wir wählen zwischen Krieg und Frieden, zwischen Hass und Liebe, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Mensch und Maschine, zwischen Ausbeutung und Unterstützung, zwischen Schöpfung und Materiallager, zwischen Hoffnung und Verzweiflung.
Liebe beziehungsweise Hass als Summe unserer Beziehungen, Arbeit beziehungsweise Arbeitslosigkeit im Sinne eines würdevollen und produktiven Lebens oder eben nicht sowie Sinn als Folge eines gelungenen und erfüllten Lebens oder Verzweiflung und Selbstauflösung in einer abstrakten Matrix – das sind die großen Fragen und Herausforderungen des neuen Jahrtausends, zumindest meiner Meinung und meiner Einschätzung nach, wenn ich meine Patientinnen und Patienten der letzten zehn Jahre vor meinem geistigen Auge Revue passieren lasse.
Diese Tiefen und Untiefen wollen die drei Teile dieses Buches Liebe, Arbeit und Sinn nun folgend ausloten.
TEIL 1 // LIEBE 4.0
AM ENDE GEHT ES UM LIEBE UND WERTSCHÄTZUNG