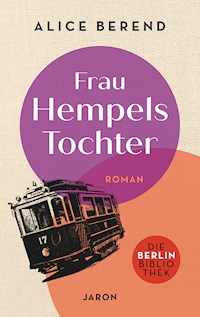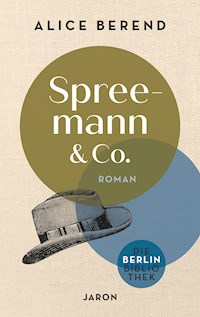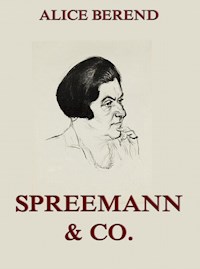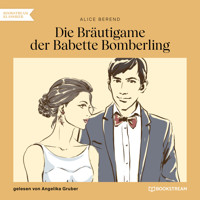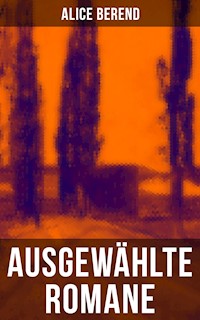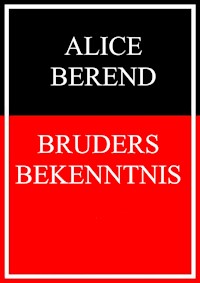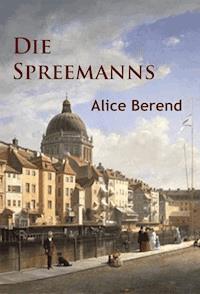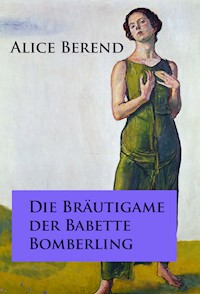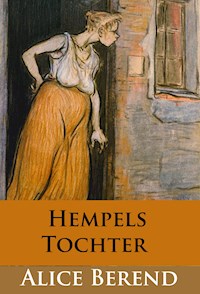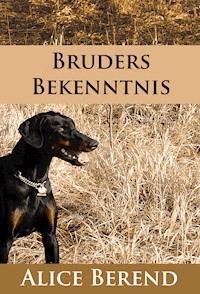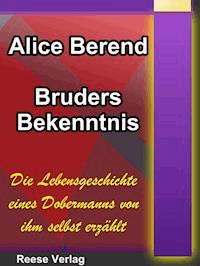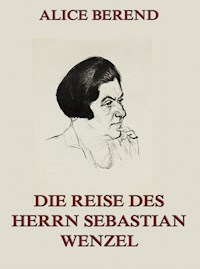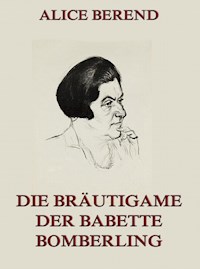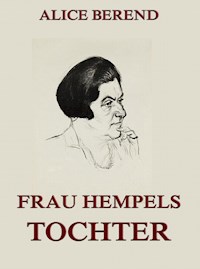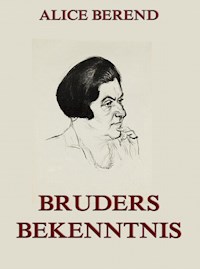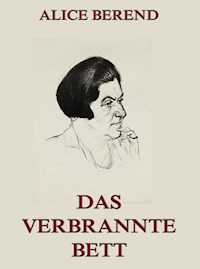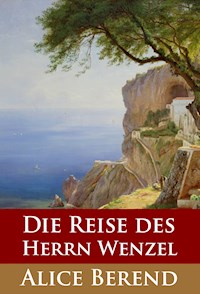
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müller, Dirk
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
»Warte doch, Sebastian«, sagte eine seiner Schwestern. »Falls es zu spät wird, nimmst du dir eine Droschke.« Alle lachten. Der Gedanke, daß sich Sebastian Wenzel eine Droschke nehmen könne, war ebenso komisch, wie wenn man sich den Kaiser barfuß durch die Straßen laufend dächte. Sebastian warf einen verächtlichen Blick durch den Raum, verbeugte sich und ging. Ehe er aus der Haustür trat, klappte er die Beinkleider an den Füßen auf, und nachdem er sich überzeugt hatte, daß noch Zeit genug übrig sei, um zu Fuß gehen zu können und die Straßenbahn zu sparen, eilte er mit langen Schritten durch das Gedränge. Im Büro empfing ihn die spöttische Frage: »Nun, wieviel?« »Ich habe die Sache nicht abwarten können«, sagte Sebastian, steckte den Bleistift hinter das Ohr, nahm den Federhalter in die Hand und setzte sich vor sein Schreibpult. Zum letzten Mal. Einige Stunden später war er Millionär geworden ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
w
Alice Berend
Die Reise des Herrn Wenzel
idb
ISBN 9783961509393
1
Die meisten müssen arbeiten, um essen zu dürfen, essen, um wieder arbeiten zu können und so, mit Sorge, Mühe und ein bißchen Glück, mahlen sie die ihnen zugeteilten Tage ab.
Herr Sebastian Wenzel hatte das nicht nötig.
Daß er einmal selbst, treu und bedächtig, an dem Maschinenrad des Alltags mitgedreht hatte, lag weit zurück. Er wußte es selbst nicht mehr.
Jetzt war ihm das Essen ein Genuß, für den er sich durch regelmäßige Spaziergänge, kalte Abreibungen, angenehme Gedanken und kleine Arzneien frisch und aufnahmefähig erhielt. An Regentagen, an denen er aus Furcht vor Rheumatismus und anderen Erkältungserscheinungen niemals das Zimmer verließ, sorgte er für die notwendige Bewegung des Blutes, indem er sich einem kleinen Ärger heftig, aber nicht übertrieben, hingab.
Verdruß findet sich genug in der Welt.
Wird zum Beispiel je eine Köchin begreifen, daß eine Prise Salz mehr oder weniger den Geschmack eines Gerichtes vollständig verändert? Oder: daß das köstlichste Stück Lende, nur den Bruchteil einer Sekunde zu lang auf dem Rost gelassen, zäh und ledern zu werden beginnt? Daß eine Omelette soufflée – übrigens eines der delikatesten Gerichte der Welt – sofort vom Backofen aus auf den Tisch gebracht werden muß? Wird sie das je begreifen? Niemals.
Oder ein andrer Verdruß, der Herrn Sebastian Wenzel gerade heute wieder traf:
Er wartet mit der Uhr in der Hand auf die einzige Zerstreuung des verregneten Tages: Die Zeitung. Er klingelt und sagt, daß die Zeitung längst da sein müsse, aber erhält zur Antwort, daß sie bei Regenwetter immer später käme. Schließlich geht er selbst hinaus, schlägt den Rockkragen hoch und öffnet vorsichtig die Hintertreppentür. Richtig, da liegt das Blatt vor der Schwelle, und wirklich ist auch schon ein nasser Stiefel darüber hinweggetreten. Er hat seit Jahr und Tag einen breiten Kasten mit Luftlöchern und Nickelschloß anbringen lassen, aber noch niemals durfte dieser Behälter seine Bestimmung erfüllen.
So hat er Ärger über Ärger.
Denn nun muß das feuchte Blatt erst in der Küche getrocknet werden. Diese Notwendigkeit begreift ein Dienstbote natürlich nicht im geringsten. Gegrinst wird, wenn Herr Wenzel nun deutlich erklärend sagt: Trocknen Sie das Blatt über dem Feuer, ungefähr drei oder vier Minuten, und achten Sie darauf, daß Sie es dabei nicht versengen. Dann plätten Sie es, lassen es gehörig abkühlen und bringen es mir mit sauberen Fingern in mein Zimmer. Im ganzen hat alles in allem nicht mehr als zehn Minuten in Anspruch zu nehmen. Verstanden?
Nun wartet Herr Wenzel wieder, die Uhr in der Hand, in dem bequemen Stuhl am Fenster. Aber es ist ihm wohler zu Mut. Die kleine Bewegung hat ihn erfrischt.
Draußen klappt wütend das Bügeleisen – ein zufriedenes Lächeln legt sich um die schmalen Lippen Sebastian Wenzels.
Er fühlt sich wieder ruhig und behaglich. Nichts tut so gut wie ein kleines Ärgerchen ...
2
Daß Herr Sebastian Wenzel diesen Zuschauerplatz im Leben einnahm, war höchst verwunderlich. Sonst hatten alle Wenzels immer etwas weniger gehabt, als sie brauchten. Bis auf eine Tante. Diese war, mittels Heirat, zu großem Reichtum gelangt. Ihr Mann hatte mit einer kleinen Farm unversehens eine Kupfermine gekauft. Im Laufe des Lebens wurde sie Witwe und in der Familie der Gegenstand allgemeiner Verehrung. Denn Kinder hatte sie nicht.
Als siebenjähriger Knabe nahm Sebastian, im Beisein seiner Tante, eine Stecknadel vom Boden auf. Die Tante, die dies beobachtete, sagte sich: in diesem Kinde steckt der wahre Sinn zur Sparsamkeit. Sie beschloß bei sich, allen lauernden Verwandten zum Trotz, den kleinen Neffen zu ihrem einzigen Erben einzusetzen.
Sebastians Absicht damals war, die Stecknadel mit der Spitze nach oben in den Stuhlsitz der Tante zu stecken. Er mochte sie nicht leiden, weil alle schön mit ihr taten, obgleich eine große Warze auf ihrer kurzen, dicken Nase saß.
Niemand kann hinter die Stirn des andern sehen. So müssen wir uns gefallen lassen, daß unsern Handlungen falsche Beweggründe untergeschoben werden ...
Die Tante hatte ihren letzten Willen geschrieben und ihn beglaubigen lassen.
Manche behaupten, dies sei das sicherste Mittel, um lange zu leben. In diesem Fall muß ihnen recht gegeben werden. Die vorsichtige Frau überlebte diese ernste Tat, zu der sie sich im fünfzigsten Lebensjahr entschloß, um siebenunddreißig und dreiviertel Jahr. –
Inzwischen ging Sebastian Wenzel seinen bescheidenen Weg durch Kindheit und Jugend.
Vielleicht lag seine künftige Bestimmung als dunkle Ahnung in ihm. Wenigstens kannte er keine größere Freude, als Geld zusammenzuhalten und anzuhäufen. Was andern Knaben die Käfersammlung und später das Heftchen mit den ersten unbeholfenen Reimen ist, war Sebastian das Sparkassenbuch.
Hatte also Sebastians so reich begüterte Tante auch damals den Neffen mißverstanden, so hatte sie sich doch im Grunde seines Wesens nicht geirrt.
Er war der einzige der Verwandten, der ohne Kranz zur Beerdigung kam. Es fiel ihm nicht ein, Geld für etwas herauszuwerfen, was niemand zunutze kam. Die drei Mark, die er dafür hätte ausgeben müssen, trug er auf dem Rückweg vom Kirchhof zur Sparkasse.
An die Erbschaft dachte er nicht im geringsten. Es war ihm klar, daß ihm von Weibern nichts Gutes kommen könne.
Im engen Heim, zwischen den Streitigkeiten einer kränkelnden Mutter und zwei rechthaberischen Schwestern, war ihm der Geschmack für das andere Geschlecht gründlich verleidet worden. Er rechnete die Frauen zu einer minderwertigen Gattung Mensch und behauptete, daß die Luft schwül und dumpf werde, wenn sie im Zimmer oder nur in der Nähe wären.
Nicht viele junge Männer denken so. Daher lachten ihn seine Kollegen aus. Er bemitleidete sie. Es tat ihm leid, daß sie den größten Teil ihres Verdienstes, wofür sie von früh bis spät im Büro saßen, an den Sonntagen für ein solches plapperndes, gefräßiges Ding ausgaben. Er begriff nicht, wie sie in Regen und Sonne geduldig warten konnten, bis es dem Fräulein einfiel, fein geputzt daherzukommen. In den Hüften wippend, wie ein gackerndes Huhn. Er wußte schon in seiner Kindheit, wie sie, hinter den Gardinen, ungekämmt in den Frisierjacken aussahen. Er kannte sie. Er mied sie und die mit ihnen verbundenen Unkosten auf das strengste. Nein, Weiber sind nichts wert, und wenn sie hundert Jahr alt werden.
Trotzdem ging er zur Testamentseröffnung. Nicht weil er dabei etwas für sich erhoffte, sondern weil er auf alles gespannt war, was mit Geld zusammenhing.
Leidenschaft reißt uns hin.
Sonst wäre es kaum zu erklären, daß Sebastian an einen Ort ging, wo er mit Sicherheit seiner ganzen Familie begegnen mußte.
Von dem Tag an, an dem er sein erstes Gehalt bezog, war er allen miteinander aus dem Weg gegangen. Denn wenn man aufrichtig ist – worin besteht das Familienleben des Unverheirateten? Daß er zu Hochzeiten, Taufen und Geburtstagen eingeladen wird, um Geschenke zu bringen. Davon hatte sich Sebastian zurückgezogen.
Man war ihm nicht sehr nachgelaufen. Man hatte keinen Grund dazu. Es ist durchaus ein Irrtum, wenn behauptet wird, daß kleine Geschenke die Freundschaft erhalten. Auch hier wird immer die Größe siegen. –
Die Begrüßung im Vorzimmer des Notars war gegenseitig kühl und gemessen.
Was von der Familie Wenzel lebendig und aus den Kinderschuhen heraus war, wartete hier verdrießlich und unruhig. Groß, hager und mager stand Sebastian unter ihnen. Er musterte seine beiden Schwestern, die mürrisch neben ihren einmal hartnäckig erkämpften Gatten saßen. Die langweiligen, geduldigen Gesichter seiner Schwager erschienen ihm in der Untätigkeit des Wartens noch leerer. Zwei gleichgekleidete fette Frauen, mit hastig aufgesteckten Kapotthüten und dem verärgerten Ausdruck der aus den häuslichen Beschäftigungen gerissenen Hausfrau, nickten ihm herablassend zu. Erst allmählich erkannte er in ihnen seine schnippischen, zierlichen Cousinen wieder. Ein dicker Herr, dessen Atem durch das Zimmer pfiff, sagte: »Sieh einer an. Auch unser Sebastian gibt uns die seltne Ehre.« Das war Vetter Fritz, mit dem er auf die Bäume geklettert war.
Man flüsterte, man scharrte ungeduldig mit den Füßen. Uhrdeckel klappten auf und zu. Eigentlich dachten alle, in bezug auf die Erbschaft, nicht anders als Sebastian. Die – nun sanft entschlafene – Tante hatten Gicht und Gelbsucht nicht liebenswürdiger gemacht, als sie es als echte Wenzel ohnedies war. Oft genug hatte sie wiederholt, daß ihr Tod nur einem einzigen Freude machen würde. Daß dies niemand aus der Familie sein konnte, schien allen klar zu sein.
Aber der Mensch hofft, solange er atmet. So saßen sie hier mit dem unverwüstlichen Glauben, mit dem man zeitlebens auf Dinge wartet, die niemals kommen. Nur Sebastian riß die Geduld. Er mußte zurück in das Büro, er hatte nicht mehr als zwei Stunden Urlaub.
»Warte doch, Sebastian«, sagte eine seiner Schwestern. »Falls es zu spät wird, nimmst du dir eine Droschke.«
Alle lachten.
Der Gedanke, daß sich Sebastian Wenzel eine Droschke nehmen könne, war ebenso komisch, wie wenn man sich den Kaiser barfuß durch die Straßen laufend dächte.
Sebastian warf einen verächtlichen Blick durch den Raum, verbeugte sich und ging.
Ehe er aus der Haustür trat, klappte er die Beinkleider an den Füßen auf, und nachdem er sich überzeugt hatte, daß noch Zeit genug übrig sei, um zu Fuß gehen zu können und die Straßenbahn zu sparen, eilte er mit langen Schritten durch das Gedränge.
Im Büro empfing ihn die spöttische Frage: »Nun, wieviel?«
»Ich habe die Sache nicht abwarten können«, sagte Sebastian, steckte den Bleistift hinter das Ohr, nahm den Federhalter in die Hand und setzte sich vor sein Schreibpult.
Zum letzten Mal. Einige Stunden später war er Millionär geworden ...
3
Wie die Ameise nichts weiter sieht als ihren Bau und den schmalen Weg, auf dem sie im geschäftigen Hin und Her die großen, schweren Winzigkeiten herbeischleppt, so hatte auch Sebastian Wenzel nichts anderes gekümmert als das, was ihn selbst anging. Alles, was nicht im engsten Zusammenhang mit ihm selbst stand, war ihm gleichgültig. Bei unsinnigen Wünschen hatte er sich nicht aufgehalten. Unmögliches war ihm lächerlich.
Die sanften, rosenduftenden Sommerabende freuten ihn, weil er die Lampe sparen durfte. Der verlorene Ton eines Liedes, den der Wind zu ihm trug, weckte kein schmerzliches Verlangen nach den Wundern Ägyptens, den Geheimnissen Indiens, den Seen Japans, sondern er sagte sich, daß man es gut haben könne, auch ohne teure Reisen.
Er hatte auch seine Sehnsucht. Aber sie schwebte nicht im blauen Dunst. Einfach und ehrlich, wie er selbst, schritt sie neben ihm. Nur an den Sonntagen – im Sommer in einem Vorstadtgärtchen, im Winter in der verräucherten Stube eines Bürgerbräus – konnte sie einmal über die Stränge schlagen. Dann wünschte er sich in das kleine eigene Heim, das er stets vor Augen hatte: einen Klubsessel aus Juchten und einen automatischen Staubreiniger.
Ihm graute vor den möblierten Zimmern, in denen er wohnen mußte. Wo der Staub von Generationen in den Ecken lag, wo die scharfen Lehnen der Stühle gerade da aufhörten, wo sie den Rücken stützen sollten, wo man nie wußte, wieviel verliebte Mädchen schon auf dem abgenutzten Sofa gesessen hatten. Ein eignes Bett hatte sich Sebastian von seinen ersten Ersparnissen gekauft.
Ein eignes Heim, das war seine Sehnsucht. Drei Zimmer und eine saubere, appetitliche Küche mußte er haben. Ohne Frau, lärmende Kinder und unreinliche Hunde. Schon wenn man die Tür aufschloß, sollte man den Geruch guter Bratensoßen spüren.
Die andre Hälfte seiner Sehnsucht war: Gut und in Ruhe essen zu können. Nicht mit der Uhr in der Hand die Mahlzeiten einzunehmen und statt des ausgekochten Suppenfleisches oder der Fleischklöße, von denen außer der Wirtin nur Gott wußte, woraus sie bestanden, köstliche, sorgfältig zubereitete, lecker aufgetragene Speisen vorgesetzt zu bekommen.
In jedem übrigen Augenblick modelte er an diesem Plan. Im Laufe der Jahre war die Wohnung schön mit Möbeln aus allen Holzarten der Tischlerkunst ausgestattet gewesen. Über dem blanken Herd in der Küche zog sich jahrelang eine Borte aus krähenden Hähnen, jetzt sollte sie aus Sonnenblumen sein. Dann und wann unterstützte Sebastian seine Sehnsucht durch den Besuch eines fertiggestellten Neubaus, wo er die leeren, hellen Zimmer mit den neuen Dielen und Fenstern andachtsvoll durchschritt.
Dieser Blick in die Ferne trug ihm so reichlich Freude, daß er keine kostspieligen Vergnügungen brauchte. Schmucklos gingen seine Tage durch den wundervollen Wandel der Jahreszeiten. Doch keiner war ohne Freude. An jedem fand sich die Möglichkeit zu einer kleinen Ersparnis, die er nicht vorausgesehen hatte. –
Von einer Minute zur andern stand Sebastian Wenzel vor dem Ziel seiner Wünsche.
Früher als er erfuhr es die schwarzgekleidete Verwandtenschar. In schweigenden Gruppen verließ sie das Zimmer des Notars, wie tags zuvor das Grab der Tante. Alle Mienen waren wirklich so, wie man sie von trauernden Hinterbliebenen verlangt.
Eine der Schwestern flüsterte zur andern: »Sebastian, der mit Pfennigbruchteilen rechnet. Und plötzlich – dieses Vermögen, er kann vor Schreck den Tod haben.«
Sie sah nicht sehr besorgt dabei aus.
»Immerhin ein schöner Tod«, antwortete ihr Gatte.
»Und kein gewöhnlicher«, fügte ihr Schwager hinzu. –
»Wenigstens kann ich mich unter meinen Bekannten keines ähnlichen Falls erinnern.«
Sebastian starb nicht und nahm keinerlei Schaden an seiner Gesundheit.
Eine Sehnsucht, die man stets mit sich führt, mit der man sich die Zähne putzt und die Nägel schneidet, wirft nicht so leicht zu Boden, wenn sie sich erfüllt, wie vielleicht die Verwirklichung eines Traumes, dem man bei Tage nicht in die Augen zu sehen wagt.
Auch war Sebastian geübt in zäher Willenskraft. Sie brauchte er allerdings, um sich an das Neue zu gewöhnen. Das war nicht so leicht, wie die vielen denken mögen, die ihre freien Stunden dazu benutzten, von Millionen und ihrer angenehmen Verwendung zu träumen.
Zuerst hatte Sebastian weit mehr das Empfinden, daß ihm etwas abhanden gekommen sei. Wenn er auf dem Weg zu den langen Besprechungen mit dem Notar die Uhr hervorzog und lächelnd feststellte, daß es Zeit genug sei, um zu Fuß zu gehen und damit zehn Pfennig zu sparen, erinnerte er sich enttäuscht, daß dies nicht mehr dringend nötig sei. So ging es ihm häufig im Laufe des Tages.
Langsam lernte er die Freude am Ärger.
Es begann beim Notar, dem ersten Menschen, mit dem er stets in heftigen Wortwechsel geriet. Mit seinen Verwandten war er sanft und allmählich auseinander gekommen. Seinen Zimmerwirtinnen war er der friedlichste Mieter. Er hatte sich immer gesagt: Bescheidenheit verbilligt. Mit seinen Kollegen wechselte er nur wenige höfliche Worte.
Aber dieser Notar! Sebastian war noch nicht zehn Minuten mit ihm zusammen, so stieg ihm der Zorn blutrot zu Kopf. Und doch war noch niemand so untertänig, hochachtungsvoll Sebastian Wenzel begegnet wie dieser Mann. Aber gerade das machte Sebastian mißtrauisch. In der Wenzelschen Familie galt von jeher der Spruch: Große Liebenswürdigkeit will etwas. Und man selbst hatte sich bescheiden vor jedem Überfluß dieser Eigenschaft gehütet.
Der Hauptgrund des Zwistes war, daß Sebastian das Geld der Tante als preußische Staatsanleihe anlegen wollte, dem einzigen Papier, zu dem er Zutrauen hatte.
Der Rechtsvertreter rang die Hände.
»Aber verehrter Herr, Sie bringen sich um dreißigtausend Mark im Jahr. Das ist eine Verschwendung, die man nicht mit ansehen kann!« schrie er. »Sie sind ein heilloser Verschwender.«
Sebastian Wenzel fuhr zusammen. Verschwender hatte ihn noch niemand gescholten. Er wurde unruhig. Und immer wieder verließ er grübelnd das Zimmer, ohne zu einem Schluß gekommen zu sein. Dabei war er sich klar, daß ihm jeder Besuch teuer berechnet wurde.
Zum erstenmal bedauerte Sebastian, niemand zu haben, mit dem er sich aussprechen konnte. Er überlegte. Im Büro war ein Kollege, dem wohl zu trauen gewesen wäre. Er hatte viele Kinder und Sorgen und kannte das Leben. Nach reiflichem Bedenken wartete Sebastian Wenzel eines Abends auf diesen Mann vor dem Tor, durch das er selbst Jahre hindurch ein- und ausgeschritten war.
Müde kam der Erwartete die ausgetretenen Stufen herunter. Auf seinem schlaffen Gesicht, das ein grauschwarzer Bart bewucherte, zuckte das trostlose Hinundherrechnen des bedrängten Familienvaters.
Sebastian Wenzel sprang auf ihn zu und bat ihn um einige Augenblicke Gehör. Der andere folgte ihm in der stillen Freundlichkeit des Übermüdeten. Es war ihm zu viel Anstrengung, diese Bitte abzuschlagen.
Sie gingen in Sebastian Wenzels enges Mansardenzimmer, dessen verschlissene Vorhänge zu beben begannen, als die Männer sich über die Papiere beugten und fünf- und sechsstellige Zahlen durch den Raum flogen. Der müde Familienvater rechnete. Er kam zu dem gleichen Schluß wie der Rechtsanwalt.
»Sie haben allerdings bedeutend weniger, sind aber dafür sicher wie der liebe Gott«, sagte er. »Denn ich glaube, eher fällt der Himmel ein als der preußische Staat.«
Das war als treuer Beamter zu einem treuen Beamten gesprochen. Und wirkte. Sebastian Wenzel wurde es klar, daß er fest bei seinem Willen beharren mußte.
Er stand auf und sagte: »Ich danke Ihnen.« Der andere blieb sitzen, obwohl er unruhig zu sein schien.
Dann sagte er leise:
»Werter Kollege, wenn Sie – mir hundert Mark leihen könnten!«
Auch das war Sebastian Wenzel noch nicht geschehen. Wer ihn kannte, wußte, daß ihm schon der Pfennig heilig war. Aber die Hunderttausende lagen noch in der Luft.
Sebastian sah in die matten, unruhigen Augen des Wartenden, und ohne daß es ihm bewußt geworden war, hatte er dem andern einen blauen Schein gegeben ...
Sein ganzes Leben lang wunderte er sich darüber. Am stärksten am folgenden Morgen. Er fühlte sich beunruhigt. War mit dem Geld auch schon der Leichtsinn der Reichen über ihn gekommen?
Er legte den langen Weg zum Notar wieder zu Fuß zurück. Sein Gefühl sagte ihm, daß er etwas einzusparen habe.
Aber bei dem Notar blieb er standhaft bei seinem Willen.
»Sie sind der größte Verschwender, der mir je begegnet ist«, sagte dieser zum Abschied.
»Niemand kann aus seiner Haut«, erwiderte Sebastian kühl.
4
Eines Tages fühlte Sebastian Wenzel wirklich den Schlüssel zum eigenen Heim in der Tasche.
Es lag in keiner der Straßen, durch die nur Gummiräder rollen, auch nicht in einem jener Häuser, wo hinter den vornehm verhängten Fenstern niemand zu ahnen schien, daß man Brot auch ohne Butter essen kann.
Um diese Gegenden war die Sehnsucht Sebastians nie gestrichen.
Er erinnerte sich noch zu deutlich der Sonntagsspaziergänge seiner Kindheit. Wenn sie in den ungewohnten Feiertagskleidern, die immer irgendwo drückten oder preßten, durch diese ruhigen, baumbeschatteten Straßen gingen, sagte die Mutter: Hier wohnt das Geld. Aber auch das Laster und die Sünde. –
Sebastian hatten von frühauf die kurzen, belebten Straßen gefallen, wo ein kleiner Laden mit unterhaltenden Auslagen neben dem andern lag. Wo man Menschen hinter den Fenstern sah, wo sich jeder zu kennen schien.
Eine jener Straßen, die eine Kleinstadt für sich im Getriebe der Großstadt ist.
Hier hatte Sebastians Traum die behaglichsten Parterrewohnungen mit den von Pelargonien rot umsäumten Balkonen umschwebt. Er kannte nur die Fenster der Hinterhäuser, wo man Schornsteine zählen konnte von früh bis spät, ohne fertig zu werden. Welch ein Vergnügen müßte es sein, aus niederem Fenster das Leben der Straße beobachten zu können:
Da saß er nun wirklich.
Er begann, sein neues, geregeltes Leben zu führen. Langsam durchdrang ihn die Würde des Besitzenden. Seine Person wurde eine Wichtigkeit. Nicht für die Welt, die ihn übrigens nichts anging, aber für die Welt, die die seine war. Für diese kleine, tätige, lebhafte Straße. Hier war er nicht ein reicher Herr, sondern der reiche Herr. Jeder kannte ihn. Man wußte genau, um welche Zeit der reiche Herr an seinem Platz am Fenster oder auf dem Balkon saß oder nicht saß.
Der Bäckerjunge versuchte einen leutseligen Gruß zu erwischen, der Milchmann mit den klappernden Blechkannen schob an seiner Mütze, wenn er vor dem Hause hielt. Der Schutzmann, der auf der andern Seite der Straße von einem Bein auf das andere trat, wußte, wenn der reiche Herr spazierenging, wurde er bald abgelöst. Wenn Herr Sebastian Wenzel in Gummischuhen ausging, sagte man: Es wird heute regnen.
Kurzum, was dem Südländer die Sonne, dem Fischer der Polarstern, dem Wetterpropheten der Frosch, das war Sebastian Wenzel für seine kleine Straße.
Man sah zu ihm auf und richtete sich nach ihm. Er ahnte dies, und es tat ihm wohl.
Mit dem liebenswürdigsten Lächeln, das je eines Wenzels Lippen umspielt hatte, schritt er durch seine Straße und ließ jedem Ladeninhaber Zeit zu einem ehrerbietigen Gruß.
Täglich wuchs er mehr hinein in seinen neuen Beruf. Sein Gaumen wurde immer geübter und verwöhnter. Als er das erstemal den gediegenen Zobelpelz trug, fühlte er sich selbst als der reiche Herr. Einen Pelz zu besitzen war ihm schon zu der Zeit, in der er als Schulkind an grauen Wintermorgen fröstelnd zur Schule eilte, als etwas Ungeheuerliches erschienen.
Aber das wußte er jetzt nicht mehr. Ebensowenig wie vieles andere, von dem er nicht mehr zu sagen vermochte, ob er es erlebt oder vor vielen Jahren einmal in der Zeitung gelesen hatte.
5
Man kann trotz redlichen Bemühens nicht immer folgerecht im Leben handeln. Das mußte auch Sebastian Wenzel erfahren. Trotz seines tiefen Hasses gegen das andere Geschlecht wurde sein erster Gast eine Frau. Seine Nachbarin, die auf dem gleichen Flur die andere Wohnung und den von Blumentöpfen umrahmten Balkon innehatte.
Sie hieß Amalie Zwink und war ganz das Gegenteil des langen, hagern Herrn Wenzel. Auf einem kurzen, prallen, runden Körper saß ein wohlfrisierter, rotwangiger Apfel, aus dem zwei blanke Kanarienvogelaugen neugierig und freundlich blinzelten. Daß dieses runde Apfelhaupt und das übrige Rund durch einen Hals verbunden war, verrieten ein weißer Kragen und eine goldene Brosche, die sonst wohl nicht dagewesen wären. Zu sehen war er nicht.
Freundschaft ist ein Geschenk des Himmels. Ohne jedes Zutun war Sebastian Wenzel zu dieser Freundin gekommen.
Eines Tages klingelte sie bei Herrn Sebastian Wenzel und war da. Sie sagte, daß sie noch aus der guten, alten Zeit stamme, wo Nachbar und Nachbar sich besuchten, setzte sich ihm gegenüber und erzählte ihm nach wenigen einleitenden Worten ihre Lebensgeschichte.
Sie war immer ein anständiges Fräulein gewesen und jeder Mann hatte sich ihr gegenüber auch anständig benommen. Der Liebenswürdigste von allen hatte ihr ein Schnittwarengeschäft eingerichtet, das sie nun verkauft habe. Jetzt war sie Privatiere und nichts weiter. Sie wollte Ruhe haben. Ihr ganzes Leben hatte sie sich dieses Heim gewünscht, wo niemand außer ihr zu mucksen habe.
Hier nickte Sebastian Wenzel langsam. Er verstand dieses Fräulein.
Aber noch in einem wichtigeren Punkt stimmten beide Nachbarn überraschend überein. Amalie Zwink beseelte eine ebenso große und starke Abneigung gegen das weibliche Geschlecht wie Herrn Wenzel. Sie verabscheute es.
»Ich kenne die Weiber«, sagte sie. »Herr Gott, was haben sie mir zugesetzt im Leben. Dieses Geklatsch, dieses Spionieren, dieses neidische Getue. Noch heute, wo ich doch sozusagen über die Grenze bin und mich um niemand mehr zu kümmern habe, sind mir diese Teufel im Unterrock ein Greuel. Dagegen die Männer. Welch ein vornehmes Geschlecht. Wieviel Liebenswürdigkeit, Nächstenliebe und Offenherzigkeit begegnet man, wenn man nur halbwegs seine Auswahl zu treffen weiß.«
Fräulein Zwink schloß ihre Rede mit der Versicherung, daß sie das stets vollkommen anerkannt habe. Sie habe Gutes mit Gutem vergolten. –
Amalie Zwink sprach immer. Zu Haus, wo niemand außer ihr zu mucksen hatte, mit ihrem Papagei. Der widersprach nicht, sondern krähte zu allem: Recht so, mein Pappelpäppchen. Genau wie es einst sein Herr getan, dem das Fräulein diese lebende Gabe verdankte. Das war ein Kapitän gewesen, der, als er alt und müde und dick geworden war, seine Tage bei Amalie Zwink vergähnt hatte. Tief aus dem Lehnstuhl heraus hatte er auf alle Fragen der lebhaften Ladendame: Recht so, mein Pappelpäppchen, geantwortet. Als ein guter Mann mit einem Gemüt wie ein Kind war er seiner Freundin im Gedächtnis geblieben ...
Wenn Fräulein Amalie dem Papagei nichts mehr zu sagen hatte, kam sie, wie sie sich ausdrückte: auf einen Sprung zu Herrn Wenzel hinüber. Mit diesem Sprung schlug sie den Weltrekord aller Sprünge, denn er währte mindestens eine Stunde. Sie erzählte und erzählte, und es war beinahe, als ob sie zu Haus wäre. Sebastian Wenzel rührte sich nicht. Und so wie der Papagei stets liebenswürdig: Recht so, mein Pappelpäppchen lobte, sagte Sebastian Wenzel in kurzen Abständen: Wie Sie das Leben kennen, mein Fräulein.
Und diese Worte schürten aufs neue die Flamme der Beredsamkeit.
Herr Sebastian Wenzel hatte sich schon an die Eigentümlichkeiten seiner beredten Nachbarin gewöhnt. Von ihrer langjährigen Wirksamkeit hinter dem Ladentisch hatte die Dame eine eigentümliche Angewohnheit zurückbehalten. Ihr war noch immer der Meter das Maß aller Dinge. In der Eile ihrer Rede sagte sie:
»Nein, wenn ich denke; was jetzt der Meter Milch kostet. Und erst der Meter Butter.« Oder sie fragte heftig:
»Was zahlen Sie für den Meter Kaffee, werter Freund?«
Manchmal ertappte sie sich bei ihrem Irrtum und sagte lachend:
»Ja, mir steckt der Meter nun einmal im Leibe.«
An den langen Winterabenden wurde es Sitte, daß Herr Sebastian Wenzel eine Tasse Tee bei Fräulein Zwink trank. Da saßen sie sich in der wunschlosen Schläfrigkeit alternder Leute gegenüber. Neben ihnen schlief der Papagei auf seiner Stange, den Kopf unter den Flügeln. Nur wenn Amalie Zwink sich bei dem lebhaften Erzählen ihrer vielen, reichen Erinnerungen zu einem lauteren Wort hinreißen ließ, steckte er den Schnabel hervor und stotterte: Recht so, mein Pappelpäppchen. Dies weckte für gewöhnlich auch Herrn Wenzel aus seinem leichten Dusel, und er murmelte: Wie Sie das Leben kennen, mein Fräulein.
Diese Abende mußten beide gemütlich finden. Herr Wenzel war beinahe ärgerlich, als sich ein Dritter dazugesellte, trotzdem es sich um ein männliches Wesen handelte.
Es war ein alter General außer Diensten, der – nach Amalie Zwinks Aussagen – eine kleine Wohnung im Hinterhaus und das Podagra im großen Zeh hatte. Fräulein Zwink wußte dies durch den Portier. In einem ihrer nicht seltnen Augenblicke unbezwinglicher Neugier hatte sie sich auch seine Bekanntschaft erzwungen, als sie eines Tages gleichzeitig das Haus betraten.
Und auch er wurde schwach gegen sie.
Wenn auch aus ganz anderer Ursache als Herr Sebastian, den der Haß zum Weibe mit ihr verband. Er im Gegenteil konnte keinem weiblichen Wesen etwas abschlagen. Als Amalie Zwink mit dem ganzen Geschütz ihrer galanten Jugenderinnerungen anrückte, schloß er die Augen und begann sie sich jung und schlank und schön vorzustellen. Denn er träumte immer noch von den Reizen junger Frauen. Er sagte: Das Weib ist das Kleinod der Welt.
Aus diesem Grunde mußte er Herrn Sebastian Wenzel unausstehlich sein. Es war schade um den Mann, dessen ganzes Wesen sonst vornehm und einwandfrei war. Auch war Herr Wenzel nicht ganz unempfindlich gegen das Wort Exzellenz. Es war immer wieder angenehm zu hören, wenn die Haushälterin anmeldete:
»Seine Exzellenz ist da, Herr Wenzel.«
Außerdem wußte der feine alte Herr einige ganz auserlesene Gerichte. Zum Beispiel eine Pastete mit Krebsschwänzen. Noch ganz spät am Abend war er mit dem Rezept dazu angehumpelt gekommen, das er lange unter seinen Papieren gesucht hatte. Trotzdem er sich selbst alle diese guten Dinge versagen mußte.
»Das Podagra, mein Lieber, die vielen allzu guten Stunden ...« erklärte er.
Ein Lächeln lag um die welken Lippen. Die spitzfingrigen, wohlgepflegten Hände hielten ein feines weißes Tuch, dem ein zarter Blumenduft entstieg. Man sah ihm an, daß er sich um viele Jahre zurückträumte. Dann erlosch sofort alle Herzlichkeit für ihn bei Sebastian, und er fand ihn unausstehlich.