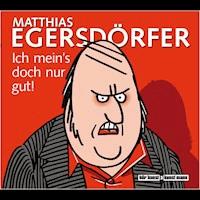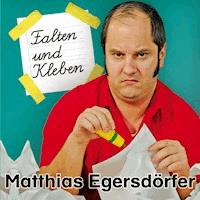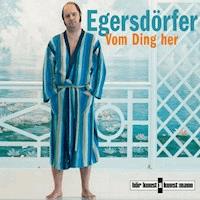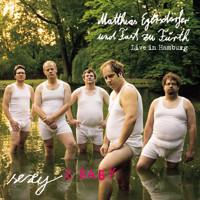9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Die Franken, die »Freien« und »Kühnen«, einst die Gründer des Heiligen Römischen Reiches und Frankreichs. Und heute? Roth und Egersdörfer reisen kreuz und quer durch dieses Land, zu dem sie seit ihrer Geburt eine starke, von wechselnden Gefühlen begleitete Bindung haben. Mit genauem, liebevoll zynischem Blick suchen und besuchen sie Denkmäler und Bausünden, Wirtshäuser und Metzgereien, Waldschwimmbäder und andere verschwindende Orte der Kindheit. Zwischen Aschaffenburg und Hof, Coburg und Gunzenhausen entdecken sie Geschichte und Geschichten, Dialekte und Charaktere. Sie ergründen das Verhältnis der Franken zum Fußball, zu Oberbayern und Oberpfälzern. Und huldigen – jenseits von Bratwürsten und Lebkuchen – regionalen Spezialitäten wie Krautwickerla und Fleischküchla.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Dank an Katharina Rehse und alle, die wir besuchen durften und die uns bewirtet, die uns Logis gewährt und die mit uns gesprochen haben.
ISBN 978-3-492-96610-8
Januar 2016
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2014
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Covermotiv: Clemens Zahn / laif (Titelphoto: Fränkische Schweiz)
Karte: Angelika Solibieda, Karlsruhe
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Odi et amo. Quare id faciam fortasse requiris.Nescio. Sed fieri sentio et excrucior.
(Ich hasse, und ich liebe – warum, fragst du vielleicht.Ich weiß es nicht. Ich fühl’s – es kreuzigt mich.)
Catull: carmen 85
Auch mische man sich, wenn es uns ein Ernst ist, unsre Menschen- und Länderkenntnis zu erweitern, unter Personen von allerlei Ständen. […] Das eigentliche Volk – oder noch mehr der Mittelstand – trägt das Gepräge der Sitten des Landes. Nach ihnen muß man den Grad der Kultur und Aufklärung beurteilen. […] Zum Reisen gehören Geduld, Mut, guter Humor, Vergessenheit aller häuslichen Sorgen und daß man sich durch kleine widrige Zufälle, Schwierigkeiten, böses Wetter, schlechte Kost und dergleichen nicht niederschlagen lasse. Dies ist doppelt zu empfehlen, wenn man einen Gesellschafter bei sich hat; denn nichts ist langweiliger und verdrießlicher, als mit einem Manne zu reisen und in einem Kasten eingesperrt zu sitzen, der stumm und mürrischer Laune ist, bei der geringsten unangenehmen Begebenheit aus der Haut fahren will, über Dinge jammert, die nicht zu ändern sind, und in jedem kleinen Wirtshause so viel Gemächlichkeit, Wohlleben und Ruhe fordert, als er zu Hause hat.
Adolph Freiherr Knigge: Über den Umgang mit Menschen
Frühe Klage
Fürth, den 18. 6.
Sehr geehrter Herr Dr. Roth,
wie Sie sich hoffentlich entsinnen wollen, beabsichtigen wir, ein Buch über Franken zu schreiben. Fernmündlich haben wir deshalb vereinbart, diesen Landstrich, in dem die ostfränkische Dialektgruppe beheimatet ist, gemeinsam zu bereisen, um im Nachgang aus dem Gehörten und Gesehenen, aber auch aus den Archiven des Erinnerten – nicht zu vergessen sind freilich auch das Geschmeckte und Gerochene –, kurz gesagt: aus den umfassenden Erlebnissen dieser Reise einen schäumenden Sud zu brauen, aus welchem ein Destillat aus Buchstaben gewonnen und sodann ein Buch verfertigt werden soll.
In meinem Kalender zieht sich ein langer Strich über viele Tage und Wochen. Mit Wonne habe ich diesen Strich gezogen. Dieser Strich kennt keinen Unterschied zwischen Wochentagen, Wochenenden und Feiertagen. Dieser Strich negiert die Überstunden, nimmt etwaige Entbehrungen wacker in Kauf und ignoriert sämtlichen Kummer. Neben dem Strich steht in strammen Versalien: »MIT JÜRGEN ROTH DURCH FRANKEN«.
Als ich das schrieb, habe ich den Satz gesungen beinahe wie der Tannhäuser beim Sängerwettstreit auf der Wartburg. Mein Weib hat gejammert und schlimm geklagt. Allein, es war nicht zu hören in meinem donnernden Kehlbrausen. Jetzt verhält es sich so, daß dieser erwähnte blaue Tintenstrich genau am heutigen Tage seinen Anfang findet. Aber offensichtlich fängt hier nur eine dünne Linie an. Ohne Bedeutung und Zweck habe ich mein Jahrbuch verschmiert, denn ohne jeden Zweifel fehlt von meinem Kompagnon jede Spur. Hier und jetzt beginnt keine Reise, geschweige denn ein Abenteuer oder eine Expedition. Wie ein ausgelöffeltes Frühstücksei steh’ ich kopflos am Fenster und glotze in den Fürther Hinterhof.
Kein Vogel hatte heute morgen auch nur den Hauch einer Chance, mich wachzupfeifen. Ich persönlich weckte den Wecker. Meine Frau jammerte, als ich meine Sachen packte. Übermütig strömte das Blut durch meine Adern, als ich mein Bündel schnürte. Und alles, was ich brauchte, fand ich, und was ich nicht fand, brauchte ich nicht.
Dampfenden Kaffee goß ich mir in den aufgesperrten Rachen, biß in eine bernsteinfarbene Hirnwurst aus Göring und riß mir einen Fetzen aus einem Brotlaib von der herzensguten Bäckerei Fehr. Ich war gerüstet und voller Kraft, und jetzt hätte es losgehen können.
11 Uhr hatten wir als Zeitpunkt vereinbart. Dann wurde es 11 Uhr, und ich wartete. Ich wartete immer mehr, immer mehr Zeit verstrich. Kein Klingeln erlöste mich. Roth klingelte nicht. Kein Roth weit und breit. Das können Sie nicht bestreiten, Herr Doktor Roth! Sie haben auch um 12 Uhr nicht geklingelt!
Ich konnte noch so schnell und kraftvoll warten, es änderte sich nichts. Die Warterei wurde zum Gift und zermarterte mich. Jetzt wurde es immer offensichtlicher: Der einzige, der wartete, war ich. Der einzige, der etwas erwartete, war auch ich.
Ich schreibe jetzt diesen Brief an Sie und frage ohne weitere Umschweife: Wollen Sie Franken nicht mehr bereisen? Ist Ihnen zwischenzeitlich klargeworden, daß Sie mit einer derart einfältigen Person wie mir nirgendwohin fahren möchten? Ist Ihnen etwas passiert? Sind Sie im Keller gestürzt oder von einem hessischen Hund gebissen worden?
Das Warten fühlt sich, wenn ich ehrlich bin, so an, als hätten Sie gänzlich die Lust verloren. Sagen Sie es kalt und streng, wenn es sein muß, gerade so, wie man ein Pflaster von der Haut reißt: schnell und kraftvoll. An Franken liegt Ihnen nichts mehr. Sie haben nunmehr anderweitige, dringendere Verpflichtungen. Eine SMS mit dem Text »Sic!« genügt.
Immer noch hochachtungsvoll:
M. Egersdörfer
Verspäteter Beginn
Frankfurt am Main, den 22. 6.
Sehr geehrter Herr Egersdörfer,
vorab möchte ich nicht verhehlen: Es fällt mir nicht leicht, die Contenance zu wahren und diese manierliche Anrede zu wählen. Zunächst kamen mir da ganz andere Worte in den Sinn. Ich verschweige sie, der Schicklichkeit halber. Auch will ich, so schwer es mir augenblicklich dünkt, unsere gemeinsame Unternehmung nicht gefährden, hat sie doch so vielversprechend und ergiebig begonnen.
Dreieinhalb Tage waren wir, wie verabredet, unterwegs, es war unsere erste Etappe durch das Frankenland. »Diese Provintz Francken«, schreibt der Pegnitz-Schäfer Sigmund von Birken im 17. Jahrhundert, »zu Latein Franconia genannt / welche den Sechsten Reichs-Kreiß machet / wird zwar von der Donau nicht berühret / ist aber derselben allernächst benachbart. Es ist der Mayn dieses Lands Hauptfluß / welcher die zween andere / als die Rednitz und Tauber in sich trincket. Es hat drey Bisthümer / Bamberg / Würtzburg und Aichstett / und zu Reichsfürsten / die Herren Marggrafen zu Brandenburg / als Burggrafen zu Nürnberg: derer einer / neben dem Hrn. Bischoff zu Bamberg / dieses Kreisses ausschreibender Fürst / gleichwie Nürnberg unter den 5. Reichsstädten (die andre heissen / Rotenburg / Winsheim / Schweinfurt / Weissenburg /) die ausschreibende Stadt ist.«
Diesen kunterbunten, in sich heterogenen Kreis haben wir zu durchschreiten beziehungsweise zu durchkreuzen begonnen. Wir haben die ersten Gespräche mit Franken unterschiedlichster Herkunft und Prägung geführt, wir haben in die Gegend geguckt, gegessen und getrunken. Daß uns der Wille eint, diese merkwürdigen Landstriche auf den Begriff zu bringen und notfalls zu zwingen, wollen Sie, Herr Egersdörfer, hoffentlich nicht bezweifeln. Andernfalls müßten wir jetzt sofort in den Sack hauen.
Und nun, nach meiner Rückkehr von unserer ersten Exkursion, finde ich diese Ihre Epistel im Briefkasten vor, die Sie offenbar vor vier Tagen zwischen 14 und 14.15 Uhr und zwischen Tür und Angel zusammengepatzt und sogleich auf der Post aufgegeben haben – bevor meine Wenigkeit überhaupt erst mal in der Wissenschaftsstadt Fürth ankommen konnte! Seit wann verhält sich denn ein Franke so? Werden die Franken nicht außerhalb der Grenzen ihres Reiches, gemessen am Tempo, in dem sie zu sprechen belieben, für die langsamsten Denker Deutschlands, ja für die behäbigsten Geschöpfe Gottes gehalten – oder wenigstens für die größten Stoiker der nördlichen Hemisphäre, sofern man ihre Lebensmottos »Es hilft ja nix« und »’s werd scho’ widder« ernst nimmt?
Woher rührt Ihre, Herr Egersdörfer, eines Franken ganz und gar unwürdige Hast, ja Nervosität? Ist Ihr Zagen, ist Ihr Klagen eines Franken, eines Mannes vom Stamme der »Freien« und »Kühnen«, würdig? Oder verhält es sich so, daß die heutigen Franken überhaupt nicht wissen, daß sie die kraftstrotzenden, ruppigen Gründer des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und Frankreichs waren?
Nein, sie wissen es nicht, und kühn und frei sind die Beutebayern ohnehin seit langem nicht mehr. Es ist diese fränkische Weinerlichkeit – die dito aus Ihrem Schreiben spricht, Herr Egersdörfer –, die uns Auswärtige, uns in Hessen Wohnhafte bisweilen so unwillig in die scheele Himmelsrichtung, also Richtung Aschaffenburg und darüber hinaus blicken läßt. Es ist diese Schlaffheit, dieses Weicheigefasel, diese … Sind Sie, sehr verehrter Herr Egersdörfer, nicht mittlerweile Weißweintrinker? Als gebürtiger Nürnberger? Kommt als nächstes die Weißweinschorle?
Nun, Herr Egersdörfer – wegen ein paar läppischer Stunden Verspätung also Ihre Jeremiade, Ihr Jammerlappenlied. Haben Sie nicht auch schon mal am Vorabend fünf, sechs Becher über den Durst geleert? Und sich unter dieser Voraussetzung am nächsten Tag über die A 3 quälen müssen, die ab der hessisch-fränkischen Grenze bis nach Nürnberg ein einziger automobiler, geradezu prototypisch fränkischer Gemächlichkeits- und Trägheitsmoloch ist? Und sind Sie dann, weil die Polizeipräsenz in Franken die größte ist, zudem noch in eine Schleierfahndung geraten? Schleierfahndung – eine bayerische Spezialität – kennen Sie nicht? Weil Sie, Inhaber einer BahnCard 100, mit dem Zug von Veranstaltungs- zu Veranstaltungsort zu gondeln pflegen?
Insbesondere auf fränkischen Autobahnen patrouillieren tagaus, tagein Streifenwagen. Deren Insassen picken wahl- und grundlos arglose Verkehrsteilnehmer (wie mich) heraus, fordern sie auf, den nächsten Parkplatz anzusteuern, und nehmen anschließend in einer kaugummizähen Prozedur den Wagen des Verdächtigen auseinander, den sie nebenbei geheuchelt freundlich über etwaige Drogenbesitztümer befragen und dem sie zu guter Letzt sichtlich enttäuscht und verärgert 0,15 Promille nachweisen. Zeitverlust: eine Dreiviertelstunde. Frankenbedingter Verdruß: können Sie sich ausmalen.
Schön und gut, Herr Egersdörfer, solche Vorfälle mögen Ihnen wurscht sein, mögen bei Ihnen nicht verfangen. Doch in den Raum zu stellen, an Franken liege mir nichts mehr … Hören Sie mal, Sie Doldi! Seit fast zwanzig Jahren wohne ich in Frankfurt am Main – und zwar an der: Frankenallee! Ich bin nur durch ein Mißgeschick nicht in Franken geboren worden. Meine Eltern stammen aus Neuendettelsau im Herzen Mittelfrankens und leben ebenda. Viel, sehr viel Zeit habe ich in meiner Jugend dort verbracht, und ich fahre nach wie vor gerne und oft in die Gegend, durchaus ein nostalgisch-sentimentalisches Verhältnis zur Region zwischen Aschaffenburg und Hof, zwischen Coburg und Gunzenhausen unterhaltend, wenn auch nicht ungeteilt. Womöglich zieht mich zumal die Landschaft an, die mancherorts ungebrochen und mitunter von Jahr zu Jahr stärker jene Gefühle evoziert, die Floridan und Klajus in der Fortsetzung der Pegnitz-Schäferey ins Wort erlösten: »Es fünken / und flinken / und blinken / Buntblümichte Auen / Es schimmert / und wimmert / und glimmert Früh-perlenes Tauen. / Es zittern / und flittern / und splittern / Frischläubichte Aeste: / Es säuseln / und bräuseln / und kräuseln Windfriedige Bläste. / Es singen / und klingen / und ringen Feld-schlürfende Pfeiffen. / Den Mayen / am Reyen / Schalmeyen Der Hirten / verschweiffen. / Es bellen / und gellen / und schellen Die Rüden und Heerden. / Es stralet und pralet / bemahlet / Das Stikkwerk der Erden.«
Ich schlage deshalb trotz aller durch eher unglückliche Umstände ausgelösten Irritationen vor: Wir setzen unsere mehr schlecht als recht geplante Reise in Bälde fort, und wir führen den von Ihnen initiierten Briefwechsel weiter. Während unserer nächsten Gespräche und Interviews, die wir kurzfristig anberaumen, könnten zwei unserer Leitfragen lauten: Was macht Franken aus? Wer oder was sind die Franken (an und für sich)?
In unseren Depeschen (die wir, nebenbei, von nun an ausschließlich auf elektronischem Wege zustellen sollten, so wie diese hier) legen wir uns Rechenschaft über das Erlebte ab; schildern wir Erkundungen, Eindrücke und Erfahrungen gerade so, wie uns zumute ist; nähren und mehren wir Idiosynkrasien und preisen wir Pretiosen. (Ich möchte das auch als Hinweis darauf verstanden wissen, daß Sie mir meinen womöglich hie und da etwas ruppigen Ton wenn nicht verzeihen können, so doch nicht allzusehr krummnehmen.)
Die nun einmal gefundene Form des Briefwechsels – dafür will ich Sie stark loben, Herr Egersdörfer, das geht auf Ihre Kappe! – erlaubt es uns, nach Gusto, Lust und Laune abzuschweifen und erzählerisch herumzustreunen. Sie erlaubt es uns, persönliche Erinnerungen, historische Exkurse, Dialoge, Geschichten, Anekdoten und andere narrative Sprengsel einzuweben und -zustreuen, ohne den roten Faden zu verlieren – den roten Faden einer getreulichen Chronik unserer Spuren- und Stimmensuche in dieser »närrischen Wechselwelt« (Jean Paul) namens Franken.
Wären Sie mit alledem einverstanden? Und wäre Ihnen danach, bei der Aufbereitung unserer ersten Etappe den Anfang zu übernehmen? Etwas über Lauf an der Pegnitz zu erzählen? Und über Luise Conrad, geboren in Nürnberg-Zerzabelshof, aufgewachsen in Alfeld in der Fränkischen Schweiz, Absolventin einer Zwergschule, dann einer Abendschule, ausgebildete MTA, eine quicklebendige, pragmatische Frau, die auf die Achtzig zugeht und sagt: »Der fränkische Humor? Den gibt’s. Der ist trocken.« Und die das fränkische Wesen als »a gewisse vorsichtige Zurückhaltung« charakterisiert – »daß man sich nicht gleich auf alles Neue stürzt. Die Franken wollen schon genau wissen, worauf sie sich einlassen.«
Könnten Sie sich das vorstellen?
Auf Ihr Ver- und Einverständnis hofft, gleichfalls hochachtungsvoll:
J. Roth
Don Quijote und Sancho Panza
Fürth, den 23. 6.
Sehr geehrter Herr Roth,
mit großer Freude habe ich gestern in meinem elektronischen Posteingang Ihr Schreiben vorgefunden. Eine wahre Pracht ist es, wie Sie an sich halten. Und fürwahr, Sie wohnen offensichtlich nicht grundlos in der Nähe der Frankenallee im Frankfurter Gallusviertel, und obendrein scheint mir, als würde es weit über den Zufall hinausgehen, daß sich Ihre kleine Trutzburg, die Sie bescheiden Ihr Zuhause nennen, in der Kriegkstraße Adresse und Motto gegeben hat.
Wohlige Schauer durchströmen mich, wenn ich Sie durch Ihren Brief so ansehe auf Ihrem wiehernden Schlachtroß mit den geweiteten, dampfenden Nüstern, weißer Schaum am Maul, nervös in alle Richtungen stampfend. Der geharnischte Doktor der Philosophie sitzt wacker obenauf und hält die Zügel stramm mit einer Hand, stahlgrau die Rüstung, annähernd stahlgrau das Haupthaar, von Wind und Wut zerzaust. Ihre rechte Hand hält fest den Knauf Ihres mächtigen Schwertes. Ihre Leidenschaft drängt Sie, mir, dem rundlichen Wicht mit seinem weibischen Greinen, sofort an Ort und Stelle den Kürbiskopf mit einem Schlag vom Leib zu trennen. Das wäre nicht der erste Schlag, mit dem Sie mattherzige Jämmerlichkeit bestraft und beendet hätten. Aber irgend etwas läßt Sie zögern. Im besten Fall mag es die Vernunft sein. Wahrscheinlicher aber ist, daß dem Ritter Roth seine Klinge zu schade ist, um mit ihr Gemüse zu schneiden.
An dieser Stelle fällt mir ein, sehr verehrter Reisefreund Roth: Wir müssen unbedingt die romantischen Burgen der Fränkischen Schweiz aufsuchen. Wir wandern von Pegnitz aus auf dem mit Rotkreuz markierten Pfad nach Pottenstein. Die Route führt uns durch ein dichtes Waldgebiet, »nur hin und wieder aufgelockert durch Wiesen und mit Sichtachsen auf anmutige Täler. Beiderseits des Weges wuchtige, moosbewachsene Felsbrocken« (Nürnberger Nachrichten). Wir werden die Ruine Hollenberg erklimmen. Sie können von dort aus, auf der 540 Meter hochgelegenen Plattform angekommen, nach Herzenslust Ihre Blumenvereinsgedichte und gern auch ein paar Reime vom guten Hans Sachs über die bewaldeten Hügelketten hinwegdeklamieren, während ich gleich daneben auf einem Bänkchen im Schatten eines Baumes verweile und ein Schinkenbrot verzehre und mir dazu ein Fläschchen Hebendanz Export – meiner Meinung nach das beste Bier der Welt – die Kehle hinunterrauschen lasse.
Sie merken schon, Ritter Roth, ich gerate ins Schwärmen, und es gibt, abschließend gesagt, für einen evangelischen Mittelfranken nichts Schöneres, als mit einem strengen Ehrenmann durch die Welt zu reisen, der ihn nur zu gern entleiben möchte, wenn man dessen stattliche Redlichkeit auch nur einen Hauch bezweifelt. Und das müssen Sie mir auch zugute halten: Ich habe Sie in Fürth offenen Herzens empfangen. Zerknirscht war ich nur in meinem Brief, und ich bereute bereits bei Ihrem Erscheinen die Versendung. Mit einer Tasse kräftigem Kaffee spülten Sie die Strapazen Ihres Höllenritts ein für allemal hinfort – so wie ich die Nebel des Zweifels. Wir telephonierten mit Frau Conrad, die meinem Elternhaus gegenüber in Lauf rechts der Pegnitz lebt, und sie stimmte einem Treffen ohne Umschweife zu.
Auch dies stimmt: Mit Ihnen beginnt das Reisen sofort, und so fuhren wir von dort, wo 1835 die erste deutsche Eisenbahn losfuhr, mit Furor los. 2010 wurde das Jubiläum ebendieser Fahrt des Adlers begangen, und man entblödete sich nicht, auf der Fürther Freiheit einen abgeschmackten Bahnhof aus lumpig bedruckten Gardinen zu errichten, und auf der Hundeschißwiese zwischen Königswarterstraße und Hornschuchpromenade lagen ein paar einfältig leuchtende Leisten, die den historischen Schienenstrang nachzeichneten. Das Geld für diesen Humbug wäre besser darauf verwendet gewesen, hätte man damit den Kötern, die den Wiesenstreifen ganzjährig in ein Kackminenfeld verwandeln, die Arschlöcher zugenäht.
Wir fuhren auf den Ring und in Erlenstegen unter der Bahn hindurch auf eine weitere Schicksalsstraße, die B 14. Diese Straße war Schauplatz unzähliger ungefilmter Roadmovies, die in Lauf in der Zeit ihren Anfang nahmen, als erster Flaum an meinem Kinn zu sprießen begann und meine Unruhe mich ins ferne Nürnberg zog. Es war die Zeit, als meine Freunde und ich begriffen, daß wir die Abenteuer nicht länger mehr oder weniger unbeteiligt an uns vorbeiflimmern lassen mochten, sondern selbst die Hauptdarsteller in spannenden Episoden sein wollten.
Mit meiner großen Schwester hatte ich Ende der siebziger Jahre meinen ersten Kinofilm im Admiral gesehen. Rot glühten damals meine Wangen und Ohren bei Robin Hood von Walt Disney. Vollständig gebannt staunte ich über den schlauen Fuchs, der mit seinen Kumpels die korrupte Staatsgewalt foppte und am Schluß noch das Herz einer adeligen Füchsin eroberte. Seither bin ich dem Kino verfallen. Erik Lauer war immer bestens darüber informiert, wann der neueste James Bond anlief. Entweder Frau Lauer oder meine Mutter kutschierte uns dann zum Filmstart in die Lichtspielhäuser der Großstadt.
Aber jetzt hatte Erik den Führerschein und diese silberglänzende Fregatte, und eines Abends fuhren wir los. Jörg Muskat, Philipp Moll, Jürgen Eichenmüller und ich setzten die Segel, lichteten den Anker und brausten in die Stadt unserer Träume. Die B 14 war das schäumende Meer, und Kapitän Lauer steuerte erbarmungslos aufs gelobte Land zu. Auf dem langen geraden Stück vor Erlenstegen dürften wir sogar über 120 Stundenkilometer gefahren sein, und wir fühlten uns ungefähr wie Kolumbus, kurz bevor er in Amerika ankam, obwohl der sich rein rechtlich bestimmt noch ein bißchen mehr gefreut hat. Schließlich hatte ihn ja seine Mutter nicht vorher schon mal dorthin gefahren.
Die Häuser waren hoch, die Straßen lang, der Himmel war weit, und wir waren stolz und frei. Wir hatten die Fenster heruntergedreht. Der Fahrtwind zerzauste unsere Frisuren, und die Mannschaft suchte einen Ankerplatz für ihr Piratenschiff. Alles war aufregend und neu. Wenn die Mütter gefahren waren, war es uns weitgehend egal gewesen, wo das Auto abgestellt worden war. Jetzt hielt die Mannschaft eifrig nach einer geeigneten Haltestelle Ausschau. Endlich hatten wir eine Mole gefunden, vertäuten das Schiff und sprangen an Land, nichts anderes im Sinn als Eroberung.
Nach einer Expedition durch die Innenstadt hatten wir den Hemdendienst entdeckt. Es war ein kleines Häuschen und lag zwischen der Landesgewerbeanstalt und dem heutigen Zwinger. Unser Schicksal verachtend, traten wir mutigen Schrittes ein und rutschten alsbald in eine wohlige Verwunderung hinein, aus der wir uns für einige Stunden nicht mehr befreien konnten. Wir setzten uns rund um ein Tischchen auf Stühle und Bänke, die so gar nichts mit den Möbeln zu tun hatten, die wir aus den bisherigen Besuchen in der ländlichen Gastronomie kannten. Lange versuchten wir uns das flüsternd zu erklären. Vielleicht hatte das Interieur noch annähernd etwas mit einer Teestube des CVJM gemeinsam. Aber hier lagen keine Gesangsbücher aus, kein Gruppenleiter brühte Tee oder sang zur Gitarre. Statt dessen schepperte eine Stereoanlage, und man konnte sogar die Kabel sehen.
In Lauf gab es auch eine Handvoll Kneipen, die es auf ein jugendliches Publikum abgesehen hatten: dunkle Kaschemmen, in denen auf groben Holztischen Weizenbiergläser standen. Der Wirt trug ein Oberlippenbärtchen und schenkte Bier aus dem Zapfhahn aus. Wenn man öfter kam, durfte man »Manne« zu ihm sagen. Zigarettenqualm vernebelte die Klänge von Pink Floyd. Manne war ein echter Wirt. Aber hier, im Hemdendienst, war niemand auszumachen, der auch nur annähernd so eine Qualifikation ausstrahlte.
Hinter einer provisorischen Bar stand eine wunderschöne Frau, und es dauerte einige Zeit, bis wir begriffen, daß wir bei ihr Getränke erhalten konnten. Es gab auch keine Weizengläser. Wir tranken aus der Flasche. Erik Lauer bestellte ein Käsebrot, und mit dieser Bestellung wußte die Engelsfrau wohl auf einen Schlag alles über uns. Sie brachte einen kleinen Teller mit einer Scheibe Brot, einem Messer und einem originalverpackten Bressot. Fassungslos starrten wir auf den Käse in der runden Verpackung mit dem Plastikdeckel. Genau so stand der Käse im Supermarkt im Kühlregal. Offensichtlich hatte diese Frau dort den Käse gekauft, ihn in den Hemdendienst geschafft, und sie servierte ihn, als sei nichts dabei, mit einer Scheibe Brot.
Die Möbel waren von der Entrümpelung. Die Frau hatte keinen Schnurrbart. Sie hatte einfach Lust darauf, eine Kneipe zu betreiben. Sie hatte ihre Stereoanlage hier aufgestellt und Getränke besorgt, und weil in der Kneipe vorher ein Hemdendienst gewesen war, hieß sie jetzt eben Hemdendienst. An diesem Abend hatte ich das in seiner ganzen Größe natürlich nicht im mindesten erfaßt. Aber nach und nach begann ich zu begreifen. Wenn dir danach ist, machst du einfach eine Kneipe auf. Es kann auch eine illegale Kneipe sein, im Keller eines Wohnhauses. Du kaufst ein paar Kästen Bier, stellst eine Stereoanlage auf und verteilst ein paar Zettelchen, auf denen Adresse und Uhrzeit stehen, und schon kann es losgehen. Man muß nicht singen können. Aber wenn man gerne singt, lädt man einen Kumpel ein, der ein bißchen Akkordeon spielt. Dann schreibt man ein Liedchen, und er spielt dazu. Dann kommt einer mit einer Gitarre und ein anderer mit einem Waschbrett und einer Maultrommel dazu, und schon hat man ein paar Lieder mehr, und wenn man ein paar Lieder beisammen hat, gibt man ein Konzert, und das findet dann zuerst in der Kellerkneipe statt, weil man da vorher niemanden zu fragen braucht, ob das erlaubt ist.
Insofern war der Hemdendienst mein Amerika, und der Audi vom Erik war die Santa Maria. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten nachträglich noch einmal herzlich bedanken. Und bedanken möchte ich mich bei Ihnen, Herr Roth, weil unsere Reise so trefflich begonnen hat und ich an Ihrer Seite als treuer Sancho Panza reiten darf.
Mit herzlichem Gruß:
M. Egersdörfer
Nürnbergs kleine Schwester
Frankfurt am Main, den 24. 6.
Mit Verlaub, verehrter Herr Egersdörfer,
aber Sie wollen doch nicht allen Ernstes aus diesem Reisebericht einen Fortsetzungsritteroman machen, ein Rührstück ohne Nutzanwendung, einen Reigen von Räuber- oder eben Ritterpistolen, »in denen immer phantastischere, unglaubwürdigere Abenteuer geschildert wurden« beziehungsweise werden, »die – nach Meinung der Gebildeten jener [und unserer] Zeit – die Gehirne der Leser vernebelten« (Wikipedia über Cervantes’ Machwerk) und fortgesetzt vernebeln!
Sie der pragmatische Bauerntrampel Sancho Panza, ich Don Quijote? Ein durch Schundlektüre irregeleiteter, komplett narrischer Landedelmann auf einem klapprigen Gaul und in ridiküler Montur? Der ständig satt und saftig auf die Zwölf kriegt?
Und wer gibt dann die Dulcinea? Immerhin, die gibt es tatsächlich, ich habe sie, anders als dieser Riesenrittertrottel, mit eigenen Augen gesehen, am 18. Juni, kurz nachdem wir losgefahren waren. In meinen Reiseaufzeichnungen steht: »Schönste Frau der Welt an der Stadtgrenze Fürth/Nürnberg gesehen.«
Wäre über »Nürnbergs kleine Schwester«, mithin Fürth, sonst noch etwas Gutes, etwas Schmeichelndes zu sagen? O ja! Sie gestatten mir gnädig, aus einem kleinen Besinnungsaufsatz von mir zu zitieren, der in der von Rayk Wieland und mir 1999 herausgegebenen Anthologie Öde Orte 2 erschienen ist:
»Fürth hängt am Zusammenfluß von Pegnitz und Rednitz herum. Seinen Königshof schenkte Heinrich II. im Jahre 1007 der Stadt Bamberg. Die Fürther Kartoffelköpfe indes beharrten auf Autonomie und erhielten nach ausdauerndem Quengeln 1808/18 die Stadtrechte. Es ›tat nichts‹ (Alfred Schmidt). Ein Leben zu Fürth ist beim besten Willen nicht möglich. Fast hunderttausend Menschen weigern sich noch heute, diese einfache Tatsache zu akzeptieren. Am Bahnhof, der verludertsten Bierschwemme nördlich der Alpen, stopfen sie ihre Köpfe mit Schnaps aus. Die reine und zumal ausweglose Verrohung.
Rund um ein bedeutungsloses klassizistisches Rathaus und das verachtungswürdige neobarocke Stadttheater nistet und nestelt eine augenscheinlich unbezähmbare, fiebrige Bereitschaft zum Bauen und Herumsauen. Ins urbane Zentrum stopfte man 1985 das City-Center, Schandtat höheren Grades und Zeugnis der Hirnerweichung und weiter fortschreitenden Kopfzersetzung. Als da Bauernsonntage und Schunkelabende exekutiert werden. Während der Meisterbetrieb Kracker Hörgeräte nebenan sein Ding verrichtet und das Autohaus Graf die Fluchtschneise Schwabacher Straße belagert, werbend ›Für Audi, / Für Fürth, / Für Sie!‹ O eigentümlich entschlossene Stadtverwesung.«
Und des weiteren heißt es: »Zäglich schlummert Kiefernwald am Rande Fürths. Die Auen der Pegnitz winden sich schamvoll. Vach, Stadtteil im Norden, grüßt. […] Kind mit Kettcar rollt die Hofeinfahrt hinab. Häuser aus bröckelndem Sandstein auf gegenüberliegender Straßenseite. Ein Pappschild kündigt ›Schnaps vom eigenen Obst‹ an. Der Nachbar ernennt seinen Garagenvorplatz zur ›Prosl-Gasse‹. […] Gehsteigbepflasterung unbekannt. Jeder Siedlungscharakter ist gründlich verfehlt.«
Können Sie, verehrter Reisekumpan, angesichts dieser bestechend glaubwürdigen und empiriegesättigten Zeilen nachvollziehen, warum sich mein Vater von einem seiner Wanderkollegen, der die Nürnberger Abendzeitung vom 20. Mai 1999 in Händen hielt, am Nürnberger Hauptbahnhof fragen lassen mußte: »Is’ des dei’ Bub?« Weil das Blatt an diesem Tag mit der Schlagzeile aufgemacht hatte: »›Dreckloch‹ – Buchautor beleidigt Stadt Fürth«?
»Erst mußten sich die Nürnberger als dumpfe Bierdimpfl-Provinzler beschimpfen lassen, die beim verheerenden Kriegsbombardement im Januar 1945 am besten alle umgekommen wären. Jetzt haben die gesammelten Stadt- und Landschaftsbeleidigungen […] die Nachbarn Fürth erreicht. Die beschauliche kleine Großstadt ist für Reclam-Autor und Lästerer Jürgen Roth (30) ein ›Dreckloch‹«, ächzte es auf Seite eins, und im Innenteil ging’s weiter: »Ohne eigenes Zutun [sic!] und völlig unverdient hat die Kleeblatt-Stadt den kaum imagefördernden Aufstieg in die Liga ›Öde Orte‹ geschafft.«
Wäre damit, sehr verehrter Herr Egersdörfer, die »Stadt des Rußes, der tausend Schlote, des Maschinen- und Hammergestampfs, der Bierwirtschaften, der verbissenen Betriebs- und Erwerbsgier« (Jakob Wassermann): abgehakt? Auch wenn in einem der zahllosen, x-beliebigen Reiseführer über Franken, in Ralf Nestmeyers Buch Franken (5. Aufl., Erlangen 2010), behauptet wird: »Fürth ist offen und ehrlich, hier wird nichts kaschiert, nichts beschönigt oder gestylt. […] Die Hornschuchpromenade und die parallel verlaufende Königswarterstraße sind nicht nur die schönsten Straßenzüge Fürths, sie brauchen auch den Vergleich mit anderen deutschen Städten nicht zu scheuen. […] Zeitgenossen rühmten den ›Fürther Boulevard‹ und verglichen ihn mit den Pariser Prachtstraßen.«
Nun, lassen wir dieses unappetitliche Kapitel vielleicht zumindest hier vorerst hinter uns und fahren endlich zu Frau Conrad nach Lauf. Halt, stopp! Auf dem Weg haben Sie ja Nürnberg – neben Frankfurt am Main (Kaiserwahl) und Aachen (Krönung) die ehedem bedeutendste Reichsstadt (Goldene Bulle) – gestreift, zunächst den Stadtteil Erlenstegen. Der ist auch mir wohlbekannt, allerlei erotische Verwicklungen hatten da statt. Die vergessen wir jetzt mal. Vergessen zu erwähnen haben indes Sie, daß in Erlenstegen der Nürnberger Geldsackadel residiert, zum Beispiel die Familie Wöhrl. Die grandiose Schriftstellerin Gisela Elsner wuchs in diesem Milieu auf und haßte es nach Kräften. In ihrem Romandebüt Die Riesenzwerge (Reinbek 1964) zerlegt sie das bürgerliche Personal regelrecht – und zwar bereits auf der ersten Seite, wenn sie eine recht fränkisch anmutende Mahlzeit beschreibt:
»Mein Vater ist ein guter Esser. Er läßt sich nicht nötigen. Er setzt sich an den Tisch. Er zwängt sich den Serviettenzipfel hinter den Kragen. Er stützt die Handflächen auf den Tisch, rechts und links neben den Teller, rechts und links neben Messer und Gabel. Er hebt das Gesäß ein wenig vom Sitz. Er beugt sich über den Tisch, daß seine Serviette herabhängt auf den leeren Teller, und übersieht so den Inhalt der Schüsseln. Dann senkt er das Gesäß auf den Sitz. Dann greift er zu. Er lädt sich auf mit der Vorlegegabel, mit dem Vorlegelöffel, Gabel für Gabel, Löffel für Löffel, bis er einen großen Haufen auf dem Teller hat. Und während mir meine Mutter auftut, einen Haufen, der im Haufen meines Vaters mehrmals Platz hätte, drückt mein Vater mit der Gabel das Gemüse, die Kartoffeln breit, schneidet mein Vater mit dem Messer das Fleisch zu großen Happen klein und gießt mit dem Soßenlöffel Soße über das Ganze. Und während mir meine Mutter meinen kleineren Haufen breitdrückt, mein Fleisch kleinschneidet zu kleinen Happen und das Ganze mit Soße begießt, fängt mein Vater an zu essen. Sein Bauch berührt die Tischkante. Seine Schenkel klaffen so weit auseinander, daß ein Kopf Platz hätte zwischen ihnen. Seine Beine umschlingen die Stuhlbeine. Er führt vollbeladene Gabeln zum Munde und kaut mit großer Sorgfalt klein, den Blick auf den Mittelscheitel meiner Mutter gerichtet, die sich nun selber auftut, einen Haufen, der in meinem Haufen mehrmals Platz hätte.«
Zur fränkischen Kulinarik später mehr – mit Ihrem, Herr Egersdörfer, Bressot kommen wir dann da auf keinen Fall weiter, eher schon mit, genau – Hans Sachs: »Eine Gegend heißt Schlaraffenland, / den faulen Leuten wohlbekannt; / die liegt drei Meilen hinter Weihnachten. / Ein Mensch, der dahinein will trachten, / muß sich des großen Dings vermessen / und durch einen Berg von Hirsebrei essen; / der ist wohl dreier Meilen dick; / alsdann ist er im Augenblick / im selbigen Schlaraffenland. / Da hat er Speis und Trank zur Hand; / da sind die Häuser gedeckt mit Fladen, / mit Lebkuchen Tür und Fensterladen. / Um jedes Haus rings ein Zaun, / geflochten aus Bratwürsten braun; / vom besten Weine sind die Bronnen, / kommen einem selbst ins Maul geronnen. / An den Tannen hängen süße Krapfen / wie hierzulande die Tannenzapfen; / auf Weidenbäumen Semmeln stehn, / unten Bäche von Milch hergehn; / in diese fallen sie hinab, / daß jedermann zu essen hab.«
Mit Ihrer erinnerungsgetränkten Verherrlichung Nürnbergs als top-notch Hotspot der Abenteuer, engelsgleichen Damen und antispießbürgerlichen Usancen sehen wir ebensowenig Land. Die »Stadt des Friedens und der Menschenrechte« (guter Witz) hat Wolfgang Koeppen 1971 in seinem Funkessay »Proportionen der Melancholie« (BR, Studio Nürnberg) porträtiert. »Zuweilen eine Front, die freut, selten eine geglückte Symbiose, die Stadtteilbibliothek, das Pellerhaus, dann eine wilhelminische Verschnörkelung aus dem Kinderbausteinkasten der Jahrhundertwende, die nicht alles bedauern läßt, was dahingegangen ist. Nürnberg nun eine Stadt wie andere in der Bundesrepublik, ein Aufbauwunder wie überall, auch hier zuviel zitiert die Konjunktur […], ihre Peripherie genügt ihr nicht, sie schafft sich ein Satellitenkind, Menschen für den Supermarkt«, urteilte Koeppen, und obschon die Konjunktur seitdem weitenteils den Bach runtergegangen ist (Grundig, AEG, Quelle und so fort), stimmen Koeppens Eindrücke noch immer. Nürnberg prahlt geradezu mit baulichen Monstren und Verfehlungen, von seiner zweigeteilten, puppenstubenhaften, zweifelhaften Altstadt samt »Altstadt-Giebeligkeit« (Hermann Glaser) und »Gassengedärm« (Jean Paul) abgesehen. Eines meiner Lieblingsexempel ist der U-Bahnhof Maximilianstraße (an der berüchtigten Fürther Straße), für den 1978 die sogenannte Eisenbahner-Villa abgerissen worden war. Bei dessen Anblick zerfallen einem die Worte im Munde wie die Hofmannsthalschen modrigen Pilze.
Koeppen, dem verehrungswürdigen Melancholiker auf Reisen, dem »empfindlichsten Menschen der Welt« (Alfred Andersch), verschlug es die Sprache glücklicherweise nicht. Er blickte zurück auf die unmittelbare Nachkriegszeit, in der alles »geleugnet« wurde: »Das Gericht tagte, aber man interessierte sich nicht für Gerechtigkeit. Ich hätte damals mit Alfred Kerr, der zum Gericht gekommen war, denken können: Dies wird nichts mehr, dies soll man liegenlassen, ein Mahnmal, das weite Trümmerfeld mit dem romanischen Bogen, dem gotischen Pfeiler einer zerschlagenen Kirche, verloren unter dem Himmel, allmählich grasbewachsen, ein Epitaph, auch für Dürer.«
Am liebsten würde ich den gesamten, in weiten, weichen Sätzen schwingenden Text hier hineinkleben, doch ich möchte diesen großartigen Essay Ihnen und unseren Lesern nicht mit Hilfe des Nürnberger Trichters in die Hirne pressen, diese sanfte Klage über den unerbittlichen »Gewerbefleiß« und die »Predigerstrenge des alten Melanchthon«; aber zwei Passagen seien mir noch gestattet. Zum einen:
»Nürnberg, sagt man, sei das Germanische Museum, und das Germanische Museum wäre Nürnberg. Das ist ein romantischer Gedanke. Sicher umfängt das Germanische Museum alles, was Nürnberg in der romantischen Vorstellung war: schöne deutsche Geschichte, schöne deutsche Sitte, schöne deutsche Religion, schöne deutsche Kunst, selbst noch die Wissenschaft ist deutsch und schön. Ich weiß das Museum zu schätzen. Ich gehe gerne hinein. Ich verlasse es mit Gewinn. Es ist klug geleitet, es ist sehenswert, die Sammlungen sind beispielhaft aufgestellt und gehängt. Aber sie bleiben eine Sammlung, die ein Sammler zusammengetragen hat, der sich seiner Schätze freut und sie herzeigt in der Erwartung, daß man ah sagt, ach wie schön. Die Zeugnisse der Vergangenheit sind, in das Museum gebracht, zwangsläufig Wertgegenstände, Seltenheiten, Kostbarkeiten, die man zu schätzen, zu verehren, zu bewundern und nicht zu kritisieren hat. Die alten, in das Museum gebauten Häuser, ihre Zimmer, wie behaglich sind sie, wie sauber, wie blank die Fenster, wie warm die Öfen, man möchte sich da ins Bett legen und endlich den Frieden genießen.«
An dieser Stelle stellt Koeppen eine lange Reihe von Fragen, die deutlich Brechts »Fragen eines lesenden Arbeiters« aufgreifen. Ich lasse sie, mit Bedauern, dort stehen und zitiere – zum zweiten – folgenden Abschnitt:
»Auf dem Weihnachtsmarkt aßen sie Bratwürste, als wollten sie ein für allemal beweisen, daß Nürnberg wirklich die Stadt der Bratwürste sei. Die Lebkuchen, die alten Nürnberger Lebkuchen, braun oder schwarz, waren viel weniger begehrt als das scharfe verbrannte Fleisch der Würste, niemand verschlang süße Lebkuchen auf dem Platz bei dem Schönen Brunnen, der alles überstanden hat, Autodafés, Nazis und Bomben, und vielleicht wollten die Kinder keinen Kuchen, weil es keine Großmütter und keine Hexen mehr in den Familien gibt, kein Platz ist in den Wohnungen, doch die unverkauften Lebkuchen ruhten in den vertrauten Dosen mit dem traulich vertrauten Bild des vertrauten Nürnberg und der Erinnerung an alle erlebten Weihnachten mit Lebkuchen oder keinen, wenn das Haus brannte, wenn man im Keller war unter Trümmern oder nur, weil man sich verstecken mußte, auf der Flucht, im Hunger, vor der Hinrichtung, vor dem großen Schlachtfeld.«
Seit ungefähr fünfzehn Jahren schickt mir der Fußballreportertitan Günther Koch im Advent eine große, schöne Blechdose der Firma Schmidt, mit Schnee-, Burg- oder Dürer-Motiven. »Glasierte und schokolierte Nürnberger Elisen-Schnitten« liegen in ihr, neben »Marzipan-Elisen-Lebkuchen« (»Nuremberg Marzipan Elisen-Gingerbread Cookies with minimum 25 % nuts and almonds«), für »höchste Qualitätsstandards […] bürgen unser ›Herz mit der Burg‹ sowie das ›Ganz-Frisch-Garantie-Siegel‹«. Da wird ausnahmsweise kein Gran gelogen.
Franz Lerchenmüller schrieb in der FAZ mal eine Eloge auf die Bäckerei Düll in Nürnberg-Schoppershof. »Zum Advent hin verlassen täglich 5000 bis 6000 Lebkuchen die enge Backstube. Das klingt nach viel, ist aber bescheiden, wenn man es mit dem Ausstoß des Marktführers vergleicht: Bei Lebkuchen Schmidt schieben sich in Spitzenzeiten bis zu drei Millionen Stück über die blitzblanken Bänder und Backstraßen – pro Tag. Der Unterschied ist: Bei Düll ist jedes Stück von Hand gemacht.« Nämlich so: »Lebküchner Holger Düll behält das Räderwerk aus fünfzehn Konditoren, Bäckern und Azubis fest im Blick. Er dirigiert, avisiert, findet sogar Zeit, einem Vertreter für belgische Schokolade, mit dessen Preisen er nicht einverstanden ist, in breitestem ›Fränggisch‹ die Leviten zu lesen – und läßt dabei keinen Augenblick von seiner Arbeit ab. Eine Oblate von zehn Zentimetern Durchmesser legt er auf seinen kleinen Drehteller, sticht mit einem Handspachtel eine Portion von der klebrigen, braunen Masse ab, die sich auf dem Tisch türmt, und streicht sie mit kurzen, schnellen Handgriffen zu einem kleinen Hügel: ›Der hält den Lebkuchen saftig.‹ Am Ende glättet er ein wenig nach und hebt den Rohling auf ein Blech. Wieder und wieder und wieder.«
Ich bleibe den vom Hause Koch veranlaßten Lieferungen trotzdem inniglich verbunden. Nicht unerwähnt will ich dessenungeachtet lassen, daß Sie, wertester Herr Egersdörfer, ein paar Ihrer Schauspielergesellen und ich mal auf dem Christkindlesmarkt in der Tat keinen einzigen Nürnberger Lebkuchen angefaßt, geschweige denn erworben und auf unseren Zungen haben zergehen lassen – eine Schande, es werde dereinst mit Bitternis in den städtischen Annalen verzeichnet sein. Denn wenig anderes spricht inständiger für Franken als: der Nürnberger Lebkuchen, die Wurst (in mannigfaltiger Gestalt) und das Bier, auf welchem Gebiete Sie, Magister Egersdörfer, ja das Hebendanz Export (Hell), verfertigt in Forchheim, zum Allerhöchsten kürten. Ich muß Ihnen diesbezüglich zu gegebener Zeit korrigierend an die Kandare fahren, räume allerdings ein, daß mein Freund und Kollege Michl Rudolf in seinem Standard- und Meisterwerk 2000 Biere – Der endgültige Atlas für die ganze Bierwelt (4. Aufl., Münster 2005) zu ebenjenem Trank festhielt: »Ich schaute ein tadelloses Bier: Hebendanz Hell (5,0 %). Deutlich ansprechen lassen sich Bernstein in der Farbe, überzeugende Lieblichkeit und Geschmack.«
Anzusprechen bleibt mir nicht erspart, daß wir nach unserer Visite auf diesem elenden Rumbumbelweihnachtsmarkt (er findet bekanntlich auf dem Hauptmarkt statt, dort, wo 1349 das jüdische Ghetto niedergerissen wurde, sechshundert Juden wurden anschließend vor der Stadt ermordet), mutmaßlich aus Italien mit Tanklastern semiillegal herbeigeschleppten Fuselglühwein in einer schaurigen, dunklen Ecke am Rande des Budengeraffels saufend, im Bratwurst-Röslein am Rathausplatz einkehrten, im »größten Bratwurstrestaurant der Welt« (täglich geöffnet; 10 bis 24 Uhr warme Küche). Auf der Website ist in Erfahrung zu bringen: »1431: Die Bierschenkbehausung Waizenstüblein wird in alten Hausbriefen erstmals erwähnt. Sie wird später in das Bratwurst-Röslein integriert. Um 1480: erste Erwähnung der alten Nürnberger Rostbratküche Zu den drei Rosen. Bis 1600: Bekannte Stammgäste sind Albrecht Dürer, Hans Sachs, Adam Kraft, Peter Vischer und Willibald Pirkheimer«. Ich gebe zu, es geschah auf mein Geheiß. Ihre Frau, Meister Egersdörfer, aß einen Salat. Aßen Sie etwas? Etwa Bratwürste?
Ich weiß es nicht mehr. Ich aß nichts. Ich trank mich mit Brunzbier vergeßlich. Und ich erinnerte mich, allen Widrigkeiten zum Trotz, an einen Aufenthalt in München, wo ich gelesen und am folgenden Tag mit unserem gemeinsamen Freund und Kollegen Michael Sailer auf dem Viktualienmarkt und anschließend im Bratwurstherzl herumgelungert hatte. Dort notierte ich eine Äußerung eines imposant beleibten Herrn an unserem Tisch: »Nürnberger Bratwürstl mit Bratkartoffeln? Da zerreißt’s mi’ fast. Da bin i scho’ beim Namen satt.«
Jetzt hingen wir also im Bratwurst-Röslein rum. »Herzlich willkommen im Bratwurst-Röslein. Souvenirshop. Grüß Gott im Bratwurst-Röslein.« So prangt es auf einer der Speisekarten. Man muß die ganze Verbalverrammelungsniedertracht in vollem Glanz erstrahlen lassen: »Original Nürnberger Bratwurst-Zinnherz« – »Original Saure Zipfel im Zwiebel-Frankenweinsud 6er-Dose« – »Mini-Nostalgie-Dose Elisenlebkuchen« – »BraWuRös catering.services« – »Burgwächterplatte mit: knuspriger Pfefferhaxe, Nürnberger Bratwürsten, saftigem Kasseler und Stücken von der fränkischen Bauernente, dazu gibt’s Sauerkraut, leckeres Apfelblaukraut, Salzkartoffeln und Kartoffelklöße – und das alles für sagenhafte 14,80 €« – »Gebratene Schwarzwälder Pfefferhaxe mit Dunkelbiersoße und Kartoffelkloß« – »Gekochtes vom bayerischen Rind mit Meerrettichsoße, Preiselbeeren und Salzkartoffeln« – »Saftiges Fleischpflanzerl mit Steinchampignons in Rahmsoße und Kartoffelpüree« – »Röslein’s Original Nürnberger Lebkucheneis mit ›versoffenen‹ Zwetschgen und Schlagrahm … einfach lecker!«
Über derartige touristische Eskalationen wird in irgendeiner Zukunft zu richten sein. Der Journalist Klaus Schamberger, genannt »der Spezi«, empfiehlt dagegen den Marientorzwinger, den Kettensteg, den Endreß-Garten, das Gutmann am Dutzendteich, die Silberne Kanne. Hinzufügen will ich den kleinen Biergarten an der Ecke Heubrücke/Peter-Vischer-Straße und die Schankwirtschaft Schanzenbräu in Gostenhof.
Aber, lieber Herr Egersdörfer, verschonen Sie mich fürderhin, soweit es Ihnen möglich ist, bitte mit fränkischer Burgenromantik. Ich pfeife auf die Veste Coburg, die Plassenburg in Kulmbach, auf Schloß Johannisburg in Aschebersch et cetera. Statt dessen könnten Sie womöglich bei Gelegenheit ein wenig die erbitterte Rivalität zwischen Fürthern (herausragende Persönlichkeiten: Heinrich Hoffmann, Hitlers Leibphotograph, Ludwig Erhard, Henry Kissinger) und Nürnbergern illustrieren; mich tät’s interessieren. Oder Sie inspizieren für mich und uns alle den spektakulären Playmobil-FunPark in Zirndorf. Das wär’ brutal der Oberhammer!
Zum Beschluß jedoch seien Sie vor allem herzlich gegrüßt:
J. Roth
Pfefferbeißer und güldenes Brot
Fürth, den 24. 6.
Hochgeschätzter Ritterdoktor Roth,
mein herzensguter Schwager hat einmal den Begriff der »Buchstabenvergiftung« ersonnen und freigiebig in meine großen Ohren hineingesprochen. Eine solche Infektion meine ich mir zugezogen zu haben, als ich Ihres Texthaufens ansichtig wurde.
Mir wurde ganz schwummrig, und schnell zerbiß ich zwei kinderarmlange Pfefferbeißer der hervorragenden Metzgerei Speckner aus Nürnberg und schob vier güldene Göllner-Brötchen aus der Ottostraße in Fürth hinterher. Darauf möchte ich an dieser Stelle gesondert hinweisen: Diese beiden Kunstwerke aus mittelfränkischer Handwerkshand haben, obwohl sie aus zwei verschiedenen Städten stammen, in meinem in Nürnberg geborenen und in Lauf über die Jahre vergrößerten und heute in Fürth wohnenden stattlichen Bauch ohne den Hauch einer Verzögerung praktisch sofort einen Wohlklang der Sättigung und der Glückseligkeit hergestellt. Genau mit diesem Lebensmittelwunder möchte ich Ihre auf Ranküne sinnende Anfrage bezüglich der »erbitterten Rivalität« ein für allemal vom Tisch hinunterwischen.
Mir schlafen meine Füße, meine Finger und meine Zunge ein von diesen an langen, fettigen Haaren herbeigezogenen Animositäten zwischen den beiden Städten. Wenn man darüber Witze machen möchte, gefällt mir immer noch jene Benennung einer Fußballmannschaft beim Freizeitkickerturnier »Plärrer-Cup« am besten, die sich nämlich selbst auf den hervorragenden Namen »Schießbefehl Stadtgrenze« taufte.
Tatsächlich hatte mich die Vielzahl Ihrer Worte zusammen mit der lukullischen Symphonie in meinem Bauch ein bißchen schläfrig gemacht, und so entschied ich mich, die Polsterung meiner Scheselong zu überprüfen, indem ich mich ad hoc auf das Möbel legte und kurz darauf in einen Schlummer fiel. Ich paßte nicht auf, und aus jenem Schlummer wurde ein Schlaf. Mitten im Schlaf träumte mir einiges nebulöses Zeug, dessen ich mich nicht mehr entsinnen kann. Aber dann tauchten Sie plötzlich auf, ganz und gar derangiert, und ein aufgebrachter Mob drangsalierte Sie. Ich hielt dagegen, und wo Argumentation nicht half, haute ich auch kräftig zu. Schließlich hatte ich Sie in Sicherheit gebracht. Sie schlotterten vielleicht aus Furcht und vielleicht, weil Sie sehr leicht bekleidet waren. Ich kann mich nur schwer erinnern, welche Jahreszeit im Traum war. Aber ich meine rekapitulieren zu können, daß Ihre erhitzten Gegner schwere Wintermäntel trugen. Ich selbst war mit einem Anzug bekleidet. Sie dagegen trugen nur ein kurzes Unterhöschen. Jetzt komm’ ich zum Kern des Gespinsts: Gerade als ich mir die Jacke auszog und sie Ihnen über die zitternden Schultern legen wollte, wurde ich gewahr, daß Ihr Leib über und über mit Tinte, mit langen Sätzen in unzähligen Absätzen beschrieben war. Jäh schreckte ich auf, und jäh schrecke ich jetzt bei der Niederschrift nochmals auf.
Ich fürchte, mich in eine stattliche Themenverfehlung hineinzuschwätzen. Schluß damit. Ich schreibe deshalb heute, am 24. Juni, meinen politischen Jahresrückblick – zum einen, um schon jetzt für eine derartige Anfrage im letzten Monat des Jahres präpariert zu sein, zum anderen, um das Kapitel Deutschland, Fürth und Nürnberg abzuschließen und endlich für die Akte Lauf einen Anfang zu finden:
»Die somnambule Kanzlerin zerstört ihre Partei vollständig. Die CDU ist tatsächlich nur noch betrunken wählbar. In Fürth wird der rote Teppich für die Idiotie ausgerollt. Ein geplantes Einkaufszentrum wird der Brache in der Innenstadt den Rest geben. Die Stadt Lauf an der Pegnitz versinkt im Morast einer grünen Vetternwirtschaft. So wurde ich gezwungen, mein Elternhaus zu verkaufen. In der geistfernen Ödnis verbleiben nur Zerrüttung und Schmerz. Einzig dem Oberbürgermeister Maly kann ich noch ohne Brechreiz in die Augen blicken. Wie lange noch?«
Damit soll alles gesagt sein. Die Ouvertüre ist folgende: Auf der Bundesstraße 14 braust Ritter Roth mit Steuermann Egersdörfer bei schönstem hellen Sonnenschein, Nürnberg hinter sich lassend, bald schon durch Behringersdorf, die Waldstraße nach Günthersbühl, wo das aber unbedingt noch zu erwähnende Gasthaus Fürsattel steht, ignorierend, und immer weiter geradeaus durch Rückersdorf, wo übrigens der Teppichbodenmogul und Ex-Clubpräsident Michael A. Roth kurz vor dem Ortsausgang auf einem Hügel ein ganz putzeliches Schlößchen für seine Cinderella, die sieben Zwerge, Rapunzel und Rübezahl hingezaubert hat. Vielleicht sagt Ihnen ja das zu, Herr Doktor! Wir halten uns nicht weiter auf und fahren durch eine Rechtsschleife geradewegs weiter. Es öffnet sich der rote Vorhang: Wir befinden uns auf der Urlashöhe und klingeln an der Pforte des gehobenen Mittelstands. Ich lasse Ihnen untertänigst den Vortritt, hinein in die direkte Nachbarschaft meiner Kindheit und späteren Jugend.
Die Grande Dame in Lauf rechts der Pegnitz
Frankfurt am Main, den 25. 6.
Werter Herr Egersdörfer,
grußlos beschließen Sie Ihre Antwort. Wie Sie wollen. Dann trennen sich halt unsere Wege in Bälde wieder, und der Verlag soll zusehen, was er mit den paar Seiten von Ihnen und meinethalben auch meinen anfängt.
Bis dahin aber entziehe ich mich nicht meiner Pflicht, jener des Chronisten und des Frankenerkunders. Ich werde berichten von dem, was wir bis dato gesehen, geschmeckt, gerochen, und dem, was wir bislang in Erfahrung gebracht haben. Sollten Sie die Neigung verspüren, darauf noch einmal zu antworten, dann verkneifen Sie sich doch bitte das Herumhüpfen auf meinem akademischen Titel. So, pro domo gesprochen, der Abschweifungen und Gifteleien nun genug!
In Lauf rechts der Pegnitz waren wir angekommen. Sie steuerten das Freibad an, das sich pittoresk ins Bitterbachtal schmiegt und das mit dem bedauerlicherweise nahezu ubiquitären Freizeitkrampf aufwartet: Wasserpilz, Massagebucht, Wasserspeier, Kinderplanschbecken mit Kletterfelsen, Rutsche, Schiffchenkanal, Tierplastik, Großrutsche.
Sie erhielten kostenlos Einlaß (Celebrity-Bonus), ich dito, weil ich nicht schwimmen wollte (bin als ehemaliger Sportschwimmer vorerst genug geschwommen). Sie schwammen ihre 1500 Meter Kraul in zehn Minuten, ich trank in derselben Zeit zwei Halbe auf der Terrasse des überirdisch fein ins Baum-Bach-Passepartout eingefügten Kioskes. Eine erste These, unter Umständen vom tagträumenden Unterbewußtsein formuliert, kritzelte ich aufs Schmierpapier: »Etwas leicht, a wa: manifest Bescheuertes wabert über dem Frankenland.« Hier war sie allerdings so stimmig wie die hinlänglich bekannte Franz Josef Straußsche Alaska-Ananas-Metapher: »… to establish a pineapple farm in Alaska instead of becoming Chancellor in Germany.«
In sich ruhende, keineswegs vergnügungssüchtige, sondern eben geerdete Menschen beiderlei Geschlechts und jederlei Alters gruppierten sich zwanglos rund um den ansehnlichen Zweckbau. Ein Idyll schien mir das zu sein, ein Rückzugsort, eine Insel für unaufdringlich gesellige Wesen.
Ich dachte gerade an eine Verflossene, als Sie, aus dem Becken gestiegen, freundlich vorschlugen, doch eventuell aufzubrechen. »Passend zu unserem Thema hab ich ’ne fränkische Brotzeit«, begrüßte uns Frau Conrad wenig später in ihrem großen, den Geist des kleinstädtischen Unternehmertums atmenden und von einem hübschen Garten umschlungenen Haus. »Ah, wunderbar!« entfuhr es mir, Frau Conrad, die ich fast nur lachend kenne, lachte laut und beinahe mädchenhaft, und später kassierte ich eine Rüge von ihr, weil ich zum Brot und zur Stadtwurst »keinen Budder« nahm.
Ich habe auch ausnehmend angenehme Erinnerungen an Lauf, an bronzebraune, knisternde, knusprige und knackende Schnitzel und Karpfen im Brauerei-Gasthof Wiethaler in Neunhof, im Weißen Lamm am Marktplatz oder in der Mauermühle zum Beispiel. Hier soll aber ab sofort jemand anders sprechen.
»Ich bin entschlossen, es mir gutgehen zu lassen«, sagt Frau Conrad und läßt den Blick über den Radi, die Radieschen, die sauren Gurken, den Käse- und Wurstteller, die Butterschale und den Brotkorb schweifen. Ob es Laufer Spezialitäten gebe … »Also, in Lauf könnt’ i mer etz kei’, könnte i jetz’ … Ich hab’ mir überlecht, ob i Bratwürscht machen soll, aber des war mir zu aufwendig. Des wär’ lauferisch g’wesen.«
Der Oberpfälzer, freilich, der sei der natürliche Feind des Franken, »aber ich bin ja a alde Frau, also, ich bin nicht mehr repräsentativ für die Franken«. Trotzdem: Was muß denn in einem Buch über Franken unbedingt stehen?
Lassen wir sie erzählen: »Der Großvadder, der alte Master Conrad Heinrich, der is’ so in den achtziger Jahren nach Lauf gekommen. Und zwar war der zuerst – er stammt aus Marktredewitz, aus Rawertz –, er war in Nürnberg bam Ledderer als Master, als Schlosser, und dann hat er sich selbständig g’macht. Er hat a Schlosserei g’macht, und er war ein unglaublicher Workaholic und hat seine Dinger, seine G’sell’n hat er g’haut!«
Und der Vater, der Krieg, eine Generation später? Du wurdest sozusagen auch zwangsverschleppt aus Nürnberg? »Ja, ’43 hatten wir einen Phosphorkanister in unserem Haus, und unsere Wohnung is’ ausgebrannt, wir ham im erschten Stock g’wohnt, es war nicht mehr bewohnbar. Es ist aber wieder aufgebaut worden nachm Kriech, es war ’ne Genossenschaftswohnung. Weil mei’ Vadder Blockleiter war, durften wir nemmer nei. Mein Vadder war Beamter, der einzige Beamte in der Straß’, der mußte den Blockleiter machen. Na ja, und da sin mer nach Alfeld, der letzte Ort vor der Opferpfalz, vor Lauterhofen, da waren unsere Großeltern, ham a klein’s Zeichla g’habt, vier Küh’, und mei’ Vadder is’ in demselben Herbst nach Dänemark. Da hat er in Odense ’ne Dienststelle g’habt vom Sicherheitsdienst. Aber, des hat er g’sagt, des war sei’ schönste Zeit. Die Dänen sind so nette Leut’, hat er g’sagt, mit denen hat er die größte Gaudi g’habt!
Für uns war dann Schluß mit der Schul’, weil dann kriegsmäßig nix mehr war. Da war’n mer dann ein Jahr ohne Schule, und im nächsten Jahr, ’45 im Herbst, ist die Schule wieder angegangen. Da durft’ ich dann gleich in die zweite Klasse, damit sich des net so staut. Na ja, und dann hat mei’ Mutter einen vom Wohnungsamt becirct, der hat uns dann ein winziges Zimmer zugewiesen.«
An die Kartoffelsuppe der Großmutter, »mit System und Bedacht gemacht«, im großen Kachelofen, erinnert sich Frau Conrad als an das »Allerschönste am Samstag« in Alfeld. »Alfeld liegt ja in einem Tal, zwischen dem Schneiderberg und dem Kegelberg. Schneiderberg is’ Süden, Kegelberg is’ Norden. Und jeden Kirchweihmontag wird vom Kegelberch zum Schneiderberg eine Schnur gespannt, mit einem Buschen dran, und der wird über dem Marktplatz runtergelassen. Und damit feiern sie jedes Jahr die Wiedervereinigung, die 1806, als alle nach Bayern kamen, als das Königreich Bayern gegründet wurde, daß sie da also zusammengehören. Das is’ der Brauch, der bis heute lebendig is’.
Na ja, und dann ham mer damals überlegt, was mer machen, denn mei’ Vadder war Parteigenosse, und er mußte erst entnazifiziert werden. Und in Nürnberg hatte inzwischen die SPD das Ruder übernommen, und da ham so die Fliesenleger und die Schlosser und alles, die ham inzwischen die Kripostellen besetzt. Also, ich sach nix gegen die Leute, aber des war’n halt alles Leute, die net in der Partei war’n. Aber der bayerische Staat hat ihn dann eingestellt, und er kam in die Kriminalaußenstelle Lauf, und zwar im Januar 1950.«
Luise Conrad macht das Abitur, ihre Schwester fällt durch, »für mei’ Mudder war das a Schand’«. »Und dann hat mich auch gleich die Pathologie angeworben, in Erlangen an der Uni, und da hab’ ich hundertzwanzig Mark verdient im Monat. Das war damals ganz normal für ein’ Anfänger beim Staat.«
Und die Kerle?
»Ich hatte in meiner Ausbildung in Erlangen, ’52 bis ’54, zwei Freundinnen. Wir waren so ein Trio. Wir ham natürlich alles ausgetauscht und uns unterhalten, und dann haben die g’sacht: Also, einer muß unbedingt blond sein.« Obwohl – wichtiger ist noch: »Man hat drei Etagen: Kopf, Herz und unten. Und alle drei Etagen müssen ›hier‹ schreien.«
Luise wird Rudi Conrad heiraten. Ihre Mutter hat »natürlich g’wußt, daß der Rudi a weng zu die Besser’n g’hört, und wir war’n natürlich a weng einfache Leut’, und da hat’s g’sacht: Du wirst doch den bucklerten Kerl net mög’n!« Sie lacht, sie lacht herzerwärmend glockenhell. »Wieso is’ der bucklert?«
Wir üben uns, Herr Egersdörfer, an dieser Stelle der Unterhaltung in Diskretion. Doch enden will ich nicht, ohne festzuhalten, daß Frau Conrad über ebendiese Eheanbahnung erzählte, die noch nicht gänzlich miteinander Vertrauten seien einmal während eines Spaziergangs aus Versehen »auf der linken Seite von Lauf gewesen« (»Ich weiß gar net, wie mer da hingeraten sind!«). Sie verstehen sicher, worauf ich anspiele, und können, sollten Sie wollen, daran anknüpfen.
Enden will ich ebensowenig ohne eine Anmerkung zu Behringersdorf. Warum auch immer, glaubte ich jahrelang zu wissen, daß der so knallgeniale wie grottendumm-paranoide Schachgroßmeister und Antisemit Bobby Fischer einige Jahre dort untergetaucht war. Erst jetzt stellt sich – für mich – heraus: Fischer lebte in den Jahren 1990/91 klandestin oder immerhin unerkannt, unerbittlich mit irgendwelchen Zauseln schachspielend, in der Pulvermühle südlich von Waischenfeld in der Fränkischen Schweiz, exakt dort, wo die Gruppe 47 ihr letztes Treffen anberaumt hatte, nach dem sie sich Gott sei Dank selbst in den Orkus kippte. Renate Just (Krumme Touren 1 – Reisen in die Nähe, München 2007) weiß nicht nur, daß dazumal »Augstein ›viel Bier trank‹ und auch Peter Bichsel sich im Wintergarten ›bacchantisch‹ aufführte«, sondern obendrein: »Kein Wunder, denkt man sich, daß die bundesdeutsche Autorencrème sich nach diesem trüben Versammlungsort vielleicht endgültig nicht mehr riechen konnte.«
Und noch etwas darf nicht unter den Tisch fallen: Nach unserer charmanten, geruhsamen Plauderei in der Casa Conrad donnerten wir, Fußball zu schauen, auf den Laufer Kunigundenberg hinauf; saßen dann, ich in der Pflicht, O-Töne für ein Hörspiel für den Deutschlandfunk zu sammeln, im mirakelrein kastanienbewehrten Biergarten; und trafen Ihren alten Kumpel Jürgen Eichenmüller, der über dieses Paradies mit Selbstbedienungsausschank gebietet, uns Zigaretten sonder Zahl spendierte und meinte, es sei »jetzt alles tipptopp okay« und werde ohnehin nach dem Motto runtergerockt: »Hobb etz!«
Na, das ist doch mal eine Lebensauffassung à la Franconia, die mir mundet.
Soviel hierzu, soviel dazu, zagend und in Ungewißheit dennoch grüßend:
Roth
PS: »A Wirtshaus is’ was Schönes. A Wirtshaus is’ was Lockeres, is’ so was, so was …« (Luise Conrad)
Das Schwimmbad in Lauf rechts der Pegnitz
Fürth, den 25. 6.
Lieber Herr Roth,
bitte ziehen Sie keine falschen und voreiligen Schlüsse aus meinem letzten, überstürzt endenden Brief. Keineswegs wollte ich damit Unmut ausdrücken oder gar die gesamte Unternehmung in Frage stellen. Ganz im Gegenteil, ich war so wonnetrunken vom Anfang unserer Reise, daß ich im Überschwang glattweg die formal richtige Beendigung des Schreibens außer acht ließ.
Lauf an der Pegnitz war also der erste Hafen, den unser Schiff auf seiner hoffnungsfrohen Fahrt anlief. Grob läßt sich das Städtchen in Lauf links der Pegnitz und Lauf rechts der Pegnitz unterteilen. Die verehrte Frau Conrad wohnt im rechten Stadtteil, hier befinden sich das Freibad, das Gymnasium und das Rathaus. In Lauf links befinden sich die Kläranlage, die Sonderschule und der Swinger-Club.
In genau diesem Freibad wäre ich vor zirka neununddreißig Jahren fast einmal ertrunken. Ich konnte noch nicht schwimmen, begleitete aber den Rest der Familie mit Anhang zum abendlichen Bahnenziehen in die kreisstädtische Badeanstalt. Statt jedoch, wie Sie es, grundvernünftig, taten, ruhig ein Bier zu trinken, fehlte mir zu diesem Zeitpunkt noch die Berufung hierzu, und der Kiosk im Schatten der Bäume, mit Blick auf den Bitterbach, war damals wohl auch noch ein ungeträumter Traum.
Also trieb ich am Beckenrand Schabernack, und es kam, wie es kommen mußte: Der Bubi stürzte in voller Montur ins Schwimmerbecken und sank wie ein Stein auf den Grund. Der Geistesgegenwart einer Freundin meiner Schwester war es zu verdanken, daß ich gerettet wurde. Sie tauchte mir hinterher und zog mich aus der Tiefe empor.
Schon auf Grund dieser Geschichte schwimme ich heute sehr gerne im Laufer Freibad. Aber ich schwimme wohlgemerkt Brust – und das sehr bedächtig und respektvoll, und es könnte gut sein, daß Sie sehr wohlmeinend die Zeit und die Meterangabe kurzerhand vertauscht haben. Wir wollen dem Leser, zumindest noch nicht an dieser Stelle, nicht allzu leichtfertig einen Bären aufbinden.
Aber wie hat es Achim Greser einmal sinngemäß gesagt? Eine glückliche Kindheit bringt einem gar nichts.
Mit herzlichem Gruß aus dem nächtlichen Fürth:
Matthias Egersdörfer
Ende der Leseprobe