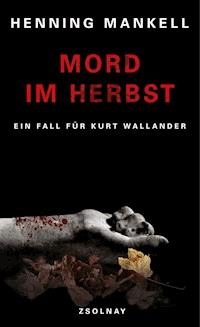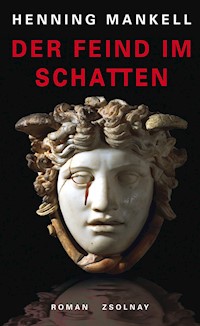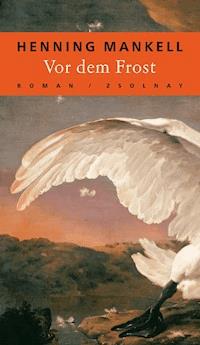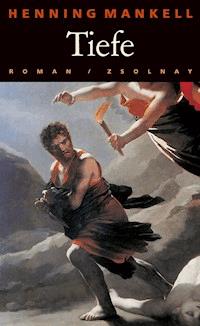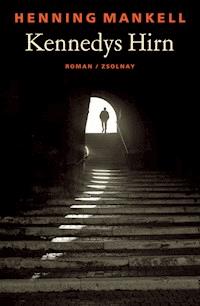Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Wer fordert einen toten Mann zum Tango auf? Mankells neuer Kommissar Stefan Lindman, 37, steht vor einem Rätsel: Sein ehemaliger Kollege Herbert Molin ist ermordet worden, und am Tatort werden blutige Fußspuren gefunden, die wie Tangoschritte aussehen. Gibt es einen Zusammenhang mit Molins Vergangenheit als SS-Mann? Lindman ermittelt auf eigene Faust in Mankells Heimatort Härjedalen ... Henning Mankell hat einen grandiosen Kriminalroman geschrieben, der ein Stück deutsch-schwedischer Geschichte erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 713
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Zsolnay E-Book
Henning Mankell
Die Rückkehr desTanzlehrers
ROMAN
Aus dem Schwedischenvon Wolfgang Butt
Paul Zsolnay Verlag
Die Originalausgabe erschien erstmals 2000
unter dem Titel Danslärarens återkomst
bei Ordfront in Stockholm.
Vorbemerkung des Übersetzers
Der mit schwedischen Verhältnissen vertraute Leser wird in der vorliegenden Übersetzung das in Schweden durchgängig gebrauchte Du als Anredeform vermissen. Es wurde, soweit es sich nicht um ein kollegiales oder freundschaftliches Du handelt, durch das den deutschen Gepflogenheiten entsprechende Sie ersetzt, auch wenn damit ein Stück schwedischer Authentizität des Textes verlorengeht.
ISBN 978-3-552-05761-6
© Henning Mankell 2000
Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2002/2015
Schutzumschlaggestaltung: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung einer Fotografie von Photo Disk
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Prolog
DEUTSCHLAND
Dezember 1945
Die Maschine hob kurz nach zwei Uhr am Nachmittag des 12. Dezember 1945 vom Militärflugplatz in der Nähe von London ab. Ein feiner Regen fiel, und es war kühl. Hin und wieder zogen kräftige Böen vorüber und zerrten an dem Sack, der die Windrichtung anzeigte. Dann war es wieder still. Die Maschine war eine zweimotorige Bristol Blenheim, die schon die Schlacht um England im Herbst 1940 mitgemacht hatte. Sie war mehrmals von deutschen Jägern getroffen und zu Notlandungen gezwungen worden. Aber sie war jedesmal wieder repariert und erneut in den Kampf geschickt worden. Jetzt, da der Krieg vorüber war, wurde die Maschine hauptsächlich für Materialtransporte benutzt, um die englischen Truppen, die im besiegten und verwüsteten Deutschland stationiert waren, zu versorgen.
Doch heute hatte Mike Garbett, der Pilot, Bescheid bekommen, daß er am Nachmittag einen Passagier zu einem Ort namens Bückeburg fliegen sollte. Dort würde dieser abgeholt werden und erst am folgenden Abend nach England zurückkehren. Wer der Mann war oder mit welchem Auftrag er nach Deutschland flog, wurde Garbett von Major Perkins, seinem nächsten Vorgesetzten, nicht mitgeteilt. Garbett stellte auch keine Fragen. Obwohl der Krieg vorüber war, konnte man immer noch das Gefühl haben, daß er andauerte. Geheime Transporte waren an der Tagesordnung.
Nachdem er seinen Flugbefehl in Empfang genommen hatte, setzte sich Garbett zusammen mit seinem Kopiloten Peter Foster und dem Navigator Chris Wiffin in eine der Baracken. Auf dem Tisch hatten sie die Deutschlandkarten ausgerollt. Ihr Zielflugplatz lag ungefähr dreißig Kilometer von Hameln entfernt. Garbett war noch nie dort gewesen, aber Peter Foster kannte den Flugplatz. Weil die Umgebung eben war, würde der Anflug keine Schwierigkeiten bereiten. Das einzige Problem war der Nebel. Wiffin verschwand, um mit den Meteorologen zu sprechen. Als er zurückkehrte, konnte er berichten, daß für den Nachmittag und Abend klares Wetter über dem Norden und der Mitte Deutschlands erwartet wurde. Sie machten ihren Flugplan, berechneten die Menge Benzin, die sie benötigen würden, und rollten dann die Karten zusammen.
»Wir sollen nur einen einzigen Passagier rüberfliegen«, sagte Garbett. »Wer der Mann ist, weiß ich nicht.«
Es wurden keine Fragen gestellt, und er erwartete auch keine. Seit drei Monaten flog er nun zusammen mit Foster und Wiffin. Sie gehörten zu denen, die überlebt hatten. Das vereinte sie. Viele Piloten der Royal Air Force waren im Krieg gefallen. Keiner von ihnen wußte, wie viele Freunde er verloren hatte. Sie empfanden keineswegs nur Erleichterung darüber, überlebt zu haben. Es war quälend, daran zu denken, daß ihnen das Leben vergönnt war, nach dem die Toten in der Erde riefen.
Kurz vor zwei Uhr fuhr ein geschlossener Wagen vor. Foster und Wiffin befanden sich bereits an Bord der Maschine und waren mit den letzten Startvorbereitungen beschäftigt. Garbett stand unten auf der rissigen Betonrollbahn und wartete. Er runzelte die Stirn, als er sah, daß ihr Passagier ein Zivilist war. Der Mann, der aus dem Fond des Wagens stieg, war untersetzt. In seinem Mund steckte eine kalte Zigarre. Aus dem Kofferraum des Wagens holte er einen kleinen schwarzen Koffer. Gleichzeitig traf Major Perkins in seinem Jeep ein. Der Mann, der nach Deutschland fliegen sollte, hatte den Hut tief in die Stirn gezogen. Garbett konnte seine Augen nicht sehen. Auf diffuse Weise fühlte er sich unwohl. Als Major Perkins die beiden einander vorstellte, murmelte der Passagier seinen Namen. Garbett verstand ihn nicht.
»Jetzt könnt ihr starten«, sagte Perkins.
»Sonst kein Gepäck?« fragte Garbett.
Der Mann schüttelte den Kopf.
»Es ist besser, während des Fluges nicht zu rauchen«, sagte Garbett. »Die Maschine ist alt, es könnte Lecks geben. Benzindämpfe bemerkt man meistens erst, wenn es zu spät ist.«
Der Mann antwortete nicht. Garbett half ihm an Bord. Im Innern der Maschine gab es drei unbequeme Stahlstühle, ansonsten war sie leer. Der Mann setzte sich und stellte den Koffer zwischen die Beine. Garbett fragte sich, was für Schätze er wohl nach Deutschland fliegen sollte.
Nach dem Abheben flog Garbett eine Linkskurve, bis er sich auf dem Kurs befand, den Wiffin ihm genannt hatte. Dann richtete er die Maschine auf, und als sie die ihnen angewiesene Flughöhe erreicht hatten, überließ er Foster den Steuerknüppel. Garbett wandte sich zu ihrem Passagier um. Der Mann hatte den Mantelkragen hochgeschlagen und den Hut noch tiefer in die Stirn gezogen.
Garbett fragte sich, ob er schlief. Aber irgend etwas sagte ihm, daß der Mann hellwach war.
Die Landung auf dem Flugplatz von Bückeburg verlief ohne Probleme, obwohl es dunkel und die Landebahn nur schwach beleuchtet war. Ein Wagen lotste die Maschine an den Rand eines langgestreckten Hangars. Dort warteten schon mehrere Militärfahrzeuge. Garbett half dem Passagier aus der Maschine. Aber als er sich nach dem Koffer bückte, schüttelte der Mann den Kopf und nahm ihn selbst. Dann setzte er sich in einen der Wagen, und die Kolonne fuhr sofort los. Wiffin und Foster waren inzwischen aus der Maschine geklettert und sahen die Rücklichter verschwinden. Es war kalt, und sie fröstelten.
»Man wird ja schon neugierig«, bemerkte Wiffin.
»Besser nicht«, erwiderte Garbett.
Dann zeigte er auf einen Jeep, der sich ihrer Maschine näherte.
»Wir sollen in einer Unterkunft schlafen«, sagte er. »Ich nehme an, das ist der Wagen, der uns holt.«
Nachdem ihnen ihre Schlafplätze zugeteilt worden waren und sie zu Abend gegessen hatten, schlugen einige Mechaniker vom Bodenpersonal vor, in einem der Wirtshäuser der Stadt, das den Krieg unbeschadet überstanden hatte, zusammen ein Bier zu trinken. Wiffin und Foster nahmen das Angebot an, aber Garbett war zu müde und blieb in der Unterkunft. Er legte sich hin, konnte aber nicht einschlafen. Er lag da und grübelte darüber nach, wer wohl ihr Passagier war. Was war in dem Koffer, den kein anderer berühren durfte?
Garbett murmelte in der Dunkelheit vor sich hin. Der Passagier hatte einen Geheimauftrag. Garbetts einzige Aufgabe war, ihn am nächsten Tag zurückzufliegen. Das war alles.
Er schaute auf seine Armbanduhr. Es war schon Mitternacht. Er rückte sein Kissen zurecht, und als Wiffin und Foster gegen eins zurückkehrten, war er eingeschlafen.
*
Donald Davenport verließ das britische Gefängnis für deutsche Kriegsgefangene kurz nach dreiundzwanzig Uhr. Er war in einem Hotel untergebracht, das keine Kriegsschäden erlitten hatte und jetzt als Unterkunft für britische Offiziere diente, die in Hameln stationiert waren. Er merkte, daß er müde war. Er brauchte seinen Schlaf, wenn er seinen Auftrag am nächsten Tag fehlerfrei ausführen wollte.
Er machte sich Sorgen wegen des britischen Sergeanten MacManaman, der zu seinem Assistenten ausersehen war. Davenport arbeitete nicht gern mit unerfahrenen Helfern. Vieles konnte falsch laufen. Besonders wenn der Auftrag so umfassend war wie der, der sie erwartete.
Er lehnte eine letzte Tasse Tee ab und ging direkt in sein Zimmer. Dort setzte er sich an den Schreibtisch und sah die Notizen der Besprechung durch, die eine halbe Stunde nach seiner Ankunft begonnen hatte. Er fing mit dem maschinengeschriebenen Formular an, das er von einem jungen Major namens Stuckford bekommen hatte, der die Verantwortung für die ganze Aktion trug.
Er glättete das Papier, richtete die Schreibtischlampe aus und las die Namen. Kramer, Lehmann, Heider, Volkenrath, Grese … Insgesamt waren es zwölf Namen. Drei Frauen und neun Männer. Er studierte die Angaben über ihr Gewicht und ihre Größe und machte sich Notizen. Es dauerte lange, weil sein Berufsstolz von ihm forderte, daß er höchste Genauigkeit walten ließ. Erst gegen halb zwei legte er den Stift zur Seite. Jetzt hatte er sich alles klargemacht. Er hatte seine Berechnungen durchgeführt und dreimal kontrolliert, daß er nichts übersehen hatte. Er stand auf, ging zum Bett und öffnete den Koffer. Obwohl er wußte, daß er nie etwas vergaß, kontrollierte er, ob alles an seinem Platz war. Er nahm ein sauberes Hemd heraus, schloß den Koffer und wusch sich dann mit dem kalten Wasser, das alles war, was das Hotel zu bieten hatte.
Er hatte nie Probleme einzuschlafen. Auch in dieser Nacht nicht.
Als um kurz nach fünf an seine Tür geklopft wurde, war er schon aufgestanden und fertig angezogen. Nach einem schnellen Frühstück fuhren sie durch die dunkle Ortschaft zum Gefängnis. Sergeant MacManaman war bereits da. Er war sehr blaß, und Davenport fragte sich, ob er wohl durchhalten würde. Aber Stuckford, der sich ihnen angeschlossen hatte und Davenports Besorgnis zu ahnen schien, nahm ihn beiseite und versicherte ihm, daß MacManaman zwar mitgenommen aussehe, aber bestimmt durchhalten würde.
Um elf Uhr waren alle Vorbereitungen abgeschlossen. Davenport hatte sich entschlossen, mit den Frauen anzufangen. Weil ihre Zellen in dem Korridor lagen, der dem Galgen am nächsten war, würden sie das Geräusch hören, das beim Öffnen der Falluke entstand. Das wollte er ihnen ersparen. Davenport kümmerte es nicht, welche Verbrechen die einzelnen Gefangenen begangen hatten. Es war lediglich seine eigene Anständigkeit, die von ihm verlangte, mit den Frauen zu beginnen.
Alle, die der Hinrichtung beiwohnen sollten, hatten ihre Plätze eingenommen. Davenport nickte Stuckford zu, der seinerseits einer der Wachen ein Zeichen gab. Es waren einzelne Kommandoworte zu hören, Schlüssel rasselten, eine Zellentür wurde geöffnet, Davenport wartete.
Die erste, die kam, war Irma Grese. Einen kurzen Augenblick schlich sich ein Gefühl der Verwunderung in Davenports kühles Herz. Wie konnte diese magere blonde Zweiundzwanzigjährige im Konzentrationslager Bergen-Belsen Gefangene zu Tode gepeitscht haben? Sie war kaum mehr als ein Kind. Aber als ihr Todesurteil gefällt worden war, hatte niemand gezögert. Sie war ein Ungeheuer gewesen, und jetzt sollte sie sterben. Sie begegnete seinem Blick und sah dann zum Galgen auf. Die Wachen führten sie die Stufen hinauf. Davenport richtete ihre Beine so aus, daß sie genau über der Falluke waren. Während er ihr die Schlinge um den Hals legte, kontrollierte er gleichzeitig, daß MacManaman den Ledergürtel um ihre Beine richtig anzog. Als Davenport ihr die Kapuze über den Kopf zog, hörte er sie mit kaum vernehmbarer Stimme ein einziges Wort sagen.
»Schnell!«
MacManaman war einen Schritt zurückgetreten und Davenport streckte sich nach dem Hebel, mit dem er die Falluke betätigte. Die Frau fiel senkrecht nach unten, und Davenport wußte, daß er die Länge des Seils richtig berechnet hatte. Lang genug, daß der Nackenwirbel brach, aber nicht so lang, daß der Kopf vom Körper getrennt wurde. Zusammen mit MacManaman ging er unter das Gestell, auf dem der Galgen stand, und machte den Körper los, nachdem der britische Militärarzt Irma Greses Tod festgestellt hatte. Die Leiche wurde fortgeschafft. Davenport wußte, daß in der harten Erde des Gefängnishofes bereits Gräber ausgehoben waren. Er stieg wieder aufs Schafott und kontrollierte in seinen Papieren, welche Seillänge er der nächsten Frau zugedacht hatte. Als alles bereit war, nickte er Stuckford erneut zu, und kurz darauf stand Elisabeth Volkenrath mit auf den Rücken gebundenen Händen in der Tür. Sie war auf die gleiche Weise gekleidet wie Irma Grese. In ein graues Kleid, das ihr bis über die Knie reichte.
Drei Minuten später war auch sie tot.
Die Hinrichtung aller Personen nahm zwei Stunden und sieben Minuten in Anspruch. Davenport hatte mit zwei Stunden und fünfzehn Minuten gerechnet. MacManaman hatte seine Aufgabe zufriedenstellend ausgeführt. Alles war nach Plan verlaufen. Zwölf deutsche Kriegsverbrecher waren hingerichtet worden.
Davenport packte das Seil und die Lederriemen in den schwarzen Koffer und verabschiedete sich von Sergeant MacManaman. »Trinken Sie ein Glas Cognac«, sagte er. »Sie waren ein guter Assistent.«
»Sie hatten es verdient«, erwiderte MacManaman kurz. »Ich brauche keinen Cognac.«
Davenport verließ das Gefängnis zusammen mit Major Stuckford. Er überlegte, ob es möglich wäre, schon früher als geplant nach England zurückzukehren. Er selbst hatte erst am Abend zurückfliegen wollen. Es hätte etwas Unvorhergesehenes eintreten können. Davenport war zwar Englands erfahrenster Henker, aber zwölf Hinrichtungen an einem Tag waren auch für ihn ungewöhnlich. Er entschied sich, den einmal gefaßten Plan nicht mehr zu ändern.
Stuckford nahm ihn mit in den Speisesaal des Hotels und bestellte Mittagessen. Sie saßen in einer abgetrennten Nische. Stuckford hatte eine Kriegsverletzung und zog das linke Bein nach. Davenport empfand Sympathie für ihn, vor allem, weil er keine unnötigen Fragen stellte. Es gab nichts, was Davenport so unangenehm berührte, als wenn Menschen ihn fragten, wie es gewesen sei, diesen oder jenen Verbrecher hinzurichten, der durch das, was die Zeitungen geschrieben hatten, bekannt geworden war.
Sie aßen und wechselten nur ein paar allgemeine Phrasen über das Wetter und ob man in England vielleicht mit einer Extrazuteilung von Tee oder Tabak zum bevorstehenden Weihnachtsfest rechnen konnte.
Erst hinterher, als sie Tee tranken, kommentierte Stuckford das Geschehen vom Vormittag. »Eins stimmt mich bedenklich«, sagte er. »Daß die Menschen vergessen, daß es ebensogut umgekehrt hätte sein können.«
Davenport war sich nicht sicher, ob er verstanden hatte, was Stuckford eigentlich meinte, aber er brauchte nicht zu fragen.
Stuckford erklärte es. »An Ihrer Stelle könnte auch ein deutscher Henker nach England fahren, um englische Kriegsverbrecher hinzurichten. Junge englische Mädchen, die in einem Konzentrationslager Menschen zu Tode gepeitscht hätten. Das Böse hätte uns ebensogut treffen können, wie es die Deutschen in Form von Hitler und dem Nationalsozialismus getroffen hat.«
Davenport sagte nichts. Er wartete auf die Fortsetzung.
»Kein Volk ist von Natur aus böse. Diesmal waren die Nazis eben Deutsche. Aber niemand kann mir erzählen, daß das, was hierzulande geschehen ist, nicht ebensogut in England hätte geschehen können. Oder in Frankreich. Oder in den USA.«
»Ich verstehe Ihren Gedankengang«, erwiderte Davenport. »Aber ob Sie recht haben oder nicht, vermag ich nicht zu beurteilen.«
Stuckford füllte ihre Teller noch einmal auf. »Wir richten die schlimmsten Verbrecher hin«, sagte er dann. »Die größten Kriegsverbrecher. Aber wir wissen auch, daß viele von ihnen davonkommen werden. Wie zum Beispiel Josef Lehmanns Bruder.«
Lehmann war der letzte gewesen, den Davenport an diesem Vormittag gehenkt hatte. Ein kleiner Mann, der vollkommen ruhig, beinah abwesend, dem Tod entgegengesehen hatte.
»Er hat einen äußerst brutalen Bruder«, fuhr Stuckford fort. »Aber dem ist es gelungen, unterzutauchen. Vielleicht hat er es geschafft, sich einer der nationalsozialistischen Seilschaften zu bedienen. Er kann sich mittlerweile in Argentinien oder Südafrika aufhalten, und da bekommen wir ihn nie zu fassen.«
Sie schwiegen. Draußen regnete es.
»Waldemar Lehmann ist ein unfaßbar sadistischer Mensch«, nahm Stuckford den Faden wieder auf. »Er war nicht nur den Gefangenen gegenüber vollkommen unbarmherzig, er fand auch ein mörderisches Vergnügen daran, seine Untergebenen in der Kunst, Menschen zu quälen, zu unterrichten. Ihn sollten wir genauso hängen wie seinen Bruder. Aber wir haben ihn nicht gefunden. Noch nicht.«
Um fünf Uhr kehrte Davenport zum Flugplatz zurück. Obwohl er einen dicken Wintermantel trug, fror er. Der Pilot stand neben der Maschine und erwartete ihn. Davenport fragte sich, was er wohl dachte. Dann setzte er sich in der kalten Flugzeugkabine auf einen Stuhl und schlug den Mantelkragen hoch.
Garbett ließ die Motoren an. Die Maschine hob ab und verschwand in den Wolken.
Davenport hatte seinen Auftrag ausgeführt. Es hatte keine Probleme gegeben. Er galt nicht umsonst als Englands geschicktester Henker.
Das Flugzeug stampfte und krängte in den Luftlöchern. Davenport dachte an das, was Stuckford über diejenigen gesagt hatte, die davonkamen. Und er dachte an Lehmann, dem es ein Vergnügen gewesen war, Menschen in der Kunst zu unterweisen, anderen Menschen gegenüber immer grauenhaftere Arten von Brutalität anzuwenden.
Davenport zog den Mantel enger um sich. Die Luftlöcher lagen jetzt hinter ihnen. Die Maschine war auf dem Weg zurück nach England. Es war ein guter Tag gewesen. Keiner der Gefangenen hatte sich gesträubt, als man sie zum Galgen führte. Kein Kopf war vom Rumpf getrennt worden.
Davenport war zufrieden. Jetzt konnte er sich auf drei freie Tage freuen. Dann würde er in Manchester einen Mörder hinrichten.
Er saß auf dem harten Stuhl und schlief ein, obwohl unmittelbar neben ihm die Motoren dröhnten.
Mike Garbett fragte sich immer noch, wer wohl sein Passagier war.
Teil 1
HÄRJEDALEN
Oktober – November 1999
1
Nachts lag er wach, von Schemen umgeben. Es hatte angefangen, als er zweiundzwanzig Jahre alt war. Jetzt war er sechsundsiebzig. Seit vierundfünfzig Jahren verbrachte er seine Nächte schlaflos. Und immer waren die Schatten um ihn gewesen. Nur in Perioden, in denen er große Mengen starker Schlafmittel genommen hatte, war es ihm gelungen, nachts zu schlafen. Aber wenn er erwachte, wußte er, daß die Schemen dennoch dagewesen waren, auch wenn er nichts von ihnen gemerkt hatte.
Die Nacht, die gerade zu Ende ging, war keine Ausnahme gewesen. Er brauchte nicht darauf zu warten, daß die Schatten, oder die Besucher, wie er sie manchmal nannte, auftauchten. Sie erschienen ein paar Stunden nach Einbruch der Dunkelheit. Plötzlich waren sie ganz dicht bei ihm. Mit ihren stummen weißen Gesichtern. Nach all den Jahren hatte er sich an ihre Gegenwart gewöhnt. Aber er wußte, daß er ihnen nicht vertrauen durfte. Eines Tages würden sie nicht mehr schweigen. Was dann passieren würde, konnte er nicht sagen. Würden sie ihn angreifen? Ihn entlarven? Es war vorgekommen, daß er sie angeschrien hatte. Daß er um sich geschlagen hatte, um sie zu verjagen. Für einige Minuten war es ihm gelungen, sie auf Abstand zu halten. Doch sie waren zurückgekommen und bis zur Morgendämmerung geblieben. Erst da hatte er einschlafen können, wenn auch meistens nur für ein paar Stunden, denn er mußte einer Arbeit nachgehen.
Sein ganzes erwachsenes Leben hindurch war er müde gewesen. Wie er immer durchgehalten hatte, wußte er nicht. Wenn er auf sein Leben zurückblickte, sah er eine sich endlos hinziehende Reihe von Tagen, durch die er sich nur mühsam geschleppt hatte. Seine Erinnerungen hingen alle in irgendeiner Weise mit seiner Müdigkeit zusammen. Zuweilen dachte er an Fotos, die ihn zeigten. Er sah immer gleich verwüstet aus. Auch in der Zeit seiner beiden Ehen hatten die Schatten ihre Rache gefordert. Die Frauen waren seiner ständigen Ängste überdrüssig geworden. Und daß er stets schlafen wollte, wenn er nicht arbeiten mußte. Sie hatten es nicht mehr ertragen, daß er Nacht für Nacht wach gelegen und nie darauf geantwortet hatte, warum er nicht schlief wie normale Menschen. Schließlich hatten sie ihn verlassen, und er war wieder allein gewesen.
Er blickte auf seine Armbanduhr. Es war Viertel nach vier. Er ging in die Küche und goß sich aus der Thermoskanne Kaffee ein. Das Thermometer vor dem Fenster zeigte zwei Grad unter Null. Es war locker und würde bald abfallen, wenn er die Schrauben nicht auswechselte. Als er die Gardine berührte, bellte draußen im Dunkeln der Hund. Shaka war seine einzige Sicherheit. Den Namen des Elchhundes hatte er in einem Buch gefunden, an dessen Titel er sich nicht mehr erinnerte. Es ging darin um einen mächtigen Zuluhäuptling, und er meinte, daß der Name gut zu einem Wachhund paßte. Er war kurz und leicht zu rufen. Er nahm die Kaffeetasse mit ins Wohnzimmer und warf einen Blick auf das Fenster. Die dicken Gardinen waren dicht zusammengezogen. Er wußte, daß es so war, aber er mußte dennoch kontrollieren, daß alles seine Ordnung hatte.
Dann setzte er sich an den Tisch und betrachtete die Puzzleteile, die verstreut vor ihm lagen. Es war ein gutes Puzzle mit vielen Teilen, und es bedurfte großer Phantasie und Ausdauer, um es zu vollenden. Wenn er mit einem Puzzle fertig war, verbrannte er es und begann sofort mit einem neuen. Er achtete immer darauf, daß er einige Spiele auf Lager hatte. Er hatte oft gedacht, daß sein Verhältnis zu Puzzlespielen ungefähr dem eines Rauchers zu Zigaretten glich. Seit vielen Jahren war er Mitglied einer weltweiten Vereinigung, die die internationale Puzzlekultur hochhielt. Sie hatte ihren Sitz in Rom und er bekam jeden Monat ein Mitgliedsblatt, das über Hersteller informierte, die aufgehört hatten, und andere, die neu begannen. Schon Mitte der siebziger Jahre hatte er bemerkt, daß es schwerer wurde, richtig gute Puzzles zu bekommen. Solche, die mit der Hand ausgesägt worden waren. Maschinengestanzte mochte er nicht. Die Teile hatten keine Logik und kein Verhältnis zum Motiv. Sie mochten schwer zu lösen sein, aber die Schwierigkeit war mechanischer Art. Im Moment arbeitete er an einem Puzzle mit Rembrandts Verschwörung der Bataver unter Claudius Civilis gegen die Römer. Es bestand aus dreitausend Teilen. Ein Künstler in Rouen hatte es geschaffen. Vor einigen Jahren war er mit dem Wagen hinuntergefahren und hatte den Mann besucht, der dieses Puzzle hergestellt hatte. Sie waren sich darin einig, daß die besten Puzzles diejenigen waren, die nur schwache Lichtveränderungen aufwiesen, wie zum Beispiel Rembrandts Motiv. Sie stellten höchste Anforderungen an Ausdauer und Phantasie.
Er saß mit einem Teil in der Hand da, das zum Hintergrund des Bildes gehörte. Es dauerte fast zehn Minuten, bis er den Platz gefunden hatte, an dem es eingefügt werden mußte. Er schaute wieder auf die Uhr. Kurz nach halb fünf. Es würde noch mehrere Stunden dauern, bis es dämmern würde, die Schatten sich zurückzögen und er schlafen könnte.
Er dachte, daß das Leben trotz allem viel einfacher geworden war, seit er mit fünfundsechzig in Pension gegangen war. Jetzt brauchte er die Müdigkeit nicht mehr zu fürchten. Und daß er während der Arbeit einschlafen könnte. Die Schemen hätten ihn schon lange in Frieden lassen sollen. Er hatte seine Strafe abgegolten. Sie brauchten nicht länger über ihn zu wachen. Sein Leben war zerstört. Warum konnten sie ihn nicht in Ruhe lassen?
Er stand auf und ging zum CD-Spieler im Bücherregal. Er hatte ihn vor ein paar Monaten auf einer seiner seltenen Reisen nach Östersund gekauft. Er spielte die CD, die sich schon im Gerät befand und die er zu seiner Verwunderung zwischen der Popmusik in dem Laden entdeckt hatte, in dem er auch den CD-Spieler gekauft hatte. Argentinischer Tango. Echter Tango. Er drehte die Lautstärke höher. Der Elchhund draußen im Dunkeln hatte ein gutes Gehör und reagierte mit einem Bellen auf die Musik, verstummte aber gleich wieder. Er lauschte der Musik, während er langsam um den Tisch ging und das Puzzle betrachtete. Es lag noch viel Arbeit vor ihm. Er würde noch mindestens drei Nächte brauchen, bis das Puzzle fertig war und er es verbrennen konnte. Dann hatte er immer noch eine Reihe nicht ausgepackter Puzzles, die in ihren Kartons auf ihn warteten. In ein paar Tagen würde er außerdem zur Post in Sveg fahren und eine weitere Sendung des alten Meisters in Rouen abholen.
Er setzte sich auf die Couch und lauschte der Musik. Es war einer seiner großen Träume gewesen, einmal im Leben nach Argentinien zu fahren. Einige Monate in Buenos Aires zu verbringen und nachts Tango zu tanzen. Aber es war nie etwas daraus geworden. Immer hatte ihn etwas zögern lassen. Als er vor elf Jahren Västergötland verlassen hatte und in die Wälder Härjedalens hinaufgezogen war, hatte er sich vorgenommen, in jedem Jahr eine Reise zu machen. Er lebte einfach, und obwohl seine Pension nicht hoch war, würde er es sich leisten können. Aber es waren nur ein paar Reisen mit dem Wagen in Europa herausgekommen. Auf der Jagd nach neuen Puzzles.
Er würde nie nach Argentinien kommen. Er würde nie in Buenos Aires Tango tanzen.
Aber nichts hindert mich daran, hier zu tanzen, dachte er. Ich habe die Musik, und ich habe meine Partnerin.
Er erhob sich. Es war fünf Uhr. Noch war die Dämmerung fern. Die Zeit zum Tanzen war gekommen. Er ging ins Schlafzimmer und nahm den schwarzen Anzug aus dem Kleiderschrank. Er musterte ihn sorgfältig, bevor er ihn anzog. Ein kleiner Fleck auf dem Revers irritierte ihn. Er befeuchtete ein Taschentuch und entfernte ihn vorsichtig. Dann zog er sich um. Zum weißen Hemd wählte er an diesem Morgen eine rostbraune Krawatte.
Am wichtigsten waren die Schuhe. Er hatte mehrere Paar italienischer Tanzschuhe, zwischen denen er wählen konnte. Alle kostbar. Für einen Mann, der den Tanz ernst nahm, mußten die Schuhe perfekt sein.
Als er fertig war, stellte er sich vor den Spiegel auf der Innenseite der Kleiderschranktür. Er betrachtete sein Gesicht. Das Haar war grau und kurz geschnitten. Er war mager und dachte, daß er mehr essen sollte. Aber er war trotzdem zufrieden. Er sah wesentlich jünger aus als sechsundsiebzig.
Dann ging er ins Wohnzimmer zurück und blieb vor der Tür des Gästezimmers stehen. Sie war geschlossen. Er klopfte und stellte sich vor, es würde ihn jemand hereinbitten. Dann öffnete er die Tür und machte Licht. Im Bett lag seine Tanzpartnerin. Er wunderte sich immer, daß sie so lebendig aussah, obwohl sie nur eine Puppe war. Er zog ihr die Decke weg und hob sie hoch. Sie trug eine weiße Bluse und einen schwarzen Rock. Er hatte ihr den Namen Esmeralda gegeben. Auf dem Tisch neben dem Bett standen Parfümflaschen. Er stellte Esmeralda ab, wählte einen diskreten Duft von Dior und besprühte vorsichtig ihren Hals. Wenn er die Augen schloß, bestand kein Unterschied zwischen der Puppe und einem lebendigen Menschen.
Er eskortierte sie ins Wohnzimmer. Er hatte oft daran gedacht, sämtliche Möbel hinauszustellen, Lampen mit gedämpftem Licht an der Decke anzubringen und eine brennende Zigarre in einen Aschenbecher zu legen. Dann hätte er seinen eigenen argentinischen Tanzsalon. Aber dazu war es nie gekommen. Er hatte nur den freien Fußboden zwischen dem Tisch und dem Bücherregal, auf dem der CD-Spieler stand. Er schob seine Schuhe in die Bügel, die unter Esmeraldas Füßen angebracht waren.
Dann begann er zu tanzen. Wenn er sich mit Esmeralda drehte, kam es ihm so vor, als sei es ihm gelungen, alle Schemen aus dem Raum zu vertreiben. Er tanzte sehr leicht. Von allen Tänzen, die er über die Jahre hinweg gelernt hatte, lag ihm Tango am meisten. Es gab niemanden sonst, mit dem er so gut tanzen konnte wie mit Esmeralda. Einmal hatte es in Borås eine Frau gegeben, Rosemarie, die einen Hutladen unterhielt. Mit ihr hatte er Tango getanzt, und keine Frau hatte sich je so gut führen lassen. Eines Tages, gerade als er sich fertig gemacht hatte, um sich mit ihr in einem Tanzclub in Göteborg zu treffen, erfuhr er, daß sie bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Er hatte noch mit anderen Frauen getanzt. Aber erst nachdem er Esmeralda angefertigt hatte, gewann er das Gefühl zurück, das er mit Rosemarie gehabt hatte.
Die Idee hatte er vor vielen Jahren bekommen, als er in einer seiner schlaflosen Nächte durch Zufall im Fernsehen ein altes Musical gesehen hatte. Darin tanzte ein Mann, vielleicht war es Gene Kelly, mit einer Puppe. Er hatte die Szene fasziniert betrachtet und sich sofort entschlossen, eine eigene Puppe anzufertigen.
Das schwierigste war die Füllung gewesen. Er hatte alles ausprobiert und verschiedene Stoffe in das Futteral gestopft. Aber erst als er es mit Schaumgummi gefüllt hatte, fühlte es sich an, als hielte er einen lebendigen Menschen in seinen Armen. Er hatte sich dafür entschieden, ihr einen großen Busen und ein kräftiges Hinterteil zu geben. Seine beiden Frauen waren mager gewesen. Jetzt hatte er sich eine Frau gegeben, bei der man etwas in den Händen hielt. Wenn er mit ihr tanzte und den Duft des Parfüms wahrnahm, konnte es ihn erregen. Allerdings nicht mehr so häufig wie noch vor fünf oder sechs Jahren. Sein erotisches Verlangen ließ allmählich nach, und er dachte, daß er es eigentlich nicht vermißte.
Er tanzte über eine Stunde. Als er Esmeralda schließlich ins Gästezimmer brachte und ins Bett legte, war er durchgeschwitzt. Er zog sich aus, hängte den Anzug in den Kleiderschrank zurück und duschte. Bald würde die Morgendämmerung hereinbrechen, und er konnte sich hinlegen und schlafen. Wieder hatte er eine Nacht bezwungen.
Er zog den Morgenrock an und goß sich Kaffee ein. Das Thermometer zeigte immer noch zwei Grad unter Null. Er berührte die Gardine. Shaka bellte ein paarmal kurz auf. Er dachte an den Wald, der ihn umgab. Genau davon hatte er geträumt. Ein einsam gelegener Hof, modern, aber ohne Nachbarn. Ein Haus, das außerdem am Ende eines Weges lag. Schließlich war es ihm gelungen, das Gesuchte zu finden. Es war ein geräumiges Haus. Solide gebaut und mit einem großen Wohnzimmer, das seinem Bedürfnis nach einem Tanzboden entsprach. Der Verkäufer war ein pensionierter Jagdmeister, der nach Spanien gezogen war.
Er setzte sich an den Küchentisch und trank seinen Kaffee. Die Dämmerung brach an. Bald würde er sich ins Bett zwischen die Laken legen und schlafen. Die Schatten würden ihn in Ruhe lassen.
Shaka bellte einmal auf. Er lauschte. Das Bellen wiederholte sich. Dann wurde es still. Wahrscheinlich ein Tier. Ein Hase. Shaka bewegte sich frei in seinem Zwinger. Der Hund bewachte ihn.
Er wusch die Tasse ab und stellte sie neben den Herd. In sieben Stunden würde er sie wieder benutzen. Er fand es nicht gut, unnötig die Tasse zu wechseln. Er konnte dieselbe Tasse wochenlang benutzen. Dann ging er ins Schlafzimmer, zog den Morgenrock aus und kroch ins Bett. Es war noch nicht hell, aber er lag gern da und hörte Radio, während er auf die Dämmerung wartete. Wenn er das erste schwache Licht vor dem Haus ahnte, würde er das Radio abschalten, die Lampe ausmachen und sich zum Schlafen zurechtlegen.
Shaka begann wieder zu bellen. Er runzelte die Stirn. Horchte und zählte still bis dreißig. Shaka war ruhig. Was für ein Tier es auch gewesen sein mochte, jetzt war es verschwunden. Er machte das Radio an. Abwesend hörte er auf die Musik. Shaka schlug erneut an. Aber jetzt klang es anders. Er setzte sich hastig im Bett auf. Shaka bellte wütend. Das konnte nur bedeuten, daß ein Elch in der Nähe war. Oder ein Bär. Es wurden jedes Jahr Bären in der Gegend geschossen. Er selbst hatte jedoch nie einen gesehen. Shaka bellte weiter. Er stieg aus dem Bett und zog den Morgenrock an. Shaka verstummte. Er wartete, aber es blieb ruhig. Er zog den Morgenrock wieder aus und kroch zurück zwischen die Laken. Er schlief immer nackt. Die Lampe beim Radio brannte.
Plötzlich fuhr er hoch. Irgend etwas stimmte nicht. Etwas mit dem Hund. Er hielt den Atem an und lauschte. Alles war still. Er bekam Angst. Ihm war, als hätten sich die Schatten um ihn her verändert. Er stieg aus dem Bett. Da war etwas mit Shakas letztem Bellen. Es hatte nicht natürlich geendet. Sondern so, als sei es abgeschnitten worden. Er ging ins Wohnzimmer und zog eine der Gardinen vor dem Fenster zur Seite, das direkt zum Hundezwinger hinausging. Shaka bellte nicht, und er merkte, daß sein Herz schneller zu schlagen begann. Er ging zurück ins Schlafzimmer und zog sich eine Hose und einen Pullover an. Dann nahm er das Gewehr, das immer unter dem Bett lag. Eine Schrotflinte mit sechs Schuß im Magazin. Er ging hinaus in den Flur und stieg in ein Paar Stiefel. Die ganze Zeit über horchte er. Shaka war still. Er dachte, daß er sich etwas einbildete, daß alles in Ordnung war. Bald würde die Dämmerung einsetzen. Es waren die Schatten, die ihm Angst machten. Nichts anderes. Er schloß die drei Schlösser der Haustür auf und schob sie vorsichtig mit dem Fuß auf. Immer noch keine Reaktion von Shaka. Jetzt wußte er, daß etwas nicht stimmte. Er nahm eine Taschenlampe von einem Regal und leuchtete hinaus in die Dunkelheit. Shaka war nicht zu erkennen. Er ließ den Lichtkegel über den Waldrand gleiten, während er nach dem Hund rief. Er bekam keine Antwort. Hastig zog er die Tür zu. Schweißgebadet. Er entsicherte das Gewehr und öffnete wieder. Vorsichtig trat er hinaus auf die Treppe. Alles war still. Er ging zum Hundezwinger und blieb abrupt stehen. Shaka lag auf dem Boden. Die Augen waren offen, und das grauweiße Fell war blutig. Er wandte sich um und lief zurück zum Haus. Er schlug die Tür hinter sich zu. Etwas passierte. Er wußte nicht, was es war, aber jemand hatte Shaka getötet. Er machte alle Lampen im Haus an und setzte sich im Schlafzimmer auf das Bett. Er merkte, wie er zitterte.
Die Schemen hatten ihn getäuscht. Er hatte die Gefahr nicht rechtzeitig erkannt. Er war davon ausgegangen, daß die Schemen sich verändern würden. Daß sie es sein würden, die ihn angriffen. Aber er hatte sich getäuscht. Die Bedrohung kam von draußen. Die Schatten hatten ihm den Blick verstellt. Vierundfünfzig Jahre lang hatte er sich täuschen lassen. Er war der Meinung, davongekommen zu sein. Jetzt sah er ein, daß das ein Irrtum war. Die Bilder von damals, aus dem furchtbaren Jahr 1945, wallten in ihm auf. Er entkam ihnen nicht.
Er schüttelte den Kopf und dachte, daß er sich trotzdem nicht freiwillig ergeben würde. Er wußte nicht, wer sich dort draußen in der Dunkelheit aufhielt und seinen Hund getötet hatte. Aber Shaka hatte ihn noch warnen können. Er würde sich nicht freiwillig ergeben.
Er trat sich die Stiefel von den Füßen, zog sich ein Paar Strümpfe an und suchte die Turnschuhe unter dem Bett hervor. Die ganze Zeit horchte er auf Geräusche. Wo blieb die Dämmerung? Wenn es erst hell wurde, würden sie ihm nicht beikommen können. Er wischte sich seine schweißnassen Hände an der Bettdecke ab. Das Gewehr gab ihm Sicherheit. Er war ein guter Schütze. Er würde sich nicht überrumpeln lassen.
Im selben Augenblick stürzte das Haus zusammen. Zumindest kam es ihm so vor. Das Getöse war so gewaltig, daß er sich auf den Fußboden warf. Weil er den Finger am Abzug hatte, löste sich ein Schuß und traf den Spiegel in der Kleiderschranktür. Vorsichtig kroch er zur Zimmertür und blickte ins Wohnzimmer. Da begriff er, was passiert war. Jemand hatte durch das nach Süden gehende große Fenster geschossen oder eine Granate hineingeworfen. Das ganze Zimmer war mit Glassplittern übersät.
Mehr Zeit, darüber nachzudenken, hatte er nicht, bevor das Fenster auf der Nordseite zerschossen wurde. Er preßte sich auf den Fußboden. Sie kommen von allen Seiten, dachte er. Das Haus ist umstellt, und sie schießen die Fenster kaputt, um hereinzukommen. Er suchte verzweifelt nach einem Ausweg. Die Dämmerung, dachte er. Die kann mich retten. Wenn nur die verdammte Nacht endlich zu Ende wäre.
Dann zerschossen sie das Küchenfenster. Er lag auf dem Bauch auf dem Fußboden und hielt die Hände über den Kopf. Als es das nächste Mal knallte, wußte er, daß das Badezimmerfenster getroffen worden war. Er spürte, wie die kühle Luft durch die zerschossenen Fenster hereinströmte.
Es zischte. Neben ihm plumpste etwas auf den Boden. Als er den Kopf hob, sah er, daß es eine Tränengaspatrone war. Er wandte sich ab, aber es war zu spät. Der Rauch hatte bereits seine Augen und seine Lungen erreicht. Ohne etwas sehen zu können, hörte er, wie neue Tränengaspatronen durch die kaputten Fenster hereingeworfen wurden. Der Schmerz in den Augen war jetzt so stark, daß er es nicht mehr aushielt. Immer noch hatte er das Gewehr in den Händen. Es gab keine andere Möglichkeit. Er mußte das Haus verlassen. Vielleicht war es trotz allem die Dunkelheit und nicht die Dämmerung, die ihn retten konnte. Er tastete sich zur Haustür vor. Der Husten riß in den Lungen. Er stieß die Tür auf und stürzte hinaus. Gleichzeitig schoß er. Er wußte, daß es ungefähr dreißig Meter bis zum Waldrand waren. Obwohl er nichts sehen konnte, lief er, so schnell er konnte. Die ganze Zeit wartete er darauf, daß der Todesschuß ihn treffen würde. Während des kurzen Laufs bis zum Waldrand gelang es ihm noch, zu denken, daß er getötet werden würde, ohne zu wissen, von wem. Er wußte, warum, aber nicht, von wem. Der Gedanke bereitete ihm ebenso große Schmerzen wie seine brennenden Augen.
Er prallte gegen einen Baumstamm und wäre fast gestürzt. Noch immer blind vom Tränengas, tastete er sich zwischen den Bäumen weiter. Zweige ritzten seine Gesichtshaut auf, aber er wußte, daß er nicht stehenbleiben durfte. Wer es auch war, dort hinter ihm, er würde ihn finden, wenn er nicht tiefer in den Wald hinein gelangte. Er stolperte über eine Unebenheit auf dem Boden und fiel. Als er sich aufrichten wollte, spürte er etwas im Nacken. Er wußte sofort, was es war. Jemand hatte den Fuß auf seinen Hinterkopf gestellt. Er erkannte, daß es vorbei war. Die Schatten hatten ihn besiegt. Sie hatten ihre dunklen Kleider ausgezogen und gezeigt, wer sie eigentlich waren.
Dennoch wollte er sehen, wer es war, der ihn töten würde. Er versuchte den Kopf zu drehen, aber der Fuß in seinem Nacken hinderte ihn daran.
Dann zog ihn jemand auf die Füße. Immer noch konnte er nichts sehen. Dennoch wurden ihm die Augen verbunden. Einen kurzen Moment lang spürte er den Atem der Person, die ihm die Binde am Hinterkopf verknotete. Er versuchte etwas zu sagen, aber als er den Mund öffnete, kamen keine Worte, nur ein weiterer Hustenanfall.
Danach schlossen sich zwei Hände hart um seine Kehle. Er versuchte, dagegen anzukämpfen. Doch es fehlte ihm die Kraft. Er spürte, wie das Leben aus ihm entwich.
Es sollte fast zwei Stunden dauern, bis er endlich tot war. Wie in einem Grenzland des Grauens, zwischen dem ungeheuren Schmerz und dem hoffnungslosen Willen zu überleben, wurde er in der Zeit zurückversetzt zu jenem Tag, an dem er dem Schicksal begegnet war, das ihn jetzt einholte. Er wurde umgestoßen und fiel auf den Boden. Jemand zog ihm Hose und Pullover aus. Er spürte die kalte Erde an seiner Haut. Dann trafen ihn die Peitschenhiebe und verwandelten alles in ein Inferno.
Wie viele Schläge er erhielt, wußte er nicht. Zwischendurch verlor er das Bewußtsein. Aber er wurde immer wieder mit kaltem Wasser übergossen und an die Oberfläche zurückgerissen. Anschließend fielen die Schläge weiter. Er hörte sich schreien, aber es gab niemanden, der ihm helfen konnte. Shaka lag tot in seinem Zwinger.
Das Letzte, was er mitbekam, war, wie er über den Hofplatz ins Haus geschleift und unter den Fußsohlen geschlagen wurde. Dann wurde alles um ihn her dunkel. Er lebte nicht mehr.
Er konnte nicht wissen, was am Ende mit ihm geschah. Daß er nackt hinaus an den Waldrand gezogen und dort liegengelassen wurde. Das Gesicht der kalten Erde zugedreht.
Da war die Dämmerung angebrochen.
Es war der 19. Oktober 1999. Einige Stunden später begann ein Regen zu fallen, der langsam, fast unmerklich in nassen Schnee überging.
2
Stefan Lindman war Polizeibeamter. Mindestens einmal jedes Jahr war er in Situationen geraten, in denen die Angst ihn gepackt hatte. Einmal war er von einem Psychopathen, der über hundert Kilo wog, zu Boden geworfen worden. Er hatte den Mann rittlings über sich gehabt und sich mit wachsender Verzweiflung dagegen zur Wehr gesetzt, daß die groben Hände des Mannes ihm den Kopf abrissen. Hätte nicht einer seiner Kollegen den Mann mit einem mächtigen Schlag an den Kopf außer Gefecht gesetzt, es wäre vorbei gewesen. Ein andermal war auf ihn geschossen worden, als er an eine Tür geklopft hatte, um einen Familienstreit zu schlichten. Der Schuß aus einer Mauser hatte sein Bein gestreift. Aber er hatte noch nie solche Angst gehabt wie heute, am 25. Oktober 1999, als er in seinem Bett lag und an die Decke starrte.
Er hatte in der Nacht fast nicht geschlafen. Dann und wann war er in einen leichten Schlummer gefallen, aus dem er aber, von Alpträumen geplagt, sofort wieder aufschreckte. Aus schierer Ohnmacht war er schließlich aufgestanden und hatte sich vor den Fernseher gesetzt und einen Sender gesucht, der einen Porno zeigte. Doch nach einer Weile hatte er den Fernseher angewidert ausgeschaltet und war wieder ins Bett gegangen.
Um sieben Uhr stand er auf. In der Nacht hatte er einen Plan entwickelt. Einen Plan, der zugleich eine Beschwörung war. Er würde nicht direkt den Hügel zum Krankenhaus hinaufgehen. Er würde die Zeit so einteilen, daß er nicht nur einen Umweg machen konnte, sondern auch noch die Möglichkeit hätte, zweimal um das Krankenhaus herumzugehen. Ununterbrochen würde er nach Zeichen dafür Ausschau halten, ob der Bescheid, den er vom Arzt bekommen sollte, positiv war. Um sich eine letzte Kraftinjektion zu geben, würde er in der Cafeteria des Krankenhauses einen Kaffee trinken und sich zwingen, ruhig die Lokalzeitung durchzulesen.
Ohne darüber nachgedacht zu haben, zog er seinen besten Anzug an. Normalerweise, wenn er nicht die Uniform oder andere Arbeitskleidung trug, ging er in Jeans und Pullover. Aber jetzt hatte er das Gefühl, der Anzug sei notwendig. Während er die Krawatte band, betrachtete er sein Gesicht im Badezimmerspiegel. Es war ihm anzusehen, daß er seit Wochen nicht richtig geschlafen und kaum gegessen hatte. Seine Wangen waren eingefallen. Außerdem hätte er sich die Haare schneiden lassen sollen. Er konnte es nicht leiden, wenn seine Haare über die Ohren ragten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!