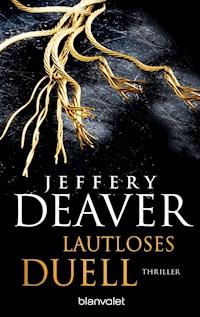8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Unvorhersehbar, rasant, verstörend
Die siebzehnjährige Megan ist spurlos verschwunden. Ihr Vater Tate Collier, ein ehemaliger Staatsanwalt, hat den furchtbaren Verdacht, dass seine Tochter entführt wurde. In seinem Beruf macht man sich viele Feinde, und nicht immer verurteilt die Justiz den wahren Schuldigen. Da die Polizei nicht an ein Verbrechen glaubt, macht er sich auf eigene Faust auf die Suche und hat bald schon eine erste Spur. Doch Megans Entführer scheint ihm immer mehrere Schritte voraus zu sein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Ähnliche
JEFFERY DEAVER
Die Saat des Bösen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Hans-Joachim Maass
Buch
Die siebzehnjährige Megan kommt nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihren Problemen nicht mehr zurecht und eckt überall an. Schließlich läßt sie sich von ihrer Mutter überreden, den Psychologen Dr. Peters aufzusuchen. Dr. Peters gelingt es tatsächlich, Megans Vertrauen zu gewinnen: Sie erzählt ihm von all ihren Sorgen. Dr. Peters schlägt Megan vor, alles aufzuschreiben.
Nach dem Arzttermin ist Megan spurlos verschwunden. Bei der Polizei tauchen nur die Aufzeichnungen der Gespräche mit Dr. Peters auf. Die Polizei glaubt an einen Routinefall: Megan sei abgehauen, um ihre Eltern zu erschrecken. Doch Megans Vater Tate, ein ehemaliger Staatsanwalt, hat ein ungutes Gefühl: Er mobilisiert seine Verbindungen zur Polizei und bittet Konnie, einen guten Freund aus alten Zeiten, nach Megan zu suchen. Konnie beginnt die Suche bei Megans Freunden. Doch jeder, der mit dem Mädchen in Verbindung stand, muß plötzlich um sein Leben bangen. Denn Dr. Peters führt ein Doppelleben, von dem niemand etwas ahnt …
Autor
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Speaking in Tongues« bei Viking, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
E-Book-Ausgabe auf Grundlage der deutschen Erstausgabe 7/98 erschienen im Goldmann Verlag Copyright © der Originalausgabe 1995 by Jeffery Deaver Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1998 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, Copyright © der E-Book Ausgabe 2016 by Blanvalet einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Covergestaltung: www.buerosued.de Coverfoto: Arcangel Images/Margie Hurwich Satz: deutsch-türkischer fotosatz, Berlin Redaktion: Cornelia Köhler FB • Herstellung: Katharina Storz/NT
Für Diana Keene,
die mir wertvolle Anregungengegeben hat und eine einsichtsvolleKritikerin gewesen ist.Sie ist ein Teil meiner Bücher,
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
MITTWOCH
Erstgeboren
Im Anfang war das Wort,und das Wort war bei Gott,und Gott war das Wort.
Johannes-Evangelium, Kap. 1, Vers 1
1
Nach Mitternacht wurden die Wolken so dick wie Trauerkleidung, doch der Regen kam noch immer nicht.
Unter diesem merkwürdig warmen Aprilhimmel watete der Mann durch ein Meer aus wilden Möhren und blassem Riedgras. Sein Ziel war ein kleines steinernes Gebäude aus wettergegerbtem Granit, der bräunlichrosafarben war wie Fleisch. Es befand sich auf einem Hügel inmitten einer Lichtung von Weihrauch- und Mastbaumkiefern.
Er hielt kurz inne, stieg dann zu der Metalltür hinauf, zog aus einer kleinen Tasche einen Hammer und einen Meißel hervor, dann drehte er sich um und blickte noch einmal auf die Lichtung zurück. Dort war nichts zu sehen außer zwei Eulen, die auf etwas Halbbegrabenem in einem Büschel von Krokussen herumhackten, das sich wie winzige beschwörende Hände in die Höhe reckte. Der Mann wandte sich wieder dem Haus zu, setzte Metall auf Stein und begann zu hämmern. Einmal, zweimal, ein dutzendmal. Das dröhnende Krachen der Werkzeuge hallte durch die Nacht.
Eine halbe Stunde lang trieb er den Meißel an der Tür entlang in die Hauswand. Der Stein zersplitterte, Brocken flogen heraus. Wieder zuckende Blitze. Der Frühlingshimmel wurde von Tentakeln weißer Flammen aufgehellt. Das Geräusch von gedämpftem Donner hüllte ihn ein und rollte dann weiter.
Und immer noch kein Regen.
Als Jesus kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen … Es war aber eine Höhle, und ein Stein lag davor … Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, daß du mich erhört hast.
Aaron Matthews, hochgewachsen und mit graugesprenkeltem Haar, war ein kräftiger Mann mit mageren, sehnigen Muskeln. Die Art von Mann, für den weder Essen noch Trinken ein Vergnügen ist; und bei dem man sich fragt, wie er sich am Leben erhält. Er schwitzte stark in der schwülen, drückenden Luft und unterbrach seine Arbeit, um sein Hemd auszuziehen. Dann fuhr er fort, den Stein wegzumeißeln und nach den Schwachstellen zu suchen.
Bald hatte er den Granit um die Scharniere herum lange genug bearbeitet, so daß er die Brechstange ansetzen konnte. Er stemmte die Tür auf. Sie fiel krachend zu Boden, und Matthew betrat das Haus.
Er machte ein Feuerzeug an und ging an den Reihen kleiner Türen vorbei. Einen Moment lang kam es ihm vor, als wäre er in eine Szene aus Dantes Inferno geraten, als hätte ihn Vergil in diese düstere, mit wabenförmigen Zellen verwirrter Sünder gefüllte Höhle geschickt, jener sich krümmender Sünder, die die Ewigkeit in stickiger Enge verbrachten. Dann fand er, wonach er suchte: ein kleines Plättchen, auf dem es in noch kleineren Buchstaben hieß: Peter Matthews. Auch diese Tür war versiegelt, gab jedoch unter einem Dutzend Hammerschläge nach.
Matthews stieß die Tür auf, griff dann behutsam hinein und berührte das dichte dunkle Haar auf dem Kopf des jungen Mannes. Er ergriff ihn an den Schultern und zog ihn aus der Gruft. Dann wiegte er den Leichnam in den Armen. Sie lagen einige Augenblicke mit aufeinandergepreßten Gesichtern auf dem Fußboden. Die Wange des Vaters war so heiß, wie die seines Sohnes kalt war.
… Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus.
Er nahm den Jungen auf die Arme, taumelte aus der Tür und stapfte zu dem Transporter, der auf dem Friedhofsweg stand. Er betrachtete das Gesicht. Bewegte er sich etwa? fragte sich Matthews. Er beugte sich hinunter. Spürte er da einen Atemhauch auf der Wange?
Lazarus, komm heraus! Komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen.
Er öffnete die Tür des Lieferwagens und bettete den jungen Mann ehrfürchtig in den Laderaum des Fahrzeugs.
Matthews fuhr zwischen den Steinsäulen hindurch, die den Eingang zum Friedhof markierten, und fuhr kurz darauf mit hoher Geschwindigkeit auf einer Landstraße entlang. Die Straße schlängelte sich durch das Shenandoah Valley in die Blue Ridge Mountains, führte immer höher und höher hinauf, bis die Lichter von Städten und dann einzelner Häuser immer kleiner wurden. Einige Meilen vom Friedhof entfernt bog er auf eine Schotterstraße ab und fuhr langsam durch einen Tunnel aus Hemlocktannen und Mastbaumkiefern.
Gleich hinter dem Einschnitt, an dem die Straße zwischen zwei steilen, mit Kletterpflanzen bedeckten Hügeln hindurchführte, tat sich plötzlich ein flaches, schalenförmiges Tal auf. Hinter einer Postenkette fast kahler Bäume war eine Gruppe niedriger, baufälliger Häuser zu sehen.
Matthews trat auf die Bremse, brachte den Lieferwagen zum Stehen und suchte den Ort sorgfältig nach Anzeichen von Eindringlingen ab, doch ein Einbruch wäre sehr unwahrscheinlich gewesen. Die Stromspannung in den Zäunen war höher als gesetzlich erlaubt, und das zehn Morgen große Gelände durchstreiften fünf Rottweiler mit bulligen Köpfen, die so brutal und gefühllos waren, wie Hunde nur sein konnten. Ihre Zähne waren so scharf wie Obsidian; sie jagten im Rudel und zerfleischten ein- oder zweimal in der Woche eins der Rehe, die durch das Tor hereinkamen, wenn es offenstand.
Die bebaute Fläche umfaßte zehntausend Quadratfuß. Darauf stand ein Gewimmel windschiefer einstöckiger Häuser, Wohnheime und Kapellen, die mehr oder weniger miteinander verbunden waren – Pappe an losen Dachschindeln, Hohlziegel an Stuck. Das alles sah aus wie eine Geisterstadt in Colorado.
Die Kathedrale im Kiefernwald: So hatte sein Vater die Anlage getauft, als er sie vor Jahren gekauft hatte. Und so hieß sie noch immer auf dem verwitterten Schild. Ein weitläufiges Gewimmel kleiner Räume, heiß und trostlos im Sommer, unbarmherzig kalt im Winter. Die eigentlichen Wohnzimmer waren fünfzehn schäbige Räume ohne Installationen. Daneben gab es noch eine dreistöckige Kapelle und ein verlassenes Gästequartier mit fünfzig Zimmern.
Die Enklave gehörte zu der großen Tradition der Lager der Pfingstbewegung und der fundamentalistischen Erweckungsbewegungen, die überall im Shenandoah Valley verstreut lagen. Als die Works Progress Administration hier die Nationalparks einrichtete, kaufte man den einheimischen Kirchen einen großen Teil des Landes ab. Einige Kirchen wurden abgerissen, andere nicht. Es konnte passieren, daß man bei einem Spaziergang durch einen unter Naturschutz stehenden Wald in den Blue Ridge Mountains plötzlich über ein verlassenes Lager stolperte, von dem das Parks Department nie etwas gewußt hatte. Verrottete Zelte, herumliegende Stühle und Kruzifixe, fast wie Beweise für ein mittelalterliches Pogrom. Man tauschte dann Seitenblicke mit seinen Begleitern und marschierte dann, ohne auch nur eine Pause einzulegen, weiter, um ein paar Meilen zwischen das Lager und den geplanten Campingplatz für den Abend zu legen.
Matthews fuhr weiter – zum Tor des Geländes –, wobei sein Blick auf eine makabre, mehr als zweieinhalb Meter hohe Engelsstatue fiel, die sein Vater vor Jahren gemacht hatte. Der verrückte alte Mann hatte sich blutige Hände geholt, als er Weinreben und Forsythienzweige zu dieser Skulptur zusammengebunden hatte. Diese verrottete jetzt und war so abstoßend wie eine Alraunenwurzel, bedeckt mit bleichem, zusammengewachsenem Moos und verfaulenden Blättern. Die Flügel waren abgesackt, und das einst glückselig wirkende Gesicht war eine schädelähnliche Maske.
Matthews parkte vor dem größten der Gebäude, stieg aus und öffnete die Seitentür des Lieferwagens. Er langte hinein und hob den Leichnam heraus. Über den Himmel zuckte wieder ein greller Blitz, dann flackerten noch weitere auf, doch das Donnergrollen blieb merkwürdig gedämpft. Matthews betrat das Gelände mit der Leiche in den Armen und ließ die Tür hinter sich zuschwingen – Vorsicht, ermahnte er sich. Vorsicht. Aaron Matthews war ein Mann, der daran glaubte, daß die Toten von heute – ebenso wie die Menschen, die bald sterben werden, und die Toten, deren Auferstehung bevorsteht – unseren vollsten Respekt verdienen.
2
Als sie den Wagen auf den Parkplatz des Arztes zurücksetzte, war das Mädchen erleichtert zu sehen, daß das Büro weit von der Innenstadt entfernt war. Niemand würde auf dem Weg zu den Einkaufszentren oder der High School hier vorbeikommen und ihren Wagen vor der Praxis eines Psychiaters stehen sehen.
He, guck mal, wer das ist! Bei der beißt jeder Seelenklempner an …
Alle mal herhören, gegen die verrückte Megan braucht ihr gar nicht erst anzutreten.
Als der Motor ausging, sah sie wie immer auf ihre Kleidung hinunter – Blue Jeans, ein dunkles Arbeitshemd aus Jeansstoff mit langen Ärmeln und Kampfstiefel. Und plötzlich löste sich ihre Erleichterung in Luft auf. Ihre Aufmachung kam ihr plötzlich völlig unpassend vor. Sie war verlegen und wünschte, sie hätte wenigstens einen Rock angezogen. Die Hosen waren zu weit, das Hemd war zu zerknittert, die Ärmel baumelten ihr bis auf die Fingerspitzen, und ihre Socken waren orangerot wie Tomatensuppe.
Was wird er von mir denken?
Daß ihm da wieder so eine Bekloppte gegenübersitzt.
Sie zog sich das hölzerne Friedenssymbol, das zwischen ihren Brüsten baumelte, über den Kopf und schleuderte es auf den Rücksitz. Megan fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und strich es sich aus dem Gesicht. Ihre geröteten Knöchel wirkten so groß wie Golfbälle. Sie trug an der einen Hand vier Ringe, an der anderen drei. Total kindlich, zuviel. Sie streifte sich alle bis auf zwei von den Fingern und warf sie ins Handschuhfach.
Soll ich einfach wegfahren? Einfach alles hinter mir lassen?
Sie seufzte. Unmöglich. Das würde nur Mega-Zoff geben.
Na schön. Also los. Achtung, hier kommt die verrückte Megan …
Sie drückte auf den Knopf der Gegensprechanlage, und einen Augenblick später summte das Türschloß. Die Praxis von Dr. James Peters beeindruckte sie nicht sehr. Sie war klein und heiß. Details, hatte ihr Joshua immer wieder eingeschärft, Joshua, der Künstler. Er hatte sie gedrängt, ernsthaft mit dem Malen anzufangen. »Halt nach den Details Ausschau«, hatte er gesagt. Das war seine erste Kunststunde. »Du mußt wie ein Künstler sehen. Wenn du das tust, geht der Rest wie von selbst.«
Es gab hier reichlich Details, die sie sich ansehen konnte: dicke Stapel von Rechnungen im Ausgangskorb neben der Tür (das beruhigte sie – daß er so viele Patienten hatte). Schäbige Einrichtung (vielleicht liquidierte er nicht genug). Massen langweilig aussehender Bücher (mußte was im Kopf haben, der Mann). Sie nahm sich eine drei Wochen alte Zeitschrift, für die sie sich nicht interessierte, und setzte sich auf die durchgesessene Couch.
Bevor sie die Geschichte über Julia Roberts fand, ging eine Tür zu den hinteren Räumen auf, und der Arzt erschien. Er hob eine Augenbraue zum Gruß. »Sie sind Megan?« sagte er mit einem routinierten Lächeln. »Dr. Peters.« Er war etwa im Alter ihres Vaters, sah gut aus. Volles, dichtes Haar. Sie hatte sich vorgestellt, daß er eine Glatze hatte und einen Spitzbart.
»Hallo.« Sie hielt die zusammengerollte Zeitschrift People fest in der Hand.
»Kommen Sie rein.« Er machte eine Handbewegung. Sie betrat sein Sprechzimmer.
Der Raum war grün gestrichen, dunkel, aber gemütlich. Sie hatte die Wahl – einen von mehreren geraden Stühlen oder eine Ledercouch.
Hm … Die verrückte Megan nimmt den Stuhl.
Als sie sich setzte, kramte der Arzt einige Augenblicke in seinem Schreibtisch und fand schließlich einen leeren Aktenordner. »Bei mir ist nicht alles so organisiert, wie es sein sollte, doch das spricht nur für einen großen Geist.«
Darauf fühlte sich Megan genötigt zu sagen: »Vielen Dank, daß Sie sich die Zeit für mich nehmen, Herr Doktor. Ich meine, weil ich erst so spät um den Termin gebeten habe.«
»Keine Ursache.«
Sie hatte ihn erst gestern angerufen, um sich einen Termin geben zu lassen. Nach dem, was am Montag passiert war (wie sollte ich es nennen – den Zwischenfall, die Situation, die Sache?), hatte das Sozialamt von Fairfax ihren Vater angerufen und ihm Namen und Telefonnummer von Peters gegeben; Tate hatte die Information an seine Tochter weitergegeben.
Er klappte den Aktenordner auf und kritzelte: »Megan Collier, richtig?«
»Nein, Collier ist der Name meines Vaters. Ich verwende den meiner Mutter. McCall.« Sie wiegte sich in dem Stuhl mit der geraden Rückenlehne und schlug die Beine übereinander. Ihre tomatensuppenfarbenen Socken waren zu sehen. Sie setzte die Füße fest auf den Boden und nahm sich vor, sie nicht mehr von der Stelle zu rühren.
Er blickte hoch. »Ein paar Details. Mein Honorar beträgt einhundertzehn pro Sitzung. Und mir wäre es lieber, Sie würden bei jedem Besuch zahlen, wenn es Sie nicht stört.«
Stören tut es mich nicht, dachte Megan. Aber ein bißchen geldgierig ist es schon. »Hm, Bett hat mir einen Scheck mitgegeben.«
»Bett?«
»Meine Mutter.« Mega wühlte in ihrer Handtasche.
»Darum kümmern wir uns später. Sie haben Ihre Versicherungsunterlagen bei sich?«
Sie tippte wieder gegen die Handtasche.
»Gut.« Er musterte sie einen Augenblick mit dem Anflug eines Lächelns. »Also, der Spielplan sieht wie folgt aus. Wir werden heute einen kleinen Blick in Ihr Gehirn riskieren, um zu erfahren, was wir sehen können. Wenn wir glauben, daß wir weitermachen sollten, können Sie ab nächster Woche, wenn ich von meiner Konferenz zurück bin, regelmäßig kommen.«
Ein Kribbeln im Magen. Bin ich total krank, oder was?
»Ah, der Blick einer Patientin, die in Panik gerät. Glauben Sie, wir werden etwas Schreckliches, etwas Dunkles finden? Nun ja, vielleicht werden wir das. Aber wenn wir es tun, werden wir einen Lichtstrahl darauf richten, und wenn wir fertig sind, wird es nicht mehr so dunkel sein.«
Er erklärte, selbst wenn sie nicht zu ihm komme, müsse sie irgendeinen Therapeuten aufsuchen. Als man sie am Montagabend betrunken auf dem Laufgang des städtischen Wasserturms aufgegriffen habe, habe sie damit eine Straftat begangen. »Und die großen bösen Wölfe vom Sozialamt können Sie zwingen, wegen des Mißbrauchs verbotener Substanzen einen Therapeuten aufzusuchen. Oder sie schleppen Sie vor das Jugendgericht, und glauben Sie mir, das werden Sie nicht wollen.«
Der Zwischenfall …
»Na schön«, sagte sie weich. Ihr Blick fiel auf einen Reiseführer auf seinem Schreibtisch. »Sie reisen nach Westen?«
»Diese Konferenz, die ich vorhin erwähnte. Die findet in Kalifornien statt.«
»Oh, großartig. Dort wollte ich schon immer mal hin. Auf Janis Joplin fahre ich total ab. Sind Sie schon mal am North Beach gewesen?«
»Wußte ich doch, daß Sie mir bekannt vorkamen. Das gleiche blonde Haar. Sie sind natürlich hübscher. Können Sie auch den Blues so rausbringen?«
»Ich wünschte, ich könnte es.«
»North Beach?« fuhr er begeistert fort. »Grant Street? Und ob ich da gewesen bin. Meine Konferenz findet in L. A. statt, aber ich liebe den Norden. Marin County, Sausalito. Ich bin ein heimlicher Hippie. An die Hippies erinnern Sie sich wohl nicht?«
»Hören Sie mal«, sagte sie begeistert, »ich habe mir Woodstock achtmal angesehen.« Jetzt wünschte sie doch, sie hätte das Friedenssymbol anbehalten.
Die verrückte Megan fühlt sich ein bißchen weniger verrückt.
Doch dann erstarrte das Lächeln, und er war wieder geschäftsmäßig. Megan spürte einen Stich der Enttäuschung, als wäre ein Junge in einem Club ihrem Blick ausgewichen. »So, sagen Sie mir jetzt die Wahrheit – der Wasserturm? Wollten Sie sich etwas antun?«
Der Richtungswechsel ließ sie zusammenzucken. Sie schluckte, und ihr Kopf war plötzlich ganz leer.
»Nein«, sagte sie schließlich.
Er fragte: »Also, was ist passiert? Haben Piraten Sie da hochgetragen?«
»Na schön, es ist so gewesen, daß ich mit diesem Mädchen losgezogen bin, das ich in einer Bar kennengelernt hatte. Sie hatte ein bißchen Stoff bei sich. Ich glaube, ich nahm ein paar Pillen, von denen ich nicht wußte, was es war. So etwas tue ich sonst nie. Es ist einfach passiert.«
»Und getrunken haben Sie auch?«
»Nur etwas Southern Comfort, das ist alles. Vielleicht mehr als nur ein bißchen.«
»Lieblingsgetränk der Joplin. Zu süß für mich.« Er blickte wieder auf ihr langes, gerades Haar. Sie nickte, und irgendwo tief drinnen spürte sie wieder ein kleines Kribbeln – diesmal vor Vergnügen und Selbstsicherheit.
Er hielt einen Finger in die Höhe. »Konflikt Nummer eins. Ihr Vater sagte, er sei überzeugt, Sie tränken überhaupt nicht.«
»Nun ja, das ist seine Sicht der Dinge. Aber so hinüber bin ich noch nie gewesen.«
Er notierte sich etwas, blickte hoch, hielt für einen Moment ihren Blick fest. »Wen sehe ich vor mir? Wer ist die Megan McCall, die mir gegenübersitzt? Die wirkliche Megan McCall?«
Das angenehme Gefühl verging. »Soll ich mich denn nicht auf die Couch legen?«
»Wenn es Ihnen Spaß macht, können Sie sich ruhig hinlegen.«
Dann würde er diese Suppensocken sehen. »Ich glaube, ich sitze lieber.« Sie atmete tief durch und lachte dann nervös. »Okay, meine geheime Geschichte … Meine Eltern sind geschieden. Ich lebe bei Bett. Sie hat ein Geschäft. Sie ist zwar nur Dekorateurin, sagt aber, sie sei Innenarchitektin, denn das hört sich besser an. Tate hat diese Farm in Prince William. Er war früher ein berühmter Anwalt, aber jetzt hat er nur noch eine kleine Kanzlei. Sie wissen schon, er setzt für die Leute Testamente auf und verkauft Häuser und solche Sachen. Er hat Leute angestellt, die für ihn die Farm bewirtschaften.«
»Und Ihre Beziehung zu Ihrer Familie? Ist der Haferbrei zu heiß, zu kalt oder gerade richtig?«
»Gerade richtig.«
»Ah.« Er nickte. Er machte eine kleine Notiz auf seinem Block, kritzelte aber vielleicht nur etwas hin. Vielleicht langweilte sie ihn. Vielleicht schrieb er gerade auf, was er noch einkaufen mußte. Dinge, die ich nach der Sitzung mit der verrückten Megan kaufen muß.
Um das Schweigen zu beenden, erzählte sie ihm, wie sie herangewachsen war, erzählte ihm vom Tod der Eltern ihrer Mutter und dem Vater ihres Vaters, von der Schule, ihren Freundinnen. Ihre Tante Susan – die Zwillingsschwester ihrer Mutter – sei bettlägerig gewesen, solange sie, Megan, zurückdenken könne. Nichts von alldem war wichtig für sie, und sie vermutete, daß es für ihn noch unwichtiger war.
»Bett und ich kommen gut miteinander aus.« Sie zögerte. »Nur eins ist komisch an ihr – sie kümmert sich sehr um ihr Geschäft, glaubt aber auch an all dieses New-Age-Zeug. Ich bin da anders. Ich halte gar nichts davon, verstehen Sie? Dieses Zeug ist doch alles unecht. Aber sie gibt mir Geld, zahlt die Versicherung für den Wagen. Viele Mütter tun das nicht. Wir streiten uns auch nicht.«
»Reden Sie miteinander? Ich meine, ob Sie alles durchhecheln, wie meine selige Großmutter zu sagen pflegte?«
»Na klar … Na ja, wahrscheinlich nicht allzuviel. Sie ist nämlich eigentlich ziemlich still. Und oft auch nicht da.«
»Und was ist mit Ihrem Dad?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Er ist in Ordnung. Er nimmt mich in Konzerte mit. Wir kommen gut miteinander zurecht. Nur scheint es mir, als hätten wir einander auch nicht viel zu sagen. Er möchte, daß ich ihn zum Surfen begleite, und das habe ich auch einmal getan, aber das ist eine total oberflächliche Art, die Zeit totzuschlagen. Ich würde lieber ein Buch lesen oder so. Ich lese gern. Kennen Sie Garcìa Márquez? Ich lese gerade Der Herbst des Patriarchen.«
Seine Augen leuchteten vor Begeisterung. »Alle Achtung. Lesen Sie wirklich, oder tun Sie nur so?«
»Hören Sie, ich …«
»Liebe in den Zeiten der Cholera. Die beste Liebesgeschichte, die je geschrieben wurde. Ich habe das Buch dreimal gelesen.«
Wieder ein angenehmes Kribbeln.
Die verrückte Megan macht ein paar astreine Punkte.
»Erzählen Sie mir mehr von Ihrem Vater«, fuhr er fort.
»Hm, er sieht immer noch ziemlich gut aus – ich meine, für einen Mann, der schon in den Vierzigern ist. Und er ist ziemlich gut in Form. Er hat viele Freundinnen, scheint sich aber für keine so recht entscheiden zu können. Er sagt, er will eine Familie.«
»Wirklich?«
»Ja. Immerzu. Aber wenn es so ist, warum geht er dann mit Mädchen aus, die Bambi heißen?«
»Nein!«
»Hab’ nur Spaß gemacht. Aber sie sehen aus, als wären sie Bambis.« Beide lachten. Einen Augenblick später verflüchtigte sich das Lächeln des Arztes. Er sah auf seine Armbanduhr und dann auf eine weitere Akte auf seinem Schreibtisch. Die Akte von jemand anderem, wie sie bemerkte.
Megan sagte kühl: »Vielleicht wollen Sie wissen, ob er mir mal an die Titten gefaßt oder mit den Fingern an mir rumgespielt hat.«
Mit Befriedigung beobachtete sie, wie seine Aufmerksamkeit sich wieder auf sie konzentrierte. »Hat er?«
»Nein. Vielleicht hat er es doch getan, und ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern.«
»Verdrängung? Sie haben sich zu oft die Sendung von Oprah Winfrey angesehen. Erzählen Sie mir von der Scheidung.«
»Ich erinnere mich wirklich nicht mehr an sie, als sie noch zusammen waren. Sie trennten sich schon, als ich drei war.«
»Wissen Sie, warum?«
»Sie haben zu jung geheiratet. Das sagt Bett jedenfalls. Sie haben sich irgendwie auseinanderentwickelt.«
Als sie ihm erzählte, wie wenig sie von der Trennung wußte, schien seine Aufmerksamkeit wieder abzuschweifen. Sie fühlte sich gekränkt, und ihre Stimme versagte fast. Kompaktes Schweigen erfüllte den Raum. Plötzlich ertappte sie sich bei der Frage: »Möchten Sie etwas über meine Phantasien hören?«
Da hatte sie ihn wieder am Haken wie eine Forelle. Sein Blick hob sich sofort. »Darauf können Sie Gift nehmen.«
»Es ist nur so, sie könnten Sie schockieren. Es geht dabei um Sex.«
»Stellen Sie mich doch auf die Probe«, sagte er. »Es braucht eine Menge, um Ihr Gegenüber zu schockieren.«
Ein glatter Fingernagel seiner linken Hand rieb einen eingerissenen an seiner rechten. Er tippte zweimal gegen seinen Ehering. Er beobachtete sie mit gesenktem Kopf und erhobenem Blick.
»Ich fühle mich komisch«, sagte ihm Megan, »wenn Sie mich so ansehen.«
»Versuchen Sie’s mit der Couch. Dann müssen Sie mein häßliches Gesicht nicht ansehen.«
Zum Teufel mit den Socken. Sie legte sich auf das harte Sofa. Dabei spannte sich ihr Hemd über den Brüsten. Die feuchte Kühle in der Luft hatte ihre Brustwarzen steif werden lassen. Der Kopf des Arztes drehte sich langsam herum; es waren nicht die Socken, die er ansah.
Als sie sich zurücklegte, krümmte sie leicht den Rücken, um den Baumwollstoff gespannt zu halten.
Die verrückte Megan schließt die Augen.
»Ich befinde mich in einem dunklen Raum. Und er ist wirklich groß. Ich meine, vielleicht ist es irgendwie, ich meine, vielleicht ist es die Turnhalle in der Schule oder so. Und darin befindet sich ein Mann. Er ist älter. Er trägt Schwarz. Er ist größer als ich und sehr … stark. Damit meine ich nicht gefährlich, aber total stark. Na ja, vielleicht ist er auch gefährlich. Ein Teil der Phantasie ist, daß ich es nicht weiß.«
»Sieht er aus wie jemand, den Sie kennen?«
»Nein, ich kann sein Gesicht nicht sehen. Er läßt mich nicht. Er will es nicht. Es liegt im Schatten. Es ist auch ein Teil von dem, was so erregend ist. Ich verstecke mich vor ihm. Es ist ein Spiel. Wie Versteckspielen. Ich höre, wie er nahe an mich herankommt, und das jagt mir Schauer durch den Körper. Verstehen Sie, ich werde irgendwie …«
»Erzählen Sie weiter.«
»Es törnt mich an. Es ist mir peinlich, Ihnen das zu erzählen.«
»Schon in Ordnung, Megan. Erzählen Sie weiter.«
Sie bemerkte eine Messinglampe, die auf dem Fußboden stand, und konnte im Schirm das konvexe Spiegelbild des Arztes sehen. Er saß vornübergebeugt da und fixierte sie.
»Dieser Mann rückt immer näher. Es kommt mir vor, als verströmte er Hitze oder so. Ich kann es überall spüren. An den Brüsten und, na, Sie wissen schon, überall. Wissen Sie, wann ich diese Phantasie meist habe?«
»Ich gebe auf.«
»Nachts. Im Bett. Bett stellt nie die Klimaanlage an. Es ist immer wirklich heiß, und ich schlafe oben auf der Bettdecke. Und …« Megan starrte den goldenen Schirm zwischen den Beinen an. Der Arzt betrachtete ihr Gesicht, während er den Füllhalter reglos in der Hand hielt. »Ich trage jetzt das gleiche wie in meiner Phantasie. Ich trage immer irgendwie schlampige Kleider – ich meine, jeden Tag. Etwa so wie jetzt. Aber das ist nicht mein eigentliches Ich.«
»Ach nein?«
»Nein. Ich mag sexy Wäsche. Meist trage ich ein Mieder und Höschen. Manchmal nur Höschen. Satin oder Seide. So Sachen, die man bei Victoria’s Secret bestellen kann. Ich mag das Gefühl auf der Haut. Wie auch immer: Wenn ich daran denke, daß dieser Mann mir immer näher kommt, fange ich an … mich zu berühren.«
Sie fixierte das sphärische goldene Spiegelbild des Arztes.
»Erzählen Sie weiter«, sagte er aufmunternd.
»Ich berühre mich überall, während er mich jagt.« In ihrem Spiegel sah sie, wie sein Brustkorb sich hob und senkte. Er kritzelte einige Notizen hin, für die er sich jedoch nicht zu interessieren schien. »Ich berühre die Brüste und stecke mir die Finger zwischen die Beine. Dann stelle ich mir vor, daß er mich umdreht und mich küßt, Sie verstehen schon, richtig tief, dann zieht er mir das Hemd über den Kopf und das Höschen runter. Er läßt mich noch immer nicht sein Gesicht sehen und hält mir mit einer Hand die Augen zu. Es ist mir absolut unmöglich, ihn zu bremsen. Ich will ihn, und er weiß es. Er ist jetzt nackt, und ich fühle seinen … Sie wissen schon, der sich an mich preßt.«
In der Fisheye-Verzerrung der Lampe sah sie, daß der Arzt sich jetzt keine Notizen mehr machte.
»Dann dreht er mich um, so daß ich ihm den Rücken zuwende«, flüsterte sie, »und dann legt er die Arme um mich und hält meine Brüste, drückt sie hart und reibt sich an mir. Weiter geht er nicht. Er hält mich einfach nur so. Ich kann mich nicht rühren. Er hält mich fest und reibt sich an mir. Manchmal wickele ich mir das Laken ganz fest um die Hüften. Dann denke ich daran, wie er hinter mir ist, mich festhält und sich an mir reibt. Ich spiele dann richtig schnell an mir, und dann … na ja, wenn ich mich richtig darauf konzentriere, brauche ich nur zwei oder drei Minuten, um zu kommen.«
Megan hob die Hände und schlug sich dann leicht auf die Jeans. »Das ist alles.« Dann fügte sie hinzu: »Ziemlich scheußlich, nicht wahr?«
»Was denn?«
»Eine solche Phantasie zu haben. Von diesem Mann herumgescheucht zu werden.«
»In meinen Ohren hat sich das ziemlich gut angehört.« Er lächelte. »Sie halten es für scheußlich?«
»Es ist nicht gerade sehr feministisch.«
»Phantasien sind nur selten politisch korrekt.«
»Ich vermute, daß ich mich manchmal schäme.«
»Warum?«
»Ich weiß nicht«, erwiderte sie und blickte zu Boden. »Ich schäme mich einfach.«
Der Arzt lehnte sich in seinem Stuhl zurück und musterte sie. »Ist einer der Gründe dafür, daß Sie sich schämen«, fragte er, »daß Sie sich die ganze Geschichte gerade ausgedacht haben?«
Ihr Herz begann zu rasen. Es flimmerte ihr plötzlich vor den Augen, als hätte ihr jemand eine Ohrfeige gegeben.
Die verrückte Megan hat sich erwischen lassen.
»Sie können es ruhig zugeben«, sagte Dr. Peters. »In meiner Praxis gibt es keine Strafbank. Sie haben diese Phantasie in Wirklichkeit nie gehabt, oder? Jedenfalls nicht beim Masturbieren.«
Sie sagte nichts. Sie hatte das Gefühl, als müßte sie weinen. Sie brachte kein Wort über die Lippen. Sie schüttelte den Kopf und richtete sich auf.
»He, he, he – entspannen Sie sich, junge Dame.« Er lächelte.
»Woher konnten Sie …?«
»Es war tatsächlich alles erfunden, nicht wahr?«
Sie nickte.
Der Arzt schien überhaupt nicht schockiert oder verletzt zu sein. »Hier, nehmen Sie noch ein Taschentuch. Was Sie soeben getan haben, ist sehr hilfreich gewesen.«
»Daß ich Sie angelogen habe?« Sie schniefte.
»Habe ich Sie eine Lügnerin genannt? Es ist immer noch eine Phantasie. Eine Geschichte, die Sie sich ausgedacht haben. Sie hatte aber nicht den Zweck, Sie anzutörnen – was bei den meisten Phantasien der Fall ist –, doch Sie bezweckten etwas damit. Was wohl, was meinen Sie?«
»Ich … ich weiß nicht.«
»Vielleicht, um meine Aufmerksamkeit zu erregen? Um eine Verbindung herzustellen?«
»Vielleicht.«
Ein leichter Vormittagsregen hatte wieder eingesetzt, und das Sprechzimmer war feucht. Der Geruch von feuchtem Haar und feuchter Kleidung hing schwer in der kühlen Luft. Es war im Zimmer sehr dunkel geworden.
Megan starrte an die Decke.
»Wenden wir uns der Vergangenheit zu«, sagte Dr. Peters. »Dem … wann war es? Montag? Dem Wasserturm. Hat Ihnen da etwas Bestimmtes Sorgen gemacht? Als Sie ausgingen und tranken?«
»Nun, ich hatte diese Freundin. Ich war in der Schule ziemlich eng mit einem Mädchen befreundet.« Sie spürte, wie Tränen in ihr aufstiegen, und hörte auf zu sprechen.
»Ja?« Dr. Peters war nicht mehr albern.
»Anne Devoe.«
Er runzelte die Stirn. »Der Name kommt mir bekannt vor. Haben sie es in den Nachrichten gebracht?«
Megan betupfte sich die Augen. »Sie hat sich letzten Monat umgebracht. In Great Falls.«
Jetzt ging ihr auf, daß das der wirkliche Grund dafür war, weshalb sie sich am Montagabend betrunken hatte. Das Mädchen, mit dem sie getrunken hatte, trank gern mal einen über den Durst, o ja. Und Bobby hatte sie belästigt, nachdem sie aufgebrochen waren. Und dann war Bett am Abend vorher nicht nach Hause gekommen oder hatte nicht angerufen, wie sie versprochen hatte – o ja, da war all das gewesen. Doch es war Annes Tod, der ihr immer wieder im Kopf herumging. Mann, es einfach so zu tun … Einfach so in die Strömung zu springen. Megans lebhafte Phantasie ließ immer wieder eine bestimmte Szene vor ihr ablaufen: Anne, die in diamantklarem Wasser trieb, das von unten blau angestrahlt wurde, während ihr schönes Haar um ihren reglosen Kopf trieb wie dunkler Rauch.
Ihre Augen silbern im Tod.
Einzelheiten …
»Megan?«
»Verzeihung?«
»Ich habe gefragt, ob Sie ihr nahestanden.«
»Ziemlich nahe. Jeder mochte Annie.«
»Das kommt auch auf unsere Liste.«
»Liste?«
»Die Liste von Dingen, über die wir sprechen müssen. Nun, noch weitere Freundinnen? Finden Sie leicht Anschluß, oder
sind Sie lieber allein?«
»Ich bin wohl eher eine Einzelgängerin. Da gibt’s Amy Walker. Sie ist meine beste Freundin. Es ist so eine Art Haßliebe.«
»Sprechen Sie oft mit ihr?«
»Oh, fast jeden Tag. Ich war eine Zeitlang sauer auf sie, weil sie mir meinen Freund ausgespannt hat. Stevie Biggs.« Sie lachte. »Aber der ist sowieso ein Blödmann. Eigentlich hat es mir nichts ausgemacht. Wir haben uns dann wieder vertragen.«
»Und wie genau steht es mit Freunden?«
Megan lachte erneut. »Das ist schnell erzählt. Ich bin eine Zeitlang mit diesem Joshua gegangen. Er lebt in Washington und ist irgendwie ein totaler Künstler. Doch wir haben Schluß gemacht. Nun ja, er hat mit mir Schluß gemacht. Vergangenes Jahr. Er ist schwarz und kam irgendwie mit der Rassensache nicht klar, glaube ich. Vor einiger Zeit ist er wieder aufgetaucht, doch ich halte Distanz. Und dann, vor ein paar Wochen, habe ich mit Bobby Schluß gemacht.«
»Bobby? Was kann er für sich in Anspruch nehmen?«
Sie lachte säuerlich. »Daß ich mit ihm Schluß gemacht habe. Meist bin ich diejenige, mit der man Schluß macht.«
»Und was war das Problem?«
»Nun, er war einfach nicht richtig für mich. Eins der Dinge, die man irgendwie weiß.«
»Treffen Sie sich noch immer mit ihm? Diesem Bobby?«
»Aber nein. Das ist doch irgendwie Vergangenheit und Geschichte.«
»Niemand am Horizont?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Und keine besonderen Probleme mit Ihren Eltern?«
»Nein«, sagte sie übertrieben forsch.
»Dann sagen Sie mir doch«, fragte er mit dem Anflug eines Lächelns im Gesicht, »warum Sie vermeiden, über sie zu sprechen.«
»Tue ich nicht.« In dem folgenden Schweigen hatte sie das Gefühl, als fragte er sie, weshalb sie leugne, nicht über ihre Eltern sprechen zu wollen. So fügte sie schnell hinzu: »Ich liebe sie. Sie lieben mich. Wir kommen, nun ja, gut miteinander aus. Und der, äh, Haferbrei ist genau richtig. Was ist das überhaupt?«
»Ein Brei aus Haferflocken. Erzählen Sie mir von einer frühen Erinnerung an Ihre Mutter.«
»Was?«
»Schnell!«
Megan preßte die Augen zusammen und entschied sich für eine Geschichte. »Bett will ausgehen und macht sich gerade zurecht, legt Make-up auf, starrt in einen Spiegel und stupst mit dem Finger gegen eine Falte, als hoffe sie, sie würde davon verschwinden. Das tut sie immer, wirklich. Als wäre ihr Gesicht für sie das Wichtigste in der ganzen Welt.«
»Und was denken Sie, wenn Sie sie dabei beobachten?« Seine dunklen Augen blitzten erwartungsvoll. In ihrem Kopf erstarrte alles.
»Nein«, flüsterte er, »Sie zögern. Sagen Sie es mir!«
»›Hure.‹«
»Fabelhaft. Jetzt erzählen Sie mir etwas über Ihren Vater, woran Sie sich besonders gut erinnern. Schnell.«
»Bären.« Megan keuchte und legte eine Hand auf den Mund. »Nein … lassen Sie mich überlegen.«
Bevor sie das Thema wechseln konnte, hakte der Arzt nach. »Bären? Im Zoo?«
»Nein, nicht so wichtig.«
»Sagen Sie es mir.«
»Ich …«
»Sagen Sie es mir, Megan«, tadelte er sanft.
»Es waren keine richtigen Bären.«
»Spielzeugbären?«
»Bären in einer Geschichte.«
»Was macht es Ihnen so schwer, es mir zu erzählen?« fragte er.
Jetzt sitzt die verrückte Megan in der Tinte. Es gibt keinen Ausweg.
Schließlich sagte sie: »Ich war ungefähr sechs, okay? Und ich verbrachte das Wochenende mit Tate. Er lebt in diesem großen Haus – er und Bett hatten es gebaut, als sie noch verheiratet waren –, und meilenweit im Umkreis lebt keine Menschenseele. Es liegt inmitten seiner Maisfelder, und es ist alles ruhig und wirklich, wirklich unheimlich. Ich fühlte mich eigenartig, total verängstigt oder so. Und ich bat ihn, mir eine Geschichte vorzulesen. Er machte ein komisches Gesicht und sagte, er habe keine Kinderbücher da. Ich fühlte mich wirklich verletzt. Meine Schulfreundin Michelle? Deren Eltern waren geschieden, doch ihr Dad hat eine Unmenge von Büchern und Spielzeugen. Ich fing an zu weinen und fragte, weshalb er keine Bücher zum Vorlesen habe.
Er machte ein total nervöses Gesicht und ging zu der alten Scheune hinaus – die ich nie betreten durfte, wie er mir eingeschärft hatte –, und dort blieb er eine Weile und kam dann mit diesem Buch zurück. Es hieß Die flüsternden Bären. Obwohl es gar kein richtiges Kinderbuch war. Ich fand später heraus, daß es ein Buch mit Volksmärchen aus Europa war.«
»Erinnern Sie sich daran?«
»Ja.«
»Nach all diesen Jahren?« wollte er wissen.
»Nach all diesen Jahren«, sagte sie und sah auf die Armbanduhr, um seinem Blick auszuweichen.
3
»Am Waldrand lag eine kleine Stadt. Und jeder, der dort lebte, war glücklich, verstehen Sie, so wie in allen Märchen, bevor das Böse passiert. Die Leute spazierten auf der Straße entlang, sangen, gingen auf den Markt oder aßen mit ihren Familien.
Und dann kamen eines Tages diese beiden großen Bären aus dem Wald und standen am Rand der Stadt mit gesenkten Köpfen da, und es hörte sich an, als flüsterten sie miteinander.
Zunächst achtete niemand auf sie. Dann hörten die Menschen allmählich mit allem auf, was sie gerade machten, und versuchten zu hören, was die Bären sagten. Doch niemand konnte es verstehen. In jener Nacht gingen die Bären wieder in den Wald. Eine Frau in der Stadt sagte, sie wisse, worüber sie flüsterten – sie machten sich über die Menschen im Städtchen lustig. Und dann fiel plötzlich allen auf, wie alle anderen in der Stadt komisch gingen und komisch sprachen und blöd aussahen, und am Ende lachten sie alle übereinander, und jeder wurde wütend.
Wie auch immer, am nächsten Tag kamen die beiden Bären aus dem Wald und flüsterten wieder miteinander. Blah-blah-blah, Sie wissen schon. Dann gingen sie wieder in den Wald zurück. Dann sagte dieser alte Mann, er wisse, worüber sie sprächen. Sie tratschten. Sie plauderten von jedem die Geheimnisse aus. Und an jenem Abend gingen die Leute in der Stadt nach Hause, schlossen all ihre Fenster und Türen, und alle schämten sich zu sehr, um wie sonst auf den Marktplatz und in die Restaurants und Cafés zu gehen.
Dann – am dritten Tag – tauchten die Bären wieder auf, wieder mit gesenkten Köpfen. Schließlich rief ein Mann: ›Ich weiß, was sie vorhaben! Sie planen, den Ort anzugreifen. Lauft!‹ Und so packten die Menschen schnell ihre Sachen und verließen ihr Zuhause. Sie verstreuten sich in die vier Ecken der Erde, und das Städtchen wurde zu einer Art Geisterstadt.
Tate hat mir die Geschichte nur einmal vorgelesen, doch ich erinnere mich immer noch an die letzte Zeile. Da hieß es: ›Und weißt du, wovon die Bären tatsächlich flüsterten? Nun, von gar nichts. Weißt du das denn nicht? Bären können nicht sprechen. ‹«
»Und die Geschichte hat Sie aufgeregt?« fragte der Arzt.
»Ja.«
»Warum?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht, weil jeder einfach aus diesem hübschen Städtchen wegfuhr und weil das Leben der Menschen zerstört wurde, obwohl es gar keinen Grund dazu gab.«
»Was passierte, nachdem Ihr Vater zu Ende gelesen hatte?«
Megan zögerte. »Das ist alles.« Sie zuckte mit den Schultern. »Bett kam, holte mich ab, und dann fuhr ich nach Hause.«
»Warum hat die Geschichte einen solchen Eindruck auf Sie gemacht? Wenn Sie meine Meinung hören wollen: Es ist nicht gerade das eindrucksvollste Gleichnis der Welt.«
»Ich weiß nicht. Wahrscheinlich war ich wütend, weil es am Ende doch keine Kindergeschichte war.« Sie spielte mit einem Knopf an ihrer Bluse.
»Das frißt ganz schön an einem, nicht wahr, Megan?«
»Ja, wahrscheinlich.«
»Würde es Ihnen leichter fallen, Ihre Gefühle aufzuschreiben? Das tun viele meiner Patienten. Da liegt Papier.« Sie nahm einige Blätter und legte sie auf die Broschüre, die er ihr als Unterlage hingeschoben hatte. Zögernd nahm Megan einen Kugelschreiber.
Sie starrte auf das Papier. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
»Sagen Sie, was Sie fühlen.«
»Ich weiß nicht, wie ich mich fühle.«
»Doch, das wissen Sie. Denken Sie an Amy. Was fühlten Sie, als sie Ihnen den Freund ausspannte? Was fühlten Sie da?«
Sie blinzelte.
»Kommen Sie schon, Megan. Stellen Sie sich das Schlimmste vor, was Sie überhaupt fühlen können, und dann gehen Sie tiefer. Sie haßten sie, nicht wahr?«
Megan löste die verschränkten Arme und fingerte an der Perlstickerei des Couchkissens herum. »Ich habe es Ihnen doch gesagt. Es hat mir nichts ausgemacht.«
»Hören Sie auf, alles zurückzuhalten. Sie waren doch wütend?«
Sie nickte zögernd.
»Erzählen Sie es mir in Worten.«
»Ja, ich war wütend!« Ihr Unterkiefer zitterte. Sie rang mühsam nach Luft. Eine Welle des Zorns durchzuckte sie.
»Was hätten Sie da am liebsten getan?«
»Ich …«
»Warum halten Sie inne?«
»Ich hätte am liebsten geschrien. Ich wollte sie wiedersehen.«
»Was wollten Sie ihr sagen?«
»Ich hätte am liebsten geschrien: ›Du Miststück! Wie konntest du mir das antun?‹«
»Gut. Schreiben Sie das auf.«
Sie starrte auf das Papier. Es gaffte sie an, ein riesiges, bewölktes Fenster. Ein Ort, von dem sie vielleicht nie zurückkehrte, wenn sie ihn erst einmal betrat.
»Sagen Sie es ihr«, flüsterte Dr. Peters und beugte sich näher heran.
Lange rührte Megan sich nicht von der Stelle. Sie hörte den Atem des Arztes, ihren eigenen. Dann strömten die Worte plötzlich aus ihr heraus, all der Zorn, den sie damals empfunden hatte, als sie Amy und Stevie miteinander flirten sah. Jetzt fiel ihr wieder ein, wie er einfach nicht mehr bei ihr angerufen hatte, wie sie beide bei einem Footballspiel im letzten Herbst gesehen hatte …
Sie reichte ihm mit zitternden Händen das vollgeschriebene Blatt und bebte vor Vergnügen, als sich sein Gesicht aufhellte. »Gut, Megan. Sehr gut. Wundervoll.« Dann zeigte er abrupt wieder auf das Papier. »Und jetzt Ihre Eltern. Nacheinander. Erst Ihre Mutter.« Er flüsterte: »Graben Sie tief.«
»Ich kann nicht denken!«
»Entscheiden Sie sich für eine Sache. Warum sind Sie so wütend auf sie?«
Megan ballte die Faust. »Weil …«
»Warum?«
»Ich weiß nicht. Weil sie … Sie geht mit diesen jungen Männern aus. Es kommt mir vor, als könnte sie sie verhexen.«
»Tatsächlich? Warum macht Sie das wütend?«
»Ich weiß nicht!«
»Ich glaube doch«, gab er zurück.
»Na ja, in Wahrheit ist sie doch nur eine Geschäftsfrau, die mit diesem Waschlappen verlobt ist. Sie ist ganz und gar nicht die Märchenprinzessin, die sie gern wäre.«
»Aber sie tut so, als wäre sie was Exotisches? Warum? Was glauben Sie?«
»Wahrscheinlich, um sich selbst glücklich zu machen. Sie möchte ewig hübsch und jung bleiben. Sie glaubt, daß dieses Arschloch Brad sie glücklich machen wird. Doch das wird er nicht.«
»Denkt sie nur an sich? Ist es das, was Sie sagen wollen?«
»Ja!« rief Megan aus. »Das ist es! Ich bin ihr völlig egal. Sie sollte mich am Sonntagabend anrufen. Sie ging zu Brad ins Haus …«
»Ihrem Verlobten?«
»Ja. Sie ging zu ihm und rief dann nicht an. Ich meine, Bobby war derjenige, der am Montagabend ins Krankenhaus kam, nachdem sie mich von dem Turm runtergeholt hatten. Er ist derjenige, der die Polizei bei Bett anrufen ließ. Es kam mir vor, als wäre ich wieder ein kleines Mädchen. Sie ließ mich damals immer allein.«
»Ganz allein?«
»Nein, mit einem Babysitter. Meist meinem Onkel.«
»Ihrem Onkel?«
»Dem Mann meiner Tante Susan. Wie ich Ihnen schon sagte, ist sie in ihrem ganzen Leben fast immer krank gewesen. Und als ich klein war, verbrachte Bett all ihre Zeit bei ihr im Krankenhaus. Und dann war Onkel Harris mein Babysitter. Er war wirklich nett, aber …«
»Aber Sie haben Ihre Mutter vermißt?«
»Ich wollte, daß sie bei mir ist. Sie sagte, es sei nur für einige Zeit, weil Tante Susan wirklich krank sei. Was heißen sollte, sie stirbt bald. Meine Mutter sagte, sie und Susan stünden sich total nahe, so nahe, wie zwei Menschen einander nur sein könnten. Verstehen Sie, sie sind eineiige Zwillinge.« Megan wischte sich ein paar Tränen aus den Augenwinkeln. »Aber ich habe immerzu gedacht, warum fühlt sie sich ihr so verbunden? Ich wollte, daß sie sich mir so nahe fühlt.«
»Hat er Sie je berührt?« fragte der Arzt behutsam. »Ihr Onkel?«
»O nein, er war nett. Es ist nur so, daß ich lieber meine Mutter oder meinen Vater bei mir gehabt hätte, um mit mir zu spielen oder mir Geschichten vorzulesen. Ich fühlte mich so einsam.«
»Aber Zorn haben Sie sich nicht erlaubt? Warum nicht?«
»Weil meine Mutter etwas Gutes tat. Meine Tante ist eine nette Frau. Ich liebe sie, und sie ist wirklich total krank. Eigentlich bräuchte sie eine Herztransplantation, aber das machen sie bei ihr nicht, weil sie die Operation nicht überleben würde.«
»Was sonst noch?«
»Ich wollte meine Mutter, fühlte mich aber schuldig.«
»Warum?«
»Meine Tante brauchte meine Mutter mehr. Verstehen Sie, Onkel Harris hat sich umgebracht.«
»Ach, wirklich?«
»Meine Tante tat mir leid, aber …« Sie unterdrückte ein Schluchzen.
»Ja? Sprechen Sie weiter, Megan, Sie machen das fabelhaft. Sagen Sie’s.«
»Ich war fast … ich war fast froh, daß er es getan hat. Ich meine, nicht wirklich … Doch ich dachte damals, daß meine Mutter jetzt mehr Zeit mit mir verbringen würde.« Megan weinte. »Meine Tante tat mir so leid, doch ich wollte meine Mutter.« Ihr Gesicht rötete sich und brannte.
»Es gab nur Sie drei? Und Sie erinnern sich, daß Sie sich damals so fühlten?«
»Ich wußte nur, daß ich traurig und einsam war. Ich nehme an, daß mir später die Gründe dafür aufgingen.«
Der Kugelschreiber rollte ihr vom Schoß auf den Fußboden. Er bückte sich und legte ihn mit einem Knall wieder aufs Papier zurück. Sie hielt ihn in zitternden Händen. Ihre Tränen tropften auf das Papier.
»Sagen Sie es ihr«, sagte der Arzt. »Sagen Sie ihr, daß sie egoistisch ist. Sie hat ihre Tochter im Stich gelassen und sich statt dessen um ihre Schwester gekümmert.«
Megan brachte heraus: »Aber das ist egoistisch von mir.«
»Natürlich ist es egoistisch. Sie waren ein Kind, und Kinder dürfen egoistisch sein. Eltern sind dazu da, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erfüllen. Das ist der ganze Sinn des Elterndaseins. Und jetzt sagen Sie ihr, was Sie fühlen.« Er beugte sich vor, drückte ihr die Schulter und sagte mit sanfter Stimme: »Sie machen das gut.«
Sie fühlte sich ganz benommen in der nach Moschus riechenden Feuchtigkeit des kleinen Zimmers – als der Blick seiner verblüffend dunklen Augen sich in ihre bohrte, als sie die Kühle auf der Haut spürte, die ihre Emotionen und die feuchten Kleider ausgelöst hatten; sie spürte ihr Verlangen, ihre Furcht.
Doch am meisten spürte sie ihren Zorn.
Sie beendete den Brief und ließ das Papier zu Boden fallen. Es schwebte in der Luft wie ein blasses Blatt von einem Baum. Der Arzt ignorierte es.
»Und jetzt Ihr Vater.«
Megan erstarrte und schüttelte den Kopf. »Beim nächsten Mal. Bitte.«
»Nein. Jetzt.«
Ihre Bauchmuskeln waren so hart wie ein Brett. Schließlich fragte sie weich: »Warum will er mich nicht sehen? Er hat nicht mal den Versuch gemacht, die Sorgerechtsentscheidung aufheben zu lassen. Ich sehe ihn alle zwei oder drei Monate.«
»Und das macht Sie wütend?«
Ein zitterndes Zögern. »Ja.«
»Sagen Sie es ihm.«
»Ich …«
»Sagen Sie es ihm!«
Sie schrieb. Vergaß Grammatik, Schreibweise, ließ die Gedanken einfach strömen. Schließlich hielt der Kugelschreiber inne.
»Was ist sonst noch, Megan? Was ist es, was Sie mir nicht sagen wollen?«
»Nichts.«
»Oh, was höre ich da? Die Leidenschaft läßt nach. Da stimmt was nicht. Sie halten etwas zurück. Flüsternde Bären. Es hat was mit der Geschichte zu tun. Was?«
»Nichts.«
»Begeben Sie sich dorthin, wo es am meisten weh tut. Und gehen Sie dann noch tiefer.«
Die verrückte Megan erträgt das jetzt nicht mehr. Sie will einfach nur in Ruhe gelassen werden.
Doch der Arzt kam näher. Ihre Knie berührten sich. »Na los doch. Was ist es? Es ist die Geschichte, nicht wahr? Die von den Bären.«
»Nein. Ich weiß nicht, was es ist …«
»Sie wollen es mir erzählen. Sie müssen es mir erzählen.« Er fiel auf die Knie und packte sie an den Schultern. »Berühren Sie den schmerzlichsten Punkt. Berühren Sie ihn! Ihr Vater hat Ihnen die Geschichte vorgelesen. Er kommt zu der letzten Zeile. ›Bären können nicht sprechen.‹ Er legt das Buch zur Seite. Und was passiert dann?«
Megan beugte sich zitternd vor und starrte auf den Fußboden. »Ich gehe nach oben, um zu packen.«
»Ihre Mutter kommt, um Sie abzuholen.«
Die Augen blinzeln, schließen sich schmerzhaft. »Sie ist da. Ich höre den Wagen in der Auffahrt.«
»Sie geht ins Haus. Sie sind oben und Ihre Eltern unten. Sie unterhalten sich?«
»Ja. Sie sagen Dinge, die ich zunächst nicht hören kann. Dann komme ich näher. Ich schleiche mich zum unteren Treppenabsatz hinunter.«
»Sie können sie hören?«
»Ja.«
»Was sagen sie?«
»Ich weiß nicht.«
»Was sagen sie?« Die Stimme des Arztes erfüllte den Raum. »Sagen Sie es mir!«
»Sie sprachen über jemanden, der im Sterben lag, ein Begräbnis.«
ENDE DER LESEPROBE