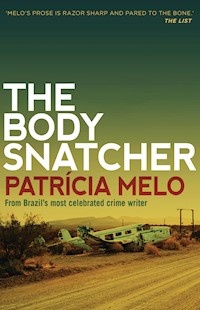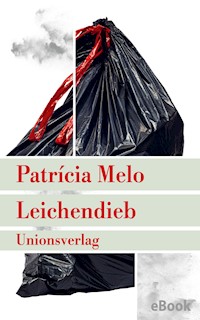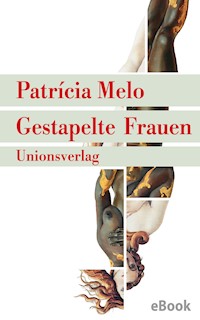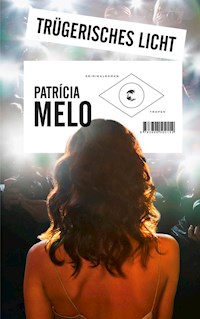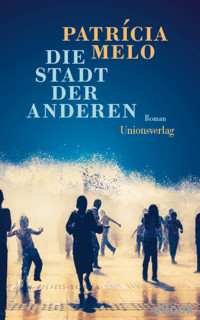
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Glitzernde Pools, kunstvolle Skulpturen und imposante Tore: Sehnsüchtig blickt Chilves auf die luxuriösen Wohnanlagen von São Paulo. Sein eigenes Leben könnte nicht weiter davon entfernt sein: Er findet Unterschlupf auf der Praça da Matriz, ein Ort, wo jene zusammenkommen, die keinen Ort mehr haben. Da ist Jéssica, seine Jéssica, die große Pläne hegt für ihre gemeinsame Zukunft. Da ist der kleine Dido mit seinem Hundewelpen, der Schriftsteller Iraquitan, der sich an der Schönheit seltsamer Worte festhält, oder Farol Baixo, der Lügner. Zwischen behelfsmäßigen Verschlägen und Öltonnen, in einer Welt, in der sich jeder selbst der Nächste ist, entsteht eine unerwartete Gemeinschaft. Patrícia Melo reißt uns mit in eine schmutzig schillernde Metropole und fragt, was uns als Mensch ausmacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Ähnliche
Über dieses Buch
In einem brodelnden São Paulo findet Chilves Zuflucht auf der Praça da Matriz, ein Ort, wo jene zusammenkommen, die keinen Ort mehr haben. Zwischen Verschlägen und Öltonnen, wo sich jeder selbst der Nächste ist, entsteht eine unerwartete Gemeinschaft. Patrícia Melo reißt uns mit in eine gnadenlose Metropole und fragt, was uns als Mensch ausmacht.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Patrícia Melo (*1962) zählt zu den wichtigsten gegenwärtigen Stimmen der brasilianischen Literatur. In ihrem Werk beschäftigt sie sich mit der Gewalt und Kriminalität in Brasiliens Großstädten. Sie wurde u. a. mit dem Deutschen Krimipreis und dem LiBeraturpreis ausgezeichnet. Sie lebt in Lugano.
Zur Webseite von Patrícia Melo.
Barbara Mesquita, geboren 1959 in Bremen, arbeitet u. a. als Literaturübersetzerin für Portugiesisch und Spanisch mit Schwerpunkt auf den lusofonen Ländern Afrikas. Sie hat u. a. Patrícia Melo, Luis Fernando Verissimo, Pepetela und Arménio Vieira übersetzt.
Zur Webseite von Barbara Mesquita.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Patrícia Melo
Die Stadt der Anderen
Roman
Aus dem Portugiesischen von Barbara Mesquita
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 2022 bei LeYa, São Paulo.
Das Zitat aus Victor Hugo, Die Elenden, wurde von G. A. Volchert aus dem Französischen übersetzt.
Originaltitel: Menos que um
© by Patrícia Melo 2022
Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit Literarische Agentur Mertin Inh. Nicole Witt e. K., Frankfurt am Main
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Roberto Armocida (istockphoto)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31177-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 11:58h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE STADT DER ANDEREN
Teil 11 – Es ist neun Minuten nach vier, erklärte der …2 – Farol Baixo, der Lügner, war derjenige gewesen …3 – An diesem Tag entfernte Douglas mit seinen zerschlissenen …4 – Iraquitan, der Schriftsteller, schrieb in sein Heft5 – Auf der Verpackung stand »Mischgewebe, 200-fädig, antiviral«6 – Pititi pototó, ich bin gerade dabei, mir das …7 – Früher, als er mit dem Verkauf von Mango- …8 – Erster Stock, Bett- und Tischwaren. Zweiter Stock …9 – Hubschrauberlärm dröhnte jäh durch die Nacht und übertönte …10 – An diesem Tag schrieb Iraquitan, der Schriftsteller …11 – Farol Baixo sagte: »Einmal, bei der Arbeit …12 – Tock, tock, tock. Jéssica hatte sich auf der …13 – Wie verkauft man ein Produkt, das niemand kaufen …14 – Zombieland: Doppelt hält besser, stand auf dem Filmplakat …15 – Gibst du mir eine Münze?«, fragte Dido die …16 – Efeu hatte die unverputzte graue Wand überwuchert …17 – Die Geschäfte hatten bereits geschlossen, sodass Chilves seinen …Teil 21 – Zum Tätowieren diente eine auf dem Boden der …2 – Sie werden es bereuen, das sage ich Ihnen.« …3 – Wer die Toten sieht, vergisst die Lebenden …4 – Ich trage die Kleidung5 – In seinem Heft der Kategorisierten Worte, das sich …6 – Draußen stritten sich zwei Nutten. Glenda legte das …7 – Handy-Ladegeräte, Masken, Fischgräten, Zahnpastatuben, Zigarettenschachteln, Batterien, alles gebraucht …8 – Nicht, wenn sie mit den Händen aßen …9 – Von dem glühend heißen ölverschmierten Grillblech hinter der …10 – Das System besteht aus einem Haufen Gerichte …11 – Caramba! Schon beim Aussteigen aus dem Bus konnte …12 – Das hier ist Indioney, den kennst du schon …13 – Und wer stand da plötzlich vor Alcides …14 – Einige Monate zuvor, bei seinem ersten Besuch in …15 – Ich rede von 1280 × 960 Pixeln bei …16 – Als Jéssica ihren Schatten am Boden betrachtete …17 – Hinweis für unsere Kunden: Aufgrund der Wiedereinräumung des …Teil 31 – Der Schlamm klebte an den Flip-Flops, bedeckte die …2 – Mit neuer Lockenfrisur, die ihr bis zur Taille …3 – Hierher, hier«, schrie Marreco, als die uniformierten Männer …4 – Abgesehen von den aufgefächerten Büchertreppchen zählte Iraquitan im …5 – Es gibt da ein Lied einer nordamerikanischen Sängerin …6 – Meine Damen und Herren, das große Virusspektakel kann …7 – Bekleidet mit einem rosa Pailletten-Top unter ihrer Jeansjacke …8 – Maria Eduarda, Kerala, Pauline. Um sich auf der …9 – Dicke zurechtgeschnittene, gefaltete und festgeschnürte Plastiktüten in verschiedenen …10 – Iraquitan saß in der schummrigen Hotellobby und blätterte …11 – WO IST GLENDA12 – SSSSSSSS. Als Seno Chacoy die Augen öffnete …13 – Auf der Plastikdecke mit den aufgedruckten Sonnenblumen stand …14 – Alle hier wissen, was ein Frontkomitee ist …15 – Selbst tagsüber war es nicht leicht, durch die …16 – Die Azaleen an der Mauer waren voller violetter …17 – Erleichtert schloss Iraquitan die Tür seines neuen Hauses …DankMehr über dieses Buch
Über Patrícia Melo
Patrícia Melo: »Literatur ist ein Risiko, ein Tauchgang, ein Abenteuer.«
Über Barbara Mesquita
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Patrícia Melo
Zum Thema Lateinamerika
Zum Thema Frau
Für John
»Würde man die Riesenstadt fragen:Was ist denn das für einer?, so würdesie antworten: ›Mein Kleiner.‹«
VICTOR HUGO, Die Elenden
Teil 1
»Und dann tun sie wieder so, als würden sie nicht sehen. Und tun noch im Sterben so, als würden sie nicht sehen. Und tun so, als würden sie sterben, um nicht zu sehen. Und letztlich sehen sie nicht.«
LUÍS CARMELO, Annähernde Sicht
1
Es ist neun Minuten nach vier, erklärte der Moderator, ehe er Selena mit ihrem Song Báilame como si fuera la última vez ankündigte. Taki taki, Taki taki, rumba! Wo-oh, oh, oh … Taki taki, Taki taki.
Der Venezolaner Seno Chacoy schaltete das Radio aus und stieg aus dem Tankwagen mit einem Gefühl, als würde eine Zange ihm die Eingeweide abklemmen.
Der Grund dafür, sein Leistenbruch, pochte, als er zur Hinterseite des Fahrzeugs hinkte, pochte, während er mit dem Entriegeln des Schlauchs kämpfte, pochte, als er Wasser auf das Pflaster der Praça da Matriz und unter die Vordächer und Viadukte des Platzes im Zentrum von São Paulo spritzte, pochte, als er zurück in das Führerhaus des Lastwagens kletterte, und würde weiterpochen, wann immer er beschleunigte oder bremste, als wollte der Schmerz ihn an die Worte des Arztes im Gesundheitszentrum erinnern: Das ist ein Fall für den Chirurgen.
»Sie haben den Typ entlassen, der hier geputzt hat, sie haben den Lagerverwalter entlassen, sie haben die Hauswirtschafterin entlassen, wenn ich Sie wäre, würde ich den Mund halten und weiterarbeiten.« Den guten Rat hatte ihm sein Vorgesetzter in der Firma gegeben, die für die Stadtverwaltung die Reinigung ausführte, als Chacoy die Möglichkeit einer Beurlaubung für die Operation ausgelotet hatte.
Nachdem er das rostige Ventil des hinteren Tanks geöffnet hatte, war das Wasser einer gereizten Anakonda gleich aus dem Schlauch geschossen. Seno Chacoy hatte gesehen, wie es mit voller Wucht auf Flaschen, Dosen, Essensreste, Zigarettenstummel, Lappen und Pappkartons traf und alles in Richtung Bordstein schwemmte, ein Großbeitrag zur Verstopfung der Gullys.
»Spritzen Sie diesen Pennern, diesen Faulenzern und Haitianern und diesen Junkies, die dort herumlungern, das Wasser bloß nicht direkt ins Gesicht«, hatte der Chef ihn in den ersten Arbeitstagen angewiesen. »Sonst kommen morgen die Menschenrechtsaktivisten mit ihren Petitionen hier an, und wir sind die Angeschmierten. Das Geheimnis besteht darin, das Handgelenk beim Reinigen leicht anzuwinkeln. So durchnässt der Schlauch nur ihre Pappen, Taschen und Karren. Das ist eine Frage der Volksgesundheit«, hatte er hinter vorgehaltener Hand zu ihm gesagt. »So entstehen nämlich heutzutage die Seuchen, sie springen von Affen, Fledermäusen und Kamelen auf den Menschen über. Und dieses Gesindel, das mit Hunden, Ratten und Kakerlaken zusammen schläft, überträgt sie letztlich genauso wie die Tiere. Schlimmer als die Chinesen. Ein echter Nährboden für neue Varianten.«
Seno Chacoy gefiel der Gedanke, dass er lediglich Befehle ausführte. Er verspürte nicht einmal mehr Mitleid, wenn er diese aschfahlen Menschen verstört von dem Wasser, das ihre Habseligkeiten aufweichte, aufwachen sah.
Manche Portiers und Hausmeister schauten dem Spektakel nur zu, andere nutzten die Gelegenheit, um ihrem Ärger Luft zu machen.
»Wir haben eine Yakult-Pfeife vor unserer Tür gefunden.«
»Sie kacken bei mir auf den Bürgersteig!«
»Hier, eine Spritze!«
Nichts von alledem kam Chacoy übertrieben vor, hatte er selbst doch, als er vor nicht allzu langer Zeit unter einem Vordach etwas herauszog, das ihm eine uralte, verdreckte, von Ratten zerfressene Isomatte zu sein schien, feststellen müssen, dass es sich in Wirklichkeit um einen Menschen handelte. Er hatte ihn sogar mit dem Fuß angetippt, weil er dachte, er würde schlafen. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er tot war.
Taki taki, Wo-oh, oh-oh, Báilame como si fuera la última vez, trällerte er, als er den Schlauch wieder einholte und zum Führerhaus des Lastwagens zurückhinkte.
Er hatte nicht bemerkt, dass er fotografiert worden war. Taki taki, Taki taki, ¡rumba! …
2
Farol Baixo, der Lügner, war derjenige gewesen, der seinem schwarzen Kumpel Chilves den Trick mit der Unsichtbarkeit verraten hatte: wie man die Swiss Life Residence betrat, ohne gesehen zu werden oder die Rezeption passieren zu müssen. Es sei gar nicht so kompliziert, hatte sein Freund ihm damals gesagt, »man muss nur tierisch weit laufen«. Dann an der Straße nach Boissunga das Häuschen der Bushaltestelle finden, an dessen metallene Seitenwand jemand geschmiert hatte: Nimm Drogen, bring deine Familie um, friss Scheiße, wähl den Präsidenten wieder. Von dort aus musste man nur noch über den Gitterzaun klettern, der das an die Wohnanlage angrenzende Waldreservat umgab. Da der Wald umzäunt war, vermittelte er den Anwohnern ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit, bot Dieben und Einbrechern aber eine günstige Gelegenheit. Die größte Schwierigkeit bestand darin, die hinter einem Bambusgehölz verborgene Mauer zu erklimmen, doch nun war er oben und passte auf, dass sich die Dreadlocks seiner gewaltigen Mähne nicht in dem Bambus verhedderten. Schließlich hockte Chilves sich vorsichtig auf die Mauer und bedeutete Jéssica, die direkt hinter ihm hochgeklettert war, es ihm gleichzutun. Er brannte darauf, seiner Freundin zu erzählen, was er bei früheren Besuchen über den Ort in Erfahrung gebracht hatte. Als sie sich voller Angst, hinunterzufallen, neben ihn gesetzt hatte, schob Chilves das Bambusdickicht vor ihnen mit seinen kräftigen Armen einen Spalt weit auseinander.
Von hier aus gesehen schienen die sieben Villen der Swiss Life Residence nicht zu einer Wohnanlage zu gehören. In den weitläufigen, von Rhododendren, Glyzinien und Azaleen bewachsenen Gartenanlagen, die sie voneinander trennten, hätte man sogar noch ein paar Fußballfelder oder Tenniscourts unterbringen können. Platzmangel herrschte jedenfalls nicht.
Auf die Villen deutend, zählte Chilves: »Zwei, drei, vier, fünf der Häuser stehen leer. Hab ich es nicht gesagt?«
Das Mädchen mit dem wachen Blick und dem kurzen, schiefen Pony, der sie jünger als vierzehn Jahre aussehen ließ, war mehr von den glänzenden Details des Ensembles beeindruckt, von dem Gold der Tore, dem Stahl und dem Metall der Skulpturen, aber auch von den blühenden Ipê-Bäumen, die die Gehwege mit gelben Blütenblättern übersät hatten.
»Farol Baixo hat nicht gelogen«, fuhr Chilves fort. »Die Reichen flüchten gerade aus der Stadt.«
Farol Baixo erzählte andauernd irgendwelchen Mist, eines Tages habe ihn eine Frau auf dem Platz ernsthaft gefragt, ob er ihren Mann für zweihundert Real umbringen könne. Er kenne einen »echten« Abgeordneten. Und er habe Geld auf der Bank, es sei allerdings wegen Steuerschulden eingefroren, und sein kaputtes Auge sei das Ergebnis eines Unfalls mit einer Harley-Davidson. Jéssica glaubte ihm kein Wort, aber dann waren hier die Swimmingpools, die Paläste und der Hubschrauberlandeplatz, die er so genau beschrieben hatte. Was trotzdem überraschend war. Denn auf der Straße sagte niemand die Wahrheit, das wusste sie. Es war fast wie eine Sucht: Man lernte zu lügen, warum man auf der Praça da Matriz lebte, man log über sein Alter, log über seinen Vater, seine Mutter, und dann fing man an, auch über den ganzen Rest Lügengeschichten zu erzählen. Und selbst die schweigsamsten Typen wie Chilves kamen plötzlich mit einem sehr merkwürdigen Text daher. Die ganzen Besuche in dieser Wohnanlage, das ganze Generve, dass sie sich diese Villen unbedingt aus der Nähe ansehen sollte, brachten sie auf den Gedanken, dass Chilves vielleicht einen Einbruch plante, und wenn er das tat, verdammt, dann wollte sie davon nichts wissen. Die Schilder standen überall. Vorsicht. Kein Eintritt. Ausweis vorzeigen. Privatgelände. Zutritt verboten. Bissiger Hund. Elektrischer Zaun. Konnte er nicht lesen? Selbst wenn einige Häuser leer standen, gab es dort eine Kamera. Da noch eine. Wenn er klauen wollte, bitte schön, auf sie konnte er nicht zählen. Ihre Pläne sahen anders aus. Sie fand es super, Glenda beim Wohnungenputzen im Stadtzentrum zu helfen. Und das bedeutete nicht, dass sie ein Dienstmädchen war. Wie ihre Urgroßmutter. Und ihre Großmutter. Wie ihre Mutter, die, bevor alles schieflief, im Haus einer Familie gekocht hatte. Jetzt hieß das »Angestellte«. Und Jéssica würde all diese Bäder und Küchen schrubben, bis die Fliesen bluteten, und die Damen des Hauses würden so zufrieden sein, dass sie sie bald engagierten, als Angestellte. Wie Glenda. Sie hatte sich schon alles ausgemalt: Mit dem Geld würde sie sich die verlorenen Papiere wiederbesorgen. Personalausweis und so. Und das Arbeitsnachweisheft. Und wenn es unterschrieben wäre, würde sie eine Baracke mieten. Und wenn alles so wäre, wie sie es sich erträumt hatte, würde sie ihre Mutter suchen. Das hatte sie ihrem Freund aber nicht erzählt. Sie wollte nicht, dass Chilves sie für eine Lügnerin hielt wie Farol Baixo oder all die Leute von der Platte, die behaupteten, ihre Mutter sei dies, ihre Mutter sei jenes, obwohl sie in Wirklichkeit gar keine Mutter hatten. Oder sie hatten eine, aber eine Rabenmutter. Eine Prostituierte. Eine Drogenabhängige. Ihre Mutter war anders. Eine echte Mutter, an die sie sich stets voller Trauer erinnerte, wie sie bei der Totenwache um ihr anderes Kind, ihren Sohn, geweint hatte. Und es nützte auch nichts, dass Chilves sie hierher mitgenommen hatte, um sich den ganzen Reichtum anzuschauen. Sie würde niemanden überfallen. Wenn sie sich etwas geschworen hatte, dann das: Sie würde nicht noch eine sein, die jung starb.
»Willst du das Haus sehen, in dem Farol Baixo gearbeitet hat?«, fragte Chilves.
Ja, das wollte sie allerdings. Wenn alles, was Farol erzählt hatte, stimmte, dann wahrscheinlich auch die Geschichte von Dona Elisa, der Hausherrin, die so weiß war, dass sie aussah wie die Blondine aus den Schauergeschichten, die die Menschen im Bad erschreckt, und von ihrem Mann, dem Amerikaner, der über seine eigene Zunge stolperte, wenn er nur Guten Morgen sagte, und von dem Tag, an dem er vom Gringo gefeuert worden war, nachdem der Farol Baixo betrunken in der Garage gefunden hatte, und das Abgefahrenste war, hatte Farol Baixo gesagt und sich dabei vor Lachen gebogen: Er hatte gar nicht kapiert, dass er entlassen worden war und hatte vor dem Gringo gestanden, den Dummen gespielt und ständig wiederholt: »Sehr erfreut!«
Chilves stand behände auf, seine schwarze Haut glänzte vom Schweiß. Es war nicht das erste oder zweite und auch nicht das dritte oder vierte Mal, dass er hier heraufgeklettert war, er kannte jeden Zentimeter dieser Mauer, er lief darauf entlang, den Bambus beiseiteschiebend, die Freundin an der Hand, setz deinen Fuß hierhin, sagte er, auf diesem Stück musst du dich bücken, sonst kann man dich sehen, er liebte dieses Programm, und wenn er jemanden vom Platz mit hierherlotsen konnte, umso besser, aber auch allein machte er es sich gerne irgendwo inmitten des Taquara-Dickichts bequem und sah den wenigen noch verbliebenen Anwohnern bei ihren täglichen Verrichtungen zu, den immer saumseligeren Sicherheitsleuten, der schwindenden Wachsamkeit im Wächterhäuschen, ohne erklären zu können, was ihn so anzog. Vielleicht war es die Idee, in einen Hubschrauber zu steigen. Zumindest am Anfang war es das gewesen. Als Farol Baixo ihm von dem Hubschrauberlandeplatz erzählte, dachte er, er könnte vielleicht von der Mauer herunterspringen und das geparkte Flugzeug aus der Nähe betrachten.
Ein blaues Flugzeug mit abgebrochenem Flügel, das seine Mutter auf der Müllhalde gefunden hatte, war jahrelang sein einziges Spielzeug gewesen. Selbst noch als Erwachsener war er ganz erpicht auf alles, was fliegen konnte. Raketen und Ähnliches. Er hatte enormen Respekt davor. Federn zu haben und mit den Flügeln schlagen zu können, war eine tolle Sache. Aber eine Maschine aus Stahl zu fliegen, das war heldenhaft. Dazu gehört eine Menge Können. Gerne wäre er Pilot geworden. Manchmal, wenn er Platte machte und seinem kleinen Radio lauschte, stellte er sich vor, wie er auf dem Pilotensitz saß, den Gehörschutz auf den Ohren, die sich über seinem Kopf drehenden Propeller, die die Stadt unter ihm in Unruhe versetzten, das Gefühl von Dringlichkeit, all der Lärm, und dann würde er über das Bataillon der Schutzpolizei, der Guarda Metropolitana, hinwegfliegen, über dasselbe, das von Zeit zu Zeit die Praça da Matriz stürmte und auf die Bewohner der Straße eintrat und einschlug, und in seinem Hubschrauber würde er abwarten, bis die Ratten anfingen zu singen, eh eh eh eh ah, ich ziele auf den Kopf und schieße, um zu töten, eh eh eh eh ah, und fehlt die Munition, dann hagelts auf die Klöten, und genau in dem Moment würde er die Klappe für das Maschinengewehr öffnen, und das wäre es dann gewesen mit dem Bataillon. Er hatte große Lust, durch die Gegend zu laufen und um sich zu schießen, es gab einen Haufen Leute, die erledigt werden mussten, all jene, die wegschauten, die sie ignorierten oder voller Ekel anblickten, die hupten, die schimpften, während er mit seinem Karren auf der Straße Pappe und Dosen sammelte, es würde nicht an Kugeln für alle mangeln. Kugeln auch für den Hinkefuß vom Tankwagen, der an jenem Morgen seine Kleider und die aller, die unter dem Vordach der Banco do Brasil schliefen, durchnässt hatte. Kugeln für den Bürgermeister, der die Kirchen einzäunte. Kugeln für die Portiers und Ladenbesitzer, die heißes Öl auf die Bürgersteige kippten, damit man dort nicht übernachten konnte. Kugeln für die Playboys, die sich einen Spaß daraus machten, ihnen auf den Kopf zu pinkeln, wenn sie auf dem Bürgersteig schliefen.
Diese Gedanken gingen Chilves durch den Kopf, als sie schließlich das nördliche Ende der Wohnanlage erreichten, von dem aus man die Villa Nummer sieben beobachten konnte.
Dort war die Mauer etwas höher und breiter und zudem stärker zugewuchert. Chilves musste mit dem Bambus kämpfen, um seiner Freundin den Weg zu bahnen. Er bat sie immer wieder, nicht nach unten zu schauen, damit ihr nicht schwindlig wurde.
Nachdem sie es sich an einem sicheren Platz bequem gemacht hatten, drückte er die Bambusstangen auseinander, und Jéssica konnte den riesigen Swimmingpool mit einer schwimmenden Insel darin sehen, genau wie Farol Baixo es beschrieben hatte.
»Waaaahnsinn!«, rief sie und schlug die Hände vor den Mund.
»Weißt du, wie viel Wasser sie brauchen, um diesen Pool zu füllen?«, fragte Chilves. »Farol Baixo hat es mir gesagt«, fuhr er fort. »Fünf Millionen Liter.«
Fünf Millionen überstieg Jéssicas Vorstellungsvermögen. Was sie gerne verstanden hätte: Warum verließen die Leute dieses Paradies?
»Aus Angst«, antwortete Chilves.
Schweigend blickten die beiden auf die blaue Weite. Das Mädchen hoffte, Dona Elisa oder ihre halbwüchsigen Töchter zu Gesicht zu bekommen, die Farol Baixo zufolge so schön waren, dass sie Schauspielerinnen hätten sein können. Im Bikini. Mit Hut und Sonnenbrille. Noch schöner wäre es, wenn sie hören könnte, was sie sagten. Das, ja, das wäre gut, um aus der Nähe zu sehen, wie diese Leute lebten.
Aber es erschien niemand, und sie begann, sich zu langweilen.
»Gehen wir?«, fragte Jéssica. Sie hatte keine Ahnung, wie sie von dort oben herunterkommen sollte.
Chilves antwortete nicht. Er starrte weiter auf die schwimmende Insel und dachte immer noch an die Zahl, fünf Millionen. Jedes Mal, wenn er die Swiss Life Residence besuchte, beschlich ihn ein seltsames Gefühl. Als ob dieser Ort in ihm den unbändigen Wunsch weckte, etwas anderes zu machen. Er wusste nur nicht, was.
3
An diesem Tag entfernte Douglas mit seinen zerschlissenen Handschuhen den Teufelszwirn, der die Bäume in der Mitte des Piedade-Friedhofs überwucherte. Er hatte bereits einen Spitznamen für den Schmarotzer erfunden: gelber Würger. Eine Art Psychopath des Pflanzenreichs, eine miese kleine, ordinäre Spezies, unfähig, ihr eigenes Chlorophyll zu produzieren. Es gab kein Herbizid, kein Gift, das ihr den Garaus machte. Die Lösung bestand darin, die Arbeit mithilfe eines Unkrautstechers zu beginnen, die mörderischen fadenförmigen Stängel zu durchtrennen und dann mit den Händen die erstickten Äste zu befreien.
Ab und an blickte er auf und schaute kurz hinüber zu dem neuen Bereich des Friedhofs, einem riesigen, rasenlosen, ungepflasterten Areal ohne einen einzigen Baum, mit nichts als Gräbern, die in erschreckendem Tempo ausgehoben und zugeschaufelt wurden, und mit Hunderten von in den Lehm gerammten handgefertigten Kreuzen schlechtester Qualität. Bei dem trostlosen Anblick war er beinahe dankbar dafür, sich auf der Seite zu befinden, die die Arbeiter jetzt als den »alten Friedhof« oder den »guten Teil« von Piedade bezeichneten.
Dank der Vereinbarung, die ihn nach seiner Rückkehr aus einer erschöpfungsbedingten Krankschreibung von der anderen Seite erlöst hatte, war er vorübergehend verantwortlich für das Zementlager, die Müllabfuhr, das Streichen von allem, was gestrichen werden musste, und die Sanierung der inzwischen von dichtem Gestrüpp verunstalteten Grünanlagen. Es war Arbeit für vier Männer, aber unter den gegebenen Umständen betrachtete Douglas sie auch ohne irgendeine Art von Hilfe als Belohnung für die zwölf Jahre, die er auf dem Friedhof beschäftigt war.
Während er fortfuhr, den Schmarotzer zu zerschneiden, musste er wieder daran denken, dass es gerade sein gärtnerisches Talent gewesen war, das ihm zu dieser Arbeitsstelle verholfen hatte. Er war schon immer gerne in der Natur gewesen und mit Pflanzen umgegangen, sogar den Geruch des warmen Kuhmists, mit dem er als Kind die Felder der Familie gedüngt hatte, mochte er. Aber für jemanden, der nur bis zur sechsten Klasse die Schule besucht hat, ist das Leben schwer. Plötzlich verliert der Vater den Hof, man zieht in die Stadt, wird auf alle möglichen Arten und Weisen fertig gemacht, eins kommt zum anderen, und schon ist man, ehe man sich’s versieht, Totengräber. Als er nun ein paar auf die Schnelle angeheuerte Jungs, die auf der anderen Seite des Friedhofs Gräber aushoben, sagen hörte, es sei ja nur ein Gelegenheitsjob, den sie da machten, wollte er nicht derjenige sein, der ihnen erklärte, dass man so in diesem Gewerbe landete. Man hatte die Wahl zwischen Arbeitslosigkeit und dem Begraben von Toten.
Gegen Mittag räumte er das Werkzeug zusammen, und während er es in seiner Tasche verstaute, sah er einen Hund über eine der Alleen im hinteren Teil des Friedhofs laufen. Er ließ alles stehen und liegen und ging dem Tier hinterher. Es gab Dutzende streunender Hunde in dem Viertel, und wenn er schon nichts tun konnte, um ihnen zu helfen, so versuchte er wenigstens, sie von dort zu verscheuchen, ehe sie von anderen Angestellten misshandelt wurden.
Als er beim Verfolgen des Tieres in den dritten Querweg einbog, stieß er plötzlich auf etwas, das wie ein Bankett für die Orixás aussah. Auf einem Grab standen wie auf einem Esstisch Schnaps, Kerzen und ein verschlossenes Gefäß. Und direkt neben der Steinplatte lag eine speckige Decke, aus der unversehens das zerzauste Haar einer mageren schwarzen Frau mit zwei großen, verstörenden Augen auftauchte.
Er erschrak. Die Frau stand ohne Hast auf und streichelte bereits den Hund, der in Begleitung eines weiteren kleineren hinter einem Grabstein hervorkam.
Es war Douglas unangenehm, der alten Frau in ihrer Lage erklären zu müssen, dass es verboten war, auf dem Friedhof zu schlafen. »Sie könnten von Ratten und Skorpionen gebissen werden, es gibt hier jede Menge Ungeziefer«, sagte er. Geistesabwesend faltete die Frau die Decke zusammen und murmelte etwas, von dem Douglas nur Bruchstücke verstand: »Da sind Steine, da ist ein Knüppel, da ist Lehm, da sind Nägel«, flüsterte sie vor sich hin, während sie ihre rings um das Grab verteilten Habseligkeiten einsammelte, zwischen denen Douglas nun einen Strandstuhl, einen Topf mit Reis, einen kleinen Teppich und alle möglichen anderen Dinge erblickte, die die Schwarze in ihren Taschen verstaute.
Er hatte schon Betrunkene, Graffiti-Sprayer und Junkies von dort fortgejagt, er war es gewohnt, bei seinen Gängen auf Alkoholflaschen und Spritzen zu stoßen, er hatte schon viele Opfergaben für Exu eingesammelt, von Hähnchen und Farofa bis zu Popcorn und Palmöl. Aber es war das erste Mal, dass er einen Petroleumkocher und Gläser mit Zwiebel- und Knoblauchresten sah, die sie im umliegenden Gebüsch versteckte, als würde sie Töpfe in den Schrank stellen.
Wenig später spürte er, wie sich ihm das Herz zusammenschnürte, als er sie in Richtung Ausgang gehen sah, eine Tasche auf dem Kopf, eine weitere auf dem Rücken, den Strandstuhl über die Schulter gehängt, die Hunde hinter ihr hertrottend. Zusammen boten sie ein Bild von erschreckendem Elend.
»Die Dose«, rief er. Er meinte damit den Kocher, den sie dort zurückgelassen hatte und den er würde wegwerfen müssen.
Abends im Bett geisterte ihm der Name João Henrique Firmino, der auf dem Grabstein stand, bei dem die Frau ihr Lager aufgeschlagen hatte, noch immer im Kopf herum, rührte an irgendetwas in den Tiefen seiner Erinnerung.
Die alte Frau ging ihm nicht aus dem Sinn.
»Kannst du dir vorstellen, dass sie da lebt?«, fragte Douglas seine Frau, als sie sich neben ihn gelegt hatte. Beim Abendessen hatten sie über die Sache gesprochen.
»Wahrscheinlich lebt man unter den Toten sowieso besser als unter den Lebenden«, erwiderte seine Frau desinteressiert und löschte das Licht.
Am darauffolgenden Sonntag in der Kirche dachte Douglas noch immer an die alte Frau auf dem Friedhof.
Padre Orestes predigte von der Kanzel herab: »Bei Lukas, Kapitel 6, Vers 20 steht: ›Selig seid ihr Armen; denn das Reich Gottes ist euer.‹ Ich frage also: Warum hat Gott sein Reich den Armen vorbehalten? Sind die Armen besser als die Reichen? Sind die Armen menschlicher als die Reichen? Warum steht hier in der Bibel nicht geschrieben, dass Gott sein Reich den Guten vorbehalten hat, denjenigen, die Reinheit und Wahrheit im Herzen tragen? Oder den Heiligen? Den Bescheidenen? Wäre das nicht logischer, da Gott sich nicht um unseren Kontostand schert? Doch die von Gott für das Maisonette-Penthouse im Paradies auserwählte Gruppe wird in der Bibel unzählige Male und klar und deutlich benannt: die Armen.«
Nach einer Kunstpause fuhr er fort: »Will mir irgendjemand sagen, dass der Reiche keinen Glauben hat? Natürlich hat er das. Meiner Meinung nach ist es sogar einfacher, an Gott zu glauben, wenn die Taschen voll sind. Ich habe ein Haus, ich bin Zahnarzt, ich habe ein großes Auto, habe einen Sohn, der auf eine Privatschule geht, habe eine Krankenversicherung. Wie sollte ich da an der Existenz eines sorgenden Vaters zweifeln? Daher frage ich euch, meine Freunde: Wie steht es um den Glauben in der Stunde der Prüfung?«
Wenn eine verirrte Kugel den Sohn tötete. Wenn der Krebs die Frau dahinraffte. Wenn man arbeitslos wurde. Wenn das Haus von einer Überschwemmung zerstört wurde. Wenn der Kühlschrank leer war. Das war es, worüber Padre Orestes sprach. Über den Glauben, der im Moment der Verzweiflung schwindet. Meine Prüfung, dachte Douglas, hat auch einen Namen: Massenbestattungen. Es gab so viele Leichen, dass die Stadtverwaltung einen Bagger zum Aufbrechen des Bodens und zum Ausheben der Gräber bereitzustellen gezwungen war. An einem einzigen Tag hatte allein er siebenundachtzig Menschen beerdigt. Als er seine Tage damit verbrachte, Gräber zuzuschaufeln, während sich schon Schlangen für die nächsten Beerdigungen gebildet hatten, war der Moment gekommen, in dem sein Glaube einen Kurzschluss erlitt.
Douglas folgerte daraus, dass bei der Abendpredigt die Rolle ausgeklammert worden war, die ihm zukam: die des Armen, der bei der Prüfung durchfällt. Die Wahrheit war, dass er den Glauben der Armen, den der Pfarrer lobgepriesen hatte, nicht mehr spürte. Er ging allwöchentlich mit seiner Frau Regiana in die Messe und las gelegentlich in der Bibel, aber er glaubte nicht mehr an Gott.
Als sie nach Hause kamen, bat Douglas seine halbwüchsige Tochter Dannielly, ihm bei einer Internetrecherche zu helfen.
»Ist es der hier?«, fragte das Mädchen und deutete auf das Bild von João Henrique Firmino auf dem Bildschirm.
Da Douglas nicht mit dem Computer umgehen konnte, musste Danny ihm helfen, die verschiedenen Berichte über den fünfzehnjährigen Jungen zu überfliegen, der bei einer Polizeiaktion getötet worden war. Der Fall hatte durch den Aufstand der Menschen aus João Henriques Viertel und vor allem durch die Anzeigen der Mutter große Resonanz gefunden. Ihr Name war Zélia Firmino. Douglas betrachtete einige Augenblicke lang stumm die Bilder und konnte kaum glauben, dass es sich um dieselbe Frau handelte, die er am Vortag schlafend auf dem Friedhof angetroffen hatte. Jetzt wirkten ihre Augen kleiner, eingesunken in ihrem verhärmten Gesicht. Ihr Körper bestand nur noch aus Haut und Knochen. Diese sogenannte Prüfung Gottes bereitete nicht nur dem Glauben ein Ende, dachte er. Auch das Fleisch ging dabei den Bach hinunter.
4
Iraquitan, der Schriftsteller, schrieb in sein Heft:
Regeln der Casa Nova Família Cristã, des Heims der Neuen Christlichen Familie:
alle Regeln des Hauses befolgen,
nicht rauchen (hart),
nicht trinken (traurig),
keine Drogen nehmen,
um 6 Uhr morgens aufstehen,
um 6:30 Uhr frühstücken (Kaffee mit Brot, Kaffee mit Brot),
am Morgengebet teilnehmen, auch wenn du Atheist bist oder eine andere Religion praktizierst (auweia),
sich an den zu erledigenden Arbeiten beteiligen: Putzdienst, Gemüsegarten, Küche oder Wäscherei,
Mittagessen um 11:30 Uhr,
Nachmittagsimbiss um 15:30 Uhr (Kaffee mit Brot, Kaffee mit Brot),
Teilnahme am Abendgebet,
Abendessen um 19 Uhr,
Freizeit bis 21 Uhr,
Schlafengehen um 22 Uhr.
Und keine Slangsprache verwenden (was geht ab, Bro, Chicks, Bitches usw.), keine Kraftausdrücke benutzen (Dreckscheiße, ich fick dein Leben, Wichser, Schwanzlutscher), jeden Tag duschen (in fünf Minuten), nach den Hauptmahlzeiten die Zähne putzen, zwischen achtzehn und sechs Uhr morgens das Haus nicht verlassen, keinen Streit mit den Angestellten anzetteln, sich nicht wegen Kleinigkeiten wie der Wahl der Fernsehkanäle streiten (Fußball X Telenovela X Nachrichten X irgendwas) und immer schön Danke sagen. Danke, danke, danke.
Es gefiel ihm überhaupt nicht, die Vorschriften dieses Hauses in sein Heft der schönen Worte zu schreiben. Für sein Empfinden verschmutzten sie seine Liste von Ausdrücken voller natürlicher Poesie wie Wirbel wogend wallen Wachtturm Sultanine Saum Quadratur oder Arabien. Die Terminologie der Vorschriften, so stellte er fest, war eine andere. Sie steckten voller übellauniger Worte (verboten) oder waren wie aus Zellophan, fade (Gefallen, Anordnung), hatten nichts von der poetischen Suggestivkraft eines wölfisch Verbrämung Jasmin oder unbefleckt. »Keine Kraftausdrücke benutzen« waren zum Beispiel drei Wörter, die nicht auf derselben Seite stehen sollten wie Ultramarin Blau Türkis Saphir Schwimmbadblau Unermesslichkeit Lyriker. Auch das Gebot »Keine Slangsprache verwenden« hatte es nicht verdient, neben dem Federkleid zu stehen. Oder neben der Galerie. Der Sommerfrische. Seiner Meinung nach gehörten sie nicht zur selben Spezies. Sie verschandelten die Schönheit seiner Sammlung. Sie störten seine Übung in möglicher Schönheit, »dem Schönen in meiner Reichweite«, das nur die Sprache bot. Er schrieb diese abgeschmackten, dehydrierten und schiefen Begriffe (Abendessen, Frühstück, Kraftausdrücke) aus der Hausordnung des Heims der Neuen Christlichen Familie nur deshalb auf, weil er sich seit seiner Ankunft vier Tage zuvor desorientiert fühlte.
»Das ist ganz normal«, sagte Emílio zu ihm, der Mann, der ihn auf der Praça da Matriz aufgelesen hatte und der einer der Verantwortlichen der Einrichtung war. »Dort draußen führt ihr ein lockeres Leben, ihr arbeitet nicht, trinkt, die Leute geben euch Almosen, die Restaurants verpflegen euch, manche Leute schenken euch Kleider und Schuhe, die Stadtverwaltung verteilt Decken, die Bürger bringen Boxen mit warmem Essen, Hygienesets, ihr bekommt alles auf dem Silbertablett serviert, kostenlos, ihr seid frei, habt keine Pflichten, zahlt keine Steuern, kümmert euch nicht um eure Kinder, müsst nichts abbezahlen, habt keine Papiere, kein Haus, ihr habt nichts als Freiheit, und so viel Freiheit ist der Weg, der direkt in die Sucht führt. Andere Gründe, weshalb ihr Alkoholiker, Diebe, Crack-Süchtige, alleinerziehende Mütter, Penner oder Prostituierte werdet, gibt es nicht. Wie könnt ihr wieder in die Gesellschaft integriert werden? Wir haben das Zauberwort: Mit Regeln. Und merk dir eins: Regeln gibt es hier nicht, weil wir sie mögen«, sagte Emílio. »Regeln sind selbst in der Natur wichtig. Alles in der Natur folgt der himmlischen Ordnung. Du bist zur Schule gegangen, bist ein intelligenter Mensch und weißt das. Du musst dir die Regeln wie einen Stacheldrahtzaun vorstellen, einen moralischen Zaun, der uns vor den Lastern dort draußen schützt: vor Drogen, Alkohol, Crack, vor schlechten Einflüssen, Gewalt und niederen Instinkten. Wenn du unsere Regeln befolgst, wirst du zur Herde des Herrn zurückkehren. In die Gesellschaft. Hier werden wir dich darauf vorbereiten, wieder ein christlicher Bürger zu sein.«
Der Schriftsteller, der dort nicht Schriftsteller genannt wurde, wollte kein christlicher Bürger sein. Die Garantie, seine Bürgerrechte ausüben zu können, hätte ihn schon zufriedengestellt. Und wenn er in seinem Leben als Bürger je das Bedürfnis haben sollte, einen Gott anzurufen, dann, so viel wusste er, wäre es der Gott seiner Mutter, der Gott seiner Heimat, der viele Namen hatte, Bará, Ibarabo, Legbá, Elegbara, Eleggua, Akésan, Igèlù, Yangí, Ònan, Lállú, Tiriri, Ijèlú, der aber nur ein Einziger war: Esu, Eshu, Exu. Seinetwegen hatte seine Mutter ihn oft mit einer Zubereitung aus gerösteten Augenbohnen, gewürzt mit gemahlenen Lorbeerblättern und zerriebener weißer Pemba-Kreide, zu einer Kreuzung mitgenommen, und während sie Hand in Hand mit ihm immer weitergelaufen war, stets nach vorne schauend, hatte sie eine Handvoll dieser Mischung nach der anderen hinter sich geworfen und dazu axé, axé, axé gesungen, um die Wege zu öffnen.
Viele Jahre lang hatte der Schriftsteller um Heime wie dieses einen großen Bogen gemacht, weil er wusste, dass in den meisten davon keine Hunde erlaubt waren, und er konnte sich ein Leben ohne Belinha, die Hündin, die er vor einer Rattenattacke gerettet hatte, kaum vorstellen. Erst nachdem Belinha, schon sehr alt, mit dem Köpfchen in seinem Schoß ihr Leben ausgehaucht hatte, erst nachdem er den kleinen Leichnam mit dem goldenen Fell im Park der Praça da Matriz begraben hatte, war der Schriftsteller in das geraten, was er als die »Falle der Sozialhotels« bezeichnete. Aus dem ersten war er um fünf Uhr morgens von den Angestellten hinausgeworfen worden, deren hektisches Drängen er bis dahin nur von Vorarbeitern und Produktionsleitern großer Fabriken kannte. Du bist aufgewacht, hatte er einmal zu Beto Senador gesagt, und noch während du in dem nach Desinfektionsmittel stinkenden Speisesaal gefrühstückt hast, liefen die Angestellten bereits zwischen den Tischen herum und brüllten »Raus! Aber schnell!«. In einem anderen hatten die Sozialarbeiter die ganze Zeit versucht, den Leuten das Gehirn zu waschen und sie dazu zu überreden, ein Busticket zurück in die Stadt anzunehmen, in der sie geboren worden waren. Dann hatte es noch eines mit völlig verwanzten Betten gegeben, dessen »Genesungsprogramm« er wirklich nicht verstehen konnte. Ein Beispiel: Alle Heiminsassen sollten sich zu einem Spiel im Kreis auf den Boden setzen, und jeder sollte den Namen eines Tieres sagen, den die anderen sich merken und wiederholen mussten. Wie, hatte er sich gefragt, sollte eine derartige Beschäftigung jemandem helfen, der auf der Straße lebte?
Der Schriftsteller wusste, dass er es bereuen würde, das Angebot der Neuen Christlichen Familie angenommen zu haben, aber an dem Tag, an dem er aufgelesen worden war, hatte es so stark geregnet, und er war so durchnässt gewesen, er hatte sich so schwach gefühlt und so gefroren, seine Füße waren vom Herumlaufen so wund gewesen, dass er nicht in der Lage war, sich Chilves’ Clique anzuschließen oder den Bauzaun rings um den stillgelegten Busbahnhof einzureißen, um einen trockenen Platz zum Schlafen zu finden.
In den ersten beiden Tagen blieb er die ganze Zeit liegen, studierte die Regeln, versuchte, sie zu befolgen, und als er eine leichte Besserung der Wunden an seinen Füßen verspürte, dachte er sogar, dass die ganze Struktur um ihn herum letztlich doch mehr Unterstützung als Kontrolle war.
An einem verregneten Morgen rief Emílio ihn nach dem Gebet zu sich.
»Du siehst gut aus. Wie ich sehe, ist die Ruhe dir bekommen. Aber ab jetzt wird hier gearbeitet.«
Für Iraquitan war die Bemerkung ein Witz. Fast alle, die auf der Straße lebten, taten nichts anderes als arbeiten, um etwas zu essen zu bekommen. Die Straße war in erster Linie ein Arbeitsplatz. Er hatte schon gebrauchte Sachen verkauft. Hatte Bürgersteige bewacht. Hatte auf dem Bau gearbeitet. Ganz zu schweigen davon, dass er derjenige war, der gleich als Erstes am Morgen an der Praça da Matriz den Bereich um den Zeitungsstand fegte. Jeden Tag. Wenn es Rockkonzerte, Samba-Shows oder sonstige Festivals im Stadtzentrum gab, gehörte er stets zu dem Trupp, der angeheuert wurde, um Kisten zu schleppen, Bretter zu schleppen, Equipment zu schleppen, Plattformen zu schleppen, Zelte zu schleppen, Masten zu schleppen. Beim Karneval das Gleiche. Wer beseitigte nach den Wahlen den Dreck von den Straßen? Er war schon fliegender Händler, Autowächter, Sandwich-Mann gewesen, aber Emílio zu erklären, dass er bereits ein Haus besäße, wenn man ihn für die Arbeit, die er seit Jahren verrichtete, angemessen bezahlt hätte, kam ihm gar nicht in den Sinn.
»Was kannst du?«, wollte Emílio an diesem Morgen von ihm wissen, während er sein tadellos sauberes und bis zum Kragen zugeknöpftes Hemd über der Brust glatt strich.
»Schreiben«, antwortete der Schriftsteller.
Emílio lachte. Sie lachten immer, wenn er über seine Freude am Schreiben sprach. Er war das bereits gewohnt.
»Ich rede von praktischen Fähigkeiten. Von nützlichen«, fuhr Emílio fort.
Es gab vieles, was er konnte, indem er auf »praktische und nützliche« Weise schrieb: Er konnte Analphabeten, Neuankömmlingen im Haus, beim Ausfüllen ihrer Formulare helfen. Er konnte die Anweisungen schreiben, die er überall in den Zimmern gesehen hatte: Nach dem Benutzen der Toilette die Hände waschen, nach dem Toilettengang die Spülung betätigen, nach dem Duschen das Bad trocken wischen, sich bei demjenigen bedanken, der das Essen serviert. Er könnte Büroarbeiten erledigen, er könnte die Einkaufslisten erstellen, er könnte Berichte verfassen (kein Heim ohne Berichte), aber Emílio hatte eine andere Art von Arbeit für ihn im Sinn. Er brachte ihn in eine Abstellkammer, vollgestopft mit Glühbirnen, Drähten, abgefahrenen Reifen, Hacken, Kabeln, Flaschen, Stacheldrahtrollen, Haken, Stiften, Flaschenkisten, Kisten mit Steckdosen, Wäscheleinen, zerbrochenen Spiegeln, Kisten mit Schrauben, Nägeln, Reißzwecken, alten Koffern, neuen oder kaputten Werkzeugen, Eimern und fragte: »Kannst du in diesem Durcheinander Ordnung schaffen?«
Der Schriftsteller dachte, in gewisser Hinsicht wäre es so, wie Wörter zu kategorisieren. Beim Aufräumen lernte er einen jungen Mann kennen, der Açaí, und einen anderen, der Boxen mit warmem Essen verkauft hatte, sowie einen Kassierer aus einem Supermarkt. Menschen, die ihr ganzes Leben lang Miete gezahlt hatten, bis zu dem Tag, an dem ihre Wohnungen nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes zwangsgeräumt worden waren, Menschen, die entsetzt waren, hier leben zu müssen.
»Ich bin noch nie Bittsteller gewesen«, war das Erste, was sie sagten.
Sie erzählten von der Tätigkeit, die sie ausgeübt, von der Straße, in der sie gewohnt, von dem Gehalt, das sie verdient, von dem Motorrad, dem Karren, den Möbeln und den Unterlagen, die sie verloren hatten. Als ob das sie ausgemacht hätte. Er selbst hatte sich in der Vergangenheit so verhalten. Er wusste, das war eine Übergangsphase. Dann gewöhnte man sich daran und verbarg, was man früher unbedingt hatte zeigen wollen.
Am meisten ärgerte es ihn, wenn man ihn als undankbar bezeichnete (bloß, weil er zum Beispiel ein Gemüse wie Chayote nicht mochte oder ihm die Farbe der gespendeten Kleidung nicht gefiel. Er lernte, dass wer etwas geschenkt bekam, weder Vorlieben noch Geschmack haben und schon gar nicht wählerisch sein durfte). Und dann die Gebete. Er bat sogar darum, davon freigestellt zu werden.
»Was ist so schwer daran zu beten?«, wollte Emílio wissen.
Und angesichts des Widerstands des Schriftstellers wurde er noch schärfer: »Glaubst du wirklich, du kannst hier bei uns in einem sauberen Bett schlafen, unser gutes Essen essen, ohne unser Glaubensbekenntnis zu befolgen?«
Iraquitan war zu Ohren gekommen, dass Emílio sich bei anderen über ihn beschwert hatte.
»Diese Penner«, sollte er gesagt haben, »sie kommen her und denken, wir betreiben hier ein Hotel für Touristen.«
Emílio schien ihn tatsächlich nicht zu mögen und hatte offenbar vor, ihm zu schaden. Wenn das so war, dachte Iraquitan, dann war dieser Plan zum Scheitern verurteilt. Niemand konnte ihn besser fertigmachen als er sich selbst. Das war seine größte Fähigkeit.
Deshalb kehrte der Schriftsteller noch am selben Tag, nachdem er die Abstellkammer sauber und aufgeräumt übergeben hatte, zur Praça da Matriz zurück. Wenn er fertiggemacht werden sollte, dann wenigstens auf seine Art. Gemeinsam mit seiner Clique: Chilves, Jéssica, Farol Baixo, mit allen von der Platte. Mit seinem Heft der Wörter. Und mit seinem Bedürfnis, schöne Dinge zu schreiben.
5
Auf der Verpackung stand »Mischgewebe, 200-fädig, antiviral«.
»Stirb, du Schurke!«, rief Chilves, warf den Karton auf den Boden und trampelte ihn platt.
Der Tag hatte gerade erst begonnen, aber sein Karren quoll jetzt schon über von Zeitschriften, Zeitungen, Papiertüten, Prospekten und Pappen, die er zum großen Teil am Vorabend gesammelt hatte, nachdem die Läden geschlossen und ihr Altpapier auf den Bürgersteigen zurückgelassen hatten.
Seit Chilves einige Zeit zuvor Jéssica kennengelernt hatte, versuchte er ihr beizubringen, dass man, um nicht als Bettler, Nutte oder Dieb zu enden, das Leben der Straße erlernen und sein Auge schulen musste, damit es »automatisch« funktionierte. Das Sammeln beginnt im Auge des Sammlers, hatte er erklärt. Tatsächlich aber hatte sich Jéssica von Anfang an als Katastrophe im Recyclinggewerbe erwiesen. Schmächtig, wie sie war, schaffte sie es nicht, mehr als zehn Kilo zu ziehen oder zu schieben. Und zudem vertrödelte sie viel Zeit mit Unsinnigem, ständig flatterte ihr Blick wie ein Schmetterling ziellos umher, ohne eine einzige Dose, Flasche oder Tetra-Pak ins Auge zu fassen, sondern interessierte sich mehr für Hähnchengrills. Ich habe einen Mordshunger!, beschwerte sie sich, blieb vor einem Werbeplakat für frittierte Teigteilchen stehen, Coxinha + 1 Erfrischungsgetränk im Sonderangebot, blieb vor den Verkaufsständen voller Schuhe stehen, erklärte, ihre Füße seien vom vielen Laufen wund, drehte fast durch vor den 1,99-Läden und den Center-Tudo-Märkten, die alles anboten, Puppen, Eimer, Krüge, Jonglierbälle, Plüschtiere, lass uns weitergehen, Jéssica, flehte Chilves, oh, wie hübsch!, ich will nur mal schauen, sagte sie, ohne sich um die Verkäufer zu scheren, die in Alarmbereitschaft waren, weil sie einen Diebstahl befürchteten, besser, du suchst dir eine andere Beschäftigung, Jéssica, verkündete Chilves schließlich und beendete die Partnerschaft.
Wäre er zu dieser Stunde mit Jéssica unterwegs, sein Karren wäre erst halb voll gewesen. Das Geheimnis der Arbeit bestand darin, Muskeln aus Stahl zu haben, die Strecken zu kennen, die Spreu vom Weizen trennen zu können, aus allem Unbrauchbaren schnell die Dose, das Glas, das Holz herauszufischen, und das hatte er bereits gelernt, noch ehe er fünf Jahre alt gewesen war, ehe der Jugendschutzrat ihn aufgegriffen hatte, auf der Mülldeponie, wo er und seine Brüder ihrer Mutter geholfen hatten, alles zu sammeln, was sich verkaufen oder essen ließ. Einmal hatte er gehört, wie ein Müllsammler zu seiner Mutter sagte, die Bundesregierung müsste sich bei ihnen bedanken, denn ohne Menschen wie sie wäre Brasilien nichts als eine Müllhalde. Damals hatte Chilves sich vorgestellt, die Bundesregierung sei so etwas Ähnliches wie die Leute, die zu Weihnachten mit Kleinbussen voller Altkleider kamen, sodass er und seine Nachbarn plötzlich zu kurze oder zu lange, zu weite oder zu enge Sachen trugen, und so schlecht gekleidet stellte er sich vor, den »Dank« der Regierung entgegenzunehmen.
Das Sammeln in den Hauptstraßen, wo Großhändler und kleine Fabriken in den frühen Morgenstunden beliefert wurden, war zeitaufwendiger. Hier musste er sich mit Bussen, Motorrädern und Autos um den Platz streiten, Beleidigungen einstecken, die er stets stillschweigend runterschluckte – einmal wäre er beinahe erschossen worden, als er einem Taxifahrer »Selber Rindvieh« geantwortet hatte –, und lief dann eine Strecke von etwa zwanzig Kilometern ab, die viele Stunden später, wenn seine Füße kaum mehr den Boden zu spüren schienen, im Zentrum der Stadt endete.
An diesem Tag ging bereits die Sonne unter, als Chilves bei der Reciclágora im Stadtteil Santa Maria ankam. An der Fassade prangte eine riesige blaue Tafel mit dem Foto eines lächelnden kleinen Mädchens, das Erde mit einem Pflanzenspross in den Händen hielt. Darüber stand: »Öffne der Zukunft die Tür: Recycle«. Auf dem T-Shirt des Mädchens war der Slogan des Unternehmens zu sehen: »Recycling ist eine Geste der Liebe«.
Die Tafeln an den Wänden, die die Smart-Service-Leistungen des Unternehmens und ein »hoch spezialisiertes Team« anpriesen, standen im Kontrast zu den Lumpengestalten, die mit von der Firma gemieteten, aus Supermärkten und von Baustellen gestohlenen Gefährten oder sogar mit Karren wie dem von Chilves eintrafen, die notdürftig aus Holzresten und alten Reifen zusammengebaut waren. Nach dem Abwiegen des gesammelten Materials deponierten die Sammler Glas, Pappe, Eisen, Holz, Dosen und Plastikflaschen in den riesigen farbigen Containern, die in einem Halbkreis auf dem Hof des Unternehmens standen. Das neu sortierte und verpackte Material würde später zum doppelten des an die Sammler gezahlten Preises an die Recyclingindustrie geliefert werden.
Chilves hatte, was die Sammler als »einen guten Tag« bezeichneten. Mit seiner Fuhre verdiente er dreißig Real, und nachdem er den Karren auf einem Nebengelände abgestellt und dem Firmeninhaber die Miete dafür bezahlt hatte, handelte er eine Dusche mit dem Schlauch im hinteren Teil des Lagers aus.
Dann lief er zur Praça da Matriz und suchte Farol Baixo. Er wollte unbedingt mit ihm sprechen.
»Hier«, sagte Farol Baixo und hielt ihm eine in eine braune Papiertüte eingewickelte Flasche White Horse hin, als Chilves ihn im Gespräch mit Freunden hinter der Kirche, der Igreja do Calvário, antraf.
Gemeinsam gingen sie zu einer der Betonbänke auf einem etwas heller beleuchteten Teil des Platzes. Während Chilves mit einem Stein eine vereinfachte Karte der Swiss Life Residence auf das Pflaster zeichnete, passte Farol Baixo auf. Wenn die Polizei sie erwischte, würden sie den Inhalt der Flasche ausleeren müssen.
Chilves malte ein X in eines der Quadrate auf seiner Karte. »Hier hast du malocht«, sagte er und deutete dann auf die anderen Quadrate, »und hier wohnt niemand. Die Häuser stehen leer!«
Farol Baixo betrachtete weiter den auf dem Boden gezeichneten Plan, ohne Interesse zu bekunden. Dann fragte er: »Schon wieder? Was willst du dort?«
Chilves wusste nicht, was er antworten sollte. Er hatte den ganzen Tag über noch nichts gegessen.
Und Farol Baixo hatte nichts parat, was er ihm hätte verraten können. Keinen geheimen Eingang. Er wusste nur Gutes über Dona Elisa zu berichten. Eine gute Arbeitgeberin, sagte er. Gerecht. Die nicht verhindert hatte, dass er entlassen worden war.
Später, als er bereits betrunken war, sagte Farol Baixo: »Ich mag so was nicht.«
»Was genau?«
»Leute überfallen, die ich kenne.«
»Wer hat denn was von Überfall gesagt?«
»Wenn es nicht um einen Überfall geht, worum dann?«
Chilves nahm einen weiteren Schluck. »Ums Benutzen«, antwortete er.
Farol Baixo lachte auf. »Was denn benutzen?«
»Den Pool. Die Häuser. Alles, was weiß ich.«
Als die Flasche White Horse fast leer war, sagte Farol Baixo: »Wenn du in die Wohnanlage reinwillst, musst du mit Alcides reden. Er hat mir die Arbeit dort besorgt. Ein super Elektriker.«
»Und wo finde ich Alcides?«
»Das überlass mir.«
Die beiden hatten schon schwer Schlagseite, als eine kleine Frau mit einem Einkaufstrolley vor ihnen auftauchte, aus dem sie Boxen mit warmem Essen holte.
»Bist du es, Jesus?«, fragte sie und reichte Farol Baixo eine Box.
Er grinste. »Ja, ich bin’s. Jesus Christus höchstpersönlich, Schwester. Auferstanden und hungrig.«
Der Frau gefiel die Antwort nicht. Nachdem sie gegangen war und ihnen das Essen für diesen Abend dagelassen hatte, zwinkerte Farol Baixo dem Freund mit seinem einzigen gesunden Auge zu.
»Das hätte Jesus gerade noch gefehlt, was, Chilves? Als Farol Baixo auf die Erde zurückzukehren? Nach allem, was er durchgemacht hat?«
Bevor er leicht schwankend aufstand und auf den Rasen zusteuerte, kündigte er an, Jesus würde nun pinkeln gehen.
Als er zurückkam, fragte er Chilves: »Und, was ist? Soll ich dich und Alcides miteinander bekannt machen?«
»Wird er nützlich sein?«
»Keine Ahnung. Aber wenn du gerne in Häuser einbrichst, wirst du dich gut mit Alcides verstehen.«
6
Pititi pototó, ich bin gerade dabei, mir das Haar einzudrehen, da hör ich doch diese Nervensäge quasseln, pititi pototó, lauter aufgesetztes Zeugs, boshaft wie der Teufel …« Die affektierte, nasale Stimme Glendas, die im Wohnzimmer telefonierte, hallte durch Ritas Wohnung.
Jéssica fegte den Boden und schaute sich dabei die Fotos an, die überall in den Zimmern der Journalistin hingen: Rita beim Bergsteigen, Rita, wie sie durchgeschwitzt ihre gute Platzierung bei einem Marathon hochhält, Rita im Regenwald, mit bemaltem Gesicht und Kopfschmuck. Später machte sie sich zunutze, dass Glenda sie an diesem Tag in Ruhe ließ und öffnete im Schlafzimmer neugierig die Schränke. Sie war perplex angesichts der Berge von Blusen und Kleidern, wow, ganze Regale voller Schuhe und Sandalen, irre, so viele Farben und Materialien, der Wahnsinn, alles getrennt und geordnet, wie sie es sonst nur in Geschäften gesehen hatte. Sie schnupperte auch an den Tiegeln im Bad, an den Cremes, Parfums und an dem Make-up, und auf einen Schlag wurde ihr klar, wie lächerlich ihr tägliches Streben war, eine Angestellte der Angestellten zu sein, eine Privatangestellte Glendas, was für ein gewöhnlicher, alberner Traum, dachte sie, ein richtiger, echter Traum war, gleich beim Aufwachen aus dem Kokon zu schlüpfen und frei die Flügel auszubreiten, verwandelt in Rita, die Rita, die, immer in Eile, ihre gelben Pantoffeln im Flur auszog, eine junge Frau mit wilder Mähne und Lederjacke, die immer einen Laptop unterm Arm trug, ständig auf dem Weg in die Zeitungsredaktion war, grüne Smoothies trank, bunte Flatterhosen trug, unterwegs zum Flughafen war, gerade von irgendwoher zurückkam, und die an dem Tag, an dem sie Jéssica dort unverhofft zum ersten Mal erblickte, keine große Sache daraus machte, dass Glenda sie mehr oder weniger eingeschmuggelt hatte, um die Schwerarbeit zu erledigen, sondern ihr stattdessen gleich die Bilder zeigte, die sie von einem Zuckerrohrfeld in Assis gemacht hatte.
»Hat die Dame vor, noch länger verzückt im Leben anderer Leute herumzuschnüffeln?«, fragte Glenda, als sie mit dem Mobiltelefon in der Hand das Badezimmer betrat. »Du musst die Küche putzen!«
Während Jéssica sich an die Arbeit machte, Staub wischte und hartnäckigem Schmutz zu Leibe rückte, saß Glenda in ihren winzigen Shorts und mit ihren bunten Gelnägeln auf der Couch oder lümmelte in der Hängematte und hing die ganze Zeit am Telefon. Auf der Straße zerrissen sich die Leute das Maul über Glenda. Das ganze aufreizende Hinterngewackel, die aufgeblasene, künstliche Art zu reden und die nuttigen Klamotten, so was von schamlos, all das sei nicht echt! Glenda sei überhaupt keine Frau. Sie sei eine Schwuchtel. Sie sei trans. Sie sei als Mann geboren worden. Sie heiße Weverton. Und würde jeden x-beliebigen Schwanz lutschen. Bis sie in einem Sozialhotel untergekommen sei, habe sie mit einer Crackpfeife hinter dem Ohr vor sich hinvegetiert und ihren Arsch für fünf Real hergegeben.
Jéssica aber war das alles egal. Als sie auf dem Platz landete, war Glenda bereits Glenda, sie trug bereits ein Tanktop und einen Jaguar-Minirock und zeigte allen, die sie als Weverton »beschimpften«, den Stinkefinger.
Die beiden lernten sich so kennen: Glenda verteilte Hygienesets gemeinsam mit Rita und den Leuten von Batbanho, einem Duschbus, in dem sich die Obdachlosen kostenlos waschen konnten. Eines Tages, nachdem Jéssica das Angebot genutzt und neue Kleidung erhalten hatte, nahm Glenda sie zur Seite und sagte: »Schau an, Kind, so hübsch sauber bist du ja richtig ansehnlich. Ich bringe ein paar Wohnungen hier rings um den Platz in Ordnung und brauche eine Helferin.«
Jetzt putzten die beiden auch eine Einzimmerwohnung, von der Glenda behauptete, sie gehöre »einem Geschäftsmann von Rang«, der aber in Wirklichkeit ein erkrankter Kellner war. Zuweilen ergaben sich auch Gelegenheitsjobs in den Wohnungen von Ritas Freunden. Doch selbst wenn Jéssica für das Putzen nur ein Viertel von dem erhielt, was Glenda bekam, wer hätte ihr ohne Glenda die Gelegenheit dazu gegeben? Außerdem musste sie sich dank des Geldes, das sie verdiente, nicht die Predigten eines Pastors anhören, um etwas zu essen zu bekommen, sie konnte ihre Hühnchen-Instantnudeln oder ihr Brot mit Wurst selbst bezahlen, in der improvisierten Bar unter einer Plane direkt auf dem Platz, wo die Leute, die Platte machten, das ganze Geld von ihren Diebstählen und Gelegenheitsjobs ließen.
An diesem Nachmittag gingen die beiden nach der Arbeit gemeinsam in das gegenüber dem Platz gelegene Sozialhotel, in dem Glenda wohnte, ein großes altes Haus mit fünfzig durch Sperrholzplatten voneinander getrennten Zimmern. An der Rezeption saß ins Halbdunkel getaucht Zina, die Managerin, mit der typischen Gleichmut eines Menschen, der hoch dosierte Antidepressiva nahm.
Ohne ihren Blick von der Patience zu heben, die sie gerade legte, bemerkte sie: »Das Katzenfutter ist alle.«
Glenda tat noch mehr, als nur für die Ernährung der natürlichen Kontrolleure der Rattenpopulation zu sorgen, sie leitete auch die wöchentliche Reinigung des großen Hauses, durchgeführt von den Straßenhändlern, Bedürftigen, Sammlern, Lastenträgern, Autowächtern, Verkäufern und all den anderen Gästen – Arbeitslosen, die von den Bürokraten der städtischen Anlaufstellen für Schutzbedürftige in das Hotel geschickt wurden.
Im Gegenzug hatte sie von Zina die Erlaubnis erhalten, Freunde mit auf ihr Zimmer zu nehmen. Dort duschte Jéssica, bevor sie mit ihr putzen ging.
»Ich habe auch schon auf der Straße gelebt«, hatte Glenda zu ihr gesagt, »ich weiß genau, wie das ist, man wird nachlässig, gewöhnt sich an den Dreck, an die Läuse, an den Gestank, aber um bei meinen feinen Kunden zu arbeiten, muss man gut riechen, nach dem Motto, arm, aber sauber, kapiert?«
Als die beiden an diesem Tag auf ihrem Bett mit dem knallpinkfarbenen Chenille-Überwurf saßen, machte Glenda die Tagesabrechnung für Jéssica fertig. »Pass bloß gut auf dein Popöchen auf, nicht dass du noch einen Luden aushalten musst«, sagte sie und meinte damit Chilves.
Jéssica gefiel das nicht. Chilves hatte sie nie gezwungen, mit jemandem von der Platte zu schlafen. Im Gegenteil, ohne Chilves wäre sie schon in der ersten Nacht vergewaltigt worden, als sie aus dem Haus ihrer Tante weggelaufen und auf der Praça da Matriz gelandet war.
Bei mit Schokolade gefüllten Maismehlkeksen plauderten die beiden, bis es dunkel wurde.
Später, ehe Jéssica auf die Straße zurückkehrte, holte Glenda aus dem Schrank eine Tüte mit gebrauchten Kleidern, die sie zum Verteilen von den Mitarbeitern des Duschbusses erhalten hatte. »Schau mal, was dir davon passt.«
Jéssica suchte sich eine rote Hose und eine grüne Bluse aus. Als sie mit den Kleidern unter dem Arm auf den Flur trat, hörte sie Geschrei, und plötzlich tauchte ein riesiger Schwarzer vor ihr auf, der ein sehr wütendes Gesicht machte, gefolgt von Zina, die ihm drohte, die Polizei zu rufen.
Es war Poste, Glendas ehemaliger Zuhälter. Der Mann schoss an ihr vorbei und stürmte in das Zimmer ihrer Freundin, ohne dass irgendjemand ihn hätte aufhalten können.
Als Jéssica den Türknauf zu fassen bekam, hatte Poste die Tür bereits verriegelt, und schon waren auch Glendas Hilferufe zu hören.
»Lauf zur Rezeption und hol mein Telefon!«, befahl Zina.
Jéssica stürzte los und wich den Leuten aus, die aus ihren Zimmern traten, um zu sehen, was los war.
»Das ist Poste«, sagten sie, »er hat es angekündigt!« »Dieses Mal wird er Glenda töten.«
Zurück auf dem Flur, mit Zinas Telefon in der Hand, sah Jéssica, wie sich die Tür von Glendas Zimmer öffnete und Poste seelenruhig mit dem Portemonnaie ihrer Kollegin in der Hand herauskam.
Als Jéssica und Zina hineingingen, lag Glenda neben dem Bett am Boden. Ihr Gesicht schien keine Augen und keinen Mund mehr zu haben. Es war nur noch ein Fleischkloß, aus dem das Blut nur so strömte, wie Jéssica später Chilves berichtete.
7
Früher, als er mit dem Verkauf von Mango-, Guaven- und Tuttifrutti-Eis sein Geld verdiente, hatte Seno Chacoy halb aus Rache, halb aus Eitelkeit einen eigenwilligen Traum gehegt: Er wollte in einer dieser Reportagen über Einwanderer seine Erfolgsgeschichte erzählen. Weniger, um Brasilien dafür zu danken, wie es ihn aufgenommen hatte, sondern vor allem, um über den Schaden zu berichten, den Venezuela in seinem Leben angerichtet hatte.
Mit vierzig war er aus San Cristóbal fortgegangen, als der Preis für das Hühnerfleisch, das die damals den Lebensmittelschwarzmarkt beherrschenden Drogenhändler verkauften, einem Monatsgehalt in der Tischlerei entsprach, aus der er entlassen worden war.
Ein Freund hatte ihm dann den Job als Zerleger von Schweinshaxen in einer brasilianischen Fleischfabrik vermittelt. Im ersten Jahr, das er dort verbrachte, lernte er bei einer Weihnachtsfeier der Kirchengemeinde Ana Rosa kennen, eine zwölf Jahre ältere Witwe und Besitzerin einer kleinen Eisdiele am Stadtrand von São Paulo, wohin Seno Chacoy deshalb zog. Dort lebte das frischgebackene Paar glücklich, bis die Eisdiele durch eine Überschwemmung komplett zerstört wurde.