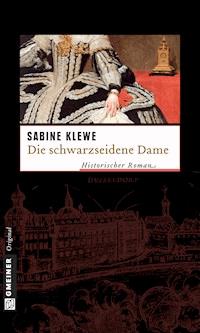8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Louis und Salomon ermitteln
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein neunjähriges Mädchen springt in Lissabon von einer Brücke. Ein Sturz, der eigentlich den sicheren Tod bedeutet – doch wie durch ein Wunder überlebt sie. Als der Düsseldorfer Kriminalhauptkommissar Chris Salomon ihr Foto in der Zeitung sieht, glaubt er, seine verschollene Tochter wiederzuerkennen. Mit seiner Kollegin Lydia fliegt er nach Portugal und erfährt, dass inzwischen zwei weitere Mädchen in den Tod gesprungen sind. Beide trugen weiße Kleider und hinterließen einen Abschiedsbrief, in dem stand, dass sie nun Engel seien. Wer oder was treibt die Mädchen zu diesem schrecklichen Schritt? Und gibt es wirklich eine Verbindung zu Chris' Tochter?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Ähnliche
SABINE KLEWE
Die Tränen
der Engel
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Juli 2017
Copyright © 2017 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Getty Images/Edward Kinsman
Redaktion: Heike Rosbach
em · Herstellung: kw
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-19633-2V004
www.goldmann-verlag.de
O meine Landsleute
Klar geworden ist mir eben
Diese Traurigkeit in mir
Wurde mir von euch gegeben.
Amália Rodrigues
Ich sehe bleiche Wangen und glanzlose Augen, aber keine Spur von Tränen. Dann hat wohl, so vermute ich, dein Herz Blut geweint?
Charlotte Brontë
Sie glaubte an Engel, und da sie an sie glaubte, existierten sie.
Clarice Lispector
Samstag, 17. September
Lissabon
Etwas war anders als sonst, wenn sie nachts wach wurde. Ein Heulen, als würde ein Sturm ums Haus tosen, aber tief und kehlig wie das wütende Grollen eines Ungeheuers.
Emília setzte sich auf und blinzelte verschlafen. Vor dem Fenster war ein helles, flackerndes Licht, als wäre schon Tag. Aber es konnte nicht Tag sein, nicht wenn es in ihrem Zimmer noch so dunkel war.
Vorsichtig schwang Emília die Beine aus dem Bett. »Mama?«, rief sie ängstlich. Und dann noch einmal lauter: »Mama!«
Keine Antwort.
Emília blickte abwechselnd zum Fenster und zur Tür. Das grollende Licht machte ihr Angst. Am liebsten wäre sie sofort zum Schlafzimmer ihrer Eltern gelaufen, hätte in Mamas Armen Schutz gesucht. Aber Papa hatte es ihr verboten, sie war schließlich kein Baby mehr. Sie war fast zehn. Zu alt, um an Drachen und Ungeheuer zu glauben.
Aber nachts, wenn es in dem alten Haus knackte und raschelte, wenn Mama und Papa ausgegangen waren und sie ganz allein in dem Teil des Anwesens war, den sie mit ihren Eltern bewohnte, war sie plötzlich nicht mehr sicher, ob sich nicht doch ein Schatten hinter dem Vorhang bewegte oder etwas unter dem Bett schnaubte und keuchte.
Das Krachen splitternden Glases, unmittelbar gefolgt von einem Schrei, ließ Emília zusammenfahren. Sie vergaß ihre Angst und stürzte zum Fenster.
Feuer! Das Nebengebäude, in dem die Mädchen schliefen, brannte lichterloh. Flammen schlugen aus den Fenstern im unteren Stockwerk, es prasselte und toste, die Hitze war selbst hier, auf der gegenüberliegenden Seite des Hofs, so groß, dass Emília nicht wagte, die Scheibe zu berühren.
Sie fasste sich an die Kehle. »Mama«, flüsterte sie noch einmal. »Hilfe.«
Wieder krachte es. Im gleichen Augenblick stürzte ein Teil des Dachs ein. Sofort schossen hohe Flammen in den Himmel. Unwillkürlich wich Emília zurück. Aber sie wandte den Blick nicht vom Fenster ab.
Auf dem Stück Dach, das noch intakt war, entdeckte sie eine Gestalt im weißen Nachthemd, eines der Mädchen, das sich durch das Dachfenster nach draußen geflüchtet hatte.
Emília hielt die Luft an und horchte in das Tosen des Feuers. Keine Rufe, keine Sirene. Wo blieb die Feuerwehr? Wo war ihr Vater? Jemand musste den Mädchen helfen!
Die Gestalt im weißen Nachthemd bewegte sich langsam auf die Kante zu. Ein weiteres Gesicht tauchte am Dachfenster auf, umrahmt von dunkelbraunen Haaren. Jetzt waren zwei Mädchen auf dem Dach. Nein drei, es waren drei Mädchen, und ein viertes krabbelte gerade nach draußen.
Kaum hatte die Gestalt sich in Sicherheit gebracht, erschien noch ein Gesicht am Fenster.
Emília presste die Fäuste gegen die Wangen, als könne sie dem Mädchen damit helfen. Es nützte nichts. Eine riesige Flamme schoss durch die Öffnung, Glas klirrte, das Gesicht verschwand.
Emília schluchzte auf.
Die vier Gestalten flüchteten zur äußersten Ecke des Dachs, doch die Flammen kamen unerbittlich näher. Einige Pfannen rutschten in die Tiefe. Lange würde das Dach die Mädchen nicht mehr tragen.
Springt, dachte Emília. Ihr müsst springen!
Als hätten die Mädchen sie gehört, stellte sich das erste an die Kante, breitete die Arme aus und machte einen Schritt ins Leere.
Emília vernahm ihren Schrei über das Tosen der Flammen hinweg, dann nichts mehr. Das Mädchen war verschwunden.
Die drei anderen zögerten, drängten sich dicht zusammen.
Emília biss sich in die Faust. In der Ferne hörte sie eine Sirene, das musste die Feuerwehr sein. Endlich!
Wieder krachte es, ein weiteres Stück des Dachs brach ein. Die Mädchen kreischten. Wichen zurück. Noch eine trat an die Kante und sprang. Diesmal hörte Emília keinen Schrei. Das Brüllen des Feuers war inzwischen so laut, dass es alle anderen Geräusche übertönte.
Das Dach war nun fast völlig eingestürzt. Die Flammen streckten ihre gierigen Zungen nach den Nachthemden der zwei verbliebenen Mädchen aus. Eins fing Feuer. Dann das zweite.
Emília schrie.
Die brennenden Mädchen fassten sich an den Händen und sprangen.
Emília hielt sich die Augen zu. Aber sie sah die Mädchen trotzdem. Von nun an würde sie sie immer sehen, wenn sie die Augen schloss. Zwei lodernde Fackeln, die in der Schwärze der Nacht erloschen wie Sternschnuppen über dem Meer.
Fünfeinhalb Jahre später
Samstag, 4. März
Düsseldorf
Die Sonne blinzelte durch die kahlen Zweige der uralten Platanen, aber der Wind blies eisige Luft vom Rhein durch die Bastionstraße in die Innenstadt.
Chris Salomon zog den Reißverschluss seiner Lederjacke hoch. »Hoffentlich ist der Winter bald zu Ende! Die Kälte nervt.«
Sonja grinste. »Mir ist warm, ich brauche nur einen Schritt zu machen, und mir bricht der Schweiß aus.« Sie deutete auf ihren kugelrunden Bauch. »Ganz schön anstrengend, unseren Sohn ständig herumzuschleppen. Aber es sind ja nur noch zwei Wochen.«
Chris betrachtete seine Freundin. Dass sie nicht fror, lag wohl eher daran, dass sie eine dicke weiße Steppjacke mit Pelzkragen, eine rosa Wollmütze und einen passenden Schal trug, während er in einem dünnen Lederjäckchen steckte. Er hatte die Nase voll von dicken Winterklamotten, also musste er frieren.
Sonja sprengte ihre Jacke beinahe. Sie hatte schon vor der Schwangerschaft eine eher frauliche Figur gehabt. Jetzt, im neunten Monat, schien alles an ihr rund zu sein. Rund und glücklich. Sie strahlte jede Minute des Tages. Sie lächelte sogar im Schlaf. Er hatte es gesehen, wenn er selbst stundenlang wach lag und sich unruhig hin und her wälzte. Wenn Albträume ihn quälten oder die Angst vor der Zukunft ihm die Kehle zuschnürte.
»So ernst?« Sonja legte den Kopf schief.
Chris lächelte. »Nur besorgt um deine Gesundheit, weil du wieder mehr kaufen wirst, als du nach Hause schleppen kannst. Und du sollst doch nichts Schweres tragen.«
Seit Sonja wusste, dass sie ein Kind erwartete, kaufte sie fast täglich Babywäsche, Teddybären, Kuscheldecken und anderen Kram für das Kind. Inzwischen waren sie so gut ausgestattet, dass sie Drillinge damit versorgen könnten. Chris hatte sie gewähren lassen. Sie hatte so lange darauf gewartet, hatte die Hoffnung auf eine eigene Familie schon fast aufgegeben. Die Einkäufe waren ihre Art, ihre Freude auszuleben.
»Dafür nehme ich ja Gudrun mit. Sie ist mein Packesel.« Sonja drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Da ist sie ja!« Sie winkte.
Chris drehte sich um und entdeckte Sonjas Schwägerin auf der anderen Straßenseite. Die drahtige kurzhaarige Blondine, die mit Sonjas Bruder verheiratet war, winkte zurück. Chris hob ebenfalls die Hand. Er mochte Gudrun nicht sonderlich. Sie war furchterregend perfekt, ihr Alltag mit Halbtagsjob und drei Kindern durchgetaktet wie die Montagestraße eines Autoherstellers.
Er drehte sich noch einmal zu Sonja um, strich ihr sanft über das lange kastanienbraune Haar, das unter der Mütze hervorquoll. »Pass gut auf dich auf, Liebling. Wir sehen uns heute Abend.«
Zehn Minuten später trat er am Carlsplatz in ein Café und bestellte einen Cappuccino, fest entschlossen, den freien Tag zu genießen. Es würde einer der letzten sein, den er ganz für sich hatte, an dem ihn nicht entweder die Arbeit in der Mordkommission oder der Säugling aufTrab halten würde. Er wusste, was ihn erwartete. Er erinnerte sich noch gut, wie es mit Anna gewesen war.
Nein, rief er sich zur Ordnung. Nicht an Anna denken. Nicht heute.
Chris griff nach der Wochenendbeilage einer Zeitung, die auf der Bank neben ihm lag. Aber es war schon zu spät. Wie konnte er auch nicht an Anna denken, wenn er gerade sein zweites Kind erwartete? Annas kleinen Bruder. Sie wussten, dass es ein Junge war. Sonja hatte es unbedingt erfahren wollen. Er hätte sich lieber überraschen lassen. Vielleicht hatte er aber auch nur Angst vor der Wahrheit gehabt. Sie hatten nie darüber gesprochen, aber er war sicher, dass Sonja genauso erleichtert war wie er, dass sie kein Mädchen bekamen.
In den vergangenen Monaten hatte er versucht, Abschied von seiner Tochter zu nehmen, in seinem Leben Platz zu schaffen für dieses neue Kind.
Das Kind, das lebte.
Er hatte das Haus in Köln verkauft, hatte Annas Sachen in vielen schmerzhaften Stunden durchgesehen, das, was er behalten wollte, in Kartons gepackt und in den Keller seines neuen Zuhauses verfrachtet. Sonja und er hatten gemeinsam eine überteuerte Eigentumswohnung im Düsseldorfer Süden gekauft, mit großer Terrasse und viel Grün drum herum.
Wie schon bei seinem bisherigen Zuhause in Köln hatte er nicht viel zur Wohnungssuche beigetragen. Damals hatte seine Exfrau Stefanie das Haus ausgewählt und nach ihren Vorstellungen eingerichtet. Diesmal war es Sonja gewesen, die die Wohnung im Internet entdeckt und ihm davon vorgeschwärmt hatte.
Die Bedienung brachte den Cappuccino. Chris nahm einen Schluck und schlug das Magazin auf. Lustlos überflog er einen Artikel über die Kommunikation mit Patienten im Wachkoma, aber seine Gedanken waren bei seinen zwei Familien. An guten Tagen freute er sich, dass er mit Sonja eine zweite Chance bekommen hatte. Sie war eine wunderbare Frau, fröhlich, unkompliziert und verständnisvoll. An ihrer Seite konnte er loslassen.
Aber an schlechten Tagen fühlte er sich wie ein Betrüger, wie ein untalentierter Schauspieler, der eine Rolle in einem Leben spielte, das nicht seines war, eine Rolle, die er sich hinterhältig erschlichen hatte.
Mehrere Male war er in den vergangenen Monaten heimlich in die Niederlande gefahren, an jenen fatalen Strand, an dem er Anna zum letzten Mal gesehen hatte. Er hatte versucht sich einzureden, dass es seine Art war, sie gehen zu lassen. Aber es war auch eine Flucht gewesen. Mehr als einmal hatte er mit dem Gedanken gespielt, nicht nach Düsseldorf zurückzukehren, und die Vorstellung hatte etwas sehr Verlockendes gehabt.
Chris blätterte weiter. Eine fette Schlagzeile sprang ihm ins Auge.
DASWUNDERVONLISSABON.
Er schüttelte den Kopf über die melodramatische Übertreibung, las ohne großes Interesse die ersten Zeilen, bis sein Blick auf das Foto neben dem Artikel fiel. Fassungslos betrachtete er das Bild, schloss die Augen, schaute wieder hin. Dann presste er die Hand vor den Mund. Erst als seine Finger nass wurden, merkte er, dass er weinte.
Es klingelte. Lydia Louis fluchte und stellte das Wasser ab. Sie erwartete niemanden und hatte auch keine Lust, irgendwen zu sehen. Nicht an ihrem freien Tag.
Wieder der schrille Klingelton, diesmal mehrfach hintereinander. Verdammt! Wer auch immer da draußen stand, sollte inzwischen begriffen haben, dass sie nicht aufmachen konnte. Oder wollte. Sie wickelte sich das Handtuch um den Körper und trat aus der Dusche. Das Klingeln hatte aufgehört. Na endlich!
Lydia ging ins Schlafzimmer und zog die Schranktür auf. Ein Geräusch ließ sie zusammenzucken. Jemand war an der Tür!
Scheiße! Scheiße!
Hässliche Erinnerungen blitzten vor ihrem inneren Auge auf, ihre Finger begannen zu zittern. Sie stürzte zum Nachttisch, wo sie verbotenerweise die Dienstwaffe aufbewahrte, und schlich mit der Walther P99 im Anschlag in die Diele.
Genau in dem Moment schwang die Tür auf. »Louis? Bist du zu Hause?«
Lydia ließ die Waffe sinken. »Salomon! Was soll der Scheiß? Du kannst doch nicht einfach in meine Wohnung marschieren! Ich hätte dich beinahe abgeknallt!«
»Tut mir leid.« Ihr Kollege zog die Tür hinter sich zu. »Ich muss dich dringend sprechen, und du hast nicht aufgemacht. Ich hätte es niemals getan, wenn es nicht wirklich wichtig wäre.« Er sah sie an.
Lydia erschrak. Sein Gesicht war bleich, die Augen gerötet, als hätte er geweint.
»Scheiße, was ist passiert?« Lydias Gedanken überschlugen sich. War etwas mit Sonja? Oder dem Kind?
Salomon wedelte mit einer Zeitschrift. »Ich muss dir was zeigen.«
»In der Zeitschrift?« Lydia fasste sich an die Stirn. »Ich kapier nicht …«
Salomon deutete auf das Handtuch. »Zieh dir was an, ich mache uns in der Zeit Kaffee. Okay?« Er setzte das zerknirschte Filmstarlächeln auf, das er so gut beherrschte.
Sie bekam weiche Knie, und Wut fegte die Beklemmung hinweg, Wut auf sich selbst. Seit Monaten versuchte sie damit klarzukommen, dass sie sich nach Jahren, in denen es mit Männern nichts als schnellen anonymen Sex gegeben hatte, ausgerechnet in ihren Kollegen verliebt hatte, den Kollegen, der glücklich liiert war und bald Vater werden würde.
Manchmal kam sie gut damit zurecht. Manchmal würde sie sich am liebsten in einem Loch verkriechen. Oder weglaufen.
Immerhin hatte Salomon keinen Schimmer davon, was sie für ihn empfand. Wenn er Bescheid wüsste, könnte sie ihm nicht mehr in die Augen sehen.
Lydia stürzte wortlos ins Schlafzimmer und zog ihre Cargohose und ein T-Shirt an. Als sie in die Küche kam, standen zwei Tassen Espresso auf dem Tisch. Salomon saß auf einem Stuhl und starrte ins Leere. Die aufgeschlagene Zeitschrift lag vor ihm.
Lydia ließ sich ihm gegenüber nieder und zog das Magazin zu sich heran. »Was soll ich lesen?«
»Diesen Artikel.« Salomon tippte auf eine Schlagzeile.
»Welchen? DASWUNDERVONLISSABON?« Lydia runzelte die Stirn. »Ich glaube nicht an Wunder, das solltest du eigentlich wissen.« Lydia gab Zucker in ihren Kaffee und rührte um.
»Bitte lies. Danach erkläre ich es dir.«
»Also gut. Aber wehe, du hast keine wirklich gute Erklärung für deinen Überfall parat!« Lydia beugte sich über die Zeitschrift.
DAS WUNDER VON LISSABON
Mädchen überlebt Sprung von Tejobrücke
Ein 9-jähriges Mädchen hat einen Sprung von der 70 Meter hohen Ponte 25 de Abril in Lissabon überlebt. Nach Angaben der portugiesischen Polizei sprang die Schülerin in den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstags in den 14 Grad kalten Fluss und schwamm aus eigener Kraft in Richtung Ufer, bevor sie nach etwa 7 Minuten von einem Fischerboot aufgenommen wurde. Die kleine Ana überstand den Sprung nur leicht verletzt, ist jedoch zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht worden.
99 Prozent der Sprünge aus dieser Höhe enden tödlich. Vor einigen Jahren sprangen jedoch im Abstand von nur wenigen Wochen zwei Jugendliche von der bloß drei Meter niedrigeren Golden Gate Bridge in San Francisco und überlebten ebenfalls nur leicht verletzt.
Warum die 9-Jährige sprang, ist noch völlig unklar. Vermutlich handelt es sich um einen Unfall, laut Polizei wird jedoch auch ein Selbstmordversuch in Betracht gezogen. Ungeklärt ist ebenfalls, warum die Minderjährige zu dieser frühen Stunde allein in der Stadt unterwegs war und wie sie auf die für Fußgänger gesperrte Brücke gelangte.
Neben dem Artikel war ein Foto der kleinen Ana abgedruckt. Lydia betrachtete das Gesicht. Helle Haut, umrahmt von langen dunklen Haaren, und klare, blaue Augen, die voller Ernst in die Kamera blickten, als wüsste das Mädchen etwas, von dem sein Gegenüber nichts ahnte.
In Lydias Nacken kribbelte es. Zweimal in ihrem Leben hatte sie am Abgrund gestanden, mit dem Gedanken gespielt, zu springen und alles hinter sich zu lassen. Das zweite Mal lag erst wenige Monate zurück. Sie war dem Peiniger ihrer Jugend wiederbegegnet, und all der Schmerz, die Angst und die Ohnmacht waren zurückgekehrt, obwohl sie längst nicht mehr so wehrlos war wie damals.
Lydia hob den Blick. »Ich fürchte, ich verstehe nicht …«
»Hast du ihr Gesicht gesehen? Das ist Anna. Meine Anna.« Salomon strich über das Foto, dann fuhr er sich mit den Fingern durch das Haar. Seine Augen schimmerten feucht.
Fuck! Was sollte sie dazu sagen?
»Also … hm … ich …« Lydia rutschte unruhig auf dem Stuhl hin und her. Sie hatte einmal ein Foto von Salomons verschwundener Tochter gesehen, ein Porträt, das über seinem Wohnzimmersofa in Köln gehangen und das einen süßen Fratz mit Grübchen und riesigen blauen Augen gezeigt hatte. Sie bezweifelte, dass das Bild in der neuen Wohnung, die Salomon mit Sonja teilte, einen ähnlich exponierten Platz bekommen hatte.
Lydia betrachtete das Foto in der Zeitschrift. Okay, die Mädchen waren etwa gleich alt, hatten den gleichen Namen, wenn auch in unterschiedlicher Schreibweise, und sahen sich ähnlich. Aber brünette, blauäugige Annas gab es zu Tausenden überall auf der Welt.
»Du glaubst mir nicht?« Salomon griff nach ihrer Hand.
Ihr Herz setzte einen Schlag lang aus. Sie würde ihm gern glauben. Aber sie wusste, dass es unmöglich war. Anna Salomon war tot.
»Ich glaube dir, dass du es glaubst«, sagte sie vorsichtig. Die anderen Dinge, die ihr durch den Kopf schossen, sprach sie nicht aus. Das war auch nicht nötig. Salomon hatte ihr gegenüber kein Geheimnis daraus gemacht, wie viel Angst er davor hatte, noch einmal Vater zu werden. Die zweite Chance nicht zu verdienen. Es wieder zu vermasseln.
»Du traust mir nicht zu, meine eigene Tochter zu erkennen?« Er wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel.
»Aber darum geht es doch gar nicht.«
»Sie ist es!«
»Du hast sie seit fast fünf Jahren nicht gesehen. Selbst wenn …« Lydia stockte. »Fünf Jahre sind eine lange Zeit bei einem Kind.«
»Da hast du recht.« Salomon lächelte triumphierend und ließ ihre Hand los. Er zog sein Smartphone aus der Lederjacke. Hastig tippte er einige Male auf den Bildschirm und hielt ihr das Gerät hin.
Lydia griff danach. Ein weiteres Foto des Mädchens aus Lissabon, diesmal mit etwas kürzeren Haaren und kessem Lächeln. »Woher hast du das Bild?«
»Wer, glaubst du, ist das?« Salomon deutete auf den Bildschirm.
»Na, diese Ana. Das Mädchen, das von der Brücke gesprungen ist.«
»Irrtum. Das ist ein computergeneriertes Bild, das die Kollegen vom LKA vor einigen Wochen auf Basis eines Fotos von meiner Tochter erstellt haben, um zu ermitteln, wie sie heute aussehen könnte.« Wieder griff Salomon nach ihrer Hand. »Es ist meine Anna, glaubst du mir jetzt?«
Lydia schluckte und betrachtete abwechselnd die beiden Fotos. Die Ähnlichkeit war frappierend. Die Mädchen könnten Doppelgängerinnen sein. Oder …
Aber wie sollte Anna Salomon von einem Strand in den Niederlanden nach Lissabon gekommen sein?
»Und?« Salomon sah sie erwartungsvoll an.
»Was hast du jetzt vor?«, fragte sie mit belegter Stimme zurück.
»Ich will die Kollegen in Lissabon um Amtshilfe bitten. Sie müssen die Identität dieser Ana überprüfen. Und wenn es Ungereimtheiten gibt …«
»Du glaubst, du kannst das mit ein paar Anrufen erledigen?«
»Du musst mir helfen, du sprichst doch Portugiesisch.«
»Nein.«
»Was soll das heißen? Willst du mir nicht helfen?« Salomon zog seine Hand zurück.
»Nicht so.«
»Wie dann?«
»Flieg mit mir nach Lissabon.« Die Worte waren heraus, bevor Lydia darüber nachgedacht hatte. Sie biss sich auf die Lippe.
»Ich kann nicht.« Salomon stand auf und stellte sich mit dem Rücken zu ihr ans Fenster. »Glaub mir, ich würde am liebsten ins nächste Flugzeug steigen. Aber es geht nicht.«
»Warum nicht?« Lydias Gedanken rasten. Was stellte sie sich vor? Mit Salomon durchzubrennen? Gemeinsam auf seiner Harley in den Sonnenuntergang zu reiten? Wie lächerlich! Ihm ging es um seine Tochter. Und ihr?
Langsam drehte er sich zu ihr um. »Danke, dass du das für mich tun würdest«, sagte er mit heiserer Stimme. »Aber ich kann jetzt nicht weg. Das kann ich Sonja nicht antun. Unser Sohn kommt in zwei Wochen zur Welt. So ungeduldig, wie er von seiner Mutter herbeigesehnt wird, vermutlich schon früher. Ich habe versprochen, dass ich ihr bei der Geburt beistehe.«
»Natürlich.« Lydia erhob sich und stellte die Espressotassen auf der Spüle ab; ihre Hände zitterten so sehr, dass das Porzellan klirrte. »Ganz wie du meinst.« Sie wagte es nicht, ihm ins Gesicht zu sehen. »Ich weiß, was ich machen würde, wenn es um meine Tochter ginge.«
Lissabon
Es nieselte. Vítor Fidalgo schlug den Kragen seines Mantels hoch und blickte sich um. Es dämmerte, doch auch die weichen Farben des Abends vermochten nicht darüber hinwegzutäuschen, wie verkommen die Gegend war. Eine Ecke der Alfama, in die sich Touristen normalerweise nicht verirrten. Die Häuser standen einander so dicht gegenüber, dass die Bewohner sich gegenseitig auf den Esstisch schauen könnten – wenn es denn Bewohner gäbe. Die rechte Häuserzeile war baufällig, das Eckgebäude links eingerüstet. Auf den Bauzaun hatte jemand »Stopp Airbnb« geschmiert. Die enge Gasse endete an einer Mauer, vor der ein übervoller Müllcontainer stand. Trotz des Regens stank es nach vergammelten Lebensmitteln und Fäkalien. Kein schöner Ort zum Sterben.
Vor allem nicht für ein Kind.
Vítor unterdrückte einen Seufzer und bewegte sich auf die Ecke zwischen dem Müllcontainer und einer mit Graffiti beschmierten Hauswand zu, wo zwei uniformierte Beamte der Polícia de Segurança Pública Wache hielten. Einer stand etwas abseits und rauchte in schnellen Zügen eine Zigarette. Sein Gesicht war fahl.
Vítor sprach den anderen an, einen älteren Mann mit Halbglatze und abgeklärtem Blick. »Inspektor Fidalgo, Polícia Judiciária.« Er hielt seinen Ausweis hoch. »Wissen Sie, wer das Mädchen gefunden hat?«
»Eine alte Frau auf der Suche nach ihrer Katze«, antwortete der Uniformierte. »Ein Kollege ist bei ihr.«
»Wann war das?«
»Vor etwa einer Dreiviertelstunde.«
»Was wissen wir über das Mädchen?«
Der Mann zuckte mit den Schultern. »Hier im Viertel scheint niemand die Kleine zu vermissen. Vielleicht ist sie ausgerissen.«
»Todesursache?«
»Keine sichtbaren Verletzungen. Aber wir haben sie uns noch nicht näher angesehen. Ist euer Job.«
Vítor blickte über die Schulter des Kollegen auf den kleinen Körper, der zusammengekrümmt bäuchlings auf dem nassen Pflaster lag und nur mit einem dünnen weißen, vom Regen transparenten Kleidchen bedeckt war. »Ist das ein Nachthemd?«
»Sieht so aus.«
»Damit ist sie wohl kaum quer durch die Stadt gelaufen, da wäre sie jemandem aufgefallen. Es ist ja noch nicht einmal ganz dunkel.« Ihm kam ein Gedanke. »Oder liegt sie etwa schon länger …«
»Unwahrscheinlich. Die Alte hat ausgesagt, dass sie heute Nachmittag schon mal hier vorbeigekommen ist, und da hat sie niemanden neben dem Container gesehen.«
»Hm.« Vítor schob sich an dem Glatzkopf vorbei in die Ecke, wo das Mädchen lag.
Sie trug tatsächlich nur ein weißes Nachthemd. Keine Schuhe und, soweit er das erkennen konnte, keine Unterwäsche. Der Nieselregen hatte sich wie ein feuchter Schleier auf ihren Körper gelegt und ließ die Haut auf ihren nackten Armen schimmern. Ihre Fußsohlen waren schmutzig. Also war sie selbst hergelaufen, nicht getragen worden. Nicht von einem Mörder hier abgelegt worden. Vielleicht ein Unfall. Oder …
Vítors Blick schoss nach oben. Fünf Stockwerke ging es an der verwitterten Fassade aufwärts. Jede Menge Fenster. Und ein Dach.
Oder gesprungen?
Ein Unfall?
Suizid?
Aber das Mädchen war höchstens acht oder neun Jahre alt. Nicht älter als …
Vítor stockte. Eine kalte, irrationale Furcht schoss ihm in die Glieder und ließ ihn zittern. Er beugte sich über den leblosen Körper. Das Gesicht wurde von den langen braunen Haaren verdeckt. Er sollte auf die Kollegen von der Spurensicherung warten. Und auf den Arzt. Aber er musste Gewissheit haben. Es würde ganz schnell gehen. Nur eben die Haare zur Seite streichen, nur einen kurzen Blick auf das Gesicht werfen.
Vítor streckte die Hand aus, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne. Unter dem vom Körper abgewinkelten Arm des Mädchens klemmte etwas Weißes. Er hatte es erst für einen Teil des Nachthemds gehalten. Aber es war ein Blatt Papier. Vítor fischte Einmalhandschuhe aus seiner Manteltasche und streifte sie über. Vorsichtig zog er das Blatt unter dem Arm hervor und strich es glatt. Handgeschriebene Zeilen in unbeholfener Kinderschrift, im Dämmerlicht kaum noch zu entziffern:
Ich bin jetzt ein Engel und gehe zu Gott. Valentina.
Vítor taumelte.
Valentina.
Er musste sich am Müllcontainer festhalten, um nicht umzukippen.
Valentina.
Nur ein Name, sagte er sich. Hunderte Mädchen heißen so. Nur ein beschissener, vollkommen gewöhnlicher Name.
Seine Beine waren so wackelig, dass er es fast nicht schaffte, sich erneut neben den leblosen Körper zu hocken.
Der Kollege von der PSP sagte etwas, doch Vítor hörte gar nicht hin. Mit zitternden Fingern tastete er nach den Haaren und schob sie behutsam aus dem Gesicht.
Dann wurde ihm schwarz vor Augen.
Düsseldorf
Sonja Reiter strich die Wolldecke glatt, die über der Rückenlehne des Sofas hing und die unbenutzt roch, so wie fast alles in dieser Wohnung, die noch kein Zuhause war. Sie schloss die Augen, als könnte sie so verschwinden lassen, was der Vater ihres ungeborenen Kindes ihr gerade offenbart hatte.
Er wollte nach Lissabon fliegen. Jetzt. Wenige Tage vor dem Geburtstermin ihres gemeinsamen Kindes. Wegen Anna. Wegen des anderen Kindes, das er nicht loslassen konnte.
Sonja hatte von Anfang an gewusst, dass Chris nie ganz ihr gehören, dass ihr ein Teil von ihm für immer verschlossen bleiben würde. Dass ihn etwas mit seiner toten Tochter verband, zu dem sie keinen Zugang hatte. Sie war bereit gewesen, es zu akzeptieren. Das zumindest hatte sie bisher geglaubt. Es war der Preis gewesen, den sie gern zahlen wollte, um mit dem Mann zusammen zu sein, den sie schon angehimmelt hatte, als er noch ein wilder, vorlauter Junge gewesen war und sie das pummelige Mädchen mit der hässlichen Brille aus der letzten Reihe.
Nun war sie zum ersten Mal nicht sicher, ob sie sich nicht getäuscht hatte. Ob der Preis nicht zu hoch war.
»Bitte versteh doch!« Chris trat vor sie hin und fasste sie an den Schultern. »Glaubst du, es fällt mir leicht, dich gerade jetzt allein zu lassen?«
»Warum tust du es dann?«
»Weil ich nicht weiß, ob die Spur zu Anna in drei oder vier Wochen vielleicht schon kalt ist. Wenn es dein Kind wäre, würdest du es auch tun. Und ich würde dich gehen lassen.«
Sonja presste die Lippen zusammen. Das ist nicht fair, dachte sie. Aber sie sagte es nicht. »Kannst du nicht wenigstens noch ein paar Tage warten? Ich habe das Gefühl, dass es schon bald so weit ist.«
»Nein.« Er umfasste ihr Gesicht mit den Händen und küsste sie auf die Stirn. »Je eher ich fliege, desto besser. Mit etwas Glück bin ich Ende der Woche zurück, und Anna ist dabei, wenn ihr Bruder zur Welt kommt.«
Sonja senkte den Blick, damit er ihre Gedanken nicht in ihren Augen lesen konnte. Sie glaubte nicht daran, dass Chris mit Anna zurückkehren würde. Wie auch? Seine Tochter lebte nicht mehr. Er jagte einem Phantom nach. Fragte sich nur, ob er wirklich davon überzeugt war, Anna in Lissabon zu finden, oder ob dieser Zeitungsartikel ein willkommener Vorwand war, sich vor der Entbindung und dem Babyrummel der ersten Tage zu drücken.
Vielleicht hatte er Angst, dass die Geburt seines Sohnes die Erinnerungen an die Anfangszeit mit Anna hochspülen, dass er damit nicht klarkommen könnte. Aber warum sagte er das dann nicht? Wenn er offen wäre, könnten sie gemeinsam eine Lösung finden, und er müsste nicht ans äußerste Ende von Europa fliehen.
Ein anderer Gedanke kam ihr. War es ein Zufall, dass Chris seine Tochter ausgerechnet in Lissabon entdeckt zu haben glaubte? Oder spielte Lydia Louis dabei eine Rolle?
Nein, diese Route wollte Sonja nicht einschlagen, das hatte sie sich fest vorgenommen. Es genügte, wenn sie auf ein totes Kind eifersüchtig war. Lydia Louis war seine Kollegin und enge Vertraute, mehr nicht. Sie hatte nicht den geringsten Anlass, Chris zu misstrauen.
Umgekehrt sah es da allerdings anders aus.
Sonja spürte einen Stich, als ihr schlechtes Gewissen sich meldete, wie so häufig in den letzten Monaten. Sie hatte Chris hintergangen, und sie hatte bisher nicht den Mut aufgebracht, es ihm zu gestehen. Sie hatte Angst, dass sie ihn verlieren würde, wenn er die Wahrheit erfuhr. Die Entscheidung für sie und das Kind war ihm auch so schon nicht leichtgefallen.
Chris war nicht begeistert gewesen, als er von der Schwangerschaft erfahren hatte. Er hatte kein weiteres Kind gewollt, jedenfalls nicht so schnell. Eine Zeit lang hatte Sonja befürchtet, er würde sich von ihr zurückziehen. Zwar die Verantwortung für das Kind übernehmen, aber kein gemeinsames Leben zu dritt wollen.
Als er sich anders entschieden hatte, war sie überglücklich gewesen. Und an manchen Tagen lief es so gut zwischen ihnen, dass Sonja kurz davorstand, ihm ihre große Lüge zu beichten. Doch jedes Mal machte sie im letzten Augenblick einen Rückzieher.
Sie schlang die Arme um seinen Körper und schmiegte sich an ihn. »Ich brauche dich.«
»Und ich bin für dich da, für dich und unseren Sohn. Das werde ich immer sein. Versprochen.«
Sie hob den Blick. »Ich kann mir nicht vorstellen, je wieder ohne dich zu sein.«
»Das musst du auch nicht.« Er küsste sie.
»Ich bringe dich morgen zum Flughafen«, sagte sie, als er seine Lippen von den ihren löste. »Und ich wünsche dir von Herzen, dass du in Lissabon findest, was du suchst. Ich will, dass du glücklich bist. Das weißt du hoffentlich.«
»Ja, ich weiß.« Er küsste sie wieder und strich dann mit der Hand sanft über ihren gewölbten Bauch. »Ihr beide seid das Kostbarste, was ich habe. Ihr beide und Anna.«
Vielleicht war das der Moment? Sollte sie reinen Tisch machen, bevor es zu spät war? Sie hatte sich fest vorgenommen, es hinter sich zu bringen, bevor der Junge auf die Welt kam. Womöglich war dies die letzte Gelegenheit. »Chris?«
»Ja?«
»Ich muss dir …«
Ein ziehender Schmerz jagte durch ihren Unterleib. Sie keuchte, presste die Hand auf den Bauch.
»Du lieber Himmel, Sonja, was hast du?« Chris hielt sie fest.
»Eine Wehe, glaube ich«, presste sie hervor, bevor sie von einer zweiten Schmerzwelle erfasst wurde.
Chris sah sie besorgt an. »Was nun?«
Sie versuchte sich an einem Lächeln. »Ich glaube, du solltest mich ins Krankenhaus bringen.«
Sonntag, 5. März
Lissabon
Chris lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen. Die vergangenen vierundzwanzig Stunden hatten ihn so geschlaucht, dass er auf der Stelle hätte einschlafen können, gleichzeitig hielt ihn die Aufregung wach.
Das Taxi bremste abrupt, und er öffnete die Augen. Sie kurvten durch einen gigantischen Kreisverkehr, der nach seinen eigenen Regeln zu funktionieren schien. Lydia saß vorn und plauderte überraschend entspannt mit dem Fahrer. Ihre Stimme klang anders, wenn sie Portugiesisch sprach, tiefer und weicher.
Chris hatte ihr im Flugzeug die Kurzversion des Dramas erzählt, das ihn in der vergangenen Nacht wach gehalten hatte. Nachdem Sonja plötzlich Wehen bekommen hatte, hatte er sich die seitWochen bereitstehende Reisetasche geschnappt und seine Freundin ins Krankenhaus gefahren. Dort hatten sie über eine Stunde warten müssen, bis endlich eine Hebamme Zeit für Sonja fand. Nervös waren sie den Korridor auf und ab gelaufen, aber Sonja hatte keine weiteren Schmerzkrämpfe bekommen.
Die Hebamme hatte dann bestätigt, was Sonja selbst schon vermutet hatte. Senkwehen. Das Baby brachte sich in Geburtsposition, aber es kam noch nicht.
Nach einer Reihe zusätzlicher Untersuchungen waren sie unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren. Sonja hatte sich geschämt, dass ausgerechnet sie als Frauenärztin wegen ein paar Senkwehen so in Panik geraten war.
Chris hatte sie beschwichtigt und versucht, sein schlechtes Gewissen zu verbergen. Er war überzeugt, dass alles seine Schuld war. Seine Reisepläne hatten den Fehlalarm ausgelöst, da war er sicher. Er hatte sogar daran gedacht, seinen Flug zu canceln. Aber dann hatte er das Foto von Ana betrachtet und gewusst, dass er nicht anders konnte.
Immerhin hatte sich ihr Chef nicht quergestellt, als Lydia und er ihn heute Morgen zu Hause angerufen und gebeten hatten, ihnen kurzfristig ein paar Tage Urlaub zu gewähren. Vielleicht war er froh, seine beiden unbequemsten Ermittler eine Weile los zu sein.
Das Taxi bog in eine große Prachtstraße. Chris sah herausgeputzte Fassaden, Brunnen und Straßencafés an sich vorüberziehen und fragte sich, ob sich in dieser Stadt sein Schicksal entscheiden würde. Sein Blick blieb an einem Rosenstrauch hängen, in dem sich ein schwarzer Schal verfangen hatte. Der Stoff flatterte im Wind wie Trauerbeflaggung. Unwillkürlich schauderte er. Er glaubte nicht an schlechte Omen, trotzdem wandte er den Blick hastig ab.
Kurz darauf passierten sie eine riesige Kirche, folgten den Straßenbahnschienen einen Hügel hinauf und hielten schließlich in einer einspurigen Straße mit Fassaden in leuchtenden Farben. Rua dos Navegantes entzifferte Chris auf einem Schild an einer Hauswand. Kaum waren sie ausgestiegen, öffnete sich eine Tür in einem gelb gestrichenen Haus, und eine dunkelhaarige Frau um die sechzig trat nach draußen. Sie trug ein graues Kostüm mit weißer Bluse, an ihren Ohren und um ihren Hals schimmerten große Perlen.
»Minha querida sobrinha!« Die Frau breitete die Arme aus.
»Tia!« Lydia ließ sich umarmen.
Chris war so perplex, dass er fast den Taxifahrer vergaß. Nachdem er diesem mit dem Gepäck geholfen und bezahlt hatte, trat er auf die Frauen zu.
»Salomon, das ist meine Tante Maria, die Schwester meines Vaters.« Lydia deutete auf die Frau. »Tia, esse é o meo colega Chris Salomon.«
Noch bevor Chris seine Hand ausstrecken konnte, nahm die Frau ihn in die Arme und küsste ihn auf beide Wangen. Dann sagte sie etwas zu Lydia, die errötete und ihre Tante verärgert anfauchte.
»Was hat sie gesagt?«, fragte Chris.
»Nichts.« Lydia drückte ihm seine Reisetasche in die Hand und schob ihn ins Haus.
Drinnen war es kühl und dunkel. Es roch nach einer Mischung aus Zimt, Koriander und alten Möbeln.
»Hier habe ich fast all meine Schulferien verbracht«, sagte Lydia. »Für mich war es immer der schönste Ort der Welt.«
Allmählich gewöhnte Chris sich an das Dämmerlicht. Sein Blick fiel auf eine Kommode, auf der eine Madonnenstatue und ein Strauß Plastiknelken standen. »Interessant«, antwortete er gedehnt.
Lydias Tante winkte ihnen, und sie stiegen eine steile Treppe hinauf in den ersten Stock. Die Stufen knarrten. Oben stieß Maria eine Tür auf und machte eine einladende Geste.
Chris trat ein und sah sich um. Ein mit Kissen beladenes Bett, ein uralter Schrank, ein Spiegel, zwei Polsterstühle. Ein herb-süßlicher Geruch hing in der Luft. Mottenkugeln, wie Chris annahm. »Sehr hübsch. Werde ich hier schlafen?«
Lydia sprach mit ihrer Tante. Chris konnte nur anhand der Gesten erahnen, worum es ging. Lydias Wangen röteten sich erneut, sie senkte die Stimme, obwohl Chris ohnehin kein Wort verstand. Offenbar gab es ein Missverständnis wegen des Zimmers.
»Was ist los?«, fragte er.
»Meine Tante hat da wohl was falsch verstanden«, erklärte Lydia mit schiefem Grinsen. »Sie sucht mir Bettwäsche raus, und dann mache ich es mir in meinem alten Kinderzimmer bequem. Richte dich schon mal ein. Gleich gibt es unten was zu essen.«
Die Tür fiel zu. Benommen blieb Chris in dem Raum stehen. Es fühlte sich merkwürdig an, in einem Haus zu sein, das so fremd war und trotzdem etwas Vertrautes ausstrahlte, weil es für Lydia so etwas wie das Zuhause ihrer Kindheit war. Als würde er durch einen Türspalt in die Vergangenheit blicken und das kleine Mädchen sehen, das hier einmal gespielt, gelacht und von der Zukunft geträumt hatte.
Er stellte die Reisetasche auf dem Bett ab und trat ans Fenster. Ein kleiner Hinterhof lag unter ihm, eine mit Steinplatten ausgelegte Fläche, von einem großen Baum beschattet und von einigen blühenden Büschen entlang der Grundstücksmauer eingerahmt. Chris konnte sich gut vorstellen, dass es hier selbst an heißen Sommertagen angenehm kühl war.
Er wandte sich ab und verließ das Zimmer. Unten hörte er Gemurmel aus einem der hinteren Räume. Dem Geklapper und Wasserrauschen nach zu urteilen musste es die Küche sein. Er betrat den Raum gegenüber der Eingangstür und fand sich in einem großen Wohnzimmer wieder. Auch hier dominierten schwere alte Möbel. Auf einer Anrichte standen gerahmte Fotos.
Chris betrachtete sie. Auf einem entdeckte er ein blondes Mädchen, vielleicht sechs oder sieben Jahre alt, das auf dem Schoß eines Mannes saß. Beide lachten ausgelassen in die Kamera. Vater und Tochter vermutlich. Er nahm das Foto in die Hand.
Hinter ihm knarrte es. Schuldbewusst fuhr er herum.
»Was Interessantes gefunden?« Lydia stand im Türrahmen, die Hände in die Hüften gestemmt.
»Bist du das?«, fragte er zurück und hielt ihr das Foto hin.
»Ja.«
»Mit deinem Vater?«
»Ja.«
Chris betrachtete das Foto. Lydia war einmal ein glückliches Mädchen gewesen. Sie hatte gelacht, sich sicher und geborgen gefühlt. Aus dem glücklichen Mädchen war keine glückliche Frau geworden. Und seit dem vergangenen Sommer wusste Chris, warum. Schweigend stellte er das Bild zurück.
»Sag’s nicht!«
»Was denn?«, fragte Chris.
»Was auch immer dir im Kopf herumgeht.«
»Meinetwegen.« Er zuckte mit den Schultern und nahm den Rest des Raums in Augenschein. Er war sehr erstaunt gewesen, als Lydia vorgeschlagen hatte, bei ihrer Tante zu wohnen. Sie hatte es mit dem Geld begründet, das sie so sparen konnten. Und mit den Insiderinfos, die sie eventuell bekommen würden. Maria Amarante Luiz war mit einem einflussreichen Regierungsbeamten verheiratet gewesen. Sie kannte noch immer allerhand wichtige Leute. Aber Chris nahm Lydia das nicht so richtig ab. Sie war in den vergangenen Monaten weicher geworden, weniger abweisend, zumindest ihm gegenüber. Es kam ihm so vor, als wolle sie ihm auf diese Art etwas über sich sagen. Allerdings hatte er keine Ahnung, welche Botschaft in ihrer Einladung verborgen war. Es gab so viele Dinge an Lydia, die er nicht verstand.
Maria rief etwas aus der Küche.
»Das Essen ist fertig«, erklärte Lydia. »Es gibt Eintopf. Und Milchreis zum Nachtisch. Ich hoffe, du hast Hunger. Meine Tante hat für eine zehnköpfige Familie gekocht.«
»Jedenfalls riecht es wunderbar.« Chris lächelte.
»Vorher habe ich allerdings noch eine schlechte Nachricht für dich.«
Chris erstarrte. Alle möglichen Szenarien schossen ihm durch den Kopf. Und in jedem einzelnen war der kleinen Ana, die er für seine Tochter hielt, etwas Schreckliches zugestoßen.
»Ich habe meiner Tante erzählt, dass wir wegen des Mädchens hier sind, das von der Brücke gesprungen ist. Kein Wort von deiner Tochter natürlich. Nur dass es etwas mit einem Fall in Deutschland zu tun haben könnte, an dem wir gerade arbeiten. An dieser Version würde ich auch gegenüber der portugiesischen Polizei festhalten. Okay?«
Chris nickte ungeduldig. »Ja, einverstanden. Aber was ist mit der schlechten Nachricht?«
»Meine Tante hat in der Zeitung gelesen, dass Ana angeblich in Brasilien lebt und nur zu Besuch bei Verwandten in Lissabon war. Möglicherweise ist sie inzwischen wieder nach Hause geflogen.«
Es dämmerte bereits, aber Clara hatte keine Angst. Nicht vor der Dunkelheit zumindest. Vor dem Hund der Nachbarn, der immer so laut bellte, hatte sie Angst. Und vor dem Jungen, der am Ende der Straße wohnte und der sie einmal auf dem Heimweg abgefangen und ihr die neue Jacke abgenommen hatte. Mama und Papa hatte sie erzählt, sie hätte sie auf dem Schulhof liegen lassen.
Vorsichtig schob Clara die Zweige zur Seite und zwängte sich durch die Hecke, bis sie das Loch im Zaun erreichte. Sie musste sich beeilen. Mama würde bald nach Hause kommen. Sonntags arbeitete sie normalerweise nicht. Aber heute Mittag hatte sie einen Anruf aus der Firma bekommen.
»Es tut mir leid, Schatz«, hatte sie zu Clara gesagt, »aber ich muss heute Nachmittag ein paar Stunden arbeiten. Du darfst einen Film anschauen, ich versuche, ganz schnell wieder da zu sein.«
Clara wusste, dass Mama nie ganz schnell wieder da war. Es kam immer etwas Wichtiges dazwischen. Während der Woche passte Nádia nach der Schule auf Clara auf. Clara mochte Nádia, obwohl sie die meiste Zeit über ihr Smartphone gebeugt dasaß und mit ihren Freundinnen Nachrichten austauschte. Dafür half sie Clara bei den Hausaufgaben und ließ sie am Computer Videoclips schauen, solange sie wollte. Mama würde das nie erlauben. Und Papa erst recht nicht. Aber der war fast nie da. Er reiste für seine Firma in ganz Portugal herum, manchmal sah Clara ihn wochenlang nicht.
Sie schob sich durch das Loch und trat auf den Bürgersteig. Ein Auto näherte sich. Mit klopfendem Herzen beobachtete Clara, wie sich die Karosserie allmählich aus der Dämmerung schälte. Nicht Mamas BMW.
Erleichtert schlich Clara los. Sie würde nur kurz bleiben, das hatte sie sich fest vorgenommen. Sie wollte nur eben nachsehen, ob es allen gut ging. Sie musste ja bloß ein Stück die Straße hinaufgehen, zu dem grün gestrichenen Haus mit den verwitterten Fensterläden und dem verwilderten Garten, das sie früher für ein Hexenhaus gehalten hatte. Damals hatte sie immer ihre Schritte beschleunigt, wenn sie allein an dem Grundstück vorbeilaufen musste. Aber da war sie auch noch klein und dumm gewesen.
Montag, 6. März
Lissabon
Chris legte den Kopf in den Nacken. Das Gebäude der Polícia Judiciária war hell und modern mit geschwungenen Formen und schmalen Fensterschlitzen. Der Unterschied zu dem trutzigen Nazibau in Düsseldorf hätte nicht größer sein können.
»Schick«, murmelte er.
»Neidisch?« Lydia legte den Kopf schief.
»Ich hoffe bloß, dass die hier mit uns Normalbullen überhaupt reden.« Chris blickte zweifelnd zum Eingang.
Lydia hatte ihm erklärt, dass die Polícia Judiciária, die portugiesische Kriminalpolizei, sich nicht aus der gewöhnlichen Polizei rekrutierte. Ihre Beamten hatten nie eine Uniform getragen, waren nie Streife gelaufen, sondern hatten Jura, Kriminalistik oder Psychologie studiert.
»Nun hab dich mal nicht so.« Lydia trat durch die Glastür in die Eingangshalle.
Chris folgte ihr und sah zu, wie sie mit dem Beamten am Empfang diskutierte. Schließlich griff der Mann zum Telefon, unterhielt sich kurz mit jemandem und sagte dann etwas zu Lydia.
»Und?«, fragte Chris. »Kriegen wir eine Audienz?«
Lydia drehte sich zu ihm um. »Chefinspektor João Pinto ist bereit, mit uns zu sprechen.« Sie sah ihn eindringlich an. »Überlass mir das Reden, wenn es geht. Wir platzen unangemeldet hier rein, wollen Ermittlungsinterna wissen, obwohl es kein offizielles Ersuchen gibt. Also sollten wir mit Fingerspitzengefühl vorgehen.«
»Und das ist dein Spezialgebiet«, rutschte es Chris heraus.
Lydia starrte ihn an.
»Entschuldige.« Er fasste sich an die Stirn. »Ich habe kaum geschlafen und …«
»Schon gut«, unterbrach sie ihn ungeduldig.
In dem Moment glitten hinter der Sperre Aufzugtüren auf. Ein älterer Mann mit Halbglatze und Brille trat in die Vorhalle.
Der Portier sagte etwas und Lydia zog Chris durch die Sperre. Sie begrüßte den älteren Mann auf Portugiesisch, der etwas erwiderte und sich dann in tadellosem Englisch an Chris wandte.
»Guten Tag«, sagte er. »Ich bin Chefinspektor Pinto, Leiter der Ersten Brigade der Abteilung für Tötungsdelikte.«
»Chris Salomon, Kripo Düsseldorf.«
»Sehr erfreut. Kommen Sie doch mit!«
Wenig später betraten sie ein Büro, dessen gläserne Seitenwände den Blick auf die zwei benachbarten Räume freigaben, in denen jeweils vier Schreibtische standen. Nur ein Teil der Arbeitsplätze war besetzt. Chris zählte vier Männer und eine Frau.
Chefinspektor Pinto ließ sich auf einem wuchtigen Ledersessel nieder und deutete auf die Stühle vor seinem Schreibtisch. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Sie müssen entschuldigen, dass wir ohne jede Voranmeldung hereinplatzen«, begann Lydia vorsichtig. »Aber es ist wirklich wichtig. Es geht um das Mädchen, das von der Brücke gesprungen ist.«
Pinto hob die Brauen, sagte aber nichts.
»Es gibt da einen Fall in Düsseldorf, der damit zusammenhängen könnte.«
»Wie das?« Pinto beugte sich vor.
»Ein verschwundenes Mädchen«, brach es aus Chris hervor, »das dem von der Brücke zum Verwechseln ähnlich sieht.«
Lydia warf ihm einen wütenden Blick zu.
Pinto runzelte die Stirn. »Ich dachte, Sie wären von der Mordkommission. Warum suchen Sie nach einem vermissten Kind? Und warum kommen Sie deshalb persönlich her?«
Chris brach der Schweiß aus.
»Die Sache ist kompliziert«, sagte Lydia und sah ihn warnend an. »Wir würden gern mit dem Mädchen sprechen. Ist das machbar? Sie ist doch noch in der Stadt?«
Plötzlich verschloss sich das Gesicht des Chefinspektors. »Könnte ich bitte mal Ihre Dienstausweise sehen?«
Chris ballte die Fäuste. Scheiße! Er hatte es vermasselt! Er sah durch die Scheibe in das linke Großraumbüro, sein Blick begegnete dem eines bärtigen jungen Mannes.
»Salomon?«
Chris schreckte hoch.
Lydia streckte ihm die Hand entgegen. »Dein Dienstausweis, du hast ihn doch wohl nicht vergessen?«
»Der Giftzwerg macht uns einen Kopf kürzer, wenn er von der Sache Wind bekommt«, murmelte Chris auf Deutsch und zog den Ausweis aus derTasche. Er konnte sich lebhaft ausmalen, wie ihr ChefWinfried Weynrath, ein cholerischer kleiner Mann mit kurzem Geduldsfaden, sie in ein fensterloses Kämmerchen im Keller verbannte, wo sie bis zur Pensionierung Berichte tippen mussten.
Pinto studierte die Ausweise.
»Ich verstehe, dass Ihnen das Ganze etwas merkwürdig vorkommen muss«, sagte Lydia und fügte noch etwas auf Portugiesisch hinzu. »Uns geht es nicht anders. Das Mädchen wird schon seit einigen Jahren vermisst. Es gibt Hinweise auf ein Kapitalverbrechen.«
»Schon seit einigen Jahren?« Pinto runzelte die Stirn. »Aber wie …?«
»Das Bild.« Lydia sah Chris auffordernd an.
Er begriff sofort und zückte sein Handy.
»Das ist unser verschwundenes Mädchen, wie es heute aussehen würde«, erklärte Lydia.
Pinto rückte seine Brille zurecht und studierte das Bild. Er ließ sich nicht anmerken, was er dachte. Schließlich lehnte er sich zurück. »Und Sie glauben, das könnte das Mädchen von der Brücke sein? Haben Sie irgendwas Offizielles aus Deutschland? Oder zumindest die ursprüngliche Vermisstenmeldung?«
»Nicht dabei.« Lydia nahm das Telefon entgegen und reichte es Chris. »Aber das können wir jederzeit nachreichen.«
Chris biss sich auf die Unterlippe. Konnten sie nicht. Und das wusste Lydia auch. Wenn Pinto den Namen des vermissten Mädchens sähe, wüsste er, dass sie aus privaten Gründen ermittelten, und sie wären sofort raus.
»Wir wollen der Kleinen nur ein paar Fragen stellen«, sagte er beschwörend. »Natürlich in Anwesenheit ihrer Eltern.«
Pinto faltete die Hände vor dem Bauch. »Das Mädchen steht unter Schock. Außerdem gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass sie nicht Ana Miranda de Melo ist. Und Sie haben nichts vorzuweisen außer einem fragwürdigen Computerbild. Ich kann Ihnen nicht helfen, ich muss Sie bitten zu gehen.«
Irgendwo draußen im Hinterhof sang jemand von seiner Liebe, die das Meer ihm geraubt hatte. Der Gesang war zu leise, als dass Lydia den Text verstanden hätte, aber sie kannte das Lied. Sie saßen in einer Pastelería in der Nähe der Metrostation Anjos und tranken Galão, portugiesischen Milchkaffee.