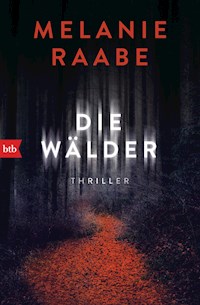9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Vor sieben Jahren ist der reiche und zurückgezogen lebende Geschäftsmann Philipp Petersen während einer Südamerikareise spurlos verschwunden. Seither zieht seine Frau Sarah (37) den gemeinsamen Sohn alleine groß. Doch dann erhält Sarah wie aus heiterem Himmel die Nachricht, dass Philipp am Leben ist. Die Rückkehr des vermeintlichen Entführungsopfers löst ein gewaltiges Medieninteresse aus. Sarah hat zwiespältige Gefühle, nach all der Zeit verständlich. Sie hat eine harte Zeit hinter sich. Gerade war sie dabei, sich von der Vergangenheit zu lösen. Ihr Ehemann taucht, wenn man so will, zur Unzeit auf. Was wird werden? Gibt es eine gemeinsame Zukunft? Sie ist auf alles vorbereitet, nur auf das eine nicht: Der Mann, der aus dem Flugzeug steigt, ist nicht der, als der er sich ausgibt. Es ist nicht ihr Ehemann. Es ist ein Fremder – und er droht Sarah: Wenn sie ihn jetzt bloßstelle, werde sie alles verlieren: ihren Mann, ihr Kind, ihr ganzes scheinbar so perfektes Leben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Ähnliche
Zum Buch
Vor sieben Jahren ist der reiche Geschäftsmann Philipp Petersen während einer Südamerikareise spurlos verschwunden. Seither zieht seine Frau Sarah den gemeinsamen Sohn alleine groß. Doch dann erhält sie wie aus heiterem Himmel die Nachricht, dass Philipp am Leben ist. Die Rückkehr des vermeintlichen Entführungsopfers löst ein gewaltiges Medieninteresse aus. Sarah hat zwiespältige Gefühle, nach all der Zeit verständlich. Sie hat eine harte Zeit hinter sich. Gerade war sie dabei, sich von der Vergangenheit zu lösen. Ihr Ehemann taucht, wenn man so will, zur Unzeit auf. Was wird werden? Gibt es eine gemeinsame Zukunft? Sie ist auf alles vorbereitet, nur auf das eine nicht: Der Mann, der aus dem Flugzeug steigt, ist nicht der, als der er sich ausgibt. Es ist nicht ihr Ehemann. Es ist ein Fremder – und er droht Sarah: Wenn sie ihn jetzt bloßstelle, werde sie alles verlieren: ihren Mann, ihr Kind, ihr ganzes scheinbar so perfektes Leben …
Zur Autorin
MELANIE RAABE wurde 1981 in Jena geboren. Ihr Thriller »Die Falle« war international eines der heißumkämpftesten Bücher der letzten Jahre. Der Roman wurde bislang in 22 Länder verkauft und mit dem Stuttgarter Krimipreis als bestes Debüt 2015 ausgezeichnet. TriStar Pictures sicherte sich die Filmrechte. Melanie Raabe lebt und schreibt in Köln. »Die Wahrheit« ist ihr zweiter Roman.
MELANIE RAABE
DIE WAHRHEIT
Thriller
I don’t care about truth. I want some happiness.
F. Scott Fitzgerald
1
Die Welt ist schwarz. Die Sonne über mir ist schwarz.
Ich stehe da, den Kopf in den Nacken gelegt. Die Augen weit offen. Ich versuche, den Moment ganz in mich aufzunehmen. Ihn mir zu merken. Keine anderen Gedanken zuzulassen. Die Bäume rauschen leise, es klingt fast feierlich. Nur die Vögel in ihren Wipfeln zeigen sich unbeeindruckt von dem, was gerade geschieht. Sie singen gegen die Dunkelheit an, als ob es um ihr Leben ginge. Die Sonne ist schwarz, und ich stehe da und bade mich in ihrem Anblick. Es gibt keine Wärme mehr. Kein Licht.
Dies ist nicht die erste Sonnenfinsternis, die ich erlebe. Die Erinnerung an meine erste macht mich lächeln – trotz allem. Philipp hatte damals aus der Stadt gewollt, in den Wald. Er hatte wissen wollen, ob seine Vermutung, dass die Vögel bei einer Sonnenfinsternis schlagartig aufhören zu singen, stimmte. Aber ich wollte in der Stadt bleiben. Das Spektakel mit unseren Freunden genießen. Wir alle gemeinsam, jung, albern und aufgekratzt, mit unseren Spezialbrillen auf den Nasen. Ich überredete ihn. Es war nicht schwer, Philipp ließ sich damals immer gerne von mir zu allem Möglichen überreden. Er startete einen letzten Versuch. Sagte, dass es alleine und im Wald viel romantischer sei. Ich sagte: »Sei nicht kitschig!«, und er lachte. Wir blieben also. In der Stadt, bei unseren Freunden.
Seltsam ist, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, wie die verdunkelte Sonne aussah. Ich erinnere mich an alles drum herum, an das Geschnatter unserer Freunde, an die Musik, die aus dem Radio kam. Ich erinnere mich, dass es verbrannt roch, weil irgendwer den Grill angeworfen und Würstchen darauf vergessen hatte, ich erinnere mich an Philipps Hand in meiner. Ich erinnere mich, dass wir die Brillen irgendwann abnahmen, weil sie beim Küssen störten. Wir hatten einander bei den Händen gehalten und den Moment wohl einfach verpasst. Und zum ersten Mal hatten wir über die Zukunft gesprochen. Was ich zuvor immer abgelehnt hatte, weil ich nicht glaubte, dass es das gab: die Zukunft. Aber wir hatten gehört, dass die nächste Sonnenfinsternis in unseren Breiten im Jahr 2015 kommen würde und die übernächste erst im Jahr 2081. Und das war konkret, das konnte ich glauben. Also hatten wir ausgerechnet, dass Philipp bei der nächsten Sonnenfinsternis fast vierzig wäre und ich immerhin siebenunddreißig. Wir hatten gelacht über den schieren Irrsinn des Gedankens, dass wir einmal so alt sein könnten. Aber wir versprachen einander, dass wir beim nächsten Mal besser aufpassen würden, dass wir sie sehen würden, gemeinsam, die schwarze Sonne, und zwar im Wald, damit Philipp das überprüfen konnte. Diese Sache mit den Vögeln.
Ich stehe auf einer kleinen Lichtung mitten im Wald. Allein. Ich bin siebenunddreißig Jahre alt. Ich starre eine riesige, schwarze Sonne an, sie starrt zurück, und ich frage mich, ob Philipp sie auch sieht. Ob man sie sehen kann, von dort, wo Philipp ist. Ich denke daran, dass unser Sohn bei der nächsten Sonnenfinsternis fünfundsiebzig Jahre alt sein wird. Dass ich nicht mehr da sein werde, dass Philipp nicht mehr da sein wird. Das hier, dieser Tag heute – das war unsere letzte Chance. Während ich so dastehe und der Mond sich die letzten paar Millimeter vor die Sonne schiebt, wird mir klar, dass Philipp Unrecht hatte. Das gefiederte Orchester um mich herum ist keinen Deut leiser geworden. Ich frage mich, ob ihn das enttäuscht oder gefreut hätte. Sage mir, dass das keine Rolle mehr spielt. Philipp ist nicht mehr da, denke ich. Philipp ist weg. Philipp ist verschwunden. Philipp ist vom Rand der Welt gefallen.
Und in diesem Moment hören die Vögel auf zu singen.
2
Der Friseur hat ein schönes Gesicht mit markanten Wangenknochen und schlanke, feminine Hände. Ich habe gezögert, den Salon zu betreten. Bin ein paar Mal bewusst daran vorbeigelaufen, bevor ich durch die Tür getreten bin.
Nun sitze ich hier, auf einem drehbaren Stuhl, und fühle mich ausgeliefert. Der Friseur fährt mit seinen Klavierspielerfingern durch meine Haare, die mir beinahe bis zur Hüfte reichen, einmal, zweimal, dreimal, mit gespreizten Fingern vom Ansatz zu den Spitzen. Er stößt bewundernde Laute aus, eine Kollegin, die sich als Katja vorstellt, kommt hinzu, befühlt ebenfalls meine Haare. Die Berührungen der beiden sind mir unangenehm, viel zu intim, es gab so viele Jahre lang nur einen, der meine Haare anfassen durfte, und er hat sie geliebt, er hat seinen Kopf auf ihnen gebettet, er hat mit ihnen seine Tränen getrocknet. Dennoch lasse ich den beiden ihren Spaß, tue so, als freute ich mich über ihre Komplimente. Irgendwann beruhigen sie sich, und Katja macht sich wieder daran, sich um die Extensions ihrer Kundin zu kümmern.
»Also«, sagt der Friseur, die Hand schon wieder in meinem Haar. »Spitzen schneiden?«
Ich schlucke einmal trocken.
»Alles ab«, sage ich dann.
Der Friseur, dessen prätentiösen Namen ich mir nicht merken kann, kichert kurz auf, verstummt, als er merkt, dass ich nicht mit ihm lache, dass das kein Scherz ist. Sieht mich an. Ich krame in meiner Handtasche, ich bin vorbereitet, ich finde die Seite, die ich aus einem Modemagazin gerissen habe, ziehe sie aus meiner Tasche, halte sie dem Friseur entgegen und tippe auf das Foto oben rechts.
»So«, sage ich. Und dann, wie um mir selbst Mut zu machen, noch einmal. »So. So will ich das.«
Der Friseur nimmt mir die Magazinseite aus der Hand, betrachtet sie, stirnrunzelnd erst, dann verschwindet die steile Falte, die seine Stirn in zwei Hälften geteilt hat. Er schaut mich an, dann schaut er noch einmal das Magazin an, schließlich nickt er.
»Okay.«
Ich atme auf, ich bin froh, dass ich ihn nicht erst überzeugen muss. Ich bin eine erwachsene Frau. Ich hasse es, wenn andere meinen, besser zu wissen, was gut für mich ist, als ich selbst. Patrice, jetzt weiß ich den Namen des Friseurs plötzlich wieder, er heißt Patrice. Patrice ist Profi genug, mich nicht in Frage zu stellen. Er legt sein Equipment auf einem kleinen Frisiertisch bereit: verschiedene Scheren und Kämme, Bürsten, Fluids, Sprays und einen Fön mit verschiedenen Aufsätzen. Seinen kleinen Handspiegel, mit dem er mir später vermutlich zeigen will, wie meine Haare am Hinterkopf aussehen, legt er auf einen Magazinstapel. Aber der Spiegel rutscht von der glatten Oberfläche des Türmchens und fällt zu Boden. Patrice flucht, hebt ihn auf, dreht ihn herum, sieht das geborstene Glas.
»Zerbrochene Spiegel bedeuten sieben Jahre Pech«, sage ich.
Der Friseur schaut mich aus braunen Rehaugen erschrocken an, lacht dann ein nervöses Lachen. Ich bedauere meinen Kommentar, der lustig hatte klingen sollen, den Ärmsten aber anscheinend verschreckt hat. Wie schön es doch sein muss, das Pech noch zu fürchten. Das bedeutet schließlich, dass es noch nicht eingetreten ist. Ich könnte ein ganzes Spiegelkabinett zerschlagen, es würde mich nicht kümmern.
Vor sieben Jahren ist mein Mann auf einer Geschäftsreise nach Südamerika spurlos verschwunden. Seither halte ich die Pausen-Taste meines Lebens gedrückt und warte auf ihn. Sieben Jahre Hoffen und Bangen und ein Gefühl absoluten Verlorenseins, das manchmal so stark war, dass ich am liebsten jede Erinnerung an Philipp aus meinem Gedächtnis getilgt hätte. Obgleich auch das nichts genützt hätte. Das Vermissen war bereits in meine DNA übergegangen.
Sieben Jahre Pech habe ich bereits hinter mir.
Patrice holt einen neuen Spiegel, schweigend. Beginnt anschließend vorsichtig, die größten Scherben zusammenzuklauben, den Rest zusammenzufegen. Ich sage nichts mehr, lasse ihn einfach machen. Innerlich kämpfe ich meinen eigenen Kampf. Ich schließe die Augen, bewege meine Finger durch mein Haar, ganz zart, so als berührte ich kostbare Spitze. Vorsichtig. So wie meine Mutter, vor vielen, vielen Jahren, so wie Philipp früher – und seither niemand mehr. Philipp, wie er mit meinem Haar spielt.
Ich denke an unsere erste gemeinsame Nacht, so dramatisch, Wasser um und die Sterne über uns, ich spüre, wie mein nasses Haar mir um die nackten Schultern fällt wie ein Umhang. Ich sehe Philipp, Wassertropfen im Haar. Stille, nur unser Atmen, Dunkel. Die Welt plötzlich ganz klein, so weit zusammengeschrumpft, bis nur noch Platz für uns beide darin ist. Ein Kokon aus Stille und Sternen. Und Philipps Hand in meinem Haar.
Ich tauche auf aus der Erinnerung, kehre in die Wirklichkeit zurück, sehe mich selbst im Spiegel, dieselben Haare wie damals, aber eine andere Frau.
Der Friseur hat alle Scherben beseitigt, steht hinter mir. Er hält eine Schere in der Hand. Mit der Linken greift er in mein Haar, hebt es. Dann sucht er meinen Blick im Spiegel.
»Sicher?«, fragt er.
Ich schlucke.
»Sicher«, sage ich.
Ohne weitere Umschweife setzt er die Schere an.
Ich kann meine Haare schreien hören. Das Geräusch ist silbrig und zerbrechlich, wie das Wimmern eines Kindes, ein Wispern. Ich schließe die Augen.
Der Friseur arbeitet schweigend. Schnell und effizient. Bald ist nichts mehr da, durch das man versonnen mit den Fingern fahren könnte.
Ich beweine meine Haare mit drei großen, stummen Tränen, die zu Boden fallen wie der erste Schnee des Winters. Dann trockne ich meine Tränen, zahle, stehe auf, verlasse den Salon. Und das Leben geht weiter. Endlich.
3
Das aufregende Achterbahngefühl im Magen, das einen überkommt, wenn man etwas Unumkehrbares getan hat – in voller Absicht ein unschätzbares Familienerbstück zerschlagen, endlich eine schreckliche Wahrheit ausgesprochen, alte Zöpfe abgeschnitten –, begleitet mich immer noch, als ich mein Haus betrete. Besser kann ich es nicht benennen, ich bin nicht gut mit Worten. Aber es wirbelt und wabert warm in meiner Magengegend wie selbstgebrannter Schnaps. Meine Schritte hallen, werden von den Wänden zurückgeworfen. Die Stadtvilla, die Philipp mir hinterlassen hat, wenn man das so ausdrücken will, ist schon seit vielen Jahren mein Zuhause, und doch komme ich mir immer noch deplatziert darin vor. Die hanseatische Kühle, mit der sie eingerichtet wurde, passt ebenso wenig zu mir wie die elfenhaften Kleinmädchenhaare, die ich mein Leben lang getragen habe. Vielleicht sollte ich endlich ausziehen, denke ich. An einen Ort, der besser passt. Für Leo und mich.
Ich schiebe den Gedanken beiseite.
Eins nach dem anderen.
Ich betrete das Badezimmer, wasche mir die Stadt von den Händen, betrachte mich im Spiegel, der über dem Waschbecken hängt. Seit ich das Geheimnis mit mir herumtrage, habe ich das Gefühl, dass es mir jeder, der mir begegnet, sofort an der Nasenspitze ansehen müsste – aber das trügt. Zumindest meine Nase sieht aus wie immer. Ich lächle der Frau mit den kurzen braunen Haaren, die plötzlich gar nicht mehr feen-, sondern eher knabenhaft aussieht, probeweise zu, und sie lächelt zurück. Warum nicht?, denke ich mit Blick auf meine jungenhafte Frisur, verlasse das Badezimmer, trage meine Einkaufstüten in die Küche und will gerade damit beginnen, die Vorbereitungen für das Abendessen zu treffen, als sie mir wieder einfällt. Die Plastiktüte, die der Friseur mir mitgegeben hat.
Im Flur trete ich an die Garderobe, nehme meine Handtasche, öffne sie, hole die Tüte mit meinem Haar heraus. Natürlich habe ich nicht die geringste Ahnung, was ich mit den Haaren anfangen soll. Ich werde sie ganz sicher nicht aufbewahren wie ein sentimentaler Idiot. Wenn man einmal mit so etwas anfängt, dann … Ich denke den Gedanken nicht zu Ende. In diesem Haus hier wohnen schon genug Geister, sie brauchen keine Haare zum Spielen.
Ohne weiteres Zögern verlasse ich das Haus durch die Hintertür, gehe zu dem kleinen Unterstand, zu den Mülltonnen. Es fühlt sich seltsam an, meine Haare durch die Gegend zu tragen, etwas in der Hand zu halten, das einmal ein Teil von mir war.
Ich verkneife mir meine Sentimentalität, mache den losen Knoten auf, mit dem der Friseur die Tüte verschlossen hat, und lasse meine Haare in den Biomüll gleiten. Ich schließe kurz die Augen, da ist sie wieder, Philipps Hand in meinem Haar, in der kleinen Mulde zwischen meinem Nacken und meinem Hinterkopf. Meine Brust wird plötzlich sehr eng, meine Wangen werden plötzlich sehr warm, kurz bleibt mir die Luft weg, dann verscheuche ich die Gedanken, die ich wohl von der Lichtung mitgebracht habe. Waldgeister. Sie verschwinden widerstrebend, murmelnd, kichernd. Dann kann ich wieder atmen. Bin wieder ich. Ich stehe da, hinter meinem Haus, den Deckel der Biomülltonne in der Hand. Meine Haare sind ab. Und jetzt liegen sie da, zwischen verwelkten Schnittblumen, Kaffeefiltern, Kartoffel-, Orangen- und Eierschalen. Ich wende meinen Blick ab, Klappe zu, und kehre ins Haus zurück.
Ich hatte den Tag der Sonnenfinsternis gefürchtet. Hatte so lange auf ihn hingelebt, mich so oft gefragt, was ich empfinden würde. Sie hatten mich geängstigt, die alten Schmerzen, die alten Fragen, die dieser Tag – davon war ich überzeugt – wieder an die Oberfläche spülen würde wie eine verheerende Flut. Und nun ist er gekommen und im Begriff, wieder zu gehen, einfach so, wie so viele Tage vor ihm. Er hat mich nicht mit sich davongetragen, ich bin noch hier. Und ich fühle keinen Schmerz mehr und keine Bitterkeit. Seit ich den Friseursalon verlassen habe, ist mir, als hätte ich etwas ungeheuer Aufregendes und Verbotenes getan. Wie ein Teenager, nachdem er gerade heimlich seine erste Zigarette geraucht hat: ein wenig flau im Magen, ein wenig schwindelig natürlich, aber frei.
Ich sortiere meine Einkäufe, packe alles, was für Frau Theis von nebenan ist, in eine große Papiertüte und stelle es beiseite. Nachher werde ich Leo bitten, unserer Nachbarin ihre Sachen zu bringen. Ich kaufe schon seit gut einem Jahr für die alte Dame ein, die nicht mehr allzu gut zu Fuß ist und kein Auto hat, und normalerweise unterhalte ich mich gerne mit ihr, auch wenn sie wirklich etwas wunderlich ist. Aber heute habe ich einfach keine Lust, mich von ihr in ein Gespräch verwickeln zu lassen.
Ich habe zu tun. Muss alles für das Dinner vorbereiten und anschließend Leo bei Miriam abholen. Ich würde meine beste Freundin gerne alleine erwischen. Bevor Martin nach Hause kommt. Irgendwem muss ich erzählen, was ich getan habe. Oder besser: was ich nicht getan habe.
Beeilung also. Ich nehme das Bio-Hähnchen, das ich vorhin gekauft habe, und lege es auf die Ablage. Lasse es beinahe auf den Boden fallen. Merke, wie nervös ich bin. Sage mir, dass das alles keine große Sache ist. Dass eben ein paar Freunde zum Essen vorbeikommen. Keine große Sache. Eigentlich. Es sei denn, man hat seit Jahren keine Freunde mehr im Haus gehabt.
Die Dinge ändern sich, sage ich mir und nehme eine Flasche Olivenöl, Salz, Pfeffer, den frischen Bund Thymian, für den ich extra auf dem Markt war, ein paar Stängel Petersilie, eine Knoblauchknolle, ein Döschen mit Fenchelsamen und zwei Zitronen und lege alles bereit. Ich betrachte die Lebensmittel, die ich auf meiner Arbeitsfläche angeordnet habe wie Spielzeugsoldaten. Begutachte das Hähnchen. Ich habe schon ewig keines mehr gemacht. Leo mag kein Hühnchen, überhaupt isst er nicht gerne Fleisch, da kommt er ganz nach seinem Vater, nach Philipp, der schon als Teenager Vegetarier war und dem ich es, als wir zusammenzogen, nachgemacht hatte. Kurz sticht mich das schlechte Gewissen. Aber dann schüttele ich es ab. Egal jetzt. Ich bekomme Gäste. Diese Gäste sind keine Vegetarier, also gibt es Hühnchen, Salat und Kartoffeln.
Ich atme tief durch, streiche mir eine nicht vorhandene Haarsträhne hinters Ohr, dann packe ich das Hähnchen aus. Es sieht seltsam traurig und irgendwie lächerlich aus, ohne Kopf, ohne Federn, so entblößt. Im ersten Moment kostet es mich Überwindung, es anzufassen, aber ich nehme mich zusammen. Lege meine Hände auf die tote Haut. Spüre nichts außer Kühle, Leichenkälte. Das Leben, das einmal in diesem kleinen, eigenartigen Körper gewesen sein muss, ist längst entwichen, wer weiß wohin. Irgendwie kommt es mir plötzlich seltsam vor, dass ich hier stehe und plane, etwas zuzubereiten, das einmal herumgelaufen ist und Körner gepickt hat, dann schiebe ich die Gedanken beiseite. Es sind Philipps Gedanken, nicht meine, nach all den Jahren immer noch Philipps Gedanken in meinem Kopf. Schluss damit jetzt, Schluss.
Ich nehme das Hähnchen in beide Hände, spüle es kurz unter fließendem Wasser ab, tupfe es mit Küchenpapier trocken. Werfe einen schnellen Blick auf das Rezept, das ich in einem meiner alten Kochbücher gefunden habe, vergewissere mich, dass ich alles richtig im Kopf habe.
Dann zupfe ich die Thymianblätter ab, gebe sie mit ein wenig Salz und reichlich Olivenöl in meinen Mörser und beginne, sie zu zerstoßen. Als ich damit fertig bin und es bereits in der ganzen Küche nach Kräutern duftet, tunke ich meine Hände in das Kräuteröl und fange an, die Haut des Huhns damit einzureiben. Es kommt mir seltsam vor, was ich hier mache, eine archaische, okkulte Handlung, Kräuter, Öle und tote Tiere. Hexenwerk. Ich schaue mir selbst dabei zu, wie ich diese Tätigkeiten verrichte, wie in einem Film.
Ich habe das Huhn rundherum eingerieben, und nun zerschneide ich die Zitronen, zerdrücke die Knoblauchzehen, zerpflücke die Petersilienstängel. Ich muss das Huhn jetzt damit ausstopfen. Früher, vor vielen Jahren, als Brathähnchen aus dem Ofen mein Lieblingsgericht war, habe ich das getan, ganz ohne nachzudenken. Nun zögere ich kurz. Dann überwinde ich mich. Ich stecke die Zitronen, die Kräuter und den Knoblauch in das Hähnchen, bis nichts mehr reinpasst in den Hohlraum. Das Huhn ist kalt von innen, kalt und tot, es kann ihm egal sein, dass ich Zitrusfrüchte in das stecke, was von ihm übrig ist. Was tot ist, ist tot. Was tot ist, empfindet keinen Schmerz. Was tot ist, leidet nicht. Was tot ist, ist unverwundbar.
Ich habe mich so oft gefragt, ob Philipp tot ist. Konnte es mir aber nie wirklich vorstellen. Manchmal, in den besonders dunklen Nächten, hätte ich mir beinahe gewünscht, dass er tot ist. Also, es zu wissen. Nicht nur eine vage Ahnung davon zu haben. Vorbei.
Ich stecke das Brathühnchen in den vorgeheizten Backofen, fange an, Kartoffeln zu schälen, und dann fällt mir doch noch ein, wie man es nennt.
Dieses ganz spezifische Gefühl, das mich durchflutet.
4
Aufbruchsstimmung.
Der Sommer ist zurück. Am Himmel über mir spielen Mauersegler im Wind. Miriams Vorgarten erinnert mich ein wenig an den Garten meiner geliebten Großmutter – ein buntes Sammelsurium aus Tulpen und Dahlien, Rosen, Magnolien, Forsythien. Auf der kleinen Rasenfläche liegt ein blaues Kinderfahrrad. Erleichtert stelle ich fest, dass Martins Wagen noch nicht vor dem Haus steht. Ich bin tatsächlich früh genug, um Miriam allein anzutreffen. Ich drücke auf die Klingel. Darunter hängt ein Schild aus Ton, verziert mit einem Igel und in ungelenken Erstklässlerbuchstaben beschrieben: Mama, Papa, Justus und Emily. Kaum habe ich den Finger von der Klingel genommen, erscheint Miriam auch schon im Türrahmen.
»Oh mein Gott«, sagt sie spontan. »Wie siehst du denn aus?«
Ich erwidere nichts, hatte erwartet, dass sie verwundert, vielleicht sogar geschockt reagiert. Haare machen so viel aus.
Dann fängt Miriam sich und sagt: »Sorry. Das meinte ich nicht so. Du siehst …«
Sie zögert. »Du siehst toll aus. Anders. Irgendwie älter, irgendwie aber auch jünger. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich mag es.«
Ich schenke Miriam ein Lächeln.
»Danke.«
»Komm erst mal rein«, sagt Miriam. »Die Jungs sind oben.«
Ich trete über die Schwelle dieses schönen, etwas chaotischen Hauses, das ich so liebe. Immer liegt irgendwo Spielzeug herum, immer steht irgendwo eine Vase mit bunten Blumen aus dem eigenen Garten. Leichter Essensgeruch wabert mir entgegen, aus dem Obergeschoss dringen die typischen rumpelnden Geräusche, die spielende Jungs erzeugen, die beinahe bersten vor Energie.
»Jungs, nicht so wild!«, ruft Miriam, erhält aber keine Antwort.
Sie verdreht die Augen, und ich muss schmunzeln. Ich bin so gerne hier. Ein ganz normales Haus. Eine ganz normale Familie. Emily, Justus’ sechs Monate alte Schwester schläft sicher schon friedlich in ihrem Bettchen, unbeeindruckt von den Eskapaden ihres achtjährigen Bruders und dessen besten Freundes.
»Ist das Sarah?«, höre ich plötzlich Martins Stimme, und kurz darauf kommt Miriams Mann bereits um die Ecke, eine Bohrmaschine in der Hand.
Schnell schlucke ich meine Enttäuschung hinunter. Aber vielleicht ist es besser so.
»Woah«, sagt Martin, als er mich sieht. »Heiß, die kurzen Haare!«
Ich lache.
»Ach«, sagt Miriam mit gespielter Verärgerung. »Jedes Mal, wenn ich mir auch nur die Spitzen schneiden lassen will, machst du einen riesigen Aufstand, aber bei Sarah sind kurze Haare heiß?«
Martin lacht gutmütig. Dann fällt ihm die Bohrmaschine wieder ein, die er noch in der Hand hält.
»Ach so, hier«, sagt er. »Die hatte ich dir rausgelegt, wie versprochen.«
Er hält das Gerät kurz in die Höhe, dann deponiert er es nahe der Haustür, damit ich beim Gehen daran denke.
»Super«, sage ich. »Danke.«
Martin will mir immer helfen, wenn im Haus etwas Handwerkliches ansteht, aber ich mache diese Dinge lieber selber. Ich haue gerne Nägel in Wände, ich bohre gerne Löcher, ich liebe Dübel und Schrauben. Werkzeug. Man führt eine Handlung aus und erhält ein klares, voraussehbares Ergebnis. Man schafft eine Ordnung. Man bringt die Dinge unter Kontrolle. Ich liebe Ordnung. Ich liebe Kontrolle.
»Und?«, fragt Martin immer noch grinsend.
»Was, und?«
»Na, sagt man nicht, wenn Frauen sich die Haare abschneiden, dann ist ein Mann im Spiel? ›Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben‹ oder so?«
»Martin!«, stößt Miriam empört hervor.
Sie weiß, dass ich seit Philipps Verschwinden allein bin. Sie glaubt, sie muss mich beschützen.
»Ist schon gut«, antworte ich. »Martin war schon immer neugierig wie ein altes Waschweib.«
Er grinst, zufrieden mit meiner Reaktion.
»Was macht das Training?«, fragt er.
»Läuft.«
Ich habe mit Martin für meinen ersten Marathon trainiert. Er hat danach mit dem Laufen aufgehört, weil er Probleme mit den Knien bekam, ich verlagerte mich fortan auf Triathlon.
»Du bist echt der Hammer«, sagt er.
»Ach was.«
Ich werfe Miriam einen Blick zu, mache mir manchmal Sorgen, dass es sie stören könnte, dass Martin mich mit so viel Aufmerksamkeit überhäuft, aber nein. Es freut sie. Wahrscheinlich hat sie Mitleid mit mir, immer noch, nach all den Jahren. Wahrscheinlich war es sogar Miriam, die ihren Mann dazu aufgefordert hat, besonders nett zu mir zu sein und mir ein bisschen zu helfen mit handwerklichen Dingen.
»Bleibst du zum Essen?«, fragt Miriam.
»Nein, ich habe doch heute selber Gäste«, sage ich. »Ich wollte nur schnell Leo abholen.«
»Ach, na klar, die Dinnerparty mit den Kollegen«, antwortet Miriam.
Sofort werde ich nervös. Miriam merkt es nicht.
Aus dem Obergeschoss dringt gedämpftes Kinderlachen.
»Ich gehe mal nachschauen«, sagt Martin und beginnt, die Treppen hinaufzusteigen.
Er pfeift die Melodie von »Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben«, zwinkert mir noch einmal zu, und weg ist er.
Miriam verdreht die Augen, ganz so, als wäre sie von ihrem Mann genervt, aber in Wirklichkeit liebt sie ihn, so wie er ist. Martin, der Spaßvogel. Sie weiß, was sie an ihm hat. Keinen Abenteurer, keinen Romantiker, keinen Verführer. Dafür Martin, den Spaßvogel. Martin, der gerne am Grill steht, der, obwohl er auf die Fünfzig zugeht, privat gerne T-Shirts seiner liebsten Rockbands trägt, der seine Kinder liebt und gerne Witze macht, über die er selbst am lautesten lacht, was ihm aber niemand übel nimmt, denn dafür ist er einfach zu nett. Martin eben. Der Miriam nie Blumen schenkt und sie nie mit etwas Romantischem überrascht, worüber sie manchmal klagt. Worauf ich dann denke: Es kann eben nicht jeder Mann sein wie Philipp. Und worauf ich sage: »Wer braucht schon Sträuße vom Floristen, wenn man einen ganzen Garten voller wunderschöner Blumen hat?«
Leo taucht auf der Treppe auf und unterbricht meine Gedanken.
»Hallo Mama«, sagt er, rennt mir entgegen, schmiegt sich kurz an mich, ignoriert die Tatsache, dass ich mir die Haare abgeschnitten habe, völlig.
Dann entdeckt er die Bohrmaschine, und ich bin wieder abgemeldet.
»Cool«, haucht er und hält das Gerät vor sich wie eine Laserpistole, legt auf einen imaginären Feind an, feuert. »Phhiu, phhiu! Phhiu, phhiu!«
»Also gut«, sage ich und gebe meiner Freundin einen Kuss. »Wir müssen.«
»Macht’s gut!«, sagt Miriam.
Ich schenke ihr ein Lächeln, nehme meinem Sohn die Bohrmaschine ab.
»Ciao Martin!«, rufe ich.
Martins Kopf erscheint am oberen Treppengeländer.
»See you later, alligator!«, ruft er mir nach.
Ich sehe es nicht mehr, aber ich weiß, dass Miriam lächelnd die Augen verdreht.
Ich fühle mich leicht, als ich mit Leo auf dem Rücksitz durch die Stadt brause, obwohl ich es nicht geschafft habe, mir irgendetwas von der Seele zu reden. Aber wahrscheinlich hätte ich es ohnehin nicht gekonnt. Manche Dinge sind so verdammt schwer auszusprechen.
5
Meine Gäste sind zusammen erschienen, alle drei, meine Kollegen Claudia und Mirko sowie Werner, Claudias Mann. Es ist seltsam, sie hier zu sehen, sie wirken ein wenig deplatziert, und das sind sie ja auch, sie gehören in die Schule, nicht in mein Haus. Mirko hat Blumen, Claudia und Werner haben Wein dabei.
Ich spüre, dass alle drei sich ein wenig unbehaglich fühlen, ich weiß nicht, was es ist. Ob es das große, altehrwürdige Haus ist, das sie befangen macht. Ob sie instinktiv die Geister der Vergangenheit spüren, die hier mit mir und meinem Sohn leben. Ob sie es ebenso seltsam finden, mich in meinem Zuhause zu sehen statt in der Schule, wie ich es seltsam finde, sie mal nicht als Kollegen, sondern als Privatpersonen zu betrachten.
»Ach, ist das wunderbar kühl hier drinnen«, sagt Claudia. »Die Hitze draußen ist unerträglich, oder?«
Die Männer stimmen ihr zu, Geplauder entsteht, der Bann ist gebrochen. Ich erhalte Komplimente für meine neue Frisur, die keinen zu überraschen scheint – es sei denn, sie verbergen es geschickt –, nehme meinen Gästen die Blumen und den Wein ab, bedanke mich, bemerke am Rande, dass Mirko sich für rote Rosen entschieden hat, was ich seltsam unpassend finde, doch natürlich kommentiere ich es nicht, sondern führe alle ins Esszimmer, reiche den Aperitif und entschuldige mich, um den Blumen Wasser zu geben und nach dem Essen zu sehen. Leo hat schon früher am Abend gegessen und spielt in seinem Zimmer. Alles ist gut.
Als ich die Speisen auftrage, unterhalten sich meine Gäste gerade über den letzten »Tatort«, nur um schließlich auf die neuen Referendare an unserer Schule zu sprechen zu kommen. Mir wird klar, wie sehr sich die alten Mauern dieses Hauses danach gesehnt haben, wieder mit Leben gefüllt zu werden. Es ist lange her, dass es so war.
»Ich finde dieses Verhalten unmöglich«, sagte Claudia gerade. »Die Frau ist ständig krank, und wenn sie mal da ist, dann ist sie schlecht vorbereitet. Für sie heißt Biologieunterricht, die Kinder alte Folgen von ›Es war einmal das Leben‹ in Dauerschleife anschauen zu lassen.«
Sie schnaubt empört.
»Warum fehlt sie denn so oft?«, fragt Werner, der offensichtlich keine Ahnung hat, um wen es geht, sich aber trotzdem am Gespräch beteiligen möchte.
»Ach, letztes Jahr war sie ein ganzes Halbjahr weg. Burn-out, angeblich«, sagt Claudia.
»Du sagst das, als gebe es das nicht«, wirft Mirko ein.
Claudia zuckt mit den Schultern.
»Klar gibt es das. Aber mal ganz im Ernst: Ich fühle mich auch ausgebrannt. Deswegen bleibe ich mit meinem Hintern noch lange nicht daheim. Oder schau dir Sarah an. Wenn es jemand schwer hat, dann doch wohl sie! Alleinerziehend und dann das, was mit ihrem Mann passiert ist. Aber Sarah geht arbeiten!«
Claudia sieht mich nach Zustimmung heischend an. Ich sage nichts.
»Oder wie siehst du das?«, hakt Claudia nach.
»Ich bin mir nicht sicher«, sage ich. »Ich weiß, glaube ich, zu wenig über Katharinas Situation, um darüber urteilen zu können.«
Claudia lächelt.
Es ist erstaunlich. Seit »das mit meinem Mann« passiert ist, wie Claudia es nennt, streiten die Menschen nicht mehr mit mir. Sagen mir nicht mehr, dass ich Unrecht habe. Nicken alles ab. Als wäre ich zu einer moralischen Instanz geworden, einfach, weil mir Leid zugestoßen ist und ich es überlebt habe. Selbst streitlustige Menschen wie Claudia lassen mich einfach reden. Es ist zum Verrücktwerden, manchmal.
»Du bist einfach zu gut«, sagt Claudia. »Ich weiß nicht, wie du das machst.«
Als ich den Tisch abgeräumt habe und mit dem Dessert zurückkomme, platze ich in eine Runde von »Eines davon ist gelogen« – ein Spiel, das die Schüler an unserer Schule derzeit lieben. Die Lehrer anscheinend auch.
»Ich bin dran«, sagt Claudia gerade. »Mal sehen. Okay. Erstens: Ich war schon einmal Fallschirmspringen. Zweitens: In meiner Jugend war ich mal nach einem Konzert mit einem Rockstar im Bett. Drittens: Ich habe eine sechste Zehe am linken Fuß. Eines davon ist gelogen.«
»Der Rockstar ist gelogen!«, sage ich.
»Nein«, antwortet Werner mit gespielt unglücklichem Gesicht. »Der Rockstar stimmt.«
Alle lachen, und während Claudia ihre Pumps abstreift, um uns ihre winzige sechste Zehe an ihrem linken Fuß zu zeigen, merke ich, wie sehr ich diesen Abend genieße.
»Das war ziemlich spektakulär«, sagt Mirko, als wir uns alle ein wenig beruhigt haben. »Aber gut, ich bin dran.«
Er überlegt kurz, wirft mir einen Blick zu.
»Erstens«, sagt er schließlich und fährt sich mit der Hand durchs blonde Haar, »ich spreche fließend Japanisch. Zweitens: Als Teenager habe ich mal jemanden aus einem brennenden Auto gerettet. Und drittens: Ich bin verliebt! Eines davon ist gelogen.«
Sein Blick streift meine Wange, ich sehe nicht hin.
Werner und Claudia johlen, ich öffne eine weitere Flasche Wein.
»Hm«, sagt Werner. »Sag mal was auf Japanisch!«
»Was denn?«, fragt Mirko.
»Irgendwas«, verlangt Werner.
Mirko breitet die Arme aus, als Zeichen, dass er sich geschlagen gibt.
»Auf Anhieb erwischt«, antwortet er.
»Du weißt, dass du für immer Junggeselle bleiben musst, oder, Romeo?«, wirft Claudia ein. »Andernfalls brichst du jeder Einzelnen deiner Oberstufenschülerinnen das Herz!«
Ich schenke allen frischen Wein ein. Sehe aus den Augenwinkeln, wie Mirko, der links von mir sitzt, mich lächelnd betrachtet.
»Sarah, du bist dran!«, sagt Claudia, und ich will mich gerade charmant herauswinden, als ich eine leise Stimme hinter mir höre.
»Mama?«
Ich fahre herum, sehe Leo, barfuß im Pyjama.
»Was ist denn, mein Schatz?«, sage ich ganz automatisch und stelle den Wein weg.
Mit großen Augen betrachtet mein Sohn die Erwachsenen am Tisch. Claudia und Werner blicken lächelnd zurück, Mirko hingegen steht auf und geht auf Leo zu. Beugt sich zu ihm hinab, gibt ihm die Hand, nennt ihn den »Herrn des Hauses«, was ich albern finde, allerdings nur so lange, bis ich das Lächeln auf dem Gesicht meines Sohnes sehe.
»Geh doch schon mal hoch, ich komme sofort und bringe dich ins Bett«, sage ich und blicke Leo noch einen Augenblick lang nach, wie er davontrottet.
Dann entschuldige ich mich bei meinen Gästen und verspreche, schnell wieder unten zu sein.
»Du, ehrlich gesagt wollten wir eh bald los«, sagt Claudia. »Werner muss morgen früh raus.«
»Oh«, sage ich. »Okay.«
Ich werfe einen Blick auf die Uhr, bemerke erst jetzt, wie spät es ist. Die Zeit ist tatsächlich wie im Fluge vergangen. Also muss ich mich wohl amüsiert haben, also muss der Abend doch ein Erfolg gewesen sein.
»Es war wunderbar«, sagt Werner.
»Ja, ganz wunderbar«, sagt Claudia. »Das nächste Mal kommt ihr zu uns. Ich mache mein Bœuf bourguignon.«
Die beiden stehen auf, küssen meine Wangen. Auch Mirko erhebt sich. Ich gehe zur Haustür voran, verabschiede mich von meiner Kollegin und ihrem Mann, bedanke mich, dass sie da waren, sage, dass es schön war, sie hier zu haben, merke, dass ich es ernst meine, sehe zu, wie sie in der Dunkelheit verschwinden.
»Starke Frau!«, höre ich Werner zu Claudia sagen, und damit meint er wohl mich. Ich hasse diesen Ausdruck. Starke Frau. Als wären Frauen das normalerweise nicht. Stark.
Ich wende mich Mirko zu. Bedanke mich bei ihm für den angenehmen Abend und die Blumen. Mirko sieht mir in die Augen, tätschelt mir unbeholfen die Schulter, so, als wollte er sagen: »Du hast es geschafft.«
Mirko war der Einzige von den dreien, der wusste, dass ich heute zum ersten Mal seit sieben Jahren Gäste in mein Haus gelassen habe. Mirko kann man solche Dinge sagen.
Wir schweigen kurz.
»Es war an der Zeit«, sagt er, und ich nicke.
Er dreht sich um, und ich sehe zu, wie sich seine Konturen in der Dunkelheit verlieren.
6
Leo erwartet mich. Er sitzt im Bett, unter seiner Decke, obwohl es warm ist, die Knie ans Kinn gezogen. Leo liebt Geschichten. Es ist ein Handel, den wir jeden Abend aufs Neue treiben. Nachtschlaf gibt es nur gegen eine Geschichte. Seinen wie meinen. Denn ich tue zwar so, als lese ich Leo zuliebe vor. Aber in Wirklichkeit ist dieses abendliche Ritual der schönste Teil meines Tages. Ich brauche die Märchen genauso wie mein Sohn. Nachdem wir uns das ganze vergangene Jahr durch die Grimmschen Märchen gearbeitet haben, sind wir nun bei Hans Christian Andersen angekommen. Ich mag ihn nicht, seine düsteren, seltsamen Geschichten, die so ganz anders funktionieren als die Märchen der Gebrüder Grimm, in denen Gut und Böse so klar voneinander zu unterscheiden sind und in denen es keine Facetten gibt. Ich finde die Klarheit der Grimms tröstlich, würde gerne noch einmal die traurige Geschichte von der Gänsemagd hören oder meinetwegen auch schlicht Aschenputtel oder Dornröschen, aber Leo ist momentan vollkommen fasziniert von Andersens »Schneekönigin«. Zunächst dachte ich, dass es die geheimnisvolle Figur der Schneekönigin selbst ist, die ihn so in Bann schlägt. Doch dann stellte ich fest, dass es der verwunschene Spiegel ist, von dem am Anfang des Märchens die Rede ist, der ihn so fasziniert.
Ich setze mich auf die Bettkante, Leo sagt nichts, sieht mich nur an. Diese ruhige, gelassene Art, er ist seinem Vater manchmal so ähnlich, dass es kaum auszuhalten ist. Ich streiche ihm eine klebrige Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Ist dir nicht warm, mein Schatz? Möchtest du eine dünnere Decke?«
Leo schüttelt den Kopf. Ich vermute, dass er sich vorstellt, er wäre im Palast der Schneekönigin, der komplett aus Schnee und Eis besteht, und da braucht er natürlich seine Decke, Hochsommer hin oder her.
»Was möchtest du denn heute hören?«, frage ich eher pro forma.
»Die Schneekönigin«, sagt Leo.
»Na gut.«
Ich schlage das Buch auf und beginne. Ich erzähle mehr, als dass ich lese, so gut kenne ich den Text inzwischen. Ich erzähle, dass der Teufel einst einen Spiegel erschuf, der machte, dass alles Schöne, was man darin ansah, zu fast nichts zusammenschrumpfte, und der gleichzeitig dafür sorgte, dass alles Schlimme, was sich darin spiegelte, nur noch schlimmer wurde. Leo sieht mich mit großen Augen an, die, als ich das Wort »Teufel« ausspreche, noch ein Stück größer werden.
»Doch«, so erzähle ich weiter, »eines Tages zersprang der Spiegel, und das richtete das allergrößte Unheil an. Denn die kleinen Splitter flogen umher, und wer einen von ihnen ins Auge bekam, der sah alles verkehrt oder hatte nur noch Augen für die verkehrten Sachen. Und manche Menschen bekamen sogar einen Splitter des Zauberspiegels ins Herz, und die Herzen dieser Menschen gefroren zu einem Klumpen Eis.«
Es rührt mich zu sehen, wie Leo sich an dieser Stelle jeweils unwillkürlich ans Herz fasst und wie wild blinzelt, als wolle er sicher gehen, dass sein Herz kein Eisklumpen ist und seine Augen noch völlig in Ordnung.
»Mama?«, unterbricht er mich.
Ich sehe ihn an.
»Woher weiß man, wenn man einen Eisklumpen als Herz hat?«, fragt er.
Im ersten Moment weiß ich nicht, was ich sagen soll.
Daran, dass man nichts mehr fühlt, so wie früher, denke ich. Daran, dass Freude kein Taumel mehr ist, sondern nur noch ein leichtes Lächeln. Daran, dass Wut nicht mehr siedend heiß ist, sondern höchstens noch lauwarm. Daran, dass die Farben immer weniger werden, daran, dass man nicht mehr weiß, was die Leute meinen, wenn sie von Glück sprechen.
Ich lege meinem Sohn die Hand auf die Brust. Spüre, wie sein kleines Herzchen schlägt, so schnell, so lebendig. Tränen wallen in mir auf, ich weiß selbst nicht so recht, warum, aber ich kriege sie gerade noch so in den Griff, bevor sie an die Oberfläche kommen, wo Leo, dessen kleines, aufrichtiges Gesicht sich ganz nah vor meinem befindet und der mich ganz genau anschaut, um meine Reaktion zu sehen, sie wahrnehmen könnte.
»Eisklumpen pochen nicht«, sage ich und ringe um ein Lächeln.
Leo nickt, das scheint ihn zu überzeugen. Dann legt er seine Hand auf meine Brust. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich habe kurz die irrationale Befürchtung, dass er keinen Herzschlag spüren wird, dass mich einer der Splitter aus dem Spiegel des Teufels getroffen hat, ohne dass ich es bemerkt habe, und dass da kein Herz mehr ist in meiner Brust, sondern nur noch ein faustgroßer Eisklumpen. Die Hand meines Sohnes tastet ein wenig auf mir herum, dann hellt sich Leos Miene auf. Er sagt nichts, zieht einfach seine Hand zurück und lässt sich zufrieden in sein Kissen zurücksinken. Ich kämpfe mit dem Kloß in meinem Hals.
»Lies weiter, Mama«, sagt Leo schließlich.
Also tue ich ihm den Gefallen, und wir reisen mit der Schneekönigin durch eine kalte und gefährliche Winternacht. Unsere Herzen schlagen.
7
Die Stille ist in mein großes leeres Haus zurückgekehrt. Leo ist endlich eingeschlafen, ich habe ihm einen vorsichtigen Kuss auf die Stirn gehaucht, das Licht ausgeknipst, sein Zimmer verlassen und lautlos die Tür hinter mir zugezogen.
Ich liege im Bett, als ich es höre.
Ein seltsames, undefinierbares Geräusch.
Ein … Poltern.
Es ist jemand im Haus.
Sofort bin ich auf den Füßen. Taste meine Hose, die ich eben erst ausgezogen habe, nach meinem Handy ab, bis mir klar wird, dass es auf dem Esstisch liegt. Das Festnetztelefon befindet sich in der Ladestation – am anderen Ende des Hauses. Verdammt.
Vorsichtig öffne ich die Schlafzimmertür. Bleibe stehen, lausche. Ich stehe da wie erstarrt, alle meine Sinne sind geschärft. Doch ich höre nichts, nur meinen eigenen Atem und die vertrauten knackenden Geräusche des Hauses um mich herum. Da war nichts. Ich bin übermüdet. Ich schließe kurz die Augen, atme tief ein und aus – und da höre ich es erneut. Das Poltern. Es fällt mir jetzt schwer, Atem zu holen. Nur der Wind, sage ich mir. Der Wind. Oder eine Katze. Eine Katze, die irgendwie ins Haus gelangt ist und nun etwas umgeworfen hat.
Nichts Schlimmes, denke ich. Ich glaube mir nicht.
Ich weiß, dass ich das vermutlich nicht tun sollte, aber ich gehe auf das Geräusch zu. Ich weiß selbst nicht so recht, warum, aber ich gehe den nur schummrig erleuchteten Flur entlang. Bleibe erneut stehen, unsicher über die Richtung, die ich nun einschlagen muss. Doch dieses Mal muss ich nicht lange warten, bis ich es erneut höre. Meine Kopfhaut zieht sich schmerzhaft zusammen. Ich habe Angst. Es kommt aus dem Wohnzimmer. Da ist etwas, direkt hinter der Tür. Ich halte den Atem an. Ich stehe direkt vor der Tür und bin wie versteinert, und es wird ganz still, und ich höre nichts mehr, noch nicht einmal meinen Atem, und ich weiß nicht, was ich tun soll, denn ich weiß, dass ich mich nicht einfach umdrehen und weggehen kann, ich weiß nicht, woher ich es weiß, aber ich weiß, dass ich die Tür öffnen muss. Und ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber ich weiß auch, dass ich keine andere Wahl habe.
Wieder ertönt das Poltern, undefinierbar und schrecklich. Meine Hand legt sich auf die Klinke, ganz ohne dass ich es ihr befohlen hätte. Meine Hand drückt die Klinke, ganz ohne dass ich das will, und das Geräusch hinter der Tür verstummt. Was auch immer hinter der Tür ist, wartet auf mich. Ich drücke die Klinke nach unten, ich ziehe die Tür auf. Ich weiß, dass ich nicht sehen darf, was dahinter ist, dass es mich umbringen wird, zu sehen, was dahinter ist, aber meine Hand gehorcht mir nicht, sie zieht die Tür ganz auf. Meine Augen sind weit offen, und die Tür schwingt mir entgegen, und das Poltern rollt über mich hinweg wie Donner, und ich wappne mich für den Anblick, der mich erwartet – und ich höre mich schreien, und ich wache endlich auf.
Einen Augenblick lang starre ich atemlos in die Dunkelheit. Denk jetzt bloß nicht nach über diesen Traum, sage ich mir. Schlaf einfach wieder ein. Doch es gelingt mir nicht, es gelingt mir nie, ich bin nachts so viel durchlässiger für düstere Gedanken. Ich liege da, und sie pirschen sich an. Ich denke an die Sonnenfinsternis, an die vor vielen Jahren und an die von heute, ich denke an die kleine, schwitzige Hand meines Sohnes, die nach meinem Herz tastet, um sicherzugehen, dass es nicht erfroren ist, und ich denke an all die Türen, an all die Gefahren hinter ihnen, vor denen ich mich nicht schützen kann und ihn erst recht nicht. Ich denke, dass die Welt ein gefährlicher, gefährlicher Ort ist, an dem ich nicht alleine bestehen kann.
Ich habe lange nicht von dem Poltern hinter der Tür geträumt und frage mich, was der Auslöser dafür war, dass dieser Alptraum nun plötzlich wieder zurück ist. Zumal ich zu wissen glaube, was hinter der Tür ist. Ich werfe mich im Bett herum, ganz so, als ließen sich die nächtlichen Gedanken durch eine jähe Bewegung verscheuchen wie Raben.
Ich mache Licht. Sage mir dann, dass ich Schlaf brauche, knipse das Licht wieder aus. Schließe die Augen.
Erstens, denke ich: Ich bin eine Betrügerin.
Zweitens: Ich habe jemanden umgebracht.
Drittens: Ich habe ein Tattoo an einer verborgenen Stelle.
Eines davon ist gelogen.
Ich horche in mich hinein, suche vergebens nach dem herrlichen Gefühl von heute Morgen. Der alte, böse Traum hat es vertrieben, und in mir rührt sich nun plötzlich etwas ganz anderes, zögerlich, aber unaufhaltsam, wie ein kleines Tier mit spitzen Zähnen, das erstmals nach langem Winterschlaf den Bau verlässt: die Vorahnung von etwas Schlimmem.
Sommer 2008
Der Moment unmittelbar davor, dachte er, der Augenblick, in dem man schon weiß, dass es geschehen wird, in dem es aber noch nicht geschieht. Der ist alles.
Es wirkte wie eine dieser fließenden Bewegungen, deren scheinbare Mühelosigkeit Ballerinas erst nach Jahren der Übung erreichen – und gleichzeitig vollkommen spontan. Als folgten sie einer geheimen Verabredung, die keiner Sprache bedurfte, begannen sie, ihre Köpfe zu drehen, er seinen blonden in die eine, sie ihren dunklen Lockenkopf in die andere Richtung. Dann trafen sich ihre Lippen.
Es war ein allererster Kuss, das sah er sofort. Die Aufregung, die zwischen den beiden vibrierte, war mit Händen zu greifen.
Er wird sich wundern, wie weich ihre Lippen sind, dachte Philipp, während er dem jungen Pärchen, das ihm schräg gegenübersaß, aus den Augenwinkeln zuschaute. Jedes Mal, wenn man eine Frau zum ersten Mal küsst, wundert man sich, wie weich ihre Lippen sind. Egal, wie viele Frauen man schon geküsst hat, es erstaunt einen jedes Mal aufs Neue.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © 2016 by btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur
Umschlagmotiv: plainpicture/Yvonne Röder
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18525-1V001Besuchen Sie unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de!
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag