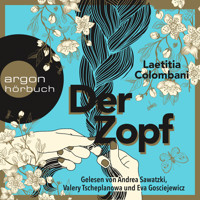9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
»Ein Stern am Literaturhimmel.« Frank Dietschreit in ›rbb kulturradio‹ Eine alte Gewürzplantage auf einer indonesischen Insel, die wispernde und raschelnde tropische Pflanzenwelt, das geheimnisvolle Säuseln des Meeres – dieses paradiesische Fleckchen Erde muss Felicia als Kind verlassen. Doch niemals wird sie die Worte ihrer Großmutter, der Plantagenbesitzerin, vergessen, die ihr zum Abschied sagt: »Auf Wiedersehen, Enkeltochter, ich warte hier auf dich.« – Jahre später kehrt Felicia, inzwischen selbst Mutter, in den »Kleinen Garten« zurück: Auch ihr Sohn Himpies wächst unbeschwert heran, streift über die Plantage und lauscht den Geschichten der einheimischen Dienstboten, bis sich eines Tages eine Tragödie ereignet
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Ähnliche
Maria Dermoût
Die zehntausend Dinge
Roman
Aus dem Niederländischen neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Bettina Bach
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Wenn die zehntausend Dinge in ihrer Einheit gesehen werden,
kehren wir zurück zum Ursprung und bleiben,
wo wir immer gewesen sind.
Tseng Shen
Die Insel
Auf der Insel in den Molukken gab es hier und da noch sogenannte Gärten aus der Zeit des Gewürzanbaus, wenige nur – es waren jedoch nie viele gewesen; und auf dieser Insel hatte man auch früher nicht von Gewürzplantagen gesprochen, sondern immer nur von Gärten.
Diese Gärten lagen heute, genau wie damals, um beide Buchten herum – die Außen- und die Binnenbucht –, mit ihren nach Gewürzarten getrennten Baumgruppen: Nelken bei den Nelken, Muskatnüsse bei den Muskatnüssen; dazwischen vereinzelt einige Schattenspender, meist Kanaribäume; und näher am Wasser, als Schutz vor dem Wind, Kokospalmen oder Platanen.
Keines der Häuser der ersten Plantagenbesitzer war noch erhalten, alle wurden sie von Erdbeben zerstört und anschließend abgetragen. Mitunter war ein Teil stehen geblieben – ein Seitenflügel, ein einzelnes Zimmer –, an den später wieder angebaut wurde, aber meist nur mit Holz, nichts als ein paar schäbige Räume.
Was war schon von der alten Pracht geblieben?
Manchmal jedoch schien in den Gärten noch ein Hauch der alten Zeiten, des längst Vergangenen spürbar zu sein.
An einer sonnigen Stelle zwischen den niedrigen Bäumen, wo es, wenn die Temperaturen steigen, so stark nach Gewürzen duftet –
In einem stillen, verfallenen Zimmer mit einem echten, typisch holländischen Schiebefenster und einer tiefen Fensterbank –
Oder an einem schmalen Strand unter den Platanen, wo die kleinen Wellen der Brandung auslaufen: drei Wellen hintereinander – hintereinander – hintereinander –
Was könnte es da noch geben?
Erinnerungen an Menschen, an frühere Geschehnisse bleiben manchmal beinahe greifbar irgendwo hängen. Vielleicht weiß noch jemand davon oder denkt daran zurück – aber hier war es anders: ohne jeden Halt, ohne Gewissheit – nicht mehr als eine Frage, ein Vielleicht?
Haben zwei Liebende einander damals an dieser Stelle umarmt und »für immer« geflüstert oder haben sie sich im Gegenteil voneinander gelöst und unter den Muskatnussbäumen »Adieu« gesagt?
Spielte ein Mädchen mit seiner Puppe auf der Fensterbank?
Wer stand am Strand und blickte über die drei kleinen Wellen der Brandung hinweg? Über die Bucht? Und wohin?
Eine Stille als Antwort, resignierte und erwartungsvolle Stille zugleich – das Vergangene und das Nicht-Vergangene.
Sonst war nicht mehr viel da.
In zwei Gärten spukte es.
In einem kleineren Garten an der Außenbucht, in der Nähe der Stadt, ging ein Ertrunkener um; das Unglück war jedoch erst vor Kurzem geschehen, heute, könnte man fast sagen! Und in einem weiteren Garten an der Binnenbucht spukten, seit jeher, drei kleine Mädchen herum.
Ihr Wohnhaus war nicht mehr erhalten; selbst das Fundament und die noch lange nach dem Erdbeben und dem Feuer liegen gebliebenen Trümmer waren irgendwann geräumt worden. Ein Gästepavillon war stehen geblieben, unter den Bäumen dicht beim Strand: vier geräumige Zimmer, die von der ehemaligen Seitenveranda abgingen.
Er war sogar noch bewohnt: Die heutige Besitzerin des Gartens lebte dort.
Sie trug einen schönen Namen – Frau von Soundso (so lautete der Name ihres Mannes, Abkömmling eines ostpreußischen Junkergeschlechts) – und war der letzte Spross einer alten Familie holländischer Plantagenbesitzer.
Fünf Generationen war der Garten nun schon in Familienbesitz; ihr Sohn, nach ihr, wäre die sechste Generation gewesen und seine Kinder nach ihm die siebte, doch das sollte nicht sein. Ihr Sohn war jung und kinderlos gestorben, und sie war schon über fünfzig, eine alte Frau ohne weitere Kinder, ohne Verwandte – die Letzte –
Auf der Insel, wo man sich fremde Namen nicht merken konnte, war es üblich, allen einen Beinamen zu geben, und sie wurde die »Dame an der Binnenbucht« genannt oder die »Frau vom Kleinen Garten«, denn so hieß die Gewürzplantage.
»Klein« war aber bloß so dahingesagt: Der Garten war groß, einer der größten der Insel, hinterm Haus reichte er weit hinauf in die Hügel, in den Wald, bis an den Fuß eines steilen Gebirges; nach vorn hin war er von der Binnenbucht begrenzt, zu beiden Seiten von Flüssen.
Der Fluss auf der linken Seite, wo das Gelände flach war, strömte braun und träge unter den Bäumen, er war nicht sehr tief, man konnte fast überall hinüberwaten. Dennoch kamen die Leute aus dem Dorf am anderen Ufer immer auf einem Floß, stakten mit einem Bambusstock hinüber.
Auf der rechten Seite des Hauses senkten sich die Hügel bis zum Strand hinab; ein reißendes Flüsschen stürzte spritzend und schäumend über Felsblöcke, durch ein Tal hindurch und immer weiter bis zur Binnenbucht.
In diesem Tal hauste das Federvieh: Hühner und Enten. Die Kuhställe lagen ebenfalls dort – so viel klares Wasser, um die Ställe und Schuppen zu schrubben – und nicht zu dicht beim Haus.
Hinter dem Pavillon und im rechten Winkel dazu hatte man eine Reihe einstöckiger Nebengebäude mit dicken Mauern quer an einen überdachten Gang angebaut. An einer Seite hing immer noch, in ihrem Glockenstuhl aus Holz, die alte Sklavenglocke; heute wurde sie, falls jemand in der Nähe war, bei der Ankunft oder Abfahrt jeder Prau[1] geläutet – willkommen – auf Wiedersehen; oft wurde es vergessen.
Dahinter begann der Wald, ein lieblicher Wald, mit vielen Pfaden und Lichtungen, vor allem in diesem Teil, dicht beim Haus. Alles, Nützliches und Nutzloses, wuchs wild durcheinander: Gewürz-, Obst- und Kanaribäume voller Nüsse, Palmen – Arengpalmen[2], denen Zucker und Wein abgezapft wurde, viele Kokospalmen, an feuchten Stellen Sagopalmen. Aber auch blühende oder seltene oder einfach nur schöne Bäume.
Eine schmale, gerade Allee, ins Nirgendwo, aus Kasuarinen – hohe Nadelbäume mit langen Nadeln, so strähnig und glatt hinabhängend wie die Federn des Kasuars[3]; in der leisesten Brise aus der Binnenbucht raschelten sie – wispernd – lispelnd – säuselnd, als tuschelten sie ständig miteinander. Die singenden Bäume, so wurden sie genannt.
Ein glasklarer Bach floss durch den Wald; weiter hügelaufwärts wurde ein Teil des Wassers durch einen hohlen Baumstamm zu einem Reservoir geleitet, das an der Vorderseite mit der Skulptur eines von seiner grün bemoosten Mähne umrahmten Löwenkopfes verziert war. Aus dem aufgesperrten Löwenmaul spritzten plätschernd ein paar Wasserstrahlen in ein Steinbecken: groß, aber flach und mit einem breiten gemauerten Rand, auf den man sich setzen konnte.
Das alles lag im Schatten: das Becken, das Reservoir mit der Skulptur, die Baumstämme, der Waldboden; und alles war feucht, dicht bemoost oder mancherorts schwarz und dunkelgrün angelaufen – nur auf dem Wasser, in den durchsichtigen Kräuselungen an der Oberfläche, behielt das Licht all seine Klarheit. Es war die ehemalige, besonders seichte Badestelle für die Kinder; sie wurde nur noch selten benutzt – wo waren die Kinder? Heute tranken die Waldvögel dort.
Dicke graue Ringeltauben mit einem grün glänzenden Halskragen – die Nussdiebinnen – tranken dort in aller Ruhe und vorsichtig gurgelnd, gurrten danach zufrieden. Ein paar glitzergrüne Wellensittiche setzten sich zusammen dicht an den Rand des Beckens, sie interessierten sich mehr füreinander als für das Wasser. Und manchmal ließ sich in einem Wirbel grellbunter Farben – smaragdgrün oder scharlachrot oder vielfarbig, gelb und himmelblau und grün und rot gemischt – ein ganzer Schwarm Loris oder Honigpapageien (oder wie sie sonst noch genannt wurden) mit krummen gelben Schnäbeln beim Becken nieder, sie spritzten mit dem Wasser herum, plantschten, tranken, schlugen mit den Flügeln, pickten wüst aufeinander ein und veranstalteten ein Höllenspektakel – aber nur einen flüchtigen Augenblick –, dann verschwanden sie wieder und die Badestelle blieb still, verlassen und ausgestorben unter den Bäumen zurück.
In der Stille flogen dann – manchmal – einige Kolibris in einem Farbbogen hinunter, strichen übers Wasser, stiegen flügelschlagend wieder auf, federleicht – nie gaben sie Ruhe.
Am Waldrand, aber noch unter den Bäumen, lagen drei Kindergräber nebeneinander im hohen Gras; die Steine zerbrochen, die Inschriften verblasst. Dort waren die drei kleinen Mädchen von früher begraben. Sie hießen Elsbet, Keetje und Marregie; das wusste die Frau vom Kleinen Garten noch, obwohl alle Papiere damals bei dem schrecklichen Erdbeben und dem Feuer verloren gegangen waren. Sie waren die Töchter ihres Ururgroßvaters gewesen.
Bisweilen saßen sie zu dritt am Rand des Wasserbeckens im Wald – pst!
Hinter den Gräbern stieg der Pfad unvermittelt steil zu den Hügeln an. Dort standen nur wenige hohe Bäume, das Land war offen und sonnig und mit dickem gelblichem, nach Kräutern duftendem Gras bewachsen, voller wilder Rosensträucher. Von da oben, über die Baumwipfel, das Haus und die Nebengebäude hinweg, sah die Binnenbucht aus wie ein runder blauer See, hier und da mit hellgrünen Stellen, wo das Wasser flach war, und dunkelgrünen, wo es besonders tief war, drumherum der weiße Saum der Brandung und das üppige Grün des Küstenstreifens.
Hinter den Hügeln kam wieder Wald, Urwald, der aus der Ferne eher dunkelblau und violett als grün wirkte, und dahinter dann das unwirtliche Gebirge.
Da oben ging immer ein Wind.
In den Hügeln weideten die Kühe der Frau vom Kleinen Garten, und die wilden Hirsche grasten dort in aller Ruhe.
Dort spielten auch die drei Mädchen in der Mittagssonne, wenn keiner da war. »Wieder lagen überall abgerupfte Rosenblätter herum!«, sagte der Hirte. »Ach, lass sie nur«, antwortete die Frau vom Kleinen Garten.
Und gelegentlich, nicht häufig, hockten alle drei nebeneinander am Strand an der Binnenbucht unter den Platanen, in einiger Entfernung vom Haus, um sich die angespülten Hornschnecken anzuschauen. Sie schabten die oberste Sandschicht ab (die Spuren waren später deutlich zu sehen), denn Hornschnecken verstecken sich gern – pst.
Jedermann dort kannte die drei Mädchen und alle hielten Ausschau nach ihnen. Sie wollten die Kinder nicht stören; solange sie wegschauten und taten, als wären sie nicht da, spielten diese einfach weiter, sagten sie immer. Die Frau vom Kleinen Garten hatte sie, zu ihrem großen Bedauern, noch nie gesehen.
Aber war es denn nötig, sie zu sehen? Solange sie sich erinnern konnte, wusste sie von ihnen; sie gehörten dazu, hatten einen festen Platz in ihrem Garten auf der Insel in den Molukken und in ihrem Leben.
Bisweilen hatte die Frau vom Kleinen Garten das Gefühl, die Insel läge vor ihr ausgebreitet wie eine Landkarte – mit einer Windrose in der Ecke, wie es sich gehört.
Zwei durch Außen- und Binnenbucht fast gänzlich voneinander getrennte Halbinseln, mit Ausnahme der Landenge an der Binnenbucht (ziemlich dicht beim Garten). »Passo«, so hatten sie vor den Holländern schon die Portugiesen genannt. Heute zogen die Ruderer dort ihre Praue über einen schmalen Bohlenweg von der Binnenbucht zur offenen See – offen und grün und mit sich aufbäumenden, schaumgekrönten Brechern an einem sanft abfallenden Strand.
Es war eine bergige Insel: mit einigen flachen Abschnitten an der Küste, aber auch dort gab es lauter bizarre braune Felsen und Riffe. Sie war stark bewaldet, auf den Bergen und in den Tälern, in der Ebene am Ufer und bis ins Wasser hinein. An der Bucht, neben dem Sumpf mit den lila Wasserhyazinthen, wuchsen mehrere Reihen kleiner glänzender Nipapalmen und düsterer Mangroven auf verdrehten, nackten Stämmen. Auf manchen Zweigen saßen, wie Porzellanfrüchte, Meeresschnecken in ihrem runden weißen Gehäuse.
So viel klares Wasser überall – Süßwasser! – Flüsse, Quellen, Bäche, von den Felsen hinabstürzende Wasserfälle.
Ein ganzes Netz schmalerer und breiterer Wege und Pfade und Treppen war in den Felsgrund gehauen, sie führten zu größeren und kleineren Dörfern: zu christlichen, zu muslimischen – die alten Gemeinschaften mit den Zahlen Neun und Fünf. (Dabei vertragen sich die Fünf und die Neun außerordentlich schlecht!) Zwischen den Dörfern, hier und da, ein »Garten«, eine verfallene kleine Festung, eine alte Kirche mit Wappenschilden aus der Zeit der Ostindien-Kompanie, eine bunt bemalte Moschee aus Holz mit einem schlanken Minarett daneben, eine große gemeißelte Steinplatte auf einem vergessenen Grab – Zum Ewigen Gedenken – ewig dauert so lang! Dann noch die große Stadt an der Außenbucht.
Die Frau vom Kleinen Garten kannte die Insel in- und auswendig, mitsamt dem steilsten Berg, dem tiefsten Urwald; sie war die ganze Küste in einer Prau abgefahren. Sie wusste, wo, da und dort und überall, nie gesehene Bäume und Pflanzen wuchsen, wo seltene Blumen blühten. Oft hatte sie sich über den Rand der Prau gebeugt und, durch ein hohles Bambusrohr lugend, die Seegärten in der Außenbucht bewundert – ein in farbiger Koralle erstarrtes Traumgesicht, unwirklich still, wo nur winzige bunte Fischchen pfeilschnell umherschossen oder ein paar ernste braune Seepferdchen, aufrecht im Wasser stehend, einander unverwandt ansahen. An einer Stelle wuchs nur die seltene rote Koralle und sonst nichts, wie ein rotes Kleefeld unter blauen Wellen.
Sie war beim Martaban-Gefäß[4] aus Steingut gewesen, im Wald hoch oben in den Bergen hinter dem Kleinen Garten; in dem Gefäß sprudelte eine kleine Quelle, die offenbar mit dem Meer in Verbindung stand – wieso hatte das Wasser in ihrem Mund sonst so bitter geschmeckt? Dort wurde in Zeiten großer Dürre um Regen gebetet und es wurden Opfer dargebracht – aber das durfte keiner wissen.
Und erst die Menschen auf der Insel!
Die Frau vom Kleinen Garten kannte sie nicht alle – natürlich nicht! Aber doch viele: einen alten Radscha – die Familie hatte einen portugiesischen Namen –, und noch einen und noch einen; jenen Priester, einen Muslim, der alle Geschichten über »Heilige Kriege« und »Helden des Glaubens« kannte (an dieser Stelle der Insel war ständig gekämpft worden, und er war selbst ein ganz schöner Haudegen); christliche Religionslehrer, die »Schulmeister« genannt wurden, unter ihnen große Prediger; einen Dichter-Sänger, einen Vortänzer oder eine Vortänzerin, eine weise Frau (eine Bibi[5]), die heilen und krank machen konnte, den Menschen Zauber auferlegte, Geister beschwor.
In der Stadt die Holländer, immer geschäftig, immer auf dem Sprung. Selten blieb einer da, selten wurde einer hier begraben und blieb dann für immer.
Und Reisende aus aller Welt, die in den Molukken vom Schiff aus – schnell – schnell – schnell – alles Mögliche kaufen wollten – Muscheln, Koralle, nicht vorhandene Perlen, Schmetterlinge, altes Porzellan, Orchideen, Vögel; am Ende mussten sie sich mit einem kleinen Korb aus Gewürznelken, gefüllt mit Blumen auf einem Bett aus bunten Sittichfedern, zufriedengeben – die Armen – und schon standen sie wieder an der Reling und vergaßen zu winken. Seltsame Leute!
Seltsame Leute gibt es überall, auch auf der Insel.
An der Bucht hatte man der Frau vom Kleinen Garten die verlassene Hütte eines Mannes und eines Jungen gezeigt, die noch vor nicht allzu langer Zeit dort wohnten, aber eigentlich ein großer und ein kleiner Hai waren – die beiden hatten nie gelacht, ihrer spitzen Zähne wegen nicht. Dann waren sie fortgegangen. Wohin? Bestimmt schwammen sie jetzt zusammen in der Bucht.
Wenn sie nur genügend Geduld hätte, würde sie vielleicht einmal die alte Frau zu Gesicht bekommen, die »Mutter der Pocken«; in Häusern mit Kindern hängte man immer einen Dornenzweig an die Tür, um ihr den Zutritt zu verwehren – von Weitem konnte sie nicht viel Schaden anrichten! In den letzten Jahren war sie allerdings nur selten gesehen worden.
Dafür hatte sie den »Mann mit dem blauen Haar« oft gesehen. Er war nur ein gewöhnlicher Fischer aus dem nahe gelegenen Dorf, der sich mit Indigo sein krauses graues Haar schön leuchtend blau färbte, immer wieder. Das musste er tun: Sein einziger Sohn kämpfte als Soldat irgendwo in der Ferne, ein Held! Die jungen Männer im Dorf sangen im Mondlicht Pantune[6] über ihn, zählten seine Schlachten auf, die Bentengs[7], die er erstürmt hatte, seine Siege, seine Wunden – und dann sollte sein Vater ein gebrechlicher, weißhaariger Alter sein? Unmöglich!
Manchmal lauschte die Frau vom Kleinen Garten der Insel. Wie die Buchten rauschten? Die Binnenbucht rauschte anders als die Außenbucht, und das offene Meer weiter weg wieder auf seine Weise. So säuselte der Landwind und so der Seewind und so heulte der Sturmwind, der Baratdaja heißt.
So klangen die Tifas[8] und der Gong, zu deren Rhythmus in den großen Prauen gerudert wurde; so das leise Klimpern der aufgefädelten leeren Muschelschalen, die am Mast oder am Vordersteven hingen und mit denen der Wind gern spielte; so der kurze, dumpfe Schlag, mit dem sich die Praue »verlegten«, von einem Ausleger auf den anderen.
Sie war musikalisch und merkte sich alle Melodien – die der Tanzlieder, die der Weisen; hier schlug man noch auf die kleinen Kupferzimbeln aus Seram, dem »Land am anderen Ufer«; dort blies man in die innen leuchtend orangefarbenen Tritonshörner. Einmal machte sie eine weite Reise, um einen bestimmten Sänger das herrliche »Lied der sterbenden Fische« singen zu hören, wie nur er es zu singen vermochte.
Und dann die vertrauten Klänge: die Stimmen der Erwachsenen und die der Kinder und die Tierlaute; dazu Musik, Alltagslieder aus dem Dorf am anderen Flussufer, vom Garten.
Jemand, der im Mondschein ein Liebeslied sang: »Der Abend ist zu lang, Liebste, und der Weg zu weit« – andere klatschten dazu in die Hände – eine einzelne Bambusflöte – schmachtend.
Ein Schlaflied für ein Kind oder eine Geschichte, die ihm vorgesungen wurde, die Kriegsgesänge der wilden Berg-Alfuren, der Kopfjäger auf Seram.
Und selten, sehr selten, das alte heidnische Klagelied (Vorsicht, der Schulmeister darf es ja nicht hören!) für einen soeben Verstorbenen. »Die hundert Dinge«, so hieß das Lied – die hundert Dinge, an die man den Toten erinnerte, die man ihn fragte, die man ihm erzählte.
Nicht nur über die Menschen in seinem Leben: dieses Mädchen, jene Frau und auch jene, dieses Kind, jenes Kind, dein Vater, deine Mutter, ein Bruder oder eine Schwester, die Großeltern, ein Enkelkind, ein Freund, ein Waffengefährte. Oder über seinen Besitz: dein schönes Haus, die auf dem Dachboden versteckten Porzellanteller, die schnelle Prau, dein scharfes Messer, der Handschild mit Einlegearbeit aus alten Zeiten, die zwei Silberringe an deiner Rechten, am Zeigefinger und am Daumen, die zahme Ringeltaube, dein kluger schwarzer Lori. Aber auch: Höre, wie der Wind weht! Wie weiß schäumend die Wellen von der Hochsee herbeischnellen! Sieh, wie die Fische aus dem Wasser springen und miteinander spielen – sieh nur, wie die Muscheln am Strand glänzen – denke an die Korallengärten unter Wasser und an ihre Farben – und an die Bucht! Die Bucht! Die Bucht wirst du doch wohl nie vergessen! Und dann sagten sie: O Seele von diesem oder jenem, und schickten zum Schluss ein lang gezogenes, schwermütiges »ä-ä-ä-ä, ä-ä-ä-ä?« übers Wasser.
Oder die Frau vom Kleinen Garten lauschte zusammen mit den anderen dem Hämmern vom gegenüberliegenden Ufer der Binnenbucht, wo früher die portugiesische Schiffswerft gewesen war – jetzt standen nur noch Bäume dort; ein Holzhammer klopfte auf einen Balken (damals wurden die schönen Galeonen mit dem reichen Schnitzwerk auf der Werft gerichtet, sicher wurde dort auch mal einen Galgen gezimmert), ganz deutlich übers Wasser hinweg vernehmbar – konnte es ein Vogel sein?
Und die alte Sklavenglocke im Kleinen Garten, die geläutet werden sollte, wann immer eine Prau kam oder wieder fuhr.
Manchmal sog die Frau vom Kleinen Garten die Düfte der Insel tief ein, Gewürze, die zum Trocknen lagen, Nelken, Muskatnuss, Mazis oder Zitronengras, die Rinde des Kajeputbaums[9] oder Vanille. Verschiedene Zitronenarten, andere Früchte, Durians – die konnte sie nicht leiden! –, alle Blumen und Gewürze aus dem Garten. Aber auch, wenn der Wind von See kam, den Gestank trocknender Koralle und den säuerlichen Schlammgeruch vom Sumpf an der Landenge.
Weihrauch – den echten arabischen –, wie ihn ihre Großmutter verbrannt hatte.
Graue und schwarze Ambra, Benzoe, pflanzlichen Moschus, das »allerbeste« Rosenwasser, arabischen Styrax oder stattdessen gemahlenes Wurzelholz – das waren die Zutaten für die Ambrakugeln.
Und in ihrem Zimmer stand auf einem hohen Fuß immer noch der alte Holzmörser, in dem früher die Schalen einiger Muscheln vorsichtig zerbrochen wurden, bloß nicht zerstampft, und dann dem trockenen Räucherwerk beigemischt. Meer-Onyx, der Duft des Meeres. »Es gibt dem Räucherwerk erst eine männliche Kraft und Ausdauer; vergleichbar mit einem Bass in der Musik«, wie Herr Rumphius[10] es ausdrückte.
Das waren schon viele Dinge, aber nicht alle, und nicht genug. Daneben gab es noch die Phantasiegestalten, die Figuren aus den Tänzen und Liedern und Erzählungen; einfach so, frei erfunden – wie sollte sie die alle aufzählen?
Allein schon an der Binnenbucht:
Gleich vorn an der Spitze, wo die Bucht am schmalsten war und durch den Sog der Gezeiten am tiefsten, ging manchmal ein Matrose auf dem Kap spazieren, ein junger Portugiese, der hier einst ertrunken war; er hatte nach Hause zurückkehren wollen, hatte aus der Ferne seinen Namen rufen hören, Martin hieß er.
Oder Martha, die junge Tochter des Radschas eines Dorfes, das es nicht mehr gab. In einer Mondnacht hatte sie versucht, auf ihrem Pferd ans andere Ufer zu reiten, zu ihrem Geliebten, dem armen Fischer ohne Prau – die Praue aus ihrem Dorf hatte ihr Vater weit oben anbinden lassen. Sie gelangte immer ans andere Ufer – sie gelangte nie ans andere Ufer –
Unter dem Kap, in einem Felsspalt, lag der Krake auf der Lauer, aber nicht etwa ein kleiner Tintenfisch, von denen es in der Bucht nur so wimmelte – nein, der Riesenkrake, der Eine, dessen acht ellenlange, fuchtelnde Fangarme sämtlich voller Saugnäpfe waren und der aus zwei schwarzen runden Äuglein spähte. Er sah alles, denn er konnte im Hellen sehen und er konnte im Dunkeln sehen, doch kein Mensch konnte den Kraken sehen.
Alle Fischer, alle Ruderer hatten von ihm gehört, jeder Steuermann nahm sich in dieser Gegend gehörig in Acht.
Weiter weg der große lilafarbene Sumpf und die Landenge und der schmale Weg aus Baumstämmen, von wo oft ein schwerfälliger, stark skandierter Gesang drang, wenn die Männer ihre Praue zur offenen See zogen.
Noch etwas weiter weg in derselben Richtung das nahe gelegene Dorf, wo nicht nur der »Mann mit dem blauen Haar« wohnte, sondern auch die Frau, die als Vortänzerin den Muscheltanz anführte. Einmal, vor langer Zeit, hatte die Frau vom Kleinen Garten dem Tanz zugesehen – eigentlich durfte man das nicht. Heute wurde er nicht mehr getanzt, weder im Dorf am anderen Flussufer noch anderswo. Aber sie hatte es nie vergessen.
Begleitet von vielen Gongs und Trommeln, einer einzelnen Flöte, hatte die Vortänzerin begonnen zu tanzen. Auf dem offenen Platz unter den Bäumen war sie barfuß, ohne Kopfbedeckung, in einem engen, dunklen Wickelrock und einer Jacke, langsam und vorsichtig einige kleine Schritte gegangen, vorwärts, rückwärts, hatte sich erst um die eigene Achse gedreht und dann weiter in einem immer größer werdenden Kreis: bis ihr ganzer Körper von einer Wellenbewegung erfasst wurde, als ginge sie über Wasser, übers Meer. Dabei hielt sie eine große helle, fast durchsichtige Muschel in die Höhe, wie aus zerknittertem Pergament – die Nautilus, die Kammertuchs-Haube –, weit hoch mal in der rechten Hand, mal in der linken, mal in beiden Händen. So schritt sie voran und alle Männer und Frauen aus dem Dorf, ebenso dunkel wie sie – die Gemeinschaft – folgten ihr langsam, folgten der weißen Muschel. Wohin?
Wohin führte sie sie mit der Muschel? Irgendwohin musste sie sie schließlich führen.
Welche Bedeutung hatte die Muschel?
Als die Frau vom Kleinen Garten spätnachts zurückkehrte (einer ihrer Leute setzte sie über) und sie sich auf dem Floß stehend noch einmal umdrehte, waren die tanzenden Menschen, auch die Vortänzerin mit den in die Höhe gestreckten Armen, von der Dunkelheit verschluckt gewesen; und die große weiße Muschel schien losgelöst in der Luft zu schweben, im dunstigen Schein des späten Mondes zwischen den Bäumen – außerirdisch hell, über alles Schwere und Dunkle erhaben.
Damals hatte sie gedacht, dachte es bisweilen noch: Ob eine Muschelschale Trost spenden kann? Ob sie Tränen trocknen kann?
Neben dem Dorf, im Kleinen Garten, lagen also die drei Mädchen, die kleinen Töchter des ersten Plantagenbesitzers, die alle drei am selben Tag gestorben waren. Gewiss bei dem Erdbeben und dem Feuer? Nein! Nicht bei dem schrecklichen Erdbeben und dem Feuer.
Und die Korallenfrau!
Die Korallenfrau durfte sie wirklich nicht vergessen, ihre Geschichte konnte man sogar bei Herrn Rumphius nachlesen: Ein kleines Stück hinter dem Garten wohnten früher ein paar Javaner an der Binnenbucht, eine einzige Großfamilie, sonst niemand. Als die Prau, in der sie die Bucht überquerten, vor Anker ging, beugte sich eine junge Frau über den Rand, um ins Wasser zu schauen, zu den Korallen in der Tiefe – vielleicht suchte sie nach jenem Baum, der Kokospalme des Meeres, die schließlich ebenfalls aus Koralle besteht.
Sie beugte sich zu weit vor, fiel ins Wasser, kopfüber, und tauchte nicht wieder auf, erst sehr viel später, als die Korallenfischer an dieser Stelle ein großes Stück Koralle in der Gestalt einer Frau hochholten. Das war sie! Die Javanerin! Ohne jeden Zweifel. Ihr Kopf hatte in den Korallen festgesteckt und sie ächzte, als sie ihn herauslösten – sagten die Fischer.
Danach stand sie jahrelang im Garten des Herrn Rumphius, der sie für fünf Silbermünzen erworben hatte. Er steckte etwas Blatterde, vermischt mit den Samen winziger blühender Kletterpflanzen, in die kleinen Korallenlöcher, sodass die nackte Korallenfrau nach einer Weile von einem züchtigen Blumenkleid bedeckt war.
Ob er wohl gelegentlich zu ihr ging und sie mit seinen fast blinden Augen betrachtete, vielleicht abends, wenn es still war, dunkel und hell im Sternenlicht, und sie fragte – ob sie?
Herr Rumphius glaubte nämlich auch an die Kokospalme des Meeres: Schließlich mussten die mal hier, mal dort angespülten Kokosnüsse irgendwo herkommen, nicht wahr? Ganz anders als gewöhnliche Kokosnüsse, fast doppelt so groß, nicht rund, sondern länglich, von den Wellen und der Brandung glatt poliert, beinahe schwarz und hart wie Stein.
Nirgends wuchsen Kokospalmen, die solche Nüsse trugen, weder auf dieser Insel noch auf einer anderen der »tausend Inseln«, nicht auf den großen Inseln weiter weg oder auf dem Festland. Alles, was Rumphius darüber in Erfahrung brachte, schrieb er auf: Manche Leute behaupteten, die Palme wachse demzufolge nicht an Land, sondern unter Wasser, in einem Strudel, dem »Nabel der Meere« – das konnte er nicht glauben! Eher an einer ruhigen, abgeschiedenen Stelle – aber im Tiefen, dachte er, in einer Bucht, einer solchen Bucht wie der Binnenbucht etwa.
Angeblich hatte die Palme einen schwarzen Stamm und schwarze Zweige (wie die kleinen Korallenbäume). Ob sie wohl auch schwarze, gefiederte Wedel hatte wie die gewöhnlichen Kokospalmen? Dessen war er sich nicht sicher, unter Wasser war Schwarz schließlich nicht immer Schwarz, sondern manchmal Dunkelblau mit einem Stich ins Lilafarbene und bisweilen Purpurrot. Eine Krabbe und ein Vogel gehörten zu der Palme, die Korallentaucher hatten sie zwar gesehen, doch sie konnten nie zu ihr gelangen.
Hatte Herr Rumphius die Korallenfrau wohl gefragt, ob sie – vielleicht – in ihrer Zeit da unten?
Er wollte doch so sterbensgern die Kokospalme des Meeres sehen – sei sie nun schwarz oder dunkelblau oder rosarot (samt Krabbe und Vogel) im tiefen blauen und grünen Wasser der Binnenbucht –, ein einziges Mal, bevor er völlig erblindete; das konnte nicht mehr lange dauern.
Was hatte die Korallenfrau ihm geantwortet, was ihr verschlossener Korallenmund kundgetan?
Die Frau vom Kleinen Garten hatte sie sehr gern, denn sie hatte Herrn Rumphius sehr gern. Seine zwei Werke gehörten seit jeher zum Haus im Kleinen Garten; zusammen mit ihrer Großmutter hatte sie in den vielen Bänden des Herbariums nach Pflanzen und Heilkräutern gesucht, und in der Raritäten-Kammer zusammen mit ihrem Sohn die Namen von »Muscheln und Schnecken und Quallen und allem, was da kreucht und fleucht«.
Sie selbst gehörte ebenfalls zur Insel – hier, in ihrem Garten an der Binnenbucht vor dem Pavillonhaus, unter den Platanen, mit den Wellen der Brandung zu ihren Füßen.
Alle wussten, wie sie aussah: klein und gedrungen, in einem gebatikten Sarong[11] und einer schlichten Kebaya[12] aus weißer Baumwolle mit einem schmalen Spitzensaum oder ganz ohne Spitze, nicht von einer schönen Brosche zusammengehalten, sondern nur von ein paar Sicherheitsnadeln; die nackten Füße in soliden Ledersandalen. Braun gebrannt, voller Sommersprossen und Sonnenflecken, nie bedeckte sie ihren Kopf, ihr widerspenstiges, grau meliertes Haar.
Die Leute hatten sie gesehen oder zumindest von ihr gehört. Auf der ganzen Insel wurde über sie geredet, manchmal im Flüsterton – so wie früher über ihre Großmutter und deren Großmutter vor ihr (die Männer in der Familie boten wenig Anlass zu reden oder zu flüstern).
Ihr wurde nicht viel Böses nachgesagt. Warum auch?
Sie war beliebt! Heute jedenfalls, früher nicht, und sie war eine durch und durch gebieterische Frau, immer wollte sie erst alles haargenau wissen, dann aber war sie hilfsbereit, wo Hilfe nötig war, und voller Mitgefühl für den anderen.
Sie selbst hatte im Leben einiges erlitten: Die Großmutter, der sie alles zu verdanken hatte, war tot, ihre Eltern ebenfalls – die hatten sich aber nie viel aus ihr gemacht, Geschwister hatte sie keine, ihr Mann – niemand wusste wirklich über ihn Bescheid: ein »feiner Herr«, hieß es, doch niemand kannte ihn, er war nie auf der Insel gewesen, war wohl schon vor vielen Jahren gestorben; und jetzt, vor nicht allzu langer Zeit, auch noch ihr Sohn, ihr einziges Kind.
Und so hatte sie niemanden mehr.
Dennoch gab es da diese eine Sache, bei der sie es zu weit trieb.
Einen Tag, eine Nacht im Jahr – der Tag, an dem ihr Sohn gestorben war – wollte sie allein sein. Das mochte ja noch angehen, aber sie verbannte sogar alle ihre Dienstboten samt Familie aus dem Garten und schickte sie weg, in die Stadt an der Außenbucht. Besucher empfing sie an diesem Tag auch nicht, und falls doch jemand kam – nicht aus Neugier, nein, um sie aufzumuntern! –, bat sie ihn, seinen Besuch auf einen anderen Tag zu verschieben, und schickte ihn, ganz gleich, wer es war, den weiten Weg in der Prau zurück.
Ein einziger Tag, eine Nacht im Jahr, die sie den Toten widmete. Und das sollte übertrieben sein?
Aber darum ging es gar nicht! Diesen Tag und diese Nacht widmete sie nicht den Toten, sondern nur jenen, die in diesem Jahr auf der Insel ermordet worden waren.
Nicht jedes Jahr geschah ein Mord, zum Glück nicht! In manchen Jahren ereignete sich gar keiner. Es war eine friedliche Insel, aber dennoch, manchmal kam es vor –
Wie in diesem gewissen Jahr zum Beispiel, da waren es vier gewesen. Vier? Oder doch drei? Aber drei ganz bestimmt! Bei einem stand nicht fest, ob er ermordet wurde oder nicht. Jedenfalls war er in der Bucht ertrunken.
Fast alles, was auf der Insel geschah, kam der Frau vom Kleinen Garten zu Ohren; und wenn ein Mord verübt wurde, machte sie sich umgehend auf und wollte die näheren Umstände erfahren, wollte wissen, wo es geschehen war, wer ermordet worden war, wer der Mörder war, warum, womit – Letzteres war ihr eigentlich gleichgültig; sie war weder krankhaft neugierig noch war sie der Meinung, etwas aufklären zu müssen, das überließ sie der Justiz. Sie hatte bloß Mitleid mit dem Ermordeten und den Hinterbliebenen; sie wollte verstehen, wie es dazu gekommen war, für Linderung sorgen, wenn sie konnte – das war meist nicht der Fall.
Was sie aber tun konnte, war, der Ermordeten an diesem einen Tag im Jahr zu gedenken. Sie zündete keine Kerzen an oder legte Blumen nieder oder solchen Firlefanz; sie verbrannte auch keinen Weihrauch, Weihrauch hatte sie noch nie gemocht – sie gedachte dieser Menschen einfach nur und weiter nichts.
Damit hatte sie nach dem Tod ihres Sohnes begonnen. Jetzt sprach sie nicht mehr darüber, wie zu Anfang gelegentlich noch; denn ihr Sohn war ebenfalls ermordet worden, oder zumindest war sie dieser Meinung.
Das nahmen ihr manche Leute beinahe übel, die jungen Offiziere aus der Garnison in der Stadt an der Außenbucht wollten es ihr noch einmal ausführlich erklären: dass ihr Sohn, ein Offizier wie sie, ein Waffenbruder, gefallen war. Nicht bei einem offenen Kampf, das nicht, er war aus dem Hinterhalt erschossen worden; aber jemanden aus dem Hinterhalt zu erschießen verstößt bei Gefechten nicht gegen die Regeln – er war ehrlich gefallen! Da durfte man nicht von einem Mord sprechen.
Doch ihnen gegenüber sprach die Frau vom Kleinen Garten nicht von Mord, und wenn sie sie trafen, sagten die jungen Offiziere nichts davon, was es hieß zu fallen.
Ein paar Alte, die bisweilen noch über »solche Dinge« sprachen, fragten sich flüsternd, ob sie etwa doch geheime Kräfte besaß – ob sie deshalb unbedingt allein sein wollte? Aber es war nichts darüber bekannt, dass sie sich mit »solchen Dingen« beschäftigte. Sie ließ auch nie eine weise Frau zum Geisterbeschwören in den Garten kommen, wie ihre Großmutter früher, zu Lebzeiten.
Ihre Großmutter! Ach, die! Das war etwas anderes, die hatte ganz bestimmt geheime Kräfte gehabt, ohne jeden Zweifel! Aber die Frau vom Kleinen Garten nicht, sonst hätte sie doch wohl mal die drei spukenden Mädchen in ihrem eigenen Garten gesehen – wenn doch alle anderen sie sahen.
All das und noch viel mehr und der Himmel über ihr machten die Insel aus.
Der Kleine Garten
Das Mädchen wurde im Kleinen Garten geboren und seine Mutter wollte es Felicia nennen. Der Vater war damit einverstanden, wie immer, wenn die Mutter etwas wollte. Die Großmutter nicht. »›Die Glückliche‹! Dass du es wagst, dein Kind ›Die Glückliche‹ zu nennen! Wie willst du das denn vorhersagen?«
Doch die Mutter ließ sich nicht davon abbringen.
Die Großmutter nannte das Kind kein einziges Mal beim Namen. »Enkeltochter«, sagte sie immer, und ab diesem Moment »Sohn« und »Schwiegertochter« zu den Eltern – Enkeltochter und Sohn waren freundliche Wörter, Schwiegertochter nicht!
Das Mädchen verbrachte die ersten sieben, ja fast acht Jahre seines Lebens auf der Insel in den Molukken. In der Stadt an der Außenbucht besaß die Familie ein altes Haus und dort wohnte sie mit ihren Eltern, weil ihre Mutter nicht im Kleinen Garten wohnen wollte und weil sie immer das machte, was sie wollte, und nie, was sie nicht wollte; sie konnte es sich leisten, denn ihr gehörte alles Geld. Ihre Familie besaß eine Zuckerplantage auf Java, und das war doch wohl was anderes als ein kümmerlicher Gewürzgarten auf einer Insel in den Molukken!
Ihr Vater ging oft zum Garten, fast jede Woche, und manchmal durften Felicia und ihr Kindermädchen mit.
Es gab nichts Schöneres für sie als einen Besuch im Kleinen Garten an der Binnenbucht!
Allein schon, weil sie in einer Prau hinfuhren: Zuerst gingen sie die Allee hinter der Festung entlang – dem »Schloss« – zu einer überdachten Anlegestelle, wo die Prau ihrer Großmutter sie schon erwartete.
Wenn sie im Garten ankamen, wurde die Glocke geläutet.
Bei Flut konnte die Prau an einer Steinmole in der Binnenbucht anlegen, bei Ebbe trugen die Ruderer sie einen nach dem anderen auf einem Stuhl ans Ufer; manchmal hob einer von ihnen Felicia mit Schwung aus der Prau und setzte sie sich auf die Schultern, Ruderer sind bärenstark!
Später durften sie und das Kindermädchen ab und zu die Fischer aus dem Dorf am anderen Flussufer ein Stück in ihrem Boot begleiten, meist einer Auslegerprau mit Segeln. Wenn es windstill war, pfiffen die Fischer und baten »den Herrn Wind«, doch zu kommen und sein langes Haar zu lösen. Sie sangen und lachten und unterhielten sich und zogen Susanna, das Kindermädchen, wegen ihrer dicken Arme und Beine auf.
Die Großmutter besaß eine weitere Prau, groß und ohne Ausleger, eine Staatsprau, in der beim Rudern getrommelt und ein kleiner Gong geschlagen wurde, doch die wurde nur selten benutzt. Dann saß Felicia immer mäuschenstill da und seufzte, weil es so schnell wieder vorbei war.
Im Garten konnte sie ein Stück ins Meer waten (aber Susanna musste achtgeben, dass keine Seeigel da waren), sie konnte am Strand unter den Platanen Muscheln suchen und im Wasserbecken im Wald baden. Sie durfte, sogar im Zitronengarten, beim Obstpflücken helfen; zwischen den Zitronenbäumchen standen einige größere Pampelmusenbäume, darunter eine Sorte mit rotem Fruchtfleisch. »Weil du ihn so gern magst, Enkeltochter, gehört der Baum dir«, sagte die Großmutter. »Du hast recht: Die roten Pampelmusen sind viel süßer als die weißen.« Sie durfte im Wald Kanarinüsse sammeln, durfte den »singenden Bäumen« lauschen.
Aber im Wald wohnte auch das Palmweinmännchen!
Bevor eine hohe Arengpalme angezapft wurde, hängte der Zapfer zum Schutz vor Dieben ein aus rohem Holz geschnitztes Männchen in den Baum: Es war gut eine halbe Elle groß, in Lumpen gekleidet, mit Schnurrbart und einer Perücke aus schwarzen Palmhaaren, einem feuerrotem Mund, weiß-schwarz funkelnden Augen; mitten durch seinen Leib steckte ein schwarzer Rattandorn, fast so lang, wie das Männchen groß war, fingerdick und so spitz wie eine Nadel, von hinten nach vorn hindurchgebohrt.
So weit oben in der hohen Palme konnte das Männchen nicht viel Böses anrichten, aber manchmal kletterte es geschwind die schmale Leiter aus Rattantau hinunter und verfolgte jemanden mit seinem Stichel. Dann musste man sich in Acht nehmen, sich rechtzeitig verstecken!
Susanna, das Kindermädchen, hielt immer und überall Ausschau nach dem Männchen, aber Felicia vertraute ihr nicht.
Bisweilen begleiteten sie den Kuhhirten – dann waren sie in Sicherheit – aus dem Wald und in die Hügel, vielleicht würden sie ja einen wilden Hirsch sehen. Felicia glaubte, dass sie vor einem wilden Hirsch keine Angst hätte, nicht einmal von Nahem; vor den Kühen aber fürchtete sie sich, selbst aus der Ferne.
Und sie ging allein mit Susanna in das grüne, das stille Tal, wo es wegen der gackernden Hühner und der schnatternden Enten nie völlig still war. Aus den Hühnern machte sie sich nichts, die stoben davon, wenn man mit dem Arm wedelte und »sch« machte – die Enten konnte sie jedoch nicht ausstehen.
Enten waren falsch und gemein! Nicht im Fluss, wenn sie tauchten und schnatterten und sich langsam mit der Strömung in Richtung Binnenbucht treiben ließen – aber dort, am Strand, wurden sie zu plumpen, grausamen Viechern, die allem hinterherwatschelten und es, wenn es nicht schnell genug entkommen konnte, auffutterten, vor allem die niedlichen Entenkrabben.
Einmal hatte Susanna ihr eine zum Anschauen auf die Hand gelegt: Ihr Panzer war glatt und leuchtend braun, kaum größer als der Nagel eines kleinen Fingers, acht hellrote Beinchen, zwei rote Miniaturzangen, eine rechts und eine links. Arme kleine Krabben, die sich von vornherein geschlagen gaben, die zarten roten Beine und Zangen anzogen, sich zu einer Kugel zusammenrollten und sich so, bei lebendigem Leibe, von den Enten hinunterschlucken ließen.
»Es sind gute Krabben«, sagte Susanna, »sie tun niemandem etwas zuleide, sie sitzen bloß still im Bauch der Enten. Ab und zu strecken sie ein Beinchen aus und kitzeln sie, das mögen die Enten und legen gleich ein Ei! Aber wehe, wenn die Enten diese anderen, ganz braunen Krabben verschlucken, die zwicken ihnen von innen den Bauch kaputt.«
»Sterben die Enten dann?«, fragte Felicia. Ihr wäre nichts lieber gewesen als das.
Natürlich starben sie dann!
Felicia schien es, als wären bisher nur niedliche Entenkrabben verschluckt worden; die Enten waren immer noch gleich zahlreich und gleich lebendig.
Aber das war alles nichts im Vergleich zu dem anderen: zu dem Schrecklichen, dem ganz Schrecklichen dort, im Tal beim Flüsschen – eine große, offene weiße Muschel, die Trinkschüssel der Hühner, und in dieser Muschel hatte das Biest gewohnt, wohnte es immer noch –, der Leviathan, sagte Susanna – sie sprach es Ewijatang aus.
Susanna, ihr damaliges Kindermädchen, hatte eine Krankheit, die ihre Arme und Beine anschwellen ließ, sodass sie aussahen wie pralle braune Würste, an denen die Hände und Füße mit ausgestopften dicken Fingern und Zehen hingen; dennoch waren die unförmigen Hand- und Fußgelenke noch beweglich und sie konnte mit ihnen flink zupacken (und die Krankheit war nicht ansteckend, hatte der Arzt gesagt).
Susanna war Felicia ein bisschen unheimlich: zum einen wegen dieser dicken Arme und Beine, zum anderen aber, weil sie sich manchmal sehr seltsam verhielt. Sie war äußerst fromm und nahm Felicia immer an menschenleere Orte mit. Das tat sie zu Hause, in der Stadt an der Außenbucht, aber auch im Kleinen Garten – damit sie ungestört ihre Psalmen aufsagen konnte.
Sie kannte alle Psalmen auswendig und rezitierte sie auf Malaiisch, mit lauter Stimme, und so lernte Felicia sie ebenfalls. In ihrem Alter können sich Kinder Texte leicht merken, ob sie sie nun begreifen oder nicht.
Susanna hatte einen Lieblingspsalm: den hundertvierten. Felicia konnte ganze Abschnitte von Psalm 104 auf Malaiisch aufsagen, ohne ins Stocken zu geraten. Dabei war es ein schwieriger Psalm, viele unbekannte Tiere kamen darin vor: die Waldesel, die Störche in den Tannen (Störche, das waren die Vögel Lakh-lakh), die Steinböcke aus den hohen Bergen, die Kaninchen in den Felsspalten und die brüllenden jungen Löwen (Löwen hießen Singa) und dazu all das wimmelnde Getier im Meer, groß und klein, und die Schiffe und der wirklich, wirklich entsetzliche Ewijatang!
Ebendieser Ewijatang war es, von dem Susanna behauptete, er wohne genau hier – in der Muschel unter den Bäumen beim Flüsschen in dem grünen, dem stillen Tal im Kleinen Garten.
Die Muschelschale war gigantisch, bestimmt einen Meter im Durchmesser, außen mit einer Art rauem Kalk besetzt, tief gefurcht und am Rand gezackt, innen glatt und elfenbeinfarben – dabei war es bloß die eine Hälfte. Niemand wusste, wo die andere Hälfte abgeblieben war.
Früher hatte es zwei gleiche Muschelschalen gegeben, die exakt aufeinanderpassten und an einer Stelle unauflösbar miteinander verbunden waren; nur das Biest in ihrem Innern war stark genug, die zwei zentnerschweren Schalen nach Belieben zu öffnen und zu schließen.
Susanna führte ihr vor, wie es das machte: Sie legte die schweren Handgelenke sorgfältig zusammen, hielt die dicken braunen Hände in Form einer Muschel mit den Fingerspitzen aufeinander; dann klappte sie die Schalen ruckartig auf – zu – auf – zu. Sie hatte eine solche Kraft in den Händen, dass ihre Fingerkuppen jedes Mal deutlich hörbar aufeinanderprallten.
»So!«, sagte sie. »So!«
Und dann beschrieb sie das mit der Muschel verwachsene Biest. Es sah furchterregend aus: dick und unförmig wie ein großer, voller Sack, und seine Haut war ledrig, fleckig und gestreift wie die einer Schlange, aber doch anders: weiß mit braun und schwarz und dazu dunkelblau. Außerdem war es blind!
»Ohne Augen«, flüsterte Susanna dann und kniff ihre Augen zusammen.
Felicia wusste nicht, warum, doch das fand sie am schrecklichsten von allem.
Einen Mund hatte das Biest aber und konnte fressen, oder jedenfalls saugen.
Und die Muschelschalen hatten damals nicht weithin sichtbar auf der Erde gelegen – unter Wasser lagen sie, am Grund der Bucht, an einer flachen Stelle, versteckt zwischen den Korallen und überwuchert von Algen und langem Seegras.
Zuerst drückte das Biest also die beiden Schalen – vorsichtig – einen Spalt auseinander, sagte Susanna, und noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen mehr und wartete dann vollkommen reglos ab, bis jemand kam – ein Korallentaucher oder ein Fischer oder jemand anderes – und in diesem Moment musste Felicia, ob sie wollte oder nicht, die Hand oder den Fuß in die Schale legen.
»So!«, sagte Susanna und ließ blitzschnell und mit aller Gewalt