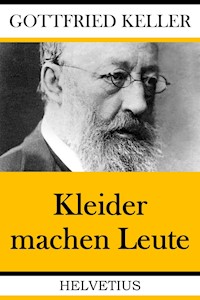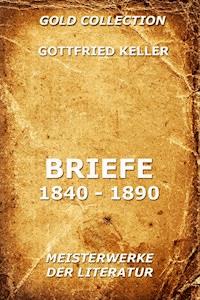1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Buch 'Dietegen' von Gottfried Keller ist ein Meisterwerk der Schweizer Literatur des 19. Jahrhunderts. Es erzählt die Geschichte eines jungen Mannes namens Dietegen, der zwischen seinen Idealen und den gesellschaftlichen Erwartungen hin- und hergerissen ist. Keller's literarischer Stil zeichnet sich durch seine präzise Beschreibung der Charaktere und seine intensive Darstellung der inneren Konflikte aus. Das Werk reflektiert die damaligen sozialen und politischen Verhältnisse und bietet einen Einblick in die menschliche Natur und Moral. Gottfried Keller, ein bedeutender Schweizer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, war bekannt für seine realistischen Darstellungen des Lebens in der Stadt und auf dem Land. Als Autodidakt verarbeitete er seine Erfahrungen und Beobachtungen in seinen Werken, darunter auch 'Dietegen'. Als Vertreter des bürgerlichen Realismus reflektierte er die gesellschaftlichen Veränderungen seiner Zeit und setzte sich kritisch mit ihnen auseinander. Für Liebhaber der Schweizer Literatur des 19. Jahrhunderts ist 'Dietegen' ein absolutes Muss. Das Buch bietet nicht nur einen faszinierenden Einblick in die damalige Gesellschaft, sondern regt auch zum Nachdenken über zeitlose Themen wie Moral, Selbstfindung und gesellschaftliche Normen an. Keller's Meisterwerk ist ein literarischer Schatz, der sowohl historischen als auch aktuellen Wert besitzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Dietegen
Inhaltsverzeichnis
Dietegen
An den Nordabhängen jener Hügel und Wälder, an welchen südlich Seldwyla liegt, florierte noch gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts die Stadt Ruechenstein im kühlen Schatten. Grau und finster war das gedrängte Korpus ihrer Mauern und Thürme, schlecht und recht die Räth’ und Burger der Stadt, aber streng und mürrisch, und ihre Nationalbeschäftigung bestand in Ausübung der obrigkeitlichen Autorität, in Handhabung von Recht und Gesetz, Mandat und Verordnung, in Erlaß und Vollzug. Ihr höchster Stolz war der Besitz eines eigenen Blutbannes, groß und dick, den sie im Verlauf der Zeiten aus verschiedenen zerstreuten Blutgerichten von Kaiser und Reich so eifrig und opferfreudig an sich gebracht und abgerundet hatten wie andere Städte ihre Seelenfreiheit und irdisches Gut. Auf den Felsvorsprüngen rings um die Stadt ragten Galgen, Räder und Richtstätten mannigfacher Art, das Rathaus hing voll eiserner Ketten mit Halsringen, eiserne Käfige hingen auf den Thürmen, und hölzerne Drehmaschinen, worin die Weiber gedrillt wurden, gab es an allen Straßenecken. Selbst an dem dunkelblauen Flusse, der die Stadt bespülte, waren verschiedene Stationen errichtet, wo die Übelthäter ertränkt oder geschwemmt wurden, mit zusammengebundenen Füßen oder in Säcken, je nach der feineren Unterscheidung des Urtheils.
Die Ruechensteiner waren nun nicht etwa eiserne, robuste und schreckhafte Gestalten, wie man aus ihren Neigungen hätte schließen können; sondern es war ein Schlag Leute von ganz gewöhnlichem, philisterhaftem Aussehen, mit runden Bäuchen und dünnen Beinen, nur daß sie durchweg lange gelbe Nasen zeigten, eben dieselben, mit denen sie sich gegenseitig das Jahr hindurch beschnarchten und anherrschten. Niemand hätte ihrem kümmelspalterischen Leiblichen, wie es erschien, so derbe Nerven zugetraut, als zum Anschau’n der unaufhörlichen Hochnotpeinlichkeit erforderlich waren. Allein sie hatten’s in sich verborgen.
So hielten sie ihre Gerichtsbarkeit über ihrem Weichbilde ausgespannt gleich einem Netz, immer auf einen Fang begierig; und in der Tat gab es nirgends so originelle und seltsame Verbrechen zu strafen wie zu Ruechenstein. Ihre unerschöpfliche Erfindungsgabe in neuen Strafen schien diejenige der Sünder ordentlich zu reizen und zum Wetteifer anzuspornen; aber wenn dennoch ein Mangel an Übelthätern eintrat, so waren sie darum nicht verlegen, sondern fingen und bestraften die Schelmen anderer Städte; und es mußte Einer ein gutes Gewissen haben, wenn er über ihr Gebiet gehen wollte. Denn sobald sie von irgend einem Verbrechen, in weiter Ferne begangen, hörten, so fingen sie den ersten besten Landläufer und spannten ihn auf die Folter, bis er bekannte oder bis es sich zufällig erwies, daß jenes Verbrechen gar nicht verübt worden. Sie lagen wegen ihren Kompetenz-Conflikten auch immer im Streit mit dem Bunde und den Orten und mußten öfter zurechtgewiesen werden.
Zu ihren Hinrichtungen, Verbrennungen und Schwemmungen liebten sie ein windstilles, freundliches Wetter, daher an recht schönen Sommertagen immer etwas vorging. Der Wanderer im fernen Felde sah dann in dem grauen Felsennest nicht selten das Aufblitzen eines Richtschwertes, die Rauchsäule eines Scheiterhaufens oder im Flusse wie das glänzende Springen eines Fisches, wenn etwa eine geschwemmte Hexe sich emporschnellte. Das Wort Gottes hätte ihnen übel geschmeckt ohne mindestens ein Liebespärchen mit Strohkränzen vor dem Altar und ohne Verlesen geschärfter Sittenmandate. Sonstige Freuden, Festlichkeiten und Aufzüge gab es nicht, denn Alles war verboten in unzähligen Mandaten.
Man kann sich leicht denken, daß diese Stadt keine widerwärtigeren Nachbaren haben konnte als die Leute von Seldwyla; auch saßen sie diesen hinter dem Walde im Nacken wie das böse Gewissen. Jeder Seldwyler, der sich auf Ruechensteiner Boden betreten ließ, wurde gefangen und auf den zuletzt gerade vorgefallenen Frevel inquiriert. Dafür packten die Seldwyler jeden Ruechensteiner, der sich bei ihnen erwischen ließ, und gaben ihm auf dem Markt ohne weitere Untersuchung, bloß weil er ein Ruechensteiner war, sechs Rutenstreiche auf den Hintern. Dies war das einzige Birkenreis, was sie gebrauchten, da sie sich selbst untereinander nicht weh zu thun liebten. Dann färbten sie ihm mit einer höllischen Farbe die lange Nase schwarz und ließen ihn unter schallendem Jubelgelächter nach Hause laufen. Deshalb sah man zu Ruechenstein immer einige besonders mürrische Leute mit geschwärzten, nur langsam verbleichenden Nasen herumgehen, welche wortkarg nach Armensünderblut schnupperten.
Die Seldwyler aber hielten jene Farbtunke stets bereit in einem eisernen Topfe, auf welchen das Ruechensteiner Stadtwappen gemalt war und welchen sie den „freundlichen Nachbar“ benannten und sammt dem Pinsel im Bogen des nach Ruechenstein führenden Thores aufhingen. War die Beize aufgetrocknet oder verbraucht, so wurde sie unter närrischem Aufzug und Gelage erneuert zum Schabernack der armen Nachbaren. Hierüber wurden diese einmal so ergrimmt, daß sie mit dem Banner auszogen, die Seldwyler zu züchtigen. Diese, noch rechtzeitig unterrichtet, zogen ihnen entgegen und griffen sie unerschrocken an. Allein die Ruechensteiner hatten ein Dutzend graubärtige verwitterte Stadtknechte, welche neue Stricke an den Schwertgehängen trugen, ins Vordertreffen gestellt, worüber die Seldwyler eine solche Scheu ergriff, daß sie zurückwichen und fast verloren waren, wenn nicht ein guter Einfall sie gerettet hätte; denn sie führten Spaßes halber den „freundlichen Nachbar“ mit sich und statt des Banners einen langen ungeheuren Pinsel. Diesen tauchte der Träger voll Geistesgegenwart in die schwarze Wichse, sprang mutig den vordersten Feinden entgegen und bestrich blitzschnell ihre Gesichter, also daß alle, die zunächst von der verabscheuten Schwärze bedroht waren, Reißaus nahmen und keiner mehr der Vorderste sein wollte. Darüber gerieth ihre Schar in's Schwanken; ein unbestimmter Schreck ergriff die Hintern, während die Seldwyler ermuthigt wieder vordrangen unter wildem Gelächter und die Ruechensteiner gegen ihre Stadt zurückdrängten. Wo diese sich zur Wehre setzten, rückte der gefürchtete Pinsel herbei an seinem langen Stiele, wobei es keineswegs ohne ernsthaften Heldenmuth zuging; schon zweimal waren die verwegenen Pinselträger von Pfeilen durchbohrt gefallen, und jedesmal hatte ein Anderer die seltsame Waffe ergriffen und von Neuem in den Feind getragen.
Am Ende aber wurden die Ruechensteiner gänzlich zurückgeschlagen und flohen mit ihrem Banner in hellem Haufen durch den Wald zurück, die Seldwyler auf den Fersen. Sie konnten sich mit Noth in die Stadt retten und das Thor schließen, welches ihre Verfolger sammt der Zugbrücke so lange mit dem verwünschten Pinsel schwarz beklecksten, bis Jene sich etwas gesammelt und die lärmenden Maler mit Kalktöpfen bewarfen.
Weil nun einige angesehene Seldwyler in der Hitze des Andranges in die Stadt geraten und dort abgeschlossen, dafür aber auch ein Dutzend Ruechensteiner von den Siegern gefangen worden waren, so verglich man sich nach einigen Tagen zur Auswechslung dieser Gefangenen, und hieraus entstand ein förmlicher Friedensschluß, so gut es gehen wollte. Man hatte sich beiderseitig etwas ausgetobt und empfand ein Bedürfnis ruhiger Nachbarschaft. So wurde ein freundnachbarliches Benehmen verheißen; zum Beginn desselben versprachen die Seldwyler den eisernen Topf auszuliefern und für immer abzuschaffen, und die Ruechensteiner sollten dagegen auf jedes eigenmächtige Strafverfahren gegen spazierende Seldwyler feierlich Verzicht leisten, sowie die diesfälligen Rechte überhaupt sorgfältig ausgeschieden werden.