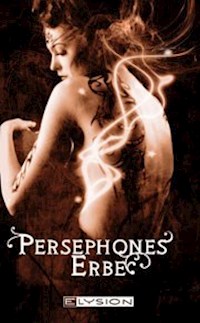3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Drache und Phönix
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
„Hört, Signor Stolnik, ohne Umschweife: Noch in der Brandnacht barg eine Gruppe Dominikanermönche aus der heißen, rauchenden Ruine eine kleine Menge goldener Asche. Es braucht Euch nicht zu interessieren, warum Wir sie wiedererlangen wollen. Doch es ist Unser Auftrag, dass Ihr sie Uns beschafft.“ Rastlos zieht Jan Stolnik, der Sohn eines Drachen, zu Beginn des 19.Jahrhunderts durch die Welt. In Rom findet er Hinweise auf jene Urne, in der die Asche seiner Geliebten ruht, der Phönixdame La Fiametta. Doch warum hat auch der Vatikan größtes Interesse daran, sie in ihren Besitz zu bringen? Die Spur führt Jan nach Paris und in die engsten Kreise Napoleon Bonapartes. Dessen Geheimpolizisten wittern überall Verschwörungen, und auch Andere sind Jan auf der Spur: Ein geheimnisvoller Mann wie er kann nichts anderes sein als eine Bedrohung, die es zu vernichten gilt. Jan gelingt es, nach Wien zu entkommen – eine Stadt, in der Magie gegenwärtiger ist, als gewöhnliche Sterbliche für möglich halten … Der dritte Band der historischen Fantasysaga, die Jahrhunderte überspannt und von der unsterblichen Liebe des Drachensohnes Jan Stolnik erzählt: spannend, abenteuerlich, faszinierend. Jetzt als eBook: „DRACHE UND PHÖNIX: Goldene Spuren“ von Angelika Monkberg. dotbooks – der eBook-Verlag. JETZT BILLIGER KAUFEN – überall, wo es gute eBooks gibt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rastlos zieht Jan Stolnik, der Sohn eines Drachen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch die Welt. In Rom findet er Hinweise auf jene Urne, in der die Asche seiner Geliebten ruht, der Phönixdame La Fiametta. Doch warum hat auch der Vatikan größtes Interesse daran, sie in ihren Besitz zu bringen? Die Spur führt Jan nach Paris und in die engsten Kreise Napoleon Bonapartes. Dessen Geheimpolizisten wittern überall Verschwörungen, und auch Andere sind Jan auf der Spur: Ein geheimnisvoller Mann wie er kann nichts anderes sein als eine Bedrohung, die es zu vernichten gilt. Jan gelingt es, nach Wien zu entkommen – eine Stadt, in der Magie gegenwärtiger ist, als gewöhnliche Sterbliche für möglich halten …
Der dritte Band der historischen Fantasysaga, die Jahrhunderte überspannt und von der unsterblichen Liebe des Drachensohnes Jan Stolnik erzählt: spannend, abenteuerlich, faszinierend.
Über die Autorin:
Angelika Monkberg, geboren 1955, lebt in Franken. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst. Daneben schreibt sie Kurzgeschichten und Romane – wenn sie nicht zeichnet oder malt. In beiden Bereichen gilt ihr Interesse vor allem dem Phantastischen.
Angelika Monkberg im Internet: www.facebook.com/1AngelikaMonkberg
Die historische Fantasy-Saga DRACHE UND PHÖNIX umfasst folgende Bände:
Erster Roman: Goldene Federn
Zweiter Roman: Goldene Kuppeln
Dritter Roman: Goldene Spuren
Vierter Roman: Goldene Asche
Fünfter Roman: Goldene Jagd
Sechster Roman: Goldene Lichter
Siebter Roman: Goldene Ewigkeit
***
Originalausgabe Februar 2014
Copyright © 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Bildmotivs von © Alexey Seleznev / shutterstock.com.
ISBN 978-3-95520-532-4
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort DRACHE UND PHÖNIX 3 an: [email protected]
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
www.gplus.to/dotbooks
Angelika Monkberg
DRACHE UND PHÖNIX:
Goldene Spuren
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Bei Assuan am ersten Katarakt; Mittwoch, der 11. November 1795; Sankt-Martinstag; kurz vor Sonnenuntergang und wie immer in der Wüste schlagartig kalt.
In seiner Kindheit hätte man jetzt Laternen angezündet, und er wäre mit den Bediensteten seines Bruders, des Kurfürsten, im Umzug zu Ehren des Heiligen mitgegangen, aber in Ägypten kannte man diesen Brauch nicht. Das fröhliche Geschrei der Jungen, die sich gegenseitig einen aufgeblasenen Ziegenbalg abjagten, war Dorfalltag. Dennoch würgte die Erinnerung an den Festtag und seine Lichter Jan so in der Kehle, dass er um ein Haar in Tränen ausgebrochen wäre. Er vermisste den Kleinen.
Ein Grund mehr, den Staub des Schwarzen Landes am Nil möglichst schnell von seinen Füßen zu schütteln. Er hatte versprochen, dass er niemals Anspruch auf seinen Sohn erheben würde, und dies sogar durch einen Bluteid bekräftigt. Er konnte nicht umkehren, und er durfte es nicht. Sein Versprechen band ihn für sein ganzes Leben, das vielleicht tatsächlich ewig währte. Aber leider saß er vorläufig hier fest. Die Nilschwemme begann jedes Jahr im Frühsommer mit dem Einsetzen des Monsuns in Ostafrika, dessen Regenfluten den Oberlauf des Flusses anschwellen ließen und fruchtbaren Schlamm auf die Felder schwemmten. Ägypten war das Geschenk des Nils. Doch seit der Herbst-Tagundnachtgleiche waren die Fluten stetig zurückgegangen, und jetzt herrschte sogar Niedrigwasser. Alle Schiffer, die er gefragt hatte, nahmen es als Ausrede. Kein Kapitän einer Dau war bereit, ihn, einen Ungläubigen, auf seinem Boot nilabwärts mitzunehmen. Es gab auch keine Karawane.
„Nicht nach Norden Richtung Kairo, Fremder. Es ist Winter.“
Er mochte aber nicht hier in Assuan bleiben und bis zum Frühjahr warten. Das hätte ihn nur noch mehr zum Grübeln gebracht. Dass man sich wegen eines kleinen Jungen, der ihm zuletzt mit der Selbstverständlichkeit eines Prinzen Befehle erteilt hatte, so verlassen fühlen konnte! Doch die Trennung schmerzte mehr, als er sich das nach all den Jahren als Reisemarschall der Kandake von Meroë vorgestellt hätte. Und dabei war er weiß Gott froh, dass er diese Bürde los war.
Er hatte die Königin von Isfahan nach Basra begleitet, und mit einer Handelskarawane durch Rub al-khali, das Leere Viertel, wie die Beduinen die Große Arabische Wüste nannten. Vor Medina hatten sie sich das erste Mal für fast drei Wochen getrennt. Er war Christ, und als solchem waren ihm Mekka und Medina, die beiden heiligsten Städte des Islam, verboten. Er hatte außerhalb des heiligen Bezirks gewartet, während seine Drachenschwester, die Königin, Daoud und der Kleine die Pflichten der Pilger erfüllt hatten. Daoud durfte sich jetzt Hadschi nennen und Amanischacheto ihrem Namen Awa voranstellen. Alle Frauen, die die Pilgerreise gemacht hatten, erhielten diesen Ehrentitel. Sie waren erst an Bord des Schiffs wiedervereint gewesen, das sie über das Rote Meer nach Port Sudan gebracht hatte. Dort hatte er sie, den Kleinen und Daoud schweren Herzen verlassen, wie er es ihr versprochen hatte.
Aber er war ein Mann, der sein Wort hielt, auch ihr gegenüber, seiner Halbschwester, und obwohl ihn mit ihr nichts verband. Abgesehen vom Zufall desselben Vaters, Zelta Pukis, des Goldenen, den er niemals kennengelernt hatte. Er war nur zur Hälfte Mensch, der Sohn einer Königin und eines Drachen, mit Stummelflügeln behaftet, die seinen Rücken bucklig erscheinen ließen. Flugunfähig, an die Erde gekettet, wahrscheinlich bis zum Jüngsten Tag. Prinz, das war er, ohne Titel und Macht, getäuscht von Dschinns, Geistern der Wüste, damit sich jene Prophezeiung erfüllte, die Amanischacheto in Persien einen Sohn von einem Prinzen versprochen hatte. Sie hatte den Kleinen aus Jans Samen empfangen, ohne dass er ihr beigewohnt hätte, verführt von zwei Dschinnis. Diese Geisterwesen hatten dafür gesorgt, dass das, was er in die Illusion ihrer Leiber ergossen hatte, den Weg in den Schoß seiner Schwester gefunden hatte. Auf welche Weise genau, mochte er sich lieber nicht vorstellen. Doch Selbstmitleid brachte ihn nicht weiter.
Er ging auf den Markt und kaufte einem Beduinen einen Esel ab. Der Handel war schlecht, das Tier alt und mager und von seinem bisherigen Herrn nur Schläge gewohnt. Doch Jan rechnete sich aus, dass ein müder, in sein Schicksal ergebener Esel seine Gegenwart eher dulden würde als ein jüngeres, fluchtbereites Exemplar seiner Gattung. Manche Huftiere schlugen nach ihm aus, wenn er sich ihnen das erste Mal näherte, und viele beäugten ihn selbst nach Wochen freundlicher Behandlung immer noch misstrauisch. Sie rochen den Drachen.
Aber der Esel machte Gott sei Dank kaum Schwierigkeiten, nachdem das Tier erst einmal begriffen hatte, dass es nur sein Gepäck tragen sollte, keineswegs ihn selbst. Er hatte vor, auf eigene Faust über Land weiterzureisen. Die Drachengabe würde ihn vor Begegnungen mit Mamelucken und räuberischen Beduinen bewahren, und mit der Einsamkeit wurde er fertig. Sie hatte sogar den Vorteil, dass er nachts keinen Schlaf heucheln musste. Er schlief nie, er konnte es nicht. Wenn er wusste, dass er in den dunklen Stunden zwischen Mitternacht und Morgen ungestört blieb, las er, betrachtete die Sterne oder lauschte einfach der Stille. Er freute sich auch darauf, in nächster Zeit mit den Flammen eines Lagerfeuers spielen zu können, ohne erstaunte Blicke befürchten zu müssen. Es war Winter in Ägypten und erstaunlich kalt, er hätte auch tagsüber reisen können und einen heraufziehenden Sandsturm sogar schneller gesehen. Aber Wüstennächte waren ihm seit Persien vertraut, ein Sturm war auch nicht zu erwarten, und er brach sofort auf. Doch er bereute seinen Entschluss schon nach vier Stunden, im nächsten Dorf.
Von Assuan bis nach Alexandria waren es 246 Wegstunden oder 48 Tagesmärsche, aber von solcher Schnelligkeit auch nur zu träumen, das verhinderte die Neugier des Scheichs, der über diese Ansammlung elender Hütten herrschte. Jan wollte nur Wasser und Futter für den Esel, vielleicht auch für sich selbst eine Mahlzeit am nächsten Morgen. Aber den alten Mann, seinen Gastgeber, plagte die Schlaflosigkeit der Greise, und er wollte alles haarklein erzählt wissen. Wo er denn herkäme, wer er sei, wo er gewesen sei und wo er hin wolle? Das Verhör drohte sich bis zum Morgengrauen zu ziehen, und weder das Affidavit der Kandake noch die Geschenke, die er anbot – Seife und zehn Piaster –, stellten den zahnlosen Alten zufrieden.
Der Scheich hält den Fremden für einen Spion, er weiß nur noch nicht, wie er herausfinden kann, wer dessen Auftraggeber ist. Die Franzosen? Allah helfe uns, der Bucklige sieht gefährlich aus. Diese hellen Augen … Er ist doch hoffentlich kein Dschinn? Der Alte überlegte fieberhaft, wie er ihn loswerden konnte. Undenkbar, es ist gegen jede Sitte, ihm einen Platz am Feuer zu verweigern. Die Gastfreundschaft ist heilig. Obwohl es für uns das Beste ist, wenn sich der Fremde mit den hellen Augen zum Teufel schert, und zwar gleich.
Endlich kam dem Scheich eine glänzende Idee. „Effendi, wir sind arme Leute. Du verstehst, dass wir dich um ein kleines Bakschisch bitten müssen, dafür, dass wir deinen Esel füttern und tränken. Nur um deinen guten Willen zu zeigen, sagen wir fünfhundert Piaster?“
Da war es, das Schlupfloch. Der Scheich warf ihm einen schnellen Blick zu, wie er wohl reagieren würde.
Jan blies kunstvoll die Backen auf. „Fünfhundert Piaster! Ja, seid Ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Woher soll ich armer Reisender eine solche Summe nehmen? Nein, mein Freund! Wenn du einen Eimer Wasser und ein kleines Bündel Hirsestroh derart hoch ansetzt, bleibt mir nichts übrig, als auf der Stelle weiterzuziehen. Gott befohlen! Er schütze mich vor Räubern, wie du einer bist!“
Er konnte sich den letzten Satz nicht verkneifen, aber sie spielten natürlich beide Theater. Der Alte brach nun fast in Tränen aus, entschuldigte sich tausendfach und wünschte ihm heuchlerisch gute Reise, und so, bei Gott, wäre das doch nicht gemeint gewesen. Sie wären eben sehr arm.
„Schon gut! Hier hast du fünf Piaster zu den zehn, die ich dir bereits schenkte. Gib mir das Bündel Stroh, und du bist mich los!“ Jan schnalzte mit der Zunge Richtung Esel, dass der sich in Bewegung setzte, wünschte dem Dorf gute Nacht, und jeder wahrte sein Gesicht.
Doch schon am nächsten Abend wiederholte sich die Geschichte. Nur, dass sie dort, zwei Dörfer weiter, auf Verhandlungen gleich verzichteten und wüst durcheinanderschreiend mit Fäusten und Stöcken auf ihn losgingen.
Ein Fremder, er wird sie an die Beduinen verraten, die sie schon einmal überfallen haben. Sie müssen ihn fesseln und dem Aga senden. Der kommt aus dem Süden, der ist unser Feind!
Finger krallten sich in sein Hemd und seine Flügel. Er fuhr herum, aufs Äußerste gereizt, und spuckte dem Angreifer Feuer ins Gesicht. Der ganze Haufen fuhr entsetzt zurück und rannte davon, plötzlich stand er allein am Dorfrand, nicht wenig beschämt, dass er dem Fellachen den Bart angesengt hatte, und natürlich ohne Quartier.
Nicht dass er sich viel daraus machte. Er konnte ohne Probleme weitermarschieren. Aber sein Esel war durstig und müde. Er trieb das schlechtgelaunte Tier sanft bis außer Sichtweite des Dorfs, suchte sich eine geschützte Ecke zwischen einigen Felsen und gönnte ihnen beiden eine ausgedehnte Ruhepause. Der Esel senkte den Kopf in den Futtersack und fraß mit der gleichen erstaunten Freude über die reichliche Mahlzeit wie schon gestern, und Jan goss Wasser in seine Essschale, gab gemahlene Hirse dazu und rührte sich kalten Brei an. Abends zogen sie weiter.
Am nächsten Tag nahm er sich einen Führer. In Begleitung eines Fellachen in einem Fellachendorf aufzutauchen schien ihm klüger. Es rettete ihn aber auch nicht davor, dass ihn der Scheich des Dorfs, das sie an diesem Abend erreichten, heuchlerisch zu einem Wetttrinken mit Palmwein einlud, in der an sich richtigen Annahme, dass das ganze Dorf doch wohl gegen einen einzelnen Ungläubigen und seinen Führer bestehen könnte. Aber er trank sie alle nieder, Alkohol bescherte ihm nie einen Rausch, nur eine volle Blase. Als er später in der Nacht zum Pissen aufstand, konnten die Männer, die nicht bereits ihren Rausch ausschliefen, nur noch lallen. Er verfrachtete seinen natürlich ebenfalls betrunkenen Führer auf den Esel und machte sich unbemerkt davon.
Kapitel 2
Westlich des Nils, flussabwärts, etwa eine Wegstunde vor al-Madiq, wahrscheinlich Mitte Dezember 1795. Ein kalter, sehr windiger Tag.
Es war ausgemacht, dass ihn sein Führer bis nach al-Madiq begleitete, das nur noch eine kurze Wegstrecke vor Luxor lag. Dort trennten sie sich in Frieden. Jan reiste mit einem Vetter des Fellachen weiter, der ihn von nun an bis Luxor und vielleicht darüber hinaus weiter nach Norden begleiten sollte. Doch sein neuer Führer zweifelte sofort an seinem Verstand, als er darauf bestand, zunächst die halb unter Wüstensand begrabenen Ruinen von Memphis auf dem anderen Nilufer besichtigen zu wollen. „Aber – dort hausen nur Wind und Einsamkeit! Und Kojoten.“
Und Dschinns. Die raunenden Stimmen hinter den zusammengebrochenen Pylonen lockten ihn in den heiligen Bezirk halb begrabener Säulenhallen. Scharfe Schatten mischten sich dort mit gleißendem Mittagslicht. Kalter Winterwind flüsterte um die von Hieroglyphen bedeckten Säulen.
Hoffe nicht, dass du sie je wiedersiehst.
Er erschrak. Aber die unsichtbaren Dschinns verrieten ihm nicht, ob sie von La Fiametta mit der goldenen Stimme sprachen, der Dame Phönix, für die er von Sachsen bis nach Persien gereist war, um in den Türmen des Schweigens eine Antwort auf ihren rätselhaften Flammentod zu finden. Oder ob sie Amanischacheto meinten, die Kandake von Meroë, seine Halbschwester, Mutter seines Sohnes.
Warum sollten wir dir das sagen, Kind eines Goldenen? Du wirst es bald selbst herausfinden.
Aber was war bald für Geister, die außerhalb der Zeit existierten? Die Dschinns wussten, dass er keinerlei Macht über sie hatte, und sie lachten nur über seinen Schmerz, während der Fellache von einem Bein aufs andere trat und das Schweigen in den Ruinen verfluchte. Sein Führer hörte das Gespräch zwischen ihm und den Dschinns nicht, nur den Wind, der um die halb unter Sand begrabenen Säulen pfiff.
Der Ungläubige steht immer noch zwischen diesen Ruinen und spricht kein Wort. Gott schütze mich vor dem Verrückten. Die Dschinns sollen ihn holen!
Jan schüttelte seufzend den Kopf. Es gab in der toten Stadt der Alten Götter nichts für ihn zu entdecken, nichts zu hoffen.
„Komm“, sagte er zu seinem Führer, „wir gehen.“
Kapitel 3
Kairo, al-Qahira, die Leuchtende; Mittwoch, der 20. Januar 1796; Tag von Sankt Sebastian. Oder nach dem Hijri-Kalender des Islam der zehnte Tag des siebten Monats Rajab 1210.
Kairo war staubig und laut. Jan kam aus der Stille der Wüste – alle Routen von Oberägypten mieden den fruchtbaren Streifen Land an beiden Ufern des Nils –, und ihm fielen die vielen Menschen und das Stimmengewirr in den Gassen doppelt auf. Er verkaufte den Esel mit Gewinn, das Tier sah trotz der langen Reise gesünder aus als bei ihrem Aufbruch in Assuan. Als Nächstes suchte er sich einen Hammam. Natürlich verlangte der Besitzer auf die Frage, ob er Waschbecken und Schwitzraum für sich allein haben könne und was es koste, ihm in der Zwischenzeit neue Kleidung zu besorgen, eine exorbitante Summe, also ging es wieder einmal ans Handeln. Kairo war teuer, selbst für die Einheimischen, und es gab ihm einen Vorgeschmack darauf, welche hohen Preise er in Europa für die einfachsten Dinge wohl würde erwarten müssen. Außerdem bestärkte ihn das Hin und Her mit dem Hamambesitzer in seiner bisherigen Strategie, sich als armen Mann darzustellen. Er wäre die Hälfte des Vermögens, das ihm seine Schwester bei ihrem Abschied in Port Said geschenkt hatte, längst wieder los gewesen, wäre er als Prinz gereist.
Dass ihm die Mittellosigkeit natürlich trotzdem niemand ganz glaubte, stand dabei auf einem anderen Blatt, außerdem wandelte er bei allem ständig auf einem schmalen Grat. Verhandelte er zu hartnäckig, hielt man ihn für unhöflich. Selbstverständlich erwartete jeder Ägypter, dass ein Ingles letztlich doch mehr bezahlte als einer seiner rechtgläubigen Brüder. Jan riss schließlich der Geduldsfaden, er sagte dem Besitzer des Hammam auf den Kopf zu, dass er wisse, dass es sich so verhielt, und ob er nicht auch als Ingles zumindest einen gewissen Anspruch auf die berühmte orientalische Gastfreundschaft habe. Sie einigten sich danach relativ schnell, und er konnte drei Stunden später sauber und bartlos und in ein Gewand gekleidet, das hier für europäisch galt, in Wahrheit aber ein türkisches war, gemächlich zum Palast des Gouverneurs schlendern.
In den Fellachendörfern hatte es hingereicht, das Affidavit der Kandake vorzuzeigen oder sogar nur zu erwähnen, dass er es besaß. Aber in Kairo musste er es von einem amtlich bestallten Schreiber in seiner Gültigkeit bestätigen lassen. Er setzte sich im kühlen Vorraum der Schreibstube auf den Boden und zog die Mola aus der Tasche, die er sich unterwegs gekauft hatte. Ein Mann konnte die Kugeln der arabischen Gebetsschnur auch nur zum Zeichen, dass er sich in Geduld zu üben bereit war, durch die Finger gleiten lassen. Jan kannte den langsamen Takt zur Genüge, in dem im Orient Entscheidungen fielen – oder auch nicht. Er machte sich darauf gefasst, den Rest des Tages und vielleicht auch noch den nächsten im Flur vor der Tür des Schreibers zu warten, wollte dabei aber nicht verdursten. Er winkte einen Teeverkäufer von der Straße zu sich herein.
Das war das Signal. Nach erstaunlich kurzer Zeit kam ein weiterer Straßenverkäufer und bot ihm Datteln an, der nächste brachte Fladenbrot. Er gab allen, was sie forderten, und ein Bakschisch dazu und bedankte sich höflich. Die Versorgung kam mehr als recht, denn er hatte seinen Proviant in der sicheren Annahme, dass er in Kairo Nahrungsmittel im Überfluss kaufen konnte, zwei Tage zu knapp kalkuliert. Und nun schwamm ihm vor Hunger ein wenig der Kopf.
Von draußen hallten die Stimmen und das Hasten der Menschen auf der Straße, dazu überschwemmte ihn ein Chaos vieler Gedanken, es war alles viel zu laut. Er verspeiste Brot und Datteln langsam, lutschte und biss auf den Silberhäuten der Kerne herum, bis er sie wirklich ganz sauber abgenagt hatte und mit ihnen im Staub neben seiner rechten Hand ein Sternmuster legen konnte. Anschließend gab er vor zu dösen. Es gab nichts, womit er die Dinge hätte beschleunigen können. Wenn man Schreiber antrieb, reagierten sie überall auf dieser Welt wie Esel: störrisch.
Trotzdem trug seine Geduld nach einigen Stunden Früchte, er merkte, dass ein Mann von seiner Anwesenheit vor der Schreibstube erfahren hatte und auf dem Weg zu ihm war. Nur, dass der kein Schreiber war, auch kein anderer Palastbediensteter, sondern ein einfacher Bote von den Nilkais.
„Seid Ihr der Bucklige, der aus Port Sudan nach Kairo kam? Dann ist dieser Brief für Euch.“
„Danke.“ Er erhob sich voll böser Vorahnung und gab dem Boten einen Piaster.
Bad news travel fast, wie das englische Sprichwort sagte. Der Brief war ihm mit einem Schiff auf dem Nil viele Wochen vorausgereist. Die Handschrift war die Daouds.
Jan fuhr entsetzliche Angst in den Darm. Er drehte den Brief um. Das Siegel war erbrochen, er konnte also davon ausgehen, dass jeder, der zwischen Assuan und Kairo lesen konnte, den Inhalt kannte.
Sidi, meine Grüße voraus. Die Liebe Allahs schütze Dich.
Der Aufstand hat die Rebellen jetzt bis vor die Tore von Khartum geführt. Sie bombardieren die Stadt seit vier Tagen. Heute in aller Frühe traf eine verirrte Kanonenkugel die Zinnen des Palasts, sie hat der Kandake den Kopf abgerissen. Jeder Widerstand ist zwecklos, der Kronrat verhandelt mit der Übermacht draußen, aber einige Soldaten sind uns noch treu. Ich werde mit dem Kleinen nach Eritrea fliehen und versuchen, von dort aus einen der Häfen am Roten Meer zu erreichen. Bete für uns, Sidi. Wenn ich kann, sende ich dir Nachricht, sobald wir in England eingetroffen sind. Ich habe keine Hoffnung, dass wir uns noch einmal wiedersehen.
„Ich muss umkehren!“
Er wollte zur Tür hinaus, doch es war zu spät. Das Affidavit der Kandake kehrte sich jetzt gegen ihn. An höherer Stelle war der Befehl ergangen, ihn zu verhaften. Vier Mamelucken und ein Aga marschierten mit gezogenen Waffen aus der Sonne herein.
„Du kommst aus dem Sudan? Folge uns!“
Der Gouverneur von Kairo hat ihn für unerwünscht erklärt.
„Du hast Glück, dass dich das Affidavit als Ingles ausweist. Deine Hinrichtung zöge für den Geschmack unseres Herrn zu viele diplomatische Verwicklungen nach sich.“
Die Gedanken des Aga ließen keinen Zweifel daran, dass Spione normalerweise noch am Tag ihrer Ergreifung geköpft wurden. Er erwog kurz, sich freizukaufen, das Gold, das er im Gürtel trug, reichte mit Sicherheit dafür aus. Doch wie sollte er mittellos in den Sudan zurückreisen? Außerdem waren die Mamelucken taubstumm.
„Versuche nichts, Ingles. Man hat sie nicht nur als Knaben entmannt, sondern ihnen bei ihrem Eintritt in die Armee des Sultans auch die Zungen herausgeschnitten und das Trommelfell durchstoßen. Aber Ungehorsam kann sie immer noch das Letzte kosten, das ihnen die Verschneider gelassen haben: den Schwanz.“
Er verstand nur zu gut und wehrte sich nicht gegen die Hiebe und Knuffe, mit denen sie ihn zum Gaudium des Volks durch die Gassen Kairos zum Nilufer trieben. Dort wurde die Sensationsgier der Menge enttäuscht, als sie ihn nicht den Krokodilen vorwarfen, sondern einem Hafenschreiber den Befehl des Gouverneurs in die Hand drückten, damit der ihn dem Kapitän einer Dau vorlas.
„Bring den Gefangenen nach Alexandria und auf das erste Schiff, das nach Europa abgeht! Du haftest mit deinem Leben dafür!“
An eine Flucht war wegen der Zuschauer nicht zu denken, er hätte höchstens in den Nil springen können. Und auch wenn er sich zutraute, den Fluss trotz der großen Echsen und der Flusspferdbullen zu durchschwimmen, deren Hauer jeden mit etwas Verstand vor dem Versuch warnten – in den Dörfern des jenseitigen Ufers hätte er auch keine freundlichere Aufnahme gefunden.
„Streck die Hände aus“, forderte der Kapitän und winkte nach Ketten.
Jan wäre freiwillig an Bord gegangen, doch er wurde nicht darum gebeten. Er ertrug die Demütigung und wehrte sich nicht gegen die Hand- und Fußschellen, weil die Matrosen der Dau bei einem Kampf sicherlich das Gewicht des Ledergürtels bemerkt hätten, den er um die Hüften trug. Er brauchte aber das Gold.
„Du hast Verstand, Ingles!“, lobte der Kapitän. „Da du mir keine Schwierigkeiten gemacht hast, werde ich die Ketten lang lassen. Gib mir zehn Piaster, und ich gebe dir dafür zu essen und zu trinken. Und unter dem Segel hast du sogar Schatten.“
Kapitel 4
Küste vor Alexandria; Samstag, der 30. Januar 1796, Tag von Sankt Martina und Barthild; stürmische See.
Die Küste des Schwarzen Landes entschwand langsam seinen Augen. Jan stand am Heck der Elizabeth de Saint-Michel, todtraurig, ohne Nachricht über das Schicksal der beiden Menschen, die seinem Herzen in dieser Welt am nächsten standen. Es war ihm nicht einmal gelungen, den Captain der englischen Fregatte zu überreden, dass der ihn wenigstens einen Brief an Daoud hätte schreiben lassen.
„Wozu, zum Teufel, Sir? Ihr wisst doch nicht einmal, wo Ihr ihn hinschicken solltet! Nach Khartum ganz sicher nicht, der ganze Sudan steht in Kriegsflammen. Und nun entschuldigt mich, Sir! Ich habe ein Schiff durch einen Sturm zu steuern.“
Er starrte dem Captain lange nach. Endlich ging Jan nach hinten zum Achterdeck, wo der Schiffsarzt stand. Er wollte es nicht, es machte nichts besser, und der Schiffsarzt konnte ihm nicht helfen, doch etwas in ihm brach. Tränen strömten ihm über die Wangen, er musste wenigstens einem Menschen von seinem Leid erzählen.
Wie sein Vater Zelta Pukis vor seiner Geburt mit August dem Starken, König von Polen und Kurfürst von Sachsen, einen Kuhhandel abgeschlossen hatte.
„Die Gunst meiner Mutter, der Kronprinzessin, gegen die Tilgung der Staatsschulden.“
Dass er als Kind vom Turm der Residenz in Dresden gesprungen war, um herauszufinden, ob er fliegen konnte. Dass sein Buckel in Wirklichkeit verkrüppelte Flügel waren, die ihn nicht trugen.
Er wusste mit dem ersten Satz, dass er besser geschwiegen hätte, doch er konnte es nicht. Er musste diesem Wildfremden sein ganzes Leben erzählen, und er redete und redete und verlor unter der Last der Erinnerungen, die er heraufbeschwor, immer mehr den Verstand.
Wie er 1774 in Venedig La Fiametta kennengelernt und auf welche Weise er sie wieder verloren hatte. Dass er sie in Persien gesucht und von den Dschinns im Turm des Schweigens von Yazd erfahren hatte, dass die Dame Phönix immer wieder ins Feuer ging, um jung und schön aus ihrer eigenen Asche neu geboren zu werden.
„Dabei brauchte sie es nicht. Sie war wunderschön! Eine voll erblühte, reife Frau. Und erst ihre Stimme!“
Die seine brach. Er hatte sich heiser geredet, und die Tränen versiegten auch irgendwann, er konnte zuletzt kaum mehr flüstern, aber das hielt ihn nicht von seiner Lebensbeichte ab. Die Worte quollen wie ohne sein Zutun aus ihm heraus.
Wie er sich mit Barberina zusammengetan hatte. Er setzte gerade eben dazu an, dem Schiffsarzt, den das, was er erzählte, überhaupt nicht interessierte, auch noch den Mord an Nanni zu gestehen, als er endlich, viel zu spät, auf dessen Gedanken aufmerksam wurde.
Und er kann wirklich nicht fliegen? Laudanum, eine große Dosis und natürlich wieder Ketten. Die Mannschaft der Dau hätte sie ihm gar nicht erst abnehmen sollen. Dazu ein Stachelhalsband.
Der Schiffsarzt war erst kürzlich zur Royal Navy gestoßen und vorher mehrmals mit einem Sklavenhändler von Dahomey zu den Westindischen Antillen gesegelt. Er wusste, wie man Wilde zähmte.
Es hat sich noch jeder gefügt, wenn man androht, ihm die Eier abzuschneiden. Ich werde ihn nach London bringen und ausstellen. Oder, halt, das ist noch besser, das ist wundervoll! Ich kann der Erste sein, der vor der Royal Society einen Drachen seziert! Und das Skelett wird hinterher präpariert. Spart auch Futterkosten.
Die Mannschaft war mit den Segeln beschäftigt, der Captain stand auf der Brücke, weder der Pilot noch der Boatswain blickten in seine Richtung. Kein Mann an Bord hatte etwas von dem Gespräch auf dem Achterdeck gehört. Er packte den überraschten Schiffsarzt bei der Kehle.
„Ich vergaß wohl zu erwähnen, werter Sir, dass ich auch Gedanken lesen kann.“
Und dann drückte er zu und brach dem Schiffsarzt das Genick. Gleichzeitig warf er ihn über die Reling. „Mann über Bord!“
Grauen schüttelte ihn. Er fühlte sich wie ein Ungeheuer. Nein, er war eines, a monster, wie der Engländer sehr zu Recht gesagt hätte. Er hatte soeben kaltblütig einen Menschen umgebracht, und jetzt benahm er sich auch noch so, als ob er an dessen Tod völlig unschuldig sei. Und das Schlimmste: Der Mord tat ihm nicht im Geringsten leid. Er war einfach notwendig gewesen.
Der Sturm ließ nicht zu, dass der Captain beidrehen und nach dem angeblich über Bord Gefallenen suchen ließ, er schüttelte von der Brücke her den Kopf. Jan sah, dass er dem Boatswain gestikulierte. Langsam wich die Betäubung von ihm. Die Drachengabe und seine Ohren erwachten gleichzeitig. Der Sturm wuchs, der Captain musste schreien, obwohl der Boatswain direkt vor ihm stand. Jan verstand ihn trotzdem.
„Ist nicht schade um den Kerl. Sagen Sie ihm das!“
„Jawohl, Sir. War ein Schwein.“
Hat sich damit gebrüstet, dass er auf den Überfahrten zu den West Indies alle Negerweiber gehabt hat. Und die Hälfte geschwängert. Die werden sich in Port of Spain gefreut haben; von wegen unbeschädigte Ware.
„Boatswain, sagen Sie unserem Gast, er soll der Mannschaft beim Segeleinholen zur Hand gehen. Wir brauchen jeden, der zugreifen kann!“
„Jawohl, Sir!“
Kapitel 5
Neapel, Golf von Sorrent; Mittwoch, der 16. März 1796; oder wie jetzt in Frankreich offenbar gerechnet wurde: Sextidi, 3. Dekade Ventôse Jahr IV; später Vormittag, und nichts zu tun, als auf die Postkutsche zu warten.
Jans Mitreisende, die genau wie er seit Tagen in der Stadt festsaßen, stellten inzwischen immer gewagtere Mutmaßungen an, warum das Vehikel ausblieb: Räuber, Krieg, der Ausbruch des Vesuv? Aber diese letzte Vermutung entbehrte derart jeder Wahrscheinlichkeit, dass er Mühe hatte, das Lachen, das ihm in der Kehle steckte, in ein höfliches Räuspern zu verwandeln.
„Rechnet damit, dass wir hier in der Stadt davon früher erfahren hätten als jener unglückliche Postreiter dort.“
Der war gerade abgestiegen, wollte nur das Pferd wechseln und musste dringend weiter, wurde aber von zwei Engländern festgehalten und um Auskunft bestürmt. Sie waren in Pompeji und Herculaneum gewesen, um die verschütteten Städte zu sehen. Soweit man davon etwas sah. Wie der eine Gentleman sich erinnerte, war der Eindruck eher enttäuschend.
Ausgedehnte Buckelwiesen, die bei den Einheimischen La Civita heißen, hie und da ein paar Schächte in die Tiefe und am Rand des Ganzen ein, zwei verfallene Tempel. Niemand weiß etwas Genaueres darüber. Man bekommt keinerlei Erklärung.
Und der Postreiter wehrte sich auch. „Es war nichts, und ich weiß von nichts, Signori. Lasst mich ziehen, ich bitte euch!“
„Aber wir warten seit Tagen!“
Die englischen Gentlemen wussten nicht, wie glücklich sie sich schätzen durften, denn immerhin gab es im Königreich Neapel eine regelmäßige Postverbindung und ein Netz von Straßen, das diesen Namen verdiente. Jan hätte ihnen von anderen Arten des Reisens berichten können. Zuerst mit einem Prahm die Donau hinunter bis ins Schwarze Meer, danach nach Georgien und von dort zu Fuß durch den Kaukasus bis nach Aserbeidschan und Persien, immer auf der Suche nach den Türmen des Schweigens. Er hatte dort eine Antwort erhalten, doch er kannte die Frage dazu nicht. Nicht in dem Sinn, dass er jetzt gewusst hätte, wie er La Fiametta wiederfinden konnte, die Dame Phönix, die sich vor mehr als zwanzig Jahren in Venedig vor seinen Augen im Teatro San Benedetto verbrannt hatte.
Die Dschinns hatten ihm zwar verraten, dass er damals nur den Sonnenaufgang hätte abwarten müssen und sie wäre aus ihrer eigenen Asche wiedergeboren worden; aber vom Turm des Schweigens hatte er selbst herunterfinden müssen. Beim Gedanken an die Kletterpartie überlief ihn selbst jetzt noch ein Schauder. Dennoch erinnerte er sich gern an diese Tage. Er hatte seinen neugeborenen Sohn ganz für sich gehabt. Einen kleinen Jungen, der als Gestaltwandler geboren war. Karim al-Tinnin musste immer Eisen auf der Haut tragen, weil er sich sonst in einen Drachen verwandelte.
Der Schmerz brannte nicht mehr ganz so scharf, aber Gott wusste, dass er seinen Sohn liebte.
Die Kommentare der Engländer holten ihn nach Neapel zurück.
„Goddam! Ein wirklich unfreundlicher Bursche“, sagte der eine. „Der Postreiter hätte uns doch wirklich Auskunft geben können.“
Die Engländer mokierten sich noch, als der Reiter schon um die nächste Straßenbiegung galoppiert war. Dass der Mann ebenfalls lauthals fluchte – über Touristenpack, das ihn an der Arbeit hinderte und nicht einmal Trinkgeld gab –, hörten die Gentlemen nicht, Jan schon. Ja, die Ungeduld der Europäer. Er selbst war davon auch nicht frei, immer noch nicht.
Er hatte die Überfahrt von Alexandria nach Palermo und die Selbstvorwürfe nur überstanden, weil er sich im Sturm an der Seite der Crew bis zur völligen Erschöpfung verausgabt hatte. Er konnte nicht sagen, dass er deshalb jetzt mit sich im Reinen war. Es klebte wieder Blut an seinen Händen, und ein wenig Matrosenarbeit wog das Leben des Schiffsarztes nicht auf. Doch die Elizabeth de Saint-Michel war ein gutes Schiff und ihr Captain ein guter Offizier. Er hatte Jan zum Abschied sogar mit fast ehrlichem Bedauern die Hand geschüttelt.
„Nun, Sir, Ihr werdet froh sein, dass wir Sizilien ohne Schiffbruch erreicht haben. Good luck! Wenn Ihr je Lust habt, doch wieder zur See zu fahren, wendet Euch getrost an mich.“
Ich frage mich, worüber er mit dem Schiffsarzt gesprochen hat. Man soll keinen Mann verdächtigen, aber der Bucklige war vor dem Vorfall auf dem Achterdeck völlig durch den Wind. Und danach viel zu ruhig. Nun, sei es, wie es will! Der Schiffsarzt war ein Trunkenbold und Quacksalber, und den Buckligen werden wir auch nicht wiedersehen. Obwohl er der Navy dienlich sein könnte. Spricht Arabisch wie ein Ägypter. Findet man nicht oft.
Die Engländer beschlossen, in die Poststation zu gehen und dort einen Imbiss zu nehmen. Sie besaßen die Güte, ihn zu fragen, ob er mit ihnen speisen wolle. Er sagte nein, denn er hatte keinen Appetit.
„Wie seid Ihr eigentlich nach Neapel gekommen, Sir? Von wo her?“
„Mit einem Fischer von Sizilien.“
„Direkt hierher nach Neapel?“
„Nein, ich bin vor einer Woche in Salerno gelandet.“
Dort hatte er sich sehr bedrückt durch alle verfügbaren Zeitungen gelesen. Zu denken, dass in Frankreich jetzt ein Direktorium regierte! Girondisten, Jakobiner, Jansenisten, der König war abgesetzt, auf das Schafott geführt und geköpft worden. Auch die unglückliche Königin, die kleine Marie Antoinette, die er als Mädchen in Schönbrunn gesehen hatte bei irgendeinem kursächsischen Verwandtenbesuch, war zu seinem Schrecken den gleichen Weg gegangen. Hunderte, wenn nicht Tausende Adelige, Geistliche, Bürger und sogar einige der neuen Mächtigen waren ihr gefolgt.