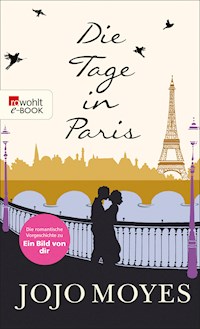Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Von der Autorin des Nr. 1-Bestsellers «Ein ganzes halbes Jahr» eine bewegende und dramatische Geschichte über Liebe und Verlust, die vom 1. Weltkrieg in Frankreich bis ins London der Gegenwart reicht. Während um sie herum der Erste Weltkrieg tobt, versucht Sophie, stark zu sein – für ihre Familie, für ihren Mann Édouard, der aufseiten Frankreichs kämpft. Nur ein Gemälde ist ihr geblieben, das sie an ihr gemeinsames Glück erinnert. Ein Porträt, das Édouard einst von ihr malte. Und das ihn jetzt retten soll … Hundert Jahre später. Liv trauert um ihren Mann David. Vor vier Jahren ist er gestorben, viel zu früh. Livs kostbarster Besitz: ein Gemälde, das er ihr einst schenkte. Der Maler: Édouard. Das Modell: Sophie. Als ihr dieses Gemälde genommen werden soll, ist sie bereit, alles zu opfern. Auch das eigene Glück … Zwei Paare – getrennt durch ein Jahrhundert, verbunden durch ein Gemälde. Gekonnt verwebt Jojo Moyes die Zeiten und die Geschichten zweier Lieben und schenkt uns einen Roman, der lange im Gedächtnis bleibt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:13 Std. 54 min
Sprecher:
Sammlungen
Ähnliche
Jojo Moyes
Ein Bild von dir
Roman
Über dieses Buch
Zwei Paare – getrennt durch ein Jahrhundert, verbunden durch ein Gemälde.
Während um sie herum der Erste Weltkrieg tobt, versucht Sophie stark zu sein – für ihre Familie, für ihren Mann Édouard, der auf Seiten Frankreichs kämpft. Nur ein Gemälde ist ihr geblieben, das sie an ihr gemeinsames Glück erinnert. Ein Porträt, das Édouard einst von ihr malte. Und das ihn jetzt retten soll …
Hundert Jahre später. Liv trauert um ihren Mann David. Vor vier Jahren ist er gestorben, viel zu früh. Livs kostbarster Besitz: ein Gemälde, das er ihr einst schenkte. Der Maler: Édouard. Das Modell: Sophie. Als ihr dieses Gemälde genommen werden soll, ist sie bereit, alles zu opfern. Auch das eigene Glück …
Vita
Jojo Moyes, geboren 1969, hat Journalistik studiert und für die «Sunday Morning Post» in Hongkong und den «Independent» in London gearbeitet. Der Roman «Ein ganzes halbes Jahr» machte sie international zur Bestsellerautorin. Zahlreiche weitere Nr.-1-Romane folgten. Jojo Moyes lebt mit ihrer Familie auf dem Land in Essex.
Karolina Fell hat schon viele große Autorinnen und Autoren ins Deutsche übertragen, u.a. Jojo Moyes, Bernard Cornwell und Kristin Hannah.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel «The Girl You Left Behind» im Verlag Penguin Books, Ltd./Penguin Group, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Girl You Left Behind» Copyright © 2012 by Jojo Moyes
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Covergestaltung SO YEAH DESIGN, Gabi Braun
Coverabbildung Silke Schmidt
ISBN 978-3-644-49811-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Charles, wie immer
Teil eins
Kapitel 1
St. Péronne, Oktober 1916
Ich träumte von Essen. Knusprige Baguettes, innen jungfräulich weiß, noch dampfend vor Ofenhitze, und reifer Käse, der zum Tellerrand hin auseinanderfließt. Trauben und Pflaumen, hochaufgetürmt in Obstschalen, dunkel und aromatisch, deren Duft das Zimmer erfüllt. Ich wollte gerade meine Hand danach ausstrecken, als mich meine Schwester aufhielt. «Lass mich», murmelte ich. «Ich habe Hunger.»
«Sophie. Wach auf.»
Ich konnte den Käse schmecken. Ich würde einen Bissen Reblochon auf ein Stück warmes Brot schmieren, kauen und mir anschließend eine Traube in den Mund schieben. Ich konnte die intensive Süße schon schmecken, das volle Aroma riechen.
Aber da war sie, die Hand meiner Schwester auf meinem Handgelenk, und sie hielt mich auf. Die Teller verschwanden, die Gerüche verflogen. Ich streckte meine Hand nach ihnen aus, doch sie zerplatzten wie Seifenblasen.
«Sophie.»
«Was?»
«Sie haben Aurélien!»
Ich drehte mich blinzelnd auf die Seite. Meine Schwester trug genau wie ich eine Nachtmütze aus Baumwolle, um sich warm zu halten. Ihr Gesicht wirkte selbst in dem schwachen Licht der Kerze totenbleich, und sie hatte die Augen weit aufgerissen vor Entsetzen. «Sie haben Aurélien. Unten.»
Langsam wurde ich richtig wach. Von unten drangen laute Männerstimmen herauf, sie hallten durch den gepflasterten Hof, die Hühner gackerten in ihrem Stall. Etwas Unheilvolles lag in der Luft. Ich setzte mich im Bett auf, zog meinen Morgenmantel an und entzündete hastig die Kerze auf meinem Nachttisch.
Ich stolperte an Hélène vorbei zum Fenster und starrte auf die Soldaten im Hof hinunter, die von den Scheinwerfern ihres Lkws angestrahlt wurden, und auf meinen jüngeren Bruder, der schützend die Arme vor den Kopf hielt, um die Schläge der Gewehrkolben abzuwehren, die auf ihn niedergingen.
«Was ist los?»
«Sie wissen von dem Schwein.»
«Was?»
«Monsieur Suel muss uns denunziert haben. Ich habe sie von meinem Zimmer aus herumbrüllen hören. Sie haben gesagt, dass sie Aurélien mitnehmen, wenn er ihnen nicht verrät, wo es ist.» Wir zogen uns wieder vom Fenster zurück.
«Er wird nichts sagen.»
Wir zuckten zusammen, als wir unseren Bruder aufschreien hörten. Ich erkannte meine Schwester kaum wieder: Sie war vierundzwanzig, sah aber zwanzig Jahre älter aus. Ich wusste, dass sich ihre Angst in meiner Miene spiegelte. Das war genau das, was wir befürchtet hatten.
«Sie haben einen Kommandant dabei. Wenn sie es finden», flüsterte Hélène, und ihre Stimme überschlug sich vor Panik, «dann verhaften sie uns alle. Du weißt, was in Arras passiert ist. Sie werden ein Exempel an uns statuieren. Was soll aus den Kindern werden?»
In meinem Kopf wirbelte alles durcheinander. Die Angst, dass mein Bruder etwas sagen könnte, ließ mich keinen klaren Gedanken fassen. Ich legte mir ein Tuch um die Schultern, ging auf Zehenspitzen wieder zum Fenster und spähte in den Hof. Die Anwesenheit eines Kommandanten ließ vermuten, dass dies nicht nur betrunkene Soldaten waren, die sich mit ein paar Drohungen und Schlägen abreagieren wollten: Wir steckten in Schwierigkeiten.
«Sie werden es finden, Sophie. Dafür brauchen sie keine zehn Minuten. Und dann …» Hélènes Stimme hob sich vor Angst.
In meinem Kopf setzte Leere ein. Ich schloss die Augen. Und dann schlug ich sie wieder auf. «Geh runter», sagte ich. «Spiel die Unschuldige. Frag ihn, was Aurélien falsch gemacht hat. Rede mit ihm, lenk ihn ab. Verschaff mir ein bisschen Zeit, bevor sie ins Haus kommen.»
«Was hast du vor?»
Ich packte meine Schwester am Arm. «Geh. Aber erzähl ihnen nichts, hast du gehört? Du musst alles leugnen.»
Hélène zögerte, dann rannte sie so schnell auf den Korridor, dass sich ihr Nachthemd aufblähte. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals so allein gefühlt hatte wie in diesen paar Sekunden, in denen mir die Angst die Kehle zuschnürte und das Schicksal meiner Familie in meinen Händen lag. Ich rannte in Vaters Arbeitszimmer und durchwühlte die Schubladen des großen Schreibtischs, warf ihren Inhalt – alte Füllfederhalter, einzelne Papiere, Teile kaputtgegangener Uhren und alte Rechnungen – auf den Boden und dankte Gott, als ich endlich fand, wonach ich suchte. Dann hastete ich nach unten, öffnete die Kellertür und eilte die kalte Steintreppe hinunter. Ich bewegte mich inzwischen so sicher im Dunkeln, dass ich das flackernde Kerzenlicht kaum brauchte. Ich hob den schweren Riegel der Tür zum hinteren Keller, der früher bis unter die Decke mit Bierfässern und gutem Wein gefüllt gewesen war, schob eines der leeren Fässer zur Seite und öffnete die Klappe des alten gusseisernen Brotofens.
Das Ferkel, immer noch sehr klein, blinzelte schläfrig. Es stellte sich auf die Beine, spähte mich aus seinem Bett aus Stroh an und grunzte. Ich habe Ihnen doch bestimmt von dem Schweinchen erzählt, oder? Wir haben es befreit, als der Bauernhof von Monsieur Girard beschlagnahmt wurde. Wie ein Geschenk des Himmels lief es durch das Chaos, entfernte sich von den anderen Ferkeln, die auf einen deutschen Lastwagen geladen wurden, und verschwand ungesehen unter den dicken Röcken von Großmutter Poilâne. Wir hatten es wochenlang mit Eicheln und Küchenabfällen gemästet, weil wir hofften, es so weit aufziehen zu können, dass wir alle ein bisschen Fleisch bekommen würden. Der Gedanke an diese knusprige Haut, dieses saftige Schweinefleisch, hatte die Bewohner des Le Coq Rouge über den letzten Monat gebracht.
Draußen hörte ich meinen Bruder erneut aufschreien, dann die Stimme meiner Schwester, sie sprach hastig und drängend, wurde harsch von einem deutschen Offizier unterbrochen. Das Schweinchen sah mich mit klugen, verständnisvollen Augen an, als wüsste es schon über sein Schicksal Bescheid.
«Es tut mir so leid, mon petit», flüsterte ich, «aber das ist die einzige Möglichkeit.»
Kurz darauf war ich wieder draußen. Ich hatte Mimi geweckt, ihr nur gesagt, dass sie mitkommen, aber unbedingt still bleiben sollte – das Kind hatte in den vergangenen Monaten so viel erlebt, dass es ohne Widerworte gehorchte. Mimi sah ängstlich zu mir auf und schob ihre kleine Hand in meine.
Die schneidend kalte Luft kündigte den Winter an, und immer noch hing der Geruch des Holzrauchs von unserem kleinen Feuer früher am Abend im Haus. Ich sah den Kommandanten durch die offene Hintertür und zögerte. Es war nicht Herr Becker, den wir kannten und hassten. Dies war ein schlankerer Mann, glatt rasiert, teilnahmslos, aber wachsam. Selbst im Dunkeln konnte ich in seinem Auftreten Intelligenz wahrnehmen, keine stumpfe Ignoranz, und das machte mir Angst.
Dieser neue Kommandant sah nachdenklich zu unseren Fenstern hinauf. Vielleicht überlegte er, ob dieses Gebäude möglicherweise ein passenderes Quartier wäre als der Hof der Fourriers, in dem die ranghöheren deutschen Offiziere schliefen. Vermutlich war ihm klar, dass die erhöhte Lage unseres Hauses einen günstigen Blick über die Stadt bot. Es gab ein Stallgebäude und zehn Schlafzimmer aus der Zeit, in der unser Haus das florierende Hotel der Stadt gewesen war.
Hélène kauerte auf dem gepflasterten Hof und schlang ihre Arme schützend um Aurélien.
Ein Soldat hatte sein Gewehr angelegt, doch der Kommandant hob die Hand. «Aufstehen», befahl er. Hélène schob sich auf dem Boden zurück, weg von ihm. Ich erhaschte einen Blick auf ihr Gesicht. Es war verzerrt vor Angst.
Ich spürte, wie sich Mimis Hand fester um meine schloss, als sie ihre Mutter sah, und ich drückte ihre Hand, obwohl mir angst und bange war. Und dann ging ich mit großen Schritten hinaus. «Was in Gottes Namen geht hier vor?» Meine Stimme tönte über den ganzen Hof.
Der Kommandant drehte sich überrascht nach mir um: einer Frau mit einem daumenlutschenden Mädchen am Rockzipfel und einem Wickelkind an der Brust. Meine Nachtmütze saß etwas schief, und mein weißes Baumwollnachthemd war mittlerweile so abgetragen, dass sich der Stoff kaum noch von meiner Haut abhob. Ich betete, dass er nicht bemerkte, wie mir das Herz bis zum Halse schlug.
Ich wandte mich direkt an ihn: «Und für welches angebliche Fehlverhalten wollen Ihre Männer uns dieses Mal bestrafen?»
Ich vermutete, dass seit seinem letzten Heimaturlaub keine Frau mehr so mit ihm gesprochen hatte. Auf dem Hof breitete sich erschrockene Stille aus. Mein Bruder und meine Schwester, die noch auf dem Boden kauerten, drehten sich in meine Richtung, und es war ihnen nur allzu klar, wohin uns diese Widerspenstigkeit bringen konnte.
«Und Sie sind?»
«Madame Lefèvre.»
Ich sah, dass seine Augen den Ehering an meiner Hand suchten. Die Mühe hätte er sich sparen können; wie die meisten Frauen in unserer Gegend hatte ich meinen Ehering schon längst gegen Lebensmittel eingetauscht.
«Madame. Wir wurden darüber informiert, dass Sie illegales Nutzvieh verstecken.» Sein Französisch war passabel, was auf frühere Posten im besetzten Gebiet hindeutete, und seine Stimme war ruhig. Das war kein Mann, der sich von Überraschungen schrecken ließ.
«Nutzvieh?»
«Wir haben aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass Sie ein Schwein auf dem Grundstück halten. Es wird Ihnen bewusst sein, dass Nutzvieh zu verstecken mit Haft bestraft wird.»
Ich hielt seinem Blick stand. «Und ich weiß genau, wer Sie mit solchen Informationen versorgt. Es ist Monsieur Suel, non?» Meine Wangen waren gerötet; meine Kopfhaut prickelte unter dem Haar, das zu einem langen Zopf geflochten über meine Schulter hing. Ein Schauder lief mir über den Nacken.
Der Kommandant drehte sich zu einem seiner Lakaien um. Die Art, auf die er den Blick abwandte, sagte mir, dass ich recht hatte.
«Monsieur Suel, Herr Kommandant, kommt wenigstens zwei Mal im Monat hierher und versucht, uns davon zu überzeugen, dass wir in der Abwesenheit unserer Männer seinen ganz besonderen Trost nötig haben. Weil wir uns dafür entschieden haben, seine vermeintlichen Freundlichkeiten nicht in Anspruch zu nehmen, zahlt er es uns mit Gerüchten heim und bringt uns so in Gefahr.»
«Die Behörden würden sich nicht einschalten, wenn die Quelle nicht glaubwürdig wäre.»
«Dagegen könnte ich einwenden, Herr Kommandant, dass dieser Besuch etwas anderes nahelegt.»
Der Blick, mit dem er mich ansah, war undurchdringlich. Er machte auf dem Absatz kehrt und ging Richtung Haustür. Ich folgte ihm und stolperte beim Versuch, mit ihm Schritt zu halten, beinahe über mein Nachthemd. Wie ich wusste, konnte schon die Tatsache, dass ich mich ihm gegenüber so herausfordernd geäußert hatte, als strafbare Handlung eingestuft werden. Und trotzdem hatte ich in diesem Moment keine Angst mehr.
«Schauen Sie uns doch an, Kommandant. Sehen wir vielleicht aus, als würden wir Gelage feiern mit Rindfleisch, Lammbraten und Schweinelende?» Er drehte sich um, und sein Blick zuckte zu meinen knochigen Handgelenken, die unter den Ärmelbündchen meines Nachthemds hervorsahen. Ich hatte allein im Vorjahr fünf Zentimeter an der Taille verloren. «Sind wir etwa abartig fett, weil unser Hotel so eine Goldgrube ist? Wir haben gerade noch drei Hühner von zwei Dutzend übrig. Drei Hühner, die wir halten und füttern dürfen, sodass Ihre Männer sich die Eier nehmen können. Wir leben derweil von dem, was die deutschen Behörden eine Ernährung nennen – immer kleiner werdenden Fleisch- und Mehlrationen und Brot aus Streusand und Kleie, das so schlecht ist, dass wir es nicht einmal dem Vieh geben würden.»
Er war im hinteren Korridor, seine Stiefelabsätze echoten auf den Bodenfliesen. Er zögerte, dann ging er weiter zur Bar und bellte einen Befehl. Wie aus dem Nichts tauchte ein Soldat auf und reichte ihm eine Taschenlampe.
«Wir haben keine Milch für unsere Babys, unsere Kinder weinen vor Hunger, die Mangelernährung macht uns krank. Und Sie kommen immer noch mitten in der Nacht hierher, um zwei Frauen in Angst und Schrecken zu versetzen, einen unschuldigen Jungen zu misshandeln, um uns zu schlagen und zu bedrohen, weil Ihnen ein liederlicher Kerl erzählt hat, wir würden hier schlemmen?»
Meine Hände zitterten. Sein Blick ruhte auf dem Baby, und ich bemerkte, dass ich es vor lauter Anspannung viel zu fest hielt. Ich trat einen Schritt zurück, zog das Tuch zurecht und summte beruhigend. Dann hob ich den Kopf. Ich konnte die Verbitterung und die Wut in meiner Stimme nicht unterdrücken.
«Dann bitte, durchsuchen Sie unser Haus, Kommandant, stellen Sie alles auf den Kopf und zerstören Sie das bisschen, das noch nicht zerstört worden ist. Durchsuchen Sie auch alle Nebengebäude, die Ihre Männer noch nicht für ihre eigenen Bedürfnisse leergeräumt haben. Wenn Sie dieses fabelhafte Schwein finden, dann hoffe ich, dass es Ihren Männer wohl bekommt.»
Ich hielt seinem Blick einen Moment länger stand, als er es wohl erwartet hatte. Durch das Fenster konnte ich meine Schwester ausmachen, die Auréliens Platzwunden mit dem Saum ihres Nachthemds betupfte, um die Blutung zu stillen. Drei deutsche Soldaten bewachten die beiden.
Meine Augen waren inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt, und ich sah, dass sich der Kommandant in dieser Situation unwohl fühlte. Seine Männer warteten unsicher auf seine Befehle. Er konnte sie anweisen, unser Haus bis unters Dach auszuräumen und uns zur Strafe für meinen Ausbruch allesamt zu verhaften. Aber ich wusste, dass er an Monsieur Suel dachte und daran, ob er vielleicht getäuscht worden war. Er schien kein Mann zu sein, der die Möglichkeit reizvoll fand, offenkundig im Unrecht zu sein.
Früher, wenn ich mit Édouard Poker spielte, hatte er gelacht und gesagt, ich wäre ein unmöglicher Gegner, weil mein Gesicht nie meine wahren Gefühle verriet. An diese Worte musste ich nun denken: Dies war die wichtigste Partie, die ich je spielen würde. Wir starrten uns an, der Kommandant und ich. Es kam mir einen Moment lang so vor, als würde die ganze Welt um uns herum stillstehen. Ich hörte das ferne Dröhnen der Kanonen an der Front, ich hörte meine Schwester husten und das Gescharre unserer armseligen, mageren Hühner, die in ihrem Stall aufgescheucht worden waren. All diese Geräusche verklangen, bis es nur noch ihn und mich gab und den Blick, mit dem wir uns ansahen, um die Wahrheit pokernd. Ich schwöre, dass ich mein eigenes Herz schlagen hörte.
«Was ist das?»
«Was?»
Er hielt die Taschenlampe hoch, und es wurde schwach von dem blassgelben Licht angestrahlt: das Porträt, das Édouard kurz nach unserer Hochzeit von mir gemalt hatte. Da war ich, im ersten Ehejahr, mein Haar fiel üppig und glänzend um meine Schultern, meine Haut war rein und strahlend, und ich blickte mit der unerschütterlichen Ruhe derjenigen aus dem Bild heraus, die wissen, dass sie angebetet werden. Ich hatte es einige Wochen zuvor aus seinem Versteck nach unten gebracht und meiner Schwester erklärt, ich wollte verflucht sein, wenn ich die Deutschen darüber bestimmen ließ, was ich mir in meinem eigenen Haus an die Wand hängte.
Er hielt die Taschenlampe noch ein bisschen höher, sodass er besser sehen konnte. Häng es nicht dort auf, Sophie, hatte Hélène mich gewarnt. Damit provozierst du nur Ärger.
Als er sich schließlich zu mir umdrehte, war es, als habe er seinen Blick nur mit Mühe von dem Bild losreißen können. Er sah mich an, dann wieder das Gemälde. «Mein Mann hat es gemalt.» Ich weiß nicht, warum ich es für nötig hielt, ihm das zu sagen.
Vielleicht war es die Bestimmtheit meiner rechtschaffenen Empörung. Vielleicht war es der offenkundige Unterschied zwischen der jungen Frau auf dem Bild und der Frau, die vor ihm stand. Vielleicht war es das schluchzende blonde Kind neben mir. Und möglicherweise war es sogar ein Kommandant nach zwei Jahren Dienst im Besatzungsgebiet leid, uns wegen lächerlicher Vergehen zu schikanieren.
Er betrachtete das Bild noch einen Moment lang, dann schaute er kurz auf seine Füße hinunter.
«Ich denke, wir haben uns verstanden, Madame. Wir unterhalten uns noch, aber ich werde Sie heute Nacht nicht weiter stören.»
Er bemerkte die Überraschung, die kurz in meiner Miene aufblitzte, und ich sah, dass er darüber irgendwie befriedigt war. Vielleicht genügte es ihm, dass ich geglaubt hatte, ich wäre geliefert. Er war klug, dieser Mann, und raffiniert. Ich würde mich vorsehen müssen.
«Männer.»
Seine Soldaten kehrten in ihrem üblichen, blinden Gehorsam um und gingen zurück zum Lkw. Die Silhouetten ihrer Uniformen zeichneten sich im Licht der Scheinwerfer ab. Ich folgte ihm nach draußen und blieb vor der Haustür stehen. Das Letzte, was ich von ihm hörte, war ein Befehl, den er seinem Fahrer erteilte.
Wir warteten, während das Militärfahrzeug die Straße hinunterfuhr und sich seine Scheinwerfer über die zerfurchte Oberfläche tasteten. Hélène zitterte. Aurélien stand verlegen neben mir, hielt Mimi an der Hand und schämte sich für seine Kindertränen. Ich wartete darauf, dass die Motorengeräusche vollständig verklangen. «Bist du verletzt, Aurélien?» Ich betastete seinen Kopf. Platzwunden. Und Prellungen. Was waren das nur für Männer, die einen unbewaffneten Jungen angriffen?
Er zuckte zusammen. «Es hat nicht weh getan», sagte er. «Sie haben mir keine Angst gemacht.»
«Ich dachte, sie würden dich verhaften», sagte meine Schwester. «Ich dachte, sie würden uns alle verhaften.» Ich bekam Angst, wenn sie so aussah: als würde sie an einem ungeheuren Abgrund entlangbalancieren. Sie wischte sich über die Augen und zwang sich zu einem Lächeln, als sie in die Hocke ging, um ihre Tochter zu umarmen. «Die dummen Deutschen. Sie haben uns allen einen Schrecken eingejagt, was? Und die dumme Maman hat sich gefürchtet.»
Schweigend und ernst musterte das Kind seine Mutter. Manchmal fragte ich mich, ob ich Mimi jemals wieder lachen sehen würde.
«Es tut mir leid. Jetzt geht es mir wieder gut», fuhr meine Schwester fort. «Lasst uns ins Haus gehen. Mimi, wir haben ein bisschen Milch, die ich dir warm machen kann.» Sie strich sich über das blutbefleckte Nachthemd und streckte die Hände nach dem Baby aus. «Soll ich Jean nehmen?»
Ich hatte angefangen krampfhaft zu zittern, als wäre mir gerade erst klargeworden, welche große Angst ich normalerweise hätte haben müssen. Meine Beine wurden schwach, ihre Kraft schien in die Lücken zwischen den Pflastersteinen zu sickern. Ich hatte das dringende Bedürfnis, mich hinzusetzen. «Ja», sagte ich, «ich glaube, das wäre besser.»
Meine Schwester nahm das Bündel in die Arme, dann schrie sie leise auf. In die Decke geschmiegt und so fest eingepackt, dass sie kaum mit der Nachtluft in Berührung kam, war die rosafarbene, haarige Schnauze des Schweinchens.
«Jean schläft oben», sagte ich. Ich streckte die Hand aus, um mich an der Hauswand abzustützen.
Aurélien spähte über Hélènes Schulter. Alle starrten das Ferkel an.
«Mon Dieu.»
«Ist es tot?»
«Betäubt. Mir ist eingefallen, dass aus Papas Zeiten als Schmetterlingssammler noch eine Flasche Chloroform in seinem Arbeitszimmer war. Ich denke, es wacht wieder auf. Aber wir müssen uns ein anderes Versteck überlegen, falls sie wiederkommen. Und du weißt, dass sie wiederkommen.»
Ein Lächeln erschien auf Auréliens Gesicht. Ein seltenes, zögerndes, begeistertes Lächeln. Hélène beugte sich hinunter, um Mimi das komatöse Schweinchen zu zeigen, und sie grinsten. Kopfschüttelnd betastete Hélène immer wieder seine Schnauze, als könnte sie nicht glauben, was sie da in den Armen hielt.
«Du hast dich mit dem Schwein vor sie hingestellt? Sie kommen hierher, und du hältst es ihnen unter die Nase? Und dann beschimpfst du sie auch noch?» Sie klang vollkommen fassungslos.
«Unter ihre Schnauzen», sagte Aurélien, der plötzlich zu seiner üblichen Dreistigkeit zurückgefunden hatte. «Hah! Du hast es ihnen direkt unter die Schnauzen gehalten!»
Ich setzte mich aufs Pflaster und musste lachen. Ich lachte, bis ich zu frieren begann, und ich wusste nicht, ob ich lachte oder weinte. Mein Bruder, der vermutlich Angst hatte, dass ich einen hysterischen Anfall bekommen könnte, lehnte sich an mich und nahm meine Hand. Er war vierzehn und manchmal hochfahrend wie ein Mann, manchmal aber auch bedürftig wie ein Kind.
Hélène war immer noch in Gedanken versunken. «Wenn ich das gewusst hätte …», sagte sie. «Wie bist du nur so mutig geworden, Sophie? Meine kleine Schwester! Was ist passiert? In unserer Kindheit warst du ein Mäuschen. Ein ängstliches Mäuschen!»
Ich wusste die Antwort selbst nicht so genau.
Und dann, als wir schließlich ins Haus zurückgegangen waren, Hélène mit dem Milchtopf beschäftigt war und Aurélien sich das schlimm zugerichtete Gesicht wusch, ging ich zu dem Porträt.
Diese junge Frau, das Mädchen, das Édouard geheiratet hatte, erwiderte meinen Blick mit einem Ausdruck, den ich nicht mehr wiedererkannte. Er hatte es als Erster in mir gesehen: den wissenden Blick, dieses Lächeln, das empfangene und verschenkte Befriedigung ausdrückte. Und Stolz. Als seine Pariser Freunde seine Liebe zu mir – einer Verkäuferin – unverständlich fanden, hatte er bloß gelächelt, weil er all das schon in mir sehen konnte.
Ich wusste nie, ob er verstanden hatte, dass ich nur seinetwegen so geworden war.
Ich stand da und schaute sie eine Weile an, ich rief mir ins Gedächtnis, wie es gewesen war, diese junge Frau zu sein, die keinen Hunger kannte, keine Angst, und die einzig von leichten Gedanken an die Momente vertraulicher Zweisamkeit mit Édouard erfüllt war. Sie erinnerte mich daran, dass es auf dieser Welt auch Schönes gibt und dass mein Leben einmal von solchen Dingen wie Kunst, Freude und Liebe bestimmt war, und nicht von Angst und Brennnesselsuppe und Ausgangssperren. Ich sah Édouard in meinem Gesichtsausdruck auf dem Bild. Und dann verstand ich erst richtig, was ich gerade getan hatte. Er hatte mich an meine eigene Stärke erinnert, daran, wie viel Kraft zum Kämpfen ich in mir trug.
Wenn du zurückkommst, Édouard, das schwöre ich, werde ich wieder die junge Frau sein, die du gemalt hast.
Kapitel 2
Bis zum Mittag hatte sich die Geschichte mit dem Schweinchen praktisch in ganz St. Péronne herumgesprochen. In der Bar des Le Coq Rouge, die in den besseren Zeiten des Hotels auch als Restaurant genutzt worden war, gaben sich die Gäste die Klinke in die Hand, obwohl wir kaum etwas anderes anzubieten hatten als Zichorienkaffee; Bier wurde nur sehr sporadisch geliefert, und wir hatten nur noch ein paar unglaublich teure Flaschen Wein übrig. Es war erstaunlich, wie viele Leute einfach nur vorbeikamen, um guten Tag zu sagen.
«Und Sie haben ihm wirklich die Leviten gelesen? Ihm gesagt, dass er sich wegscheren soll?» Der alte, schnurrbärtige René hielt sich an einer Stuhllehne fest, während ihm die Lachtränen übers Gesicht liefen. Er hatte sich die Geschichte mittlerweile vier Mal erzählen lassen, und Aurélien schmückte sie jedes Mal ein bisschen mehr aus, bis er den Kommandanten schließlich mit einem Säbel abwehrte, während ich schrie: «Der Kaiser ist Scheiß!»
Ich tauschte ein kleines Lächeln mit Hélène, die den Boden wischte. Mich störte der Spaß nicht. Wir hatten in der letzten Zeit in unserer Stadt schließlich kaum etwas zu feiern gehabt.
«Wir müssen vorsichtig sein», sagte Hélène, als René zum Abschied den Hut lüftete. Wir sahen ihm nach, wie er von einem neuen Heiterkeitsanfall geschüttelt an der Post vorbeikam und stehen blieb, um sich über die Augen zu wischen. «Diese Geschichte macht zu schnell die Runde.»
«Keiner wird etwas sagen. Alle hassen die Boches.» Ich zuckte mit den Schultern. «Und sie wollen alle etwas von dem Schwein abbekommen. Da werden sie uns kaum denunzieren, bevor sie ihr Stück Fleisch haben.»
Das Schwein war in den frühen Morgenstunden diskret zu den Nachbarn gebracht worden. Einige Monate zuvor hatte Aurélien alte Bierfässer zu Feuerholz zerhackt und dabei entdeckt, dass unser labyrinthischer Weinkeller von dem unserer Nachbarn, den Fouberts, lediglich durch eine einfache Ziegelsteinmauer getrennt war. Unter Mithilfe der Fouberts hatten wir vorsichtig einige Steine aus der Wand geholt und so einen Durchgang geschaffen. Als die Fouberts dann einmal einen jungen Engländer versteckt hatten und die Deutschen in der Abenddämmerung unangemeldet vor ihrer Tür aufgetaucht waren, hatte Madame Foubert so getan, als verstünde sie die Anweisungen des Offiziers nicht, sodass der junge Mann gerade eben genug Zeit hatte, um sich in den Keller zu schleichen und auf unsere Seite herüberzusteigen. Die Deutschen hatten das ganze Haus der Fouberts auseinandergenommen, sich sogar im Keller umgesehen, aber bei der trüben Beleuchtung hatte kein einziger von ihnen bemerkt, dass der Mörtel in der Wand verdächtige Lücken aufwies.
Das war aus unserem Leben geworden: unbedeutende Rebellionen, kleine Siege, flüchtige Gelegenheiten, unsere Unterdrücker lächerlich zu machen, winzige, schlingernde Hoffnungsschiffchen in einem Ozean aus Unsicherheit, Entbehrung und Angst.
«Also haben Sie den neuen Kommandanten kennengelernt, was?» Der Bürgermeister saß an einem der Fenstertische. Als ich ihm einen Kaffee brachte, bedeutete er mir, mich zu ihm zu setzen. Für ihn, dachte ich oft, war das Leben seit der Okkupation noch unerträglicher geworden als für alle anderen. Er hatte ständig mit den Deutschen verhandelt, damit sie der Stadt die notwendigsten Zuteilungen bewilligten, war aber regelmäßig von ihnen erpresst worden, widerspenstige Einwohner unter Druck zu setzen, damit sie ihren Anweisungen Folge leisteten.
«Ich wurde ihm nicht offiziell vorgestellt», sagte ich, als ich die Tasse vor ihn stellte.
Er neigte seinen Kopf näher zu mir und sagte mit gesenkter Stimme: «Herr Becker ist nach Deutschland zurückgeschickt worden, um eines ihrer Straflager zu leiten. Anscheinend gab es Unregelmäßigkeiten in seiner Buchführung.»
«Das überrascht mich nicht. Er ist der einzige Mann im besetzten Frankreich, der in den vergangenen zwei Jahren doppelt so dick geworden ist.» Ich scherzte, aber ich hatte gemischte Gefühle, was seine Abberufung anging. Einerseits war Becker unerbittlich gewesen, seine Strafen überzogen, ein Verhalten, das wohl aus Unsicherheit und der Angst resultierte, seine Männer könnten ihn für zu weich halten. Andererseits aber war er zu dumm gewesen – blind für viele Widerstandsakte der Bevölkerung –, um irgendwelche Beziehungen aufzubauen, die ihm hätten dienlich sein können.
«Und? Was halten Sie von ihm?»
«Von dem neuen Kommandanten? Ich weiß nicht. Er hätte auch anders reagieren können. Er hat nicht das ganze Haus durchsucht, wie es Becker vermutlich getan hätte, nur um seine Macht zu demonstrieren. Aber …», ich verzog die Nase, «… er ist klug. Wir sollten jetzt wohl besonders vorsichtig sein.»
«Ihre Einschätzung, Madame Lefèvre, deckt sich wie immer mit meiner eigenen.» Er lächelte mich an, aber das Lächeln erreichte seine Augen nicht. Ich erinnerte mich noch an die Zeiten, in denen der Bürgermeister ein heiterer, lärmender Mann gewesen war, der für seine Leutseligkeit geschätzt wurde und dessen Stimme bei Versammlungen alles und jeden übertönte.
«Bekommen wir diese Woche irgendetwas herein?»
«Ich glaube, es gibt etwas Schinken. Und Kaffee. Sehr wenig Butter. Ich hoffe, dass man mir heute noch die genaue Rationierung mitteilt. Irgendwelche Neuigkeiten von Ihrem Mann?»
«Nicht seit August, da habe ich eine Postkarte von ihm bekommen. Er war in der Nähe von Amiens. Er hat nicht viel geschrieben.» Ich denke Tag und Nacht an dich, hatte in seiner wunderschönen Kritzelschrift auf der Postkarte gestanden. Du bist mein Leitstern in dieser Welt des Irrsinns. Ich hatte aus lauter Sorge zwei Nächte wach gelegen, nachdem ich die Postkarte bekommen hatte, bis mich Hélène darauf hinwies, dass «diese Welt des Irrsinns» ebenso gut auf eine Welt passte, in der man sich von derart hartem Schwarzbrot ernährte, dass es mit einem Beil zerhackt werden musste, und in der man Schweine im Brotofen hielt.
«Der letzte Brief meines Ältesten ist vor beinahe drei Monaten gekommen», sagte der Bürgermeister. «Sie sind nach Cambrai vorgerückt. Die Stimmung ist gut, meinte er.»
«Ich hoffe, das ist sie noch. Wie geht es Louisa?»
«Einigermaßen, danke.» Seine jüngste Tochter war mit einer Lähmung geboren worden; sie wuchs nicht richtig, vertrug nur bestimmte Nahrung und war, inzwischen elfjährig, häufig krank. Für ihr Wohlergehen zu sorgen, war eine der Hauptbeschäftigungen in unserer kleinen Stadt. Wenn es Milch oder Trockengemüse gab, fand ein Anteil gewöhnlich seinen Weg in das Haus des Bürgermeisters.
«Wenn es ihr wieder besser geht, erzählen Sie ihr, dass Mimi nach ihr gefragt hat. Hélène näht eine Puppe für sie, die aussieht wie ein Zwilling von Mimis Puppe.»
Der Bürgermeister tätschelte meine Hand. «Sie und Ihre Schwester sind wirklich zu freundlich. Ich danke Gott, dass Sie hierher zurückgekommen sind, wo Sie doch im sicheren Paris hätten bleiben können.»
«Unsinn. Es gibt keinerlei Garantie dafür, dass die Boches nicht demnächst die Champs-Élysées runtermarschieren. Und davon abgesehen konnte ich Hélène hier nicht allein lassen.»
«Hélène hätte das hier ohne Sie nicht überstanden. Sie haben sich zu so einer wundervollen jungen Frau entwickelt. Paris war gut für Sie.»
«Mein Mann ist gut für mich.»
«Dann schütze ihn Gott. Gott schütze uns alle.» Der Bürgermeister lächelte, setzte seinen Hut auf und erhob sich, um zu gehen.
St. Péronne, wo die Familie Bessette seit Generationen das Le Coq Rouge führte, war eine der ersten Städte gewesen, die im Sommer 1914 von den Deutschen besetzt wurden. Hélène und ich hatten, nachdem unsere Eltern schon lange gestorben und unsere Männer an der Front waren, beschlossen, das Hotel allein weiter zu betreiben. Wir waren nicht die einzigen Frauen, die Männeraufgaben übernahmen. Die Läden, die Bauernhöfe in der Umgebung und die Schule wurden beinahe ausschließlich von Frauen geführt, die von alten Männern und halbwüchsigen Jungen unterstützt wurden. Im Jahr 1915 gab es kaum noch einen Mann mittleren Alters in St. Péronne.
In den ersten Monaten liefen die Geschäfte gut, weil französische Soldaten durch die Stadt kamen und dicht darauf die Engländer folgten. Es gab immer noch ausreichend zu essen, Musik und Jubel begleitete die marschierenden Truppen, und die meisten von uns glaubten, der Krieg sei in ein paar Monaten vorbei, höchstens. Es gab einige wenige Hinweise auf die Schrecken, die sich in hundert Kilometern Entfernung zutrugen; wir versorgten belgische Flüchtlinge mit Lebensmitteln, die, ihre Habseligkeiten hochaufgetürmt auf Fuhrwerken, durch die Stadt zogen. Einige von ihnen trugen noch immer Pantoffeln und die Kleidung, die sie bei ihrer Flucht hastig angelegt hatten. Und manchmal, wenn der Wind aus Osten kam, hörten wir das ferne Grollen der Kanonen. Doch obwohl wir wussten, dass der Krieg dicht an uns herangerückt war, glaubten nur wenige in St. Péronne, dass unsere stolze kleine Stadt irgendwann zu denjenigen gehören könnte, die unter deutsche Herrschaft fielen.
Wie sehr wir uns getäuscht hatten, erwies sich an einem stillen, kalten Spätsommermorgen, an dem unvermittelt Gewehrschüsse knallten. Madame Fougère und Madame Dérin, die sich wie immer um Viertel vor sieben zu ihrem täglichen Gang in die Boulangerie aufgemacht hatten, waren bei der Überquerung des Marktplatzes erschossen worden.
Ich hatte nach dem Lärm die Vorhänge zur Seite gezogen und brauchte eine Weile, um zu begreifen, was ich da sah: Die Leichen der beiden Frauen, die längste Zeit ihres über siebzigjährigen Lebens Witwen und Freundinnen, lagen auf dem Kopfsteinpflaster, mit verrutschten Kopftüchern, ihre leeren Einkaufskörbe neben ihren Füßen. Eine zähflüssige, rote Lache breitete sich um sie in einem beinahe perfekten Kreis aus, als stamme er von einem einzigen Lebewesen.
Die deutschen Offiziere behaupteten danach, sie seien von Heckenschützen beschossen worden und hätten Vergeltung geübt. (Das sagten sie offenbar in jedem Dorf, das sie einnahmen.) Um Widerstand in unserer Stadt zu provozieren, hätten sie nichts Besseres tun können, als diese beiden alten Frauen zu ermorden. Doch die Gräueltaten waren damit noch nicht beendet. Die Deutschen setzten Scheunen in Brand und zertrümmerten die Statue von Bürgermeister Leclerc. Vierundzwanzig Stunden später marschierten sie über unsere Hauptstraße, und ihre Pickelhauben schimmerten in der Sonne, während wir entsetzt schweigend vor unseren Häusern und Läden standen und zusahen. Dann befahlen sie die wenigen Männer, die noch in der Stadt waren, nach draußen, um sie durchzuzählen.
Die Besitzer von Läden und Marktständen schlossen einfach ihre Geschäfte und Stände und weigerten sich, die Deutschen zu bedienen. Die meisten von uns hatten Essensvorräte angelegt; wir wussten, dass wir überleben konnten. Ich glaube, irgendwie dachten wir, sie würden angesichts dieser Halsstarrigkeit einfach aufgeben und in einen anderen Ort weitermarschieren. Doch dann ordnete Kommandant Becker an, jeden Ladenbesitzer, der sein Geschäft während der üblichen Arbeitszeiten nicht öffnete, zu erschießen. Einer nach dem anderen, die Boulangerie, die Boucherie, die Marktstände und sogar das Le Coq Rouge machten wieder auf. Zögernd kehrte wieder Leben in unser mürrisches, rebellisches Städtchen ein.
Nach achtzehn Monaten gab es kaum noch etwas zu kaufen. St. Péronne war von seinen Nachbarorten abgeschnitten, genauso wie von Neuigkeiten, und es war abhängig von unregelmäßigen Zuteilungen, die von teuren Schwarzmarktlieferungen ergänzt wurden, wenn es überhaupt welche gab. Manchmal konnte man kaum glauben, dass das freie Frankreich wusste, was wir durchmachten. Die Deutschen waren die Einzigen, die genügend zu essen hatten; ihre Pferde (unsere Pferde) waren gut gepflegt und wohlgenährt und fraßen den Weizenschrot, der eigentlich für unser Brot gedacht war. Die Deutschen plünderten unsere Weinkeller und beschlagnahmten die Erträge unserer Bauernhöfe.
Und es ging nicht nur um Lebensmittel. Jede Woche hörte jemand das gefürchtete Klopfen an seiner Haustür und erhielt eine weitere Liste mit Gegenständen, die requiriert werden sollten: Teelöffel, Vorhänge, Teller, Kochtöpfe, Bettwäsche. Gelegentlich kam ein Offizier vorher zur Inspektion vorbei, notierte, welche begehrenswerten Gegenstände vorhanden waren, und kehrte mit einer Liste zurück, auf der genau diese Gegenstände aufgeführt waren. Sie schrieben Schuldscheine dafür aus, die angeblich gegen Geld gewechselt werden konnten. Aber kein einziger Bewohner St. Péronnes kannte jemanden, der wirklich bezahlt worden war.
«Was machst du da?»
«Ich hänge es um.» Ich nahm das Porträt ab und trug es in eine Ecke, wo es weniger den Blicken der Öffentlichkeit ausgesetzt war.
«Wer ist das?», fragte Aurélien, als ich es wieder aufhängte und gerade rückte.
«Das bin ich!» Ich drehte mich zu ihm um. «Siehst du das nicht?»
«Oh.» Er kniff leicht die Augen zusammen, um genauer hinzuschauen. Er wollte mich nicht beleidigen. Die junge Frau auf dem Bild unterschied sich sehr von der mageren, strengen Erscheinung mit dem grau wirkenden Teint und dem wachsamen, erschöpften Blick, die mir jeden Tag aus dem Spiegel entgegenstarrte. Ich versuchte, diese Erscheinung möglichst selten anzusehen.
«Hat das Édouard gemalt?»
«Ja. Nach unserer Hochzeit.»
«Es ist wunderschön», sagte Hélène und trat einen Schritt zurück, um einen besseren Blick auf das Bild zu haben. «Aber …»
«Aber was?»
«Es überhaupt aufzuhängen, bedeutet ein Risiko. Als die Deutschen durch Lille gezogen sind, haben sie Kunstwerke verbrannt, die sie für subversiv gehalten haben. Édouards Malerei ist … sehr besonders. Woher willst du wissen, dass sie das Bild nicht zerstören werden?»
Hélène machte sich Sorgen. Sie machte sich Sorgen um Édouards Gemälde und das Temperament unseres Bruders; sie machte sich Sorgen über meine Briefe und über die Tagebuchnotizen, die ich auf Zettel schrieb und hinter den Deckenbalken versteckte. «Ich will das Bild hier unten haben, wo ich es sehen kann. Mach dir keine Sorgen – die anderen sind in Paris sicher untergebracht.»
Sie wirkte nicht überzeugt.
«Ich will Farbe, Hélène. Ich will Leben. Ich will mir nicht Napoleon ansehen müssen oder Papas dumme Bilder mit den trübsinnigen Hunden. Und ich werde nicht zulassen, dass sie …», ich nickte Richtung Marktplatz, auf dem zwei deutsche Soldaten am Brunnen eine Zigarette rauchten, «… entscheiden, was ich mir in meinem eigenen Haus anschauen darf.»
Hélène schüttelte den Kopf, als wäre ich eine Irre, mit der sie Nachsicht haben müsse. Und dann ging sie Madame Louvier und Madame Durant bedienen, die – obwohl sie schon häufig angemerkt hatten, mein Zichorienkaffee würde schmecken, als stamme er aus der Kloake – zu uns gekommen waren, um sich die Geschichte von dem Schweinchen erzählen zu lassen.
Hélène und ich teilten uns in dieser Nacht ein Bett. Zwischen uns lagen Mimi und Jean. Manchmal war es so kalt, obwohl wir noch Oktober hatten, dass wir fürchteten, wir könnten die Kinder eines Morgens steif gefroren in ihren Nachthemden vorfinden, also drängten wir uns alle dicht aneinander. Es war spät, aber ich wusste, dass meine Schwester noch wach war. Das Mondlicht fiel durch die Lücke zwischen den Vorhängen herein, und ich konnte gerade so ihre Augen erkennen, die in eine unbestimmte Ferne blickten. Ich vermutete, dass sie darüber nachdachte, wo ihr Mann jetzt wohl sein mochte, ob er es warm hatte und in einem Haus wie unserem einquartiert worden war oder ob er in einem Schützengraben fror und zu demselben Mond aufschaute wie sie.
Weit weg kündete dumpfes Grollen von einer fernen Schlacht.
«Sophie?»
«Ja?» Wir sprachen leise flüsternd.
«Stellst du dir manchmal vor, wie es wäre … wenn sie nicht zurückkommen?»
Ich starrte in die Dunkelheit.
«Nein», log ich. «Weil ich weiß, dass sie zurückkommen. Und ich will nicht, dass es die Deutschen schaffen, mir noch mehr Angst zu machen.»
«Ich schon», sagte sie. «Manchmal vergesse ich, wie er aussieht. Ich betrachte sein Foto, und ich kann mich an überhaupt nichts erinnern.»
«Das liegt daran, dass du es so oft anschaust. Manchmal denke ich, wir verschleißen unsere Fotos, indem wir sie ansehen.»
«Aber ich kann mich an überhaupt nichts mehr erinnern … seinen Geruch, den Klang seiner Stimme. Ich weiß nicht mehr, wie er sich anfühlt. Es ist, als hätte er nie existiert. Und dann denke ich: Was ist, wenn es das war? Wenn er nie mehr zurückkommt? Was ist, wenn wir unser gesamtes restliches Leben so verbringen müssen, wenn uns selbst die kleinste Entscheidung von Männern vorgeschrieben wird, die uns hassen? Und ich bin nicht sicher … ich bin nicht sicher, ob ich das kann …»
Ich stützte mich auf einen Ellbogen und griff über Mimi und Jean hinweg nach der Hand meiner Schwester. «Doch, du kannst es», sagte ich. «Natürlich kannst du es. Jean-Michel kommt wieder nach Hause, und dein Leben wird schön sein. Frankreich wird frei sein, und das Leben wird wieder, wie es war. Besser, als es war.»
Schweigend lag sie da. Ich zitterte, weil ich nicht mehr ganz zugedeckt war, aber ich wagte nicht, mich zu rühren. Meine Schwester jagte mir Angst ein, wenn sie so redete. Es war, als hätte sie eine ganze Welt der Schrecken in ihrem Kopf, gegen die sie sich doppelt so heftig wehren musste wie wir Übrigen.
Ihre Stimme war schwach, bebte, als würde sie Tränen zurückhalten. «Weißt du, nachdem ich Jean-Michel geheiratet hatte, war ich so glücklich. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben frei.»
Ich wusste, was sie meinte. Unserem Vater war schnell die Hand ausgerutscht, wenn er nicht gleich den Gürtel benutzt hatte. In der Stadt galt er als überaus menschenfreundlicher Gastwirt, eine Stütze der Gesellschaft, der gute, alte François Bessette, immer für einen Scherz und ein Glas zu haben. Wir aber kannten seine gewalttätige Veranlagung. Unser größtes Bedauern war, dass unsere Mutter vor ihm starb, denn sonst hätte sie noch ein paar Jahre genießen können, in denen sie nicht in seinem Schatten stand.
«Es kommt mir vor … es kommt mir vor, als hätten wir einen Tyrann gegen den anderen getauscht. Manchmal denke ich, dass mir mein ganzes Leben lang jemand seinen Willen aufzwingen wird. Aber dich, Sophie, dich sehe ich lachen. Ich sehe deine Entschlossenheit, du bist so tapfer, hängst Bilder auf, streitest dich mit den Deutschen, und ich verstehe nicht, woher du das hast. Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wie es war, keine Angst zu haben.»
Schweigend lagen wir da. Ich konnte beinahe meinen Herzschlag hören. Sie glaubte, ich hätte keine Angst. Aber nichts ängstigte mich mehr als die Angst meiner Schwester. Sie hatte in den letzten Monaten eine neue Zerbrechlichkeit an sich, einen anderen Ausdruck in den Augen. Ich drückte ihre Hand. Sie erwiderte den Druck nicht.
Zwischen uns rührte sich Mimi und warf einen Arm über ihren Kopf. Hélène ließ meine Hand los, und ich sah im schwachen Licht, wie sie sich bewegte und den Arm ihrer Tochter wieder unter die Decke schob. Seltsam beruhigt von dieser Geste, legte ich mich wieder richtig hin und zog die Decke bis zum Kinn hinauf, um mein Zittern abzustellen.
«Schweinebraten», sagte ich in die Stille.
«Wie bitte?»
«Stell es dir einfach nur vor. Schweinebraten, die Haut mit Salz und Öl eingerieben, gebraten, bis sie knusprig zwischen den Zähnen knackt. Stell dir die weichen Falten aus warmem, weißem Fett vor, das rosafarbene Fleisch, das man zwischen den Fingern zerdrücken kann, dazu vielleicht Apfelkompott. Das werden wir in ein paar Wochen essen, Hélène. Stell dir bloß vor, wie gut das schmecken wird.»
«Schweinebraten?»
«Ja. Schweinebraten. Wenn ich spüre, dass ich schwach werde, denke ich an dieses Schwein und seinen fetten Bauch. Ich denke an seine knusprigen Öhrchen und an seine saftigen Keulen.» Ich konnte beinahe hören, wie sie lächelte.
«Sophie, du bist verrückt.»
«Aber stell es dir doch mal vor, Hélène. Und wie wunderbar es wäre. Stell dir Mimis Gesicht vor, während Schweinefett von ihrem Kinn tropft. Wie wird es sich wohl in ihrem kleinen Bauch anfühlen? Und kannst du dir vorstellen, wie sie sich amüsiert, wenn sie versucht, Stückchen von der Bratenkruste zwischen den Zähnen herauszubekommen?»
Jetzt musste sie doch lachen. «Ich weiß nicht mal, ob sie sich noch an den Geschmack von Schweinefleisch erinnert.»
«Die Erinnerung wäre schnell wieder da», sagte ich. «Genau wie deine Erinnerungen an Jean-Michel. Irgendwann kommt er ins Haus spaziert, und du wirst dich in seine Arme werfen, und sein Geruch, das Gefühl, wie er dich umfasst, wird dir so vertraut sein wie dein eigener Körper.»
Es war fast zu spüren, wie ihre Gedanken wieder Auftrieb bekamen. Ich hatte sie zurückgeholt. Kleine Siege.
«Sophie», sagte sie nach einer Weile. «Fehlt dir der Sex?»
«Jeden Tag», sagte ich. «Ich denke doppelt so oft daran wie an dieses Schwein.» Kurz herrschte Stille, dann kicherten wir leise. Und dann, ich weiß auch nicht, warum, mussten wir auf einmal so sehr lachen, dass wir uns den Mund zuhalten mussten, um die Kinder nicht aufzuwecken.
Ich wusste, dass der Kommandant zurückkommen würde. Und es dauerte vier Tage, bis es so weit war. Gerade hatte starker Regen eingesetzt, eine echte Sintflut, sodass unsere Gäste über leeren Tassen auf die beschlagenen Fensterscheiben sahen, ohne draußen etwas erkennen zu können. Im Nebenraum spielten der alte René und Monsieur Pellier Domino. Monsieur Pelliers Hund – er musste den Deutschen Gebühren für das Privileg zahlen, ihn halten zu dürfen – lag zwischen ihren Füßen. Viele unserer Gäste kamen täglich, um nicht mit ihren Ängsten allein sein zu müssen.
Ich bewunderte gerade Madame Arnaults Frisur, frisch hochgesteckt von meiner Schwester, als sich die Glastüren öffneten und er von zwei Offizieren flankiert in die Bar kam. In dem Raum, in dem gerade noch das harmonische Gemurmel geselliger Plauderei lag, wurde es mit einem Schlag ruhig. Ich trat hinter der Theke hervor und wischte mir die Hände an der Schürze ab.
Deutsche kamen nicht in unsere Bar, es sei denn, sie wollten etwas beschlagnahmen. Sie frequentierten die Bar Blanc, weiter oben in der Stadt, die größer war und in der man ihnen möglicherweise freundlicher begegnete. Wir hatten immer sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir kein gastlicher Ort für die Besatzungsmacht waren. Ich fragte mich, was sie uns dieses Mal wegnehmen würden. Noch ein paar Tassen und Teller weniger, und wir würden die Gäste bitten müssen, sich das Geschirr zu teilen.
«Madame Lefèvre.»
Ich nickte ihm zu. Ich spürte die Blicke meiner Gäste auf mir.
«Es wurde entschieden, dass Sie einige unserer Offiziere mit Mahlzeiten versorgen werden. In der Bar Blanc ist nicht genügend Platz für unsere neu ankommenden Männer, um in Ruhe zu essen.»
Ich konnte ihn jetzt zum ersten Mal deutlich in Augenschein nehmen. Er war älter, als ich gedacht hatte, Ende vierzig vielleicht, auch wenn das bei Männern aus den kämpfenden Einheiten immer schwer zu beurteilen war. Sie sahen allesamt älter aus, als sie waren.
«Ich fürchte, das ist unmöglich, Herr Kommandant», sagte ich. «Wir haben hier im Hotel seit über achtzehn Monaten keine Mahlzeiten mehr serviert. Wir haben kaum genügend Lebensmittel, um unsere eigene kleine Familie zu ernähren. Wir können unmöglich Mahlzeiten bereitstellen, die Ihren Ansprüchen genügen.»
«Das ist mir sehr wohl bewusst. Ab der nächsten Woche wird es ausreichende Vorratslieferungen geben. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie daraus Mahlzeiten kochen, die der Versorgung von Offizieren angemessen sind. Wie ich höre, war dieses Hotel einmal ein angesehenes Haus. Ich bin sicher, dass Sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügen.»
Hinter mir hörte ich meine Schwester Luft holen, und ich wusste, dass sie dasselbe dachte wie ich. Die schreckliche Vorstellung, Deutsche in unserem Hotel zu haben, wurde von dem Gedanken gemäßigt, der seit Monaten über allen anderen stand: Essen. Es würde Reste geben, Knochen, aus denen man Brühe kochen konnte. Es würde Essensdüfte geben, gestohlene Bissen, Extrarationen, Fleischstücke und Käsescheiben, die man heimlich beiseitegeschafft hatte.
Trotzdem. «Ich denke nicht, dass unsere Bar für Sie geeignet ist, Herr Kommandant. Wir verfügen hier über keinerlei Bequemlichkeiten mehr.»
«Ich beurteile selbst, wo es meine Männer bequem haben. Ich möchte auch Ihre Zimmer sehen. Möglicherweise werde ich ein paar von meinen Männern hier einquartieren.»
Ich hörte den alten René «Sacrebleu!» murmeln.
«Sie können sich die Zimmer sehr gern ansehen, Herr Kommandant. Aber Sie werden feststellen, dass uns Ihre Vorgänger wenig übrig gelassen haben. Die Betten, die Steppdecken, die Vorhänge und sogar die Kupferrohre, mit denen die Waschbecken versorgt wurden, befinden sich schon in deutschem Besitz.»
Ich wusste, dass ich mir möglicherweise seinen Ärger zuzog: Ich hatte in der vollbesetzten Bar reichlich deutlich gemacht, dass der Kommandant nichts von dem Vorgehen seiner eigenen Leute wusste, dass seine Informationen, jedenfalls soweit es unsere Stadt anging, mangelhaft waren. Doch es war unerlässlich, dass mich die Leute dickköpfig und stur erlebten. Deutsche in unserer Bar zu haben, würde Hélène und mich zur Zielscheibe von Klatsch und bösartigen Gerüchten machen. Es war wichtig, uns dabei sehen zu lassen, wie wir alles taten, um die Deutschen von unserem Hotel fernzuhalten.
«Noch einmal, Madame, ich beurteile selbst, ob Ihre Zimmer angemessen sind. Und jetzt möchte ich sie sehen, bitte.» Er bedeutete seinen Männern, in der Bar zu bleiben. Dort würde es vollkommen still bleiben, bis sie wieder abgezogen waren.
Ich straffte mich, ging langsam hinaus in den Eingangsflur und griff mir im Gehen die Schlüssel. Ich spürte sämtliche Blicke auf mir, als ich mit rauschenden Röcken aus dem Raum ging, die schweren Schritte des Deutschen hinter mir. Ich schloss die Tür zum Hauptkorridor auf. (Ich hielt alles abgeschlossen. Es war schon vorgekommen, dass Franzosen das gestohlen hatten, was nicht schon von den Deutschen beschlagnahmt worden war.)
In diesem Teil des Gebäudes roch es modrig und feucht; es war Monate her, dass ich zuletzt hier gewesen war. Schweigend gingen wir die Treppe hinauf. Ich war dankbar, dass er sich mehrere Schritte hinter mir hielt. Oben blieb ich stehen und wartete, dass er in den Korridor trat, dann schloss ich das erste Zimmer auf.
Es hatte Zeiten gegeben, in denen mich schon der bloße Anblick unseres Hotels in diesem Zustand zum Weinen gebracht hatte. Das Rote Zimmer war einmal der Stolz des Le Coq Rouge gewesen; das Zimmer, in dem meine Schwester und ich unsere Hochzeitsnächte verbracht hatten, das Zimmer, in dem der Bürgermeister die Würdenträger unterbrachte, die in die Stadt kamen. Hier hatte ein enormes Himmelbett gestanden, mit blutroten Tapisserien, und das große Fenster ging auf unseren Barockgarten hinaus. Der Teppich stammte aus Italien, die Möblierung aus einem Château in der Gascogne, die Tagesdecke war aus dunkelroter chinesischer Seide. Es hatte einen vergoldeten Kronleuchter gegeben und einen gewaltigen Marmorkamin, in dem jeden Morgen ein Zimmermädchen das Feuer anzündete und dafür sorgte, dass es bis zum Abend brannte.
Ich öffnete die Tür und trat einen Schritt zurück, damit der Deutsche eintreten konnte. Das Zimmer war leer, abgesehen von einem dreibeinigen Stuhl, der in einer Ecke stand. Die Dielen, auf denen kein Teppich mehr lag, waren grau und staubig. Das Bett war längst verschwunden, zusammen mit den Vorhängen hatte es zu den ersten Sachen gehört, die uns die Deutschen stahlen, nachdem sie die Stadt besetzt hatten. Der Marmorkamin war aus der Wand gerissen worden. Zu welchem Zweck, wusste ich nicht; man konnte ihn anderswo ja wohl kaum brauchen. Ich glaube, Becker hatte uns einfach demoralisieren wollen, indem er uns alles Schöne wegnahm.
Er ging einen Schritt in das Zimmer hinein.
«Passen Sie auf, wohin Sie treten», sagte ich. Er senkte seinen Blick, dann sah er es: die Ecke des Zimmers, in der sie im letzten Frühjahr versucht hatten, die Dielen für Feuerholz herauszureißen. Doch das Haus war zu solide gebaut, die Bretter zu sorgfältig angenagelt, und nach drei Stunden, in denen sie lediglich drei lange Planken hatten lösen können, hatten sie aufgegeben. Das Loch, das aussah wie ein O des Protests, ließ die Balken darunter sehen.
Der Kommandant starrte eine Zeitlang auf den Boden. Dann hob er den Kopf und ließ seinen Blick durch das Zimmer schweifen. Ich war noch nie allein mit einem Deutschen in einem Raum gewesen, und mein Herzschlag beschleunigte sich. Ich roch einen Hauch von Tabak, sah die Regenspritzer auf seiner Uniform. Ich hielt meinen Blick auf seinen Nacken gerichtet und schob meine Schlüssel zwischen die Finger, bereit, ihm mit meiner so gewappneten Faust einen Hieb zu versetzen, falls er mich plötzlich angriff. Ich wäre nicht die erste Frau, die ihre Ehre verteidigen musste.
Doch er drehte sich nur zu mir um. «Sind alle Zimmer in einem so schlechten Zustand?», fragte er.
«Nein», gab ich zurück. «Bei den anderen ist es noch schlimmer.»
Er sah mich so lange an, dass ich beinahe rot wurde. Aber ich wehrte mich dagegen, mich von diesem Mann einschüchtern zu lassen. Ich starrte ihn ebenfalls an, sein kurz geschnittenes, ergrauendes Haar, seine fast durchsichtig wirkenden blauen Augen, die mich unter seiner Schirmmütze heraus anschauten. Ich hielt mein Kinn erhoben, meine Miene war ausdruckslos.
Schließlich wandte er sich ab und ging an mir vorbei, die Treppe hinunter.
«Ich werde Sie darüber informieren lassen, wann die erste Lebensmittellieferung kommt», sagte er. Dann ging er mit schnellem Schritt den Korridor entlang und zurück in die Bar.
Kapitel 3
Sie hätten nein sagen sollen.» Madame Durant bohrte mir von hinten ihren knochigen Zeigefinger in die Schulter. Ich machte vor Schreck einen Satz. Sie trug eine weiße Rüschenhaube, und ein ausgeblichenes blaues Häkelcape lag um ihre Schultern. Diejenigen, die sich über unseren Mangel an Neuigkeiten beschwerten, nachdem wir keine Zeitung mehr haben durften, waren offensichtlich niemals meiner Nachbarin über den Weg gelaufen.
«Wie bitte?»
«Die Deutschen verköstigen. Sie hätten nein sagen sollen.»
Es war ein eiskalter Morgen, und ich hatte mir meinen Schal ums Gesicht gewickelt. Ich zog ihn herunter, um ihr zu antworten. «Ich hätte nein sagen sollen? Und werden Sie selbst nein sagen, wenn die Deutschen beschließen, Ihr Haus zu besetzen, werden Sie das dann tun, Madame?»
«Sie und Ihre Schwester sind jünger als ich. Sie haben die Kraft, um gegen sie zu kämpfen.»
«Nur leider fehlen mir die Bataillonsgeschütze. Was schlagen Sie also vor? Sollen wir uns im Hotel verbarrikadieren? Die Deutschen mit Tassen und Töpfen bewerfen?»
Sie schalt mich weiter aus, während ich die Tür für sie aufhielt. In der Bäckerei roch es nicht mehr wie in einer Bäckerei. Es war hier immer noch warm, aber der Geruch nach Baguettes und Croissants war längst verflogen. Dieses Detail machte mich jedes Mal traurig, wenn ich über die Türschwelle trat.
«Wirklich, ich weiß nicht, wohin es mit diesem Land noch kommen soll. Wenn Ihr Vater Deutsche in seinem Hotel gesehen hätte …» Madame Louvier war offenkundig ebenfalls bestens informiert. Sie schüttelte missbilligend den Kopf, als ich auf die Theke zuging.
«Er hätte genau das Gleiche getan.»
Monsieur Armand, der Bäcker, brachte sie zum Schweigen. «Sie dürfen Madame Lefèvre nicht kritisieren! Wir müssen jetzt alle nach ihrer Pfeife tanzen. Madame Durant, kritisieren Sie mich denn dafür, das Brot für sie zu backen?»
«Ich finde es einfach unpatriotisch, ihren Willen zu befolgen.»
«Leicht gesagt, wenn einem keine Waffe an den Kopf gehalten wird.»
«Also kommen noch mehr von ihnen her! Noch mehr, die in unsere Vorratskammern drängen, unsere Lebensmittel essen und unser Vieh stehlen! Wahrhaftig, ich weiß nicht, wie wir diesen Winter überleben sollen.»
«Wie wir es immer getan haben, Madame Durant. Mit Gleichmut und guter Laune, und Gebeten dafür, dass der liebe Gott, falls es nicht unsere tapferen Männer tun, den Boches einen ordentlichen Tritt in den Hintern verpasst.» Monsieur Armand zwinkerte mir zu. «Nun, die Damen, was darf es sein? Wir haben eine Woche altes Schwarzbrot, fünf Tage altes Schwarzbrot und etwas Schwarzbrot unbestimmbaren Alters, aber garantiert ohne Rüsselkäfer.»
«Es gibt Tage, an denen ich einen Rüsselkäfer sogar sehr gern als Hors d’œuvre essen würde», sagte Madame Louvier trübsinnig.
«Dann werde ich Ihnen ein Einmachglas voll aufheben, ma chère Madame. Glauben Sie mir, wir erhalten oft eine ordentliche Portion davon in unserem Mehl. Rüsselkäferkuchen, Rüsselkäferpastete, Rüsselkäferprofiteroles. Dank der großzügigen deutschen Unterstützung können wir mit allem dienen.» Wir lachten. Es war unmöglich, ernst zu bleiben. Monsieur Armand gelang es selbst an den düstersten Tagen, uns ein Lächeln zu entlocken.
Madame Louvier nahm ihr Brot und legte es mit angewiderter Miene in ihren Korb. Monsieur Armand nahm es ihr nicht übel; er sah diesen Gesichtsausdruck hundert Mal am Tag. Das Brot war schwarz, vierkantig und klebrig. Es sonderte einen modrigen Geruch ab, als würde es schimmeln, seit es aus dem Ofen gekommen war. Es war so hart, dass sich ältere Frauen häufig von jüngeren beim Schneiden helfen lassen mussten.
Wir hatten gar nicht gemerkt, dass sich die Tür geöffnet hatte. Doch dann kehrte in dem Laden schlagartig Stille ein. Ich drehte mich um und sah Liliane Béthune hereinkommen, den Kopf hoch erhoben, doch niemanden direkt ansehend. Ihr Gesicht war runder als das der meisten anderen, sie trug Puder und Rouge. Sie murmelte ein Bonjour und griff in ihre Tasche. «Zwei Laib Brot, bitte.»
Sie roch nach einem teuren Parfüm, und ihr Haar war zu Locken gedreht. In einer Stadt, in der die meisten Frauen zu erschöpft waren oder zu wenige Pflegemittel besaßen, um mehr als das Minimum an Körperpflege zu betreiben, fiel sie auf wie ein glitzerndes Juwel. Aber es war ihr Mantel, der meinen Blick anzog. Ich konnte nicht aufhören, ihn anzustarren. Er war schwarz wie Onyx, aus edelstem Persianerfell und so dick wie ein Kaminvorleger. Er besaß den sanften Schimmer neuer und kostspieliger Dinge, und der Kragen reichte bis zu ihrem Gesicht, sodass es aussah, als würde ihr langer Hals aus schwarzer Melasse herauswachsen. Ich sah, wie die beiden älteren Frauen den Mantel registrierten und wie sich ihre Mienen verhärteten, während sie ihren Blick daran heruntergleiten ließen.
«Eins für Sie und eins für Ihren Deutschen?», murmelte Madame Durant.
«Eins für mich. Und eins für meine Tochter.»
Ausnahmsweise lächelte Monsieur Armand nicht. Er griff unter die Ladentheke, ohne sie aus den Augen zu lassen, und knallte mit seinen beiden kräftigen Händen zwei Brotlaibe auf die Oberfläche. Er wickelte sie nicht ein.
Liliane hielt ihm einen Geldschein hin, aber er nahm ihn nicht an. Er wartete die paar Sekunden, die sie brauchte, um den Schein auf die Ladentheke zu legen, und nahm ihn dann mit spitzen Fingern, als könnte er eine Krankheit übertragen. Dann griff er in seine Kasse und warf zwei Münzen als Wechselgeld auf die Theke, obwohl sie die Hand ausgestreckt hielt.
Sie sah ihn an und dann auf die Theke mit den Münzen. «Behalten Sie’s», sagte sie. Und mit einem wütenden Blick in unsere Richtung schnappte sie sich die Brote und rauschte hinaus.
«Wie kann sie es nur wagen …» Madame Durant fühlte sich immer am wohlsten, wenn sie sich über das Verhalten anderer empören konnte.
«Ich vermute, sie muss essen, wie jeder andere auch», sagte ich.
«Jeden Abend geht sie zum Hof der Fourriers. Jeden Abend. Dann sieht man sie durch die Stadt huschen wie einen Dieb.»
«Sie hat zwei neue Mäntel», sagte Madame Louvier. «Der andere ist grün. Ein nagelneuer grüner Wollmantel. Aus Paris.»
«Und Schuhe. Aus Ziegenleder. Natürlich wagt sie es nicht, die tagsüber zu tragen. Sie weiß, dass wir sie am nächsten Baum aufknüpfen würden.»
«Nein, die doch nicht. Nicht, solange die Deutschen auf sie aufpassen.»
«Ja, aber wenn die erst mal weg sind, sieht es gleich ganz anders aus, eh?»
«Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken, Ziegenlederschuhe oder nicht.»
«Ich hasse es, wie sie herumstolziert und jedem ihren Wohlstand unter die Nase reibt. Für wen hält sie sich eigentlich?»
Monsieur Armand sah der jungen Frau nach, die gerade den Marktplatz überquerte. Plötzlich lächelte er. «Ich würde mir keine Sorgen machen, meine Damen. Auch bei ihr läuft nicht alles so, wie sie es will.»
Wir sahen ihn an.
«Können Sie ein Geheimnis bewahren?»
Ich wusste nicht, warum er sich die Mühe machte nachzufragen. Diese beiden alten Frauen konnten ihre Plappermäuler kaum zehn Sekunden am Stück halten.
«Was ist es?»
«Sagen wir einfach, jemand von uns sorgt dafür, dass die noble Mademoiselle eine Kur erhält, mit der sie nicht rechnet.»
«Das verstehe ich nicht.»
«Ihre Brote liegen immer etwas abseits unter der Ladentheke. Sie enthalten nämlich spezielle Zutaten. Zutaten, die, wie ich Ihnen versichere, in kein anderes meiner Brote kommen.»
Die alten Damen rissen die Augen auf. Ich wagte nicht nachzufragen, was der Bäcker meinte, aber das Glitzern in seinen Augen ließ auf mehrere Möglichkeiten schließen, von denen ich keine einzige ausführlicher besprechen wollte.
«Non!»
«Monsieur Armand!» Sie waren entsetzt, aber sie begannen trotzdem zu gackern.
Mir wurde etwas übel. Ich mochte Liliane Béthune und das, was sie tat, nicht, aber diese Sache stieß mich ab. «Ich … ich muss gehen. Hélène braucht …» Ich griff nach meinem Brot. Ihr Lachen hallte in meinen Ohren nach, als ich in die relative Sicherheit des Hotels hastete.
Die Lebensmittel kamen am darauffolgenden Freitag. Zuerst die Eier, zwei Dutzend, geliefert von einem jungen deutschen Unteroffizier, der sie mit einem weißen Tuch bedeckt hatte, als würde er Schmuggelware transportieren. Dann drei Körbe mit weißem, frischem Brot. Ich mochte Brot seit jener Offenbarung in der Boulangerie nicht mehr so recht, aber die frischen, knusprigen, warmen Laibe machten mich beinahe schwindelig vor Verlangen. Ich musste Aurélien nach oben schicken, so sehr fürchtete ich, dass er der Versuchung nicht widerstehen konnte und sich einen Bissen abbrechen würde.
Als Nächstes kamen sechs Hühner, noch ungerupft, und eine Kiste mit Kohl, Zwiebeln, Karotten und wildem Knoblauch. Und dann Einmachgläser mit Tomaten, Reis und Äpfeln. Milch, Kaffee, drei ordentliche Portionen Butter, Mehl, Zucker. Flaschenweise Wein aus dem Süden. Schweigend empfingen Hélène und ich jede Lieferung. Die Deutschen gaben uns Formulare, auf denen die zugestellte Menge genau aufgelistet war. Sich etwas davon abzuzweigen würde nicht leicht sein. Wir erhielten einen Vordruck, auf dem wir die genauen Mengen für jedes Rezept aufschreiben sollten. Außerdem verlangten sie, dass wir alle Abfälle in einem Eimer sammelten, damit sie an die Tiere verfüttert werden konnten. Als ich das sah, hätte ich am liebsten losgefaucht.
«Sollen wir für heute Abend kochen?», fragte ich den letzten Unteroffizier.
Er zuckte mit den Schultern. Ich deutete auf die Uhr. «Heute?» Ich wies auf die Lebensmittel. «Kochen?»
«Ja», antwortete er mir auf Deutsch mit einem begeisterten Nicken. «Sie kommen um sieben Uhr.»
«Sieben Uhr», sagte Hélène hinter mir. «Sie wollen um sieben Uhr essen.»