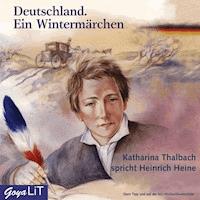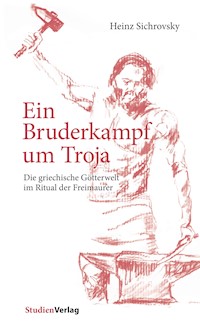
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: StudienVerlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Quellen und Darstellungen zur europäischen Freimaurerei
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ein Logenplatz für Homer: Die Epen Ilias und Odyssee, gemeinhin dem angeblich blinden Dichter zugeschrieben, sind die ältesten literarischen Werke Europas und gehören unbestritten zu den einflussreichsten der Weltliteratur. Seit Jahrtausenden werden sie eifrig gelesen, rezipiert, übersetzt, nachgedichtet. In den faszinierenden Geschichten über eifersüchtige Göttinnen, listige Helden und rachsüchtige Könige fanden sich auch die Freimaurer wieder. So sahen sie im Urteil des trojanischen Prinzen Paris die Suche nach Schönheit, Stärke und Weisheit verkörpert und betrachteten den Götterschmied Hephaistos als ihren Prototypen und Bruder im Geiste. Von Herder, Voß und Goethe bis Gabriele D'Annunzio oder Nikos Kazantzakis – immer wieder ließen sich masonische Dichter und Denker von den antiken Göttern inspirieren. Heinz Sichrovsky zeigt die vielfältigen Einflüsse, die Homers Welt auf die Werke und Rituale von Freimaurern ausübte. Mit Illustrationen von Oskar Stocker.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinz Sichrovsky
Ein Bruderkampf um Troja
Quellen und Darstellungen zur europäischen Freimaurerei
Hg. von Helmut Reinalter in Zusammenarbeit mit dem Institut fur Ideengeschichte
Band 21
Heinz Sichrovsky
Ein Bruderkampf um Troja
Die griechische Götterweltim Ritual der Freimaurer
StudienVerlag
InnsbruckWienBozen
Inhalt
Einführung
Wer sind die Freimaurer?
Woher kommen die Freimaurer?
Eine kleine Götterkunde
Eine kleine Heldenkunde
I. Die Ursprünge
1. Die Mystifikationen des Reverend Anderson
2. Singe den Zorn, o Göttin: Die Ilias
II. Vom Bauen und Schmieden
1. Hephaistos, Hirams Bruder
2. Witwensöhne
3. Athene und die Illuminaten
4. Prometheus, Luzifer und Tubal, der Schmied
5. Die antimoralische Götterbande
6. Der verurteilte Paris: Weisheit, Stärke, Schönheit
III. Kulte und Riten
1. Apollo, Helios und der Weg nach Eleusis
2. Was wusste Pythagoras?
3. Vom Tartaros ins Elysion
IV. Der Bruderkampf um Troja
1. Herder und der große Mäonide
2. Der Zwist um Bruder Pope
3. Gottfried August Bürger: Das Scheitern eines braven Mannes
4. Graf Stolberg schafft klare Verhältnisse
5. Johann Heinrich Voß: Einer gewinnt
6. Goethe und der Bruder Reißwolf
V. Österreich: Homer unkorrekt
VI. Italien: Freimaurerei als Freiheitskampf
1. Der kämpferische Bund
2. Giosuè Carducci: Homer im Widerstand
3. Giovanni Pascoli: Der desillusionierte Odysseus
4. Gabriele D’Annunzio: Odysseus, der Übermensch
VII. Nikos Kazantzakis: Der Kreis schließt sich
Anhang
Die Ilias in Bruderhand – der erste Gesang in fünf Übersetzungen von vier Freimaurern
Johann Wolfgang von Goethe: Aus Homers Odyssee
Anmerkungen
Literatur (Auswahl)
Danksagung
Einführung
Wer sind die Freimaurer?
Sämtliche Arbeiten zur Freimaurerei laborieren an einem Grundproblem: dass es nämlich im Gefolge einer früh vollzogenen, bis heute unüberbrückten Spaltung „die Freimaurerei“ nicht gibt. In den katholisch dominierten Ländern etwa des romanischen und des lateinamerikanischen Raums ist sie eine progressiv politische und antiklerikale Bewegung mit revolutionärer Geschichte, war über Jahrhunderte verboten und stand unter Kirchenbann. In protestantischen Ländern wie Deutschland, England, Schweden oder den USA hingegen wurde sie früh ins Machtgefüge einbezogen, agierte legitimistisch und religionstreu und zählte Könige, Bischöfe und Präsidenten zu ihren Mitgliedern. Als übergeordnete gesetzgebende Körperschaften fungieren einerseits die Großloge von England, andererseits der Grand Orient de France. (In Österreich arbeiten Logen beider Richtungen, wobei die maßgebliche Großloge von Österreich der legitimistischen englischen Richtung angehört.)
Zudem gab und gibt es eine Unzahl verschiedener Systeme: Neben den beiden weltumspannenden Freimaurerorganisationen existieren auch kleine Einheiten mit mystischer, politischer, sektenhaft religiöser oder geselliger Zielrichtung. Dazu kommt eine Unzahl teils dubioser Hochgrade, die auf das maurerische Fundament Lehrling–Geselle–Meister getürmt werden. Explizite Auswucherungen werden als irreguläre oder Winkellogen bezeichnet. Aber auf den Begriff „Freimaurerei“ gibt es kein Patent. Wer sich berufen fühlt, kann gründen, wozu die Berufung ihn treibt.
Zumindest äußerlich aber ist allen das Ziel gemeinsam: die Veredelung des Einzelnen vom rauen zum behauenen Stein, der sich in den Tempel der allgemeinen Menschenliebe fügt und die Welt so den Idealen von Freiheit und Mitmenschlichkeit um den Bruchteil eines Millimeters näher bringt. Übergeordnetes Symbol dieses Vorganges ist der Bau des ersten Salomonischen Tempels etwa 950 v. Chr. Das überkonfessionelle Gottessymbol heißt in der Freimaurerei „Großer Baumeister aller Welten“.
Die klassische Maurerei findet mit drei Graden – Lehrling, Geselle und Meister – ihr Auslangen. Wer beitreten will, braucht einen Bürgen, der ihn seiner eigenen Loge zuführt. Verlaufen die Vorprüfungen positiv, avanciert der Anwärter zum Suchenden. Innerhalb der Loge wird mittels weißer oder schwarzer Kugeln abgestimmt. Das Idealresultat dieser so genannten Ballotage wird „hell leuchtend“ genannt. Nun wird der Suchende in einer feierlichen rituellen Zeremonie in den Bund aufgenommen. Zuvor meditiert er in der „dunklen Kammer des stillen Nachdenkens“. Dann wird er im Tempel mit verbundenen Augen durch drei Erkenntnisstufen geführt. Am Ende dieser drei so genannten Reisen wird ihm durch Abnehmen der Binde das „große Licht“ erteilt.
Damit ist er als Lehrling gleichberechtigtes Vollmitglied der Loge. Das Ziel dieses ersten Grades ist die Selbstdefinition, die Grundanforderung entspricht der Aufschrift im Tempel von Delphi: „Erkenne dich selbst.“ Nach heute mindestens einem Jahr wird der Lehrling rituell zum Gesellen befördert. Nun geht es um seine Sozialisierung, sein Verhältnis zur Welt, im Besonderen zu den Brüdern, und die Bekämpfung der Eitelkeit mit dem Auftrag „beherrsche dich selbst“. Mindestens ein weiteres Jahr später wird der Geselle in den dritten Grad, zum Meister, erhoben. „Veredle dich selbst“ lautet hier die Erfordernis, und das Ziel wird durch das Goethe’sche Stirb und Werde (aus dem Gedicht Selige Sehnsucht) vorgegeben, dort exemplifiziert durch den Schmetterling, der in die Kerzenflamme fliegt: Der Freimaurer überwindet im Erhebungsritual symbolisch den eigenen Tod – er erleidet das Schicksal des Tempelbaumeisters Hiram, von dem in diesem Buch viel die Rede sein wird, um als veredelter Mensch weiterzuleben und zu arbeiten.
Das Logenleben artikuliert sich in einer Vielzahl an Symbolen und Ritualen. Die rituelle Arbeit findet im Tempel statt, einem rechteckigen Raum mit vier angenommenen Himmelsrichtungen, in dessen Mitte ein kunstvoll gefertigter Teppich liegt, auf dem sich die Symbole des freimaurerischen Lebens konzentrieren. Ihn umstehen drei hohe, von Kerzenflammen gekrönte Säulen. Sie verkörpern die maurerischen Grundtugenden, die oft auch große oder kleine Lichter genannt werden: Weisheit für den Meister-, Stärke für den Gesellen- und Schönheit für den Lehrlingsgrad.
Der Osten ist der Ort des Sonnenaufganges und der Vollendung. In den Ewigen Osten geht nach freimaurerischer Terminologie jeder Bruder nach seinem Tod. Der Osten, der an der einen Schmalseite des Tempels angenommen wird, ist der Platz des gewählten Meisters vom Stuhl. Vor seinem Pult befindet sich ein Altar mit den freimaurerischen Hauptsymbolen: Der Zirkel verkörpert die Menschenliebe, das Winkelmaß das redliche Handeln. Dazu kommt die Bibel, die durch andere konfessionelle Schriften (etwa den Koran) ersetzt werden kann. Dieses Buchsymbol steht für das Sittengesetz.
Im gegenüberliegenden Westen liegt das vom Tempelhüter bewachte Tor, flankiert von den beiden alttestamentarisch beglaubigten Säulen des Salomonischen Tempels (1 Könige 7). Hier haben meist die beiden Aufseher ihre Pulte. Sie und der Meister vom Stuhl sind mit Hämmern versehen und schlagen rituelle Codes auf ihre Pulte.
Das Ritual verläuft im Prinzip weltweit gleich, variiert aber in Details. Zu Beginn betreten die Brüder in ritueller Ordnung den Tempel und nehmen ihre Plätze ein. Als Reminiszenz an die Gründerväter wird über der Abendbekleidung ein kleiner symbolischer Maurerschurz getragen. Der Meister vom Stuhl und die beiden Aufseher entzünden die Kerzen der Weisheit, der Stärke und der Schönheit. In mehreren Ländern – auch in Österreich – folgt das Baustück, ein Vortrag zu einem freimaurerisch relevanten Thema. Die Loge wird rituell geschlossen. Beim anschließenden gemeinsamen Mahl, an der so genannten Weißen Tafel im Speisesaal, wird das Thema des Vortrags diskutiert.
Woher kommen die Freimaurer?
In den englischen Dombauhütten des Mittelalters arbeiteten die für Architektur und Steinbildhauerei zuständigen „freestone masons“. Sie trugen das Licht der Kunst und der Wissenschaft in eine der dunkelsten Epochen der Geschichte, doch ihr Auftraggeber – die Kirche – war Hauptverursacher des Dunkels. Also traf man einander im Geheimen, um das gemeinsame bessere Wissen brüderlich zu pflegen. Der Begriff „freemason“ findet sich erstmals in den Dokumenten des Kathedralenbaus von Exeter anno 1396. Aus diesem etymologischen Grund wird der Begriff „freimaurerisch“ oft durch das Lehnwort „masonisch“ ersetzt, und die Logen heißen als Reminiszenz an die Gründertage auch Bauhütten. Der Freimaurerforscher Helmut Reinalter verweist zudem auf den normannisch-französischen Begriff „masoun“, der schon in Wörterbüchern des 12. Jahrhunderts auftaucht.1 Als die Dombauten spärlicher wurden, akzeptierte man auch Nicht-Handwerker, um den Fortbestand der Bruderschaft zu sichern. Im frühen 18. Jahrhundert organisierte man sich unter den ersten Großlogen, und der Bund der Freimaurer, in dem einander Adel, Bürgertum und Werktätige gleichberechtigt begegneten, wurde zur bedeutenden Triebkraft der Aufklärung. Seine Ziele verfolgte er nach seiner Spaltung teils auf evolutionärem, teils auf revolutionärem Weg.
Alle anderen Herkunftsmythen sind ins Reich der Legende zu verweisen. Weder unter den altägyptischen Osiris-Priestern noch in der Tafelrunde des Gralskönigs Artus amtierte ein Urzeit-Freimaurer. Auch mit dem Templerorden, einer besonders brutalen Elite-Formation des Kreuzritterheers, hat der Bund dankenswerterweise nichts zu tun. Aber ein philosophisches Grundkonzept brauchte man und bediente sich zu dessen Erstellung aus dem unermesslichen Fundus der Mythen. Fundament des Ganzen ist das Alte Testament mit der Baugeschichte des Salomonischen Tempels.
Doch wurden auch Inhalte anderer Kulturen in das mythologische Konglomerat eingebracht. Die Wege sind nicht immer rekonstruierbar, zumal die Mythen im Sinn des „kollektiven Unbewussten“ (C. G. Jung) durch Jahrtausende und Kulturkreise wandern.
Zweifellos aber nimmt die griechische Antike, deren Wiedergeburt schon in der Renaissance für die Überwindung des mittelalterlichen Dunkels stand, innerhalb der freimaurerischen Ritualistik hervorragenden Rang ein. Dass der aufklärerisch-bildungsbürgerlich grundierte Bund mit Eifer aus diesem Fundus schöpfte, versteht sich. Apollo, Minerva (Athene), Prometheus, Helios, Eos, Phönix, Pythagoras, Eleusis, Hippokrates und Panta Rhei („alles fließt“): Diese und viele andere Logennamen zeugen von einer Verbindung, der in diesem Buch nachgespürt werden soll.
Eine kleine Götterkunde
Die Genealogie der griechischen Götterwelt beruht auf einer großen Zahl einander oft widersprechender, ja ausschließender Mythologien. Graphische Darstellungen pflegen chaotisch zu scheitern, zumal die Population unüberblickbar groß ist: Nahezu jeder Fluss oder Berg hat seine eigene Gottheit.
Ausgehend von Hesiods Theogonie, dem ältesten Versuch einer Systematisierung, ergibt sich das nachfolgende Bild. Im Fettdruck hervorgehoben sind die so genannten zwölf olympischen Götter, die Hauptgottheiten. Ihr Sitz ist der Olymp, das höchste griechische Gebirge. Deshalb wird der in der Unterwelt wohnhafte, unermesslich mächtige Hades nicht zu ihnen gezählt. Dionysos, der Gott des Rauschs, und der posthum vergöttlichte Herakles fallen wegen ihrer sterblichen Mütter, andere wegen mangelnder Bedeutung aus der Wertung.
Am Anfang war, wie in der Bibel, Chaos (das Chaos). Aus ihm entstanden zeitgleich Gaia (die Erde), Tartaros (die tiefste Unterwelt) und der ihm verwandte Erebos (Finsternis), Eros (die lustgetriebene Liebe) und Nyx (die Nacht).
Nyx gebar außer dem Schlaf (Hypnos), den Träumen (Oneiroi) und dem friedlichen Tod (Thanatos) u. a. auch Nemesis (Rache), Eris (Zank), Apate (Trug) und die Moiren, die allwaltenden, auch in der Einzahl Moira auftretenden Schicksalsgöttinnen.
Gaia wurde ohne Zeugungsvorgang im Schlaf durch Eros schwanger. Sie gebar Uranos (den Himmel), Ourea (die Berge) und Pontos (das Meer).
Uranos krönte sich zum ersten Herrscher über die Welt. Zum gewaltsamen Ende seiner Karriere erzeugte er Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Schönheit, die älteste der zwölf olympischen Gottheiten: Sein Sohn und Nachfolger Kronos schnitt ihm die Geschlechtsteile ab und warf sie ins Meer – aus Blut und Samen entstand die „Schaumgeborene“ (der Ilias zufolge ist Aphrodite allerdings die Tochter des Zeus und der Dione, gleichfalls eine Liebesgöttin).
Zu Zeiten der Macht zeugte Uranos mit seiner Mutter Gaia das Urgöttergeschlecht der Titanen, die somit aus Himmel und Erde entstanden.
Die wichtigsten Titanen sind
Kronos
Okeanos
Hyperion
Rheia
Thetys
Theia
Iapetos
Hyperion und Theia sind die Eltern des Helios (Sonne), der Selene (Mond) und der Eos (Morgenröte), die beiden Erstgenannten unmittelbare Pendants der späteren Götterzwillinge Apollo und Artemis.
Thetys (übrigens die Urgroßmutter des Achill) erzeugte mit Okeanos die Tochter Klymene. Diese wiederum gebar ihrem Onkel Iapetos u. a. den Titanen Prometheus. Letztgenannter erschuf den Menschen und brachte ihm das Feuer der Aufklärung.
Rheia (laut C. G. Jung der inbegriffliche Mutterarchetyp) und das neue Oberhaupt Kronos aber sind die wesentlichen Urheber der ersten olympischen Göttergeneration:
Zeus (Herrscher über die Götter)Hera (Herrscherin über die Götter)Hestia (Familie)Poseidon (Meer)Demeter (Landwirtschaft)Hades (Unterwelt)
Nach einem geglückten Putsch gegen Kronos teilen sich Zeus (Himmel und Erde), Hades (Unterwelt) und Poseidon (Meer) das Universum auf. Ungeachtet mehrerer Aufstände der Mit-Götter ist Zeus dauerhaft der neue Herr über das Ganze. Er vermählt sich mit seiner Schwester Hera.
Die beiden haben drei bzw. vier gemeinsame Kinder, den Kriegsgott Ares, Hebe (die Göttin der Anmut, später Gattin des Herakles) und Eleithyia (Göttin der Geburt). Überlieferungen zufolge ist auch Hephaistos (Feuer und Schmiedekunst) ein Sohn des Herrscherpaars, doch die Theogonie macht ihn als Produkt einer Selbstzeugung der eifersüchtigen Hera namhaft.
Anlass zum Unmut gibt ihr Zeus im Übermaß. Mehrfach in Tiergestalt zeugt er Kinder mit mehr als 30 Müttern. Die namhaftesten unter ihnen und ihre Kinder sind:
Leto – Apollo und Artemis
Metis – Athene
Alkmene – Herakles
Themis – die Horen, Göttinnen der Stunden
Plutos – der Frevler Tantalos, auf dessen Nachkommen, u. a. Agamemnon, ein Fluch liegt
Maia – Hermes, der Götterbote, Schützer der Kaufleute und Diebe
Semele – Dionysos, Gott des Rauschs
Demeter – Persephone
Persephone (seine eigene Tochter) – Zagreus
Leda – Helena, um die der Trojanische Krieg ausbricht
Mnemosyne – die Musen
Eine kleine Heldenkunde
Aus den Hierarchien der Götter- und Menschenwelt lassen sich auch gruppendynamische Vorgänge innerhalb der Ilias (Ilion ist ein Synonym für Troja) erklären, insbesondere die stetigen Insubordinationsdelikte des Helden Achill gegenüber dem Heerführer Agamemnon: Beide sind Könige, doch Achill ist nicht nur der kampftechnisch Überlegene, sondern auch göttlicher Abkunft. Sein sterblicher Vater, der Myrmidonenkönig Peleus, hat die Meergöttin Thetis geheiratet, die Enkelin der Thetys, einer Titanin ältesten Adels, deren Linie u. a. der Lichtbringer Prometheus entstammt. Achill weiß um seinen von der Moira, dem allwaltenden Schicksal, bestimmten frühen Tod. Dass ihn seine Mutter beim Versuch, ihm Unsterblichkeit zu verleihen, an der Ferse gehalten und diese damit schutzlos belassen hätte, ist Teil der kollektiven, zivilisationenübergreifenden Mythen (vgl. Siegfried und das Lindenblatt). Thetis hat Einfluss auf Zeus, da sie ihn einst listenreich vor einem Putschversuch der Mit-Götter gerettet hat. Deshalb kann sie Achill zwar nicht vor dem Tod retten – er stirbt unter irregulären Umständen an einem von Apollo gelenkten Pfeil des Paris –, obwohl sie ihn vor Ausbruch des Trojanischen Kriegs zu verstecken versucht. Aber sie kann Zeus dazu bringen, die ihrem Sohn durch Agamemnon erwiesene Schmach durch kurzfristige Parteinahme für die Trojaner zu entgelten.
Agamemnon hingegen entstammt der Linie eines sterblichen Erzschurken, des Lydierkönigs Tantalos. Um die Allwissenheit der Götter auf die Probe zu stellen, setzte ihnen dieser seinen eigenen Sohn Pelops zur Mahlzeit vor. Er büßt dafür unter Qualen im tiefen Tartaros, und auf seinen Nachkommen lastet ein Fluch. Agamemnon selbst überlebt seine Heimkehr nicht, seine Ehefrau Klytaimnestra und ihr Geliebter Aigisthos ermorden ihn und werden zur Sühne von Agamemnons und Klytaimnestras Sohn Orestes getötet. Odysseus ist möglicherweise sogar dubioser Herkunft, was ihm auch mehrfach vorgehalten wird: Angeblich ist er ein unehelicher Sohn des Sisyphos, des Königs zu Korinth, der mit Schläue und Skrupellosigkeit die Götter überlistet hat und in der Unterwelt mit der sprichwörtlichen Sisyphosarbeit bestraft wird. Dem offiziellen Vater Laertes, König von Ithaka, sei Odysseus bloß unterschoben worden.
Allerdings reicht Achills Herkunft nicht zur posthumen Vergöttlichung im Olymp (die bleibt etwa Herakles vorbehalten, dem Sohn des Zeus): In der Odyssee dringt der versprengte Held Odysseus bis in den Hades vor und trifft im freudlosen Totenreich auf Achill, der dort enttäuscht und verdrossen als eine Art Gouverneur amtiert.
I. Die Ursprünge
1. Die Mystifikationen des Reverend Anderson
Adam war kein Freimaurer, dennoch: Chapeau! Was er an Vorarbeit geleistet hat, verdient Respekt. „Da sich Adam aus dem Paradiese verjaget sahe, nahm er seinen Aufenthalt in den bequemsten und natürlichen Wohnplätzen des Landes Eden, allwo er sich am besten vor Kälte und Hitze, vor Sturmwinden, Regen und Ungewitter, und vor wilden Thieren, versichern konte, bis seine Söhne dergestalt heranwuchsen, daß sie eine Loge anlegen konten. Er lehrte dieselben Geometrie, und zeigte ihnen den grossen Nutzen derselben in der Bau-Kunst, ohne welche die Menschen-Kinder, wie die unvernünftigen Thiere, in Wäldern, tieffen Gruben und Höhlen, oder wenigstens in armseligen leimernen Hütten, oder aus den Zweigen der Bäume geflochtenen Lauben, u. s. f. hätten leben müssen.“2
Diese verdienstvollen Aktivitäten wurden im unmittelbaren Anschluss an die Erschaffung der Welt gesetzt, also bei Vernachlässigung kleiner Berechnungsunschärfen nach 4000 v. Chr. Weshalb die symbolische freimaurerische Zeitrechnung auch mit diesem Datum beginnt und einschlägige Dokumente entsprechend unterfertigt werden. Mozarts Geburtsjahr 1756 etwa fiele demnach auf das maurerische Jahr 5756.
Mit anderen Worten: Die Freimaurerei ist die Urzelle der menschlichen Zivilisation. Immer vorausgesetzt, man vertraut dem Konstitutionen-Buch des schottischen Priesters James Anderson aus dem Jahr 1723 – dem ersten Regelwerk der Freimaurer, dem innerhalb des verschwiegenen Bundes ähnliche Bedeutung zugestanden wird wie unter deutschsprachigen Gebildeten Robert Musils Titanenwerk Der Mann ohne Eigenschaften: Viele berufen sich darauf, wenige haben es gelesen. Wohl deshalb verehrt man den Reverend anhaltend: in erster Linie als den Aufbringer der „Alten Pflichten“, die dem Freimaurer Schätzenswertes und Zweifelhaftes auferlegen. Schätzenswert ist insbesondere die Achtung vor allen Religionen, zweifelhaft das Selbstverständnis als „friedlicher Unterthan“, der niemals „die Ehrerbietung gegen die Unter-Obrigkeiten aus den Augen setzet“.3
Die „Alten Pflichten“ beanspruchen im dickleibigen Werk überblickbare elf Seiten. Der Rest aber – aus gotischen Quellen und englischen Zunftsagen collagiert, für bare Münze erklärt und zum Standard erhoben – ist das haarsträubendste Stück Professionistenlatein in der Geschichte des Handwerks wie der Literatur. Adams Sohn Seth (der Substitut für den ermordeten Abel) war demnach der erste Freimaurergroßmeister, da sein Bruder Kain strafhalber unberücksichtigt blieb und sich mit der Existenz eines erstklassigen Technikers zufriedengeben musste. Ein Viererkomitee namens Enos, Cainan, Jared und Enoch trat Seths Nachfolge an. In weiterer Folge läuft Anderson einen atemberaubenden Parcours durch die welthistorische Prominenz: Moses (der beste von allen), der „Erzmagus“ Zoroaster (Zarathustra) aus den persischen Lichtmythen und der Babylonier Nebukadnezar waren nachgewiesenermaßen Großmeister, Hannibal mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Cäsar gab sogar die Eroberung Englands auf, „weil er im Sinn hatte, sich zum Groß-Meister von der römischen Republic zu machen“.4 Nero blieb aus Gründen, die keiner Erläuterung bedürfen, die Würde versagt, seinem zeitnahen Nachfolger Vespasian wurde sie verdientermaßen ebenso zuteil wie Marc Aurel und dem milden Titus.
In dieser Reihe, die sich zu den Gründern Englands fortsetzt und auch den Schotten Macbeth einschließt, bekleidet der Überlebenskünstler Noah herausragende Position. Der Linie seines Sohns Japhet verdankt überraschend auch das antike Griechenland seine flächendeckende freimaurerische Bemusterung: „Zuletzt hat die Königliche Kunst auch in Griechenland geblühet (…) Selbige wurde kurz nach der Zerstreuung der Völcker durch einen von Japhets Söhnen, Namen Jon, dahin gebracht, welcher Jonien bevölckert, und allda einige Frey-Maurer-Logen gestifftet, auch diesen als Großmeister vorgestanden.“ In der Liste der nachfolgenden Zelebritäten, unter ihnen Sokrates und Aristoteles, vermisst man Alexander den Großen: Er wird „für keinen Frey-Maurer geachtet, weil er, auf Anstifften einer trunckenen Hure, bey seiner nächtlichen Schwelgerey, das kostbare und vortreffliche Persepolis (…), in die Asche legen lassen, welches kein wahrer Frey-Maurer in der grösten Trunckenheit thun würde“.5
Ohne Angabe von Gründen bleibt auch der griechische Dichter Homer masonisch (das heißt: freimaurerisch) unbeteilt. Das allerdings ist ein ernstes Versäumnis. Denn so gewiss sich die Freimaurerei erst im Mittelalter in ihren Vorformen zu entwickeln begann, wesentlich aus den Zunftritualen der englischen Dombauhütten und der französischen Gesellenbruderschaften; so gewiss sie sich erst im frühen 18. Jahrhundert in englischen Logen organisierte: Wie alle – und besonders alle jungen – Weltentwürfe bediente sie sich aus dem reichen Fundus der Mythologien, Religionen und Philosophien. Und bei Homer, dem Urvater der literarisierten westlichen Zivilisation, sprudeln die Quellen besonders hell.
2. Singe den Zorn, o Göttin: Die Ilias
Μῆνιν ἄειδε, ϑεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, ἣ μυρί‘ Ἀχαιοῖς ἄλγε‘ ἔϑηκεν,
πολλὰς δ‘ ἰφϑίμους ψυχὰς Ἄιδι προΐαψεν
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε δαῖτα – Διὸς δ‘ ἐτελείετο βουλή –,
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
τίς τ‘ ἄρ σφωε ϑεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσϑαι;
Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός. ὃ γὰρ βασιλῆι χολωϑεὶς
νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
Ἀτρεΐδης.
Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus,
Ihn, der entbrannt den Achaiern unnennbaren Jammer erregte
Und viel tapfere Seelen der Heldensöhne zum Ais
Sendete, aber sie selbst zum Raub darstellte den Hunden
Und dem Gevögel umher. So ward Zeus’ Wille vollendet:
Seit dem Tag, als erst durch bitteren Zank sich entzweiten
Atreus’ Sohn, der Herrscher des Volks, und der edle Achilleus.
Wer hat jene der Götter empört zu feindlichem Hader?
Letos Sohn und des Zeus. Denn der, dem Könige zürnend,
Sandte verderbliche Seuche durchs Heer; und es sanken die Völker:
Drum, weil ihm den Chryses beleidiget, seinen Priester,
Atreus’ Sohn.6
Der griechischeHeerführerAgamemnon
Der Gott Apollo
So beginnt die Ilias, einer der einflussreichsten Texte der Kulturgeschichte. Doch abgesehen vom monumentalen, 15.693 Verse umfassenden Korpus sind die Informationen spärlich. Einigkeit besteht lediglich darüber, dass die Ilias im 8. oder 7. Jahrhundert v. Chr. entstand und auf eine lange mündliche Erzähl- oder Gesangstradition zurückgeht. Der Verfasser hat aus einem unüberblickbaren Fundus mythologisch-theologisch-belletristischer Überlieferung seine Auswahl getroffen und daraus ein kompaktes, autonomes Kunstwerk geformt. Welche Rolle dabei der Wandersänger Homer einnahm, ist in der Forschung heute noch so umstritten wie vor 200 oder 2000 Jahren.
Denn umstritten ist Homers gesamte Existenz.7 Sollte er gelebt und als Rhapsode die Epen Ilias und Odyssee aus den Quellen formuliert und mündlich weitergetragen haben, so muss dies zwingend zur Zeit der Entstehung dieser Werke stattgefunden haben, nämlich im 7. oder 8. Jahrhundert v. Chr. Dass Homer zeitgleich mit dem historisch nicht belegbaren Trojanischen Krieg – die Mythologie terminisiert ihn 1200 v. Chr. – gelebt hätte, ist somit auszuschließen. Die griechischen Gemeinden Argos, Athen, Chios, Ithaka, Kolophon, Pylos und (am häufigsten genannt) Smyrna beanspruchten ihn als ihren Sohn. Der Name seiner Mutter soll bald Kreitheïs, bald Klymene gelautet haben. Die ausführlichste Vita verfasste im 1./2. Jahrhundert n. Chr. ein unbekannter Autor, der irreführend unter dem Namen des Historikers Herodot publizierte. Die Schrift Vita Homeri Herodotea konstruiert eine umfangreiche Lebensgeschichte von der Vorgeburtszeit bis zum Tod und erklärt dabei mehrfach fiktive Gestalten aus Ilias und Odyssee zu realen Personen. Homer sei unehelich am Ufer des Flusses Meles in Smyrna geboren worden, weshalb sein eigentlicher Name Melesigenes sei (andere Quellen führen den geläufigeren Beinamen „Mäonide“ auf Homers angeblichen Vater Mäon, alternativ auf das Geburtsland Mäonien, das ist Lydien, zurück). Homer sei erst als Volksschuldirektor tätig gewesen, dann zur See gefahren und habe eine abnorme Reisetätigkeit entfaltet: Der falsche Herodot hetzt ihn durch die zahllosen Orte, mit denen Homer in den diversen Überlieferungen in Verbindung ge-bracht wird.
Der Pseudo-Herodot verfestigt auch das Gerücht, Ho-mer sei ein blinder Greis gewesen. Diese Mystifikation geht auf die Homerischen Hymnen zurück, eine Sammlung von 33 Götteranrufungen, die zwei bis drei Jahrhunderte nach den Epen Ilias und Odyssee entstanden, Homer also fälschlich zugeschrieben wurden. In der Hymne An den delischen Apollo (auf der Kykladen-Insel Delos soll die Titanin Leto dem Göttervater Zeus die Zwillinge Apollo und Artemis geboren haben) wird der Keim der Mystifikation gelegt, als der falsche Homer um Hörerstimmen wirbt:
Du aber, Phoibos und Artemis, seid ihr beide mir gnädig!
Heil euch Jungfraun alle! Und auch in späteren Zeiten
Denket noch mein, wenn einer der erdbewohnenden Menschen
Hierkommt und fragt, ein leiderfahrener Fremdling:
„Mädchen, sagt, wer gilt euch als der lieblichste Sänger,
Der hier weilte, und wer hat euch am meisten beseligt?“
Aber mit Einer Stimme sollt ihr ihm alle erwidern:
„Das ist der blinde Mann, er wohnt im felsigen Chios.
Seine Gesänge bleiben alle für immer die schönsten.“8
Phoibos(„der Leuchtende“):Apollo
Daraus resultierten wiederum mehrere antike Skulpturen und eine mutmaßlich falsche Etymologie des Namens: ὁμηρος (homeros) bedeutet „Geisel“ und hat mit ὁ μὴ ὁρῶν (ho me horon, der nicht Sehende) nichts zu tun. Auch dass Homer arm gewesen wäre, ist angesichts des überwiegend aristokratischen Publikums der Epensänger zweifelhaft, ebenso wie der mehrfach behauptete Ort seines Todes, die Insel Ios.
Homers überlieferte biographische Daten sind also ebenso nebulos wie seine Autorschaft an den Epen Ilias und Odyssee. Gesichert ist, dass die Ilias, das ältere der beiden Werke, spätestens im 6. Jahrhundert v. Chr. verschriftlicht vorlag und somit einer der ersten auf diese Art überlieferten Texte der Weltliteratur ist. Das Datum lässt sich aus übereinstimmenden Zitaten in anderen Schriften rekonstruieren, zudem sind 1.500 Papyri mit Fragmenten der Ilias erhalten. Die ersten wissenschaftlich standardisierten Ausgaben der homerischen Epen erstellten nachweislich seit dem dritten vorchristlichen Jahrhundert die Direktoren der Bibliothek von Alexandria. Die frühesten erhaltenen Gesamtausgaben der Ilias (am bekanntesten der editorisch wegweisende Codex Venetus A aus der Bibliotheca Marciana in Venedig) datieren allerdings erst aus dem 10. Jahrhundert n. Chr. – also aus dem Mittelalter, fast zwei Jahrtausende nach dem eigentlichen Schöpfungsakt.
In 24 Kapiteln werden 51 (nach anderen Berechnungen 48 oder 50) Tage aus der Endphase des schon neun Jahre währenden Kampfs um Troja beschrieben. Die Kapitel heißen „Gesänge“, seit sie der Freimaurer Johann Heinrich Voß (aufgenommen 1774 in die Hamburger Loge „Zu den drei Rosen“) in seiner 1781 erschienenen Übersetzung so benannt hat.
Geschrieben sind sie in 15.693 Hexametern: sechshebigen Daktylen mit einer Zäsur nach der dritten Hebung. Der Daktylus —◡◡ kann dabei durch einen Spondeus mit zwei Längen —— ersetzt werden, wodurch sich der Versfluss wesentlich belebt. Der letzte Versfuß ist unvollständig (—◡
Μῆνιν ἄειδε, ϑεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος
Menin aeide, thea, Peleiadeo Achileos
—◡◡—◡◡———◡◡—◡◡—◡
Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus
—◡◡———◡◡———◡◡—◡
Was gemeinhin mit dem Krieg um die Stadt Troja assoziiert wird, kommt in der Ilias gar nicht vor: Das ihn auslösende Urteil des Paris (in der Ilias alternativ auch Alexandros genannt) wird als bekannt vorausgesetzt und nur erwähnt (24. Gesang, v. 28–30). Achill lebt am Schluss noch, und zwar mit unversehrter Achillesferse. Und das Trojanische Pferd ist noch nicht einmal geplant. Es findet erst in der Odyssee (8. Gesang, v. 493) Erwähnung und wurde auch nicht von Odysseus, dem Meister des Untergriffs, erdacht: Das einzig probate Instrument zur Erstürmung der Stadt wurde den Belagerern vielmehr unter Zwang vom seherisch begabten trojanischen Prinzen Helenos – nach anderer Version vom griechischen Feldgeistlichen Kalchas – ausgehändigt.