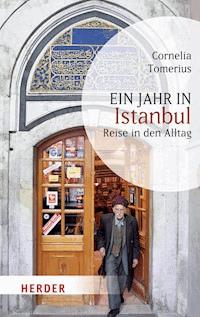
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
"Sie wissen nicht, wie hier im Sommer die Winde wehen und den Leuten fast den Verstand rauben. Sie wissen nicht, wie sich die Stadt verändert, wenn Ramadan ist. Sie wissen nicht, wie unglaublich bürokratisch es hier ist - und dann wieder südländisch unkompliziert." Dann wendete sie sich wieder zu mir: "Sie sollten eine Zeitlang in Istanbul leben. Ein Jahr brauchen Sie, mindestens."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cornelia Tomerius
Ein Jahr in Istanbul
Reise in den Alltag
Impressum
Originalausgabe
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2008
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80261-4
ISBN (Buch): 978-3-451-05940-7
Inhalt
März Die schönste Bardame der Welt
April Über Nacht gelandet
Mai Einmal Konstantinopel und zurück
Juni Komm, wir spielen Harem!
Juli Die Kunst der Improvisation
August Verwirrung am Weltwunder
September Es brennt!
Oktober Eigenartige Vorlieben
November 2 : 2 Unentschieden
Dezember Der Silvesterbaum
Januar Unbestimmtes Präteritum
Februar Die Henna-Nacht
Für Stephan
März Die schönste Bardame der Welt
„Eigentlich wollte ich hier nur vorbeischauen. Aber wer einmal hier ist und die Schönheit der Stadt sieht, verlässt sie nie wieder, verstehst du?“
(HASSAN VOM PEYOTE-CLUB IN „UNDER THE BRIDGE – THE B-SIDE OF ISTANBUL“ VON FATIH AKIN)
„TSCHAI?“, FRAGT FRAU Ö. knapp und gießt, ohne die Antwort abzuwarten, den heißen Tee in die Tasse. Ich nehme in dem Sessel Platz, den sie mir mit einer unwirschen Geste zuweist, und betrachte sie neugierig. Frau Ö. trägt das einst blonde Haar zu einem opulenten Dutt drapiert und gehört zweifellos zu den Frauen, die auch jenseits ihrer Jugend als schön bezeichnet werden. Als das Alter die unvermeidlichen Linien in ihr Gesicht gezogen hat, ist es dabei vorgegangen wie der Erbauer eines komplizierten Saiteninstruments, der nur sehr feines Material verwendet und jede Saite sorgfältig platziert. Bei einem Lachen würde eine nach der anderen zärtlich gestrichen, wie beim leisen Akkord auf der Laute, nur dass die Harmonie, die dabei entsteht, sichtbar ist und nicht zu hören. Im Moment jedoch ist von Heiterkeit keine Spur. Der Mund von Frau Ö. ist zu einem dünnen Strich geschrumpft, und auf der Stirn üben sich die Fältchen in einer düsteren Moll-Arie. Sie nimmt einen Schluck Tee und kommt ohne Umschweife zur Sache.
„Mir gefällt ganz und gar nicht, was meine Kinder da ausgeheckt haben.“
Ich folge ihrem Blick, der in einem Winkel von knapp dreißig Grad an mir vorbei auf die Wand gerichtet ist. In Silber gerahmt hängen sie da, die drei Übeltäter. Ich kenne nur Tochter Suzan, die das Blond von der Mutter und die markante Nase vom Vater geerbt hat und nun mit meiner Hilfe ein wenig mehr als deren Gene an die Nachwelt weitergeben möchte.
„Sie glauben, ich sei einsam seit dem Tod ihres Vaters“, fährt Frau Ö. fort, den Blick noch immer auf die gerahmte Nachkommenschaft geheftet. Dann schaut sie mich verbittert an: „Doch statt mich einfach häufiger zu besuchen, jagen sie mir eine Ghostwriterin auf den Hals.“
So verächtlich spricht sie das Fremdwort aus, dass ich für einen Moment wünschte, Ghostwriting hätte auch damit zu tun, unsichtbar wie ein Geist durch Wände verschwinden zu können.
„Wenn ich Ihre Kinder richtig verstanden habe, geht es ihnen nicht um eine Ganztagsbetreuung für ihre Mutter, sondern darum, Ihre Lebensgeschichte aufschreiben zu lassen, damit Ihre Enkel und Urenkel sie eines Tages nachlesen können.“
„Meine Lebensgeschichte!“, ruft Frau Ö. aus. „Als ob die so interessant wäre.“
Natürlich kokettiert sie. Zu gut weiß sie, wie spannend ihre Biographie auf andere wirkt, zumindest auf arglose Dreißigjährige, die Berlin bis dato für den Nabel der Welt hielten. In den Fünfzigern hatte sich Marianne K. aus Oberbayern unsterblich in einen durchreisenden Türken verliebt. Seinetwegen ließ sie Familie, Freundinnen und das aufziehende Wirtschaftswunder hinter sich und folgte ihm in den Orient, von dem sie damals nicht viel mehr wusste, als Scheherazade ihrem Sultan einst geflüstert hatte. Aus Fräulein K. wurde Frau Ö. und aus der Ingolstädterin eine Istanbulerin. Sie gebar drei Kinder, lernte die Stadt und den Bosporus lieben, und zwar so sehr, dass sie auch nach dem Tod ihres Mannes vor wenigen Jahren nicht nach Deutschland zurückkehren wollte. Angesichts der umfangreichen Antiquitätensammlung in ihrer Wohnung scheint eine gewisse Sesshaftigkeit allerdings auch verständlich.
„Haben Sie schon eine Fahrt auf dem Bosporus gemacht?“, fragt Frau Ö. unvermittelt. Ich nicke, erleichtert über die angenehme Wendung, die das Gespräch nun zu nehmen scheint. Doch bevor ich von meinem kleinen Bootsausflug erzählen kann, stellt sie schon die nächste Frage: „Und auf dem Basar?“
„Nein, noch nicht.“
„Blaue Moschee?“
„Ja, da war ich.“ Allerdings nicht lange, weil sich mir unter der märchenhaften Kuppel der schönen Moschee, die man wie alle Gebetshäuser Allahs auch als Nicht-Moslem nur ohne Schuhwerk betreten darf, das Bild von der „Käseglocke“ unangenehm aufdrängte. Auf wundersame Weise mischten sich hier die Ausdünstungen aus den unzähligen Tennissocken transpirierender Touristen zu einem ballongroßen Bouquet, das mich leider viel zu schnell wieder an die Frischluft trieb.
„Topkapi-Palast?“, fragt Frau Ö. weiter, wobei sie das „i“ wie ein kurzes „e“ ausspricht.1 Aber ich muss wieder passen. Bis auf den Film von 1964 – Topkapi mit Melina Mercouri, Peter Ustinov und Maximilian Schell – habe ich noch nichts gesehen vom Sultanspalast.
„Das machen sie nämlich sonst alle“, fährt Frau Ö. fort. „Sie schippern auf dem Bosporus herum, laufen über den Basar und durch ein paar Moscheen und Paläste. Am Abend gehen sie mit Vorliebe dort essen, wo zwischen den Gängen eine Bauchtänzerin die Hüften schwingt, und dann fahren sie nach Hause und glauben, Istanbul gesehen zu haben.“ Verächtlich winkt Frau Ö. ab. „Wussten Sie, dass der Tourismusminister der Türkei vor ein paar Jahren gefordert hat, dass der Bauchtanz nicht mehr als typisch türkische Attraktion vorgeführt wird? Arabisch sei der, so seine Begründung, nicht türkisch. Im Ausland solle man schließlich kein falsches Bild von uns bekommen.“
Ich frage mich, ob das Image der Türkei, das unter anderem von fettigem Döner, finsteren Schnurrbartträgern und den gruseligen Zuständen in türkischen Gefängnissen geprägt ist, nicht doch ein paar hübsche Hüften kreisende Bauchtänzerinnen gut vertragen könnte. Doch ich übergehe ihren Exkurs und erwidere, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Tourist, der ein paar Tage in der Stadt verbracht hat, tatsächlich denkt, Istanbul zu kennen. Diese Riesenstadt überfordere jeden, der sie besucht. Niemand könne hier abreisen ohne das unbefriedigende Gefühl, längst nicht alles gesehen und stattdessen viel zu viel verpasst zu haben.
Zum ersten Mal seit meiner Ankunft glaube ich, einen freundlichen Zug um ihre Mundwinkel ausmachen zu können. Ihre Augen funkeln belustigt. Ich war ihr auf den Leim gegangen.
„Sehen Sie, genauso blauäugig ist das, was Sie mit mir vorhaben.“
Ich schaue sie fragend an.
„Sie kommen her, stellen mir vier Wochen lang irgendwelche Fragen. Dann fahren Sie nach Hause in Ihre gewohnte Umgebung und wollen ein Buch schreiben über mein Leben in dieser Stadt, in dieser Kultur, die Sie doch gar nicht kennengelernt haben können. Wie soll das funktionieren?“
Sie hat mich eiskalt erwischt. Wie ein kleines Schulmädchen fühle ich mich, das im Aufsatz das Thema verfehlt hat und von der strengen Lehrerin vor der gesamten Klasse dafür gerügt wird. Ich fixiere das Muster der Tischdecke und muss Frau Ö. recht geben. Bisher schrieb ich nur die Erinnerungen von Menschen auf, die ihr Leben in Deutschland verbrachten. Ihre Geschichten waren mir nicht fremd, viele Schauplätze und Situationen sogar bestens bekannt. Dieser Auftrag hier war anders. Wie könnte ich das Leben von Frau Ö. authentisch beschreiben, ohne ständig im Klischee hängen zu bleiben?
„Sie wissen gar nichts nach vier Wochen“, sagt sie wie zu sich selbst, während sie aus dem Fenster schaut. „Sie wissen nicht, wie es ist, wenn man als Fremde in dieser Stadt eine Heimat sucht, wie es sich anfühlt, eine von vielen und eine von wenigen zu sein. Sie wissen nicht, wie sich der Bosporus verändert, wenn die Sonne scheint oder wenn der Himmel voller Wolken hängt. Sie wissen nicht, was in der Stadt los ist, wenn Ramadan ist, oder ein Fußballspiel der hiesigen Clubs. Sie wissen nicht, wie unglaublich bürokratisch es hier zugehen kann, und dann wieder wie südländisch unkompliziert.“ Dann schaut sie mich eindringlich an: „Sie wissen nicht, was es heißt, eine Istanbulerin zu sein.“
Es ist bedrückend still im Raum. Draußen hupen Autos, ein Straßenverkäufer preist im monotonen Sprechgesang seine Waren an. „Vielleicht“, fährt Frau Ö. fort, nachdem sie einen Schluck Tee genommen und das Glas geräuschlos auf die Untertasse gesetzt hat, „vielleicht bekommen Sie eine Ahnung davon, wenn Sie eine Zeitlang in Istanbul leben.“ Auf der Straße strebt das Hupkonzert seinem vorläufigen Höhepunkt entgegen. „Ein Jahr brauchen Sie“, sagt Frau Ö. und fügt nachdrücklich an: „Mindestens.“
Ich lache auf, als hätte sie einen schlechten Witz gemacht. Ein Jahr in einer Stadt, in der so viele Menschen auf einem Haufen leben wie in dem gesamten Staat, in dem ich geboren wurde? Deren Verkehrschaos so sehr an den Kräften zehrt, dass man nach einer Woche am liebsten eine Dauerkarte für den Hamam kaufen möchte? Der ein Kontinent nicht genügt, so dass sie sich gleich über zwei erstrecken muss und die Menschen somit unweigerlich an den Rand der Schizophrenie treibt? Aber vor allem: Ein Jahr in einer Stadt, die 1700 Kilometer weit weg ist von Berlin und damit von Tom? Undenkbar.
„Überlegen Sie es sich“, sagt Frau Ö. schließlich und steht auf, um mich zur Tür zu begleiten. „Wenn Sie nicht bereit sind, sich so weit auf die Geschichte einzulassen, können Sie den Auftrag vergessen.“
Wenn dies eine Drohung sein soll, so verfehlt sie ihre Wirkung. Ich habe nämlich jetzt schon keine Lust mehr auf diesen Job.
Wenige Augenblicke später befinde ich mich auf einem schmalen Gehsteig und inmitten der Geräuschkulisse eines Formel-1-Rennens. So schnell wie die Autos neben mir rasen die Gedanken durch den Kopf. Warum eigentlich nicht? Ein Jahr als Gastarbeiterin in der Türkei? Einige meiner Jobs könnte ich dank Internet und Telefon auch in Istanbul erledigen. Wenn ich den Platz in meiner Bürogemeinschaft kündige, habe ich die Miete für ein Zimmer hier schon fast drin. Mit meinen Freundinnen daheim ist ohnehin nicht mehr viel los, seitdem eine nach der anderen in die Elterngeld-Falle tapst. Und führen Tom und ich nicht sowieso schon seit Jahren eine Fernbeziehung, die es doch eigentlich verkraften müsste, wenn die Ferne ein wenig ferner wird?
Ich balanciere auf dem schmalen Bürgersteig entlang, und Istanbul wird zum Abenteuer, zur Herausforderung, der man eigentlich nicht widerstehen kann. Hieß die Stadt nicht auch einmal Dersaadet, was übersetzt so viel heißt wie „Pforte der Glückseligkeit“? Und macht Istanbul nicht jedem Platz, der hier sein Glück suchen will? Duldet es nicht großzügig, wenn die Einwanderer aus den Provinzen am Stadtrand über Nacht ihre Häuser auf bauen, wohl wissend, dass nach einem alten islamischen Gesetz niemandem das Dach über dem Kopf genommen werden darf, auch wenn es auf noch so wackeligen Pfosten ruht? Wie ein angesagter Nachtclub, der auf muskelbepackte Türsteher verzichtet, gewährt die Stadt jedem Einlass, der danach begehrt. Jeder darf sich an ihrer Musik, ihren Gerüchen und Geschichten berauschen. Nur kümmert es auch niemanden, wenn es zu eng wird auf der Tanzfläche, wenn an der Bar die Getränke knapp werden, die Stimmung kippt und die Menschen dicht an dicht gedrängt im heißen Dunst verzweifelt nach Luft schnappen. Das Chaos kennt kein Regulativ.
In Gedanken versunken überquere ich die Straße, um im nächsten Moment durch das laute Quietschen von Bremsen jäh aus ihnen herausgerissen zu werden. Ich sehe noch, wie das Auto auf mich zurollt, ganz knapp vor mir zum Stehen kommt, höre den Fahrer etwas brüllen, was ich zum Glück nicht verstehe und auch gar nicht verstehen will, renne mit Herzklopfen von der Fahrbahn – und direkt in eine gut gepolsterte türkische Mama, die mindestens sechs prall gefüllte Plastiktüten in den Händen hält und mich erschrocken anschaut. Mir ist klar: Keine drei Tage würde ich in dieser Stadt überleben.
Das eigenartige Fahrverhalten der Istanbuler, so viel hat sich mir nach meinen ersten Tagen in der Stadt schon erschlossen, ist nicht nur eine Frage des Temperaments, sondern auch der Stadtstruktur. Nur zwei Brücken verbinden den europäischen mit dem asiatischen Teil. Und da die meisten Istanbuler auf der einen Seite arbeiten, auf der anderen leben, und keine U- oder S-Bahn die Ufer verbindet, allenfalls Fähren und Fischerboote, geht es auf den Brücken, wenn überhaupt, nur sehr langsam voran. Man steht im Stau. Nun nutzen die Istanbuler die Zeit weniger, um den herrlichen Ausblick auf das gewaltige Meer zu genießen, sich die Fingernägel zu lackieren oder Entspannungsübungen zu machen. Was hier passiert, erinnert eher an den Verschlag, in dem die Stiere von Pamplona alljährlich im Juli zusammengepfercht darauf warten, gleich befreit durch die Straßen zu jagen. Wie die Tiere in der Enge erregt mit den Hufen scharren und durch die Nüstern schnaufen, so stöhnen die Motoren ungeduldig auf, während sich die Karossen zentimeterweise nach vorn kämpfen, zum Ende der Brücke, zum Anfang der Freiheit. Ist der Stau vorbei, ist die Stampede nicht mehr aufzuhalten. Weh dem, der nicht schnell genug in Sicherheit ist. Das Ampelrot hat dabei in etwa die gleiche Wirkung wie das rote Tuch beim Stierkampf bullen: Es sorgt für Extra-Tempo. „Istanbullu“ heißt der Istanbuler übrigens auf Türkisch.
Das Handy klingelt und Gizem ist dran. Sie ist eine Freundin von Suzan, der Tochter von Frau Ö. Für die Zeit meiner Recherchen darf ich bei ihr wohnen. Vier Wochen waren ausgemacht, eine ist schon vergangen. „How are you?“, fragt sie. Wir sprechen Englisch miteinander, weil es um mein Türkisch in etwa so schlecht bestellt ist wie um ihr Deutsch. „I’m still alive“, sage ich und finde das keineswegs selbstverständlich. Sie fragt, wo ich gerade bin, aber ich habe keine Ahnung. Jetzt erst merke ich, dass ich mich verlaufen habe. Der Bosporus, an dem sich Verirrte in Istanbul zumindest grob orientieren können, ist nicht zu sehen. Nur die Minarette stechen aus dem Häusermeer in den Himmel wie abgemagerte Leuchttürme. Leider sind sie in etwa so hilfreich wie die allgegenwärtigen Litfaßsäulen in Berlin. Die Straße runter entdecke ich den Namen eines Hotels, das Gizem glücklicherweise kennt. Wir vereinbaren, dass ich in der Lobby auf sie warte.
Gizem ist eine der modernen Türkinnen, auf die Staatsgründer Atatürk, der sein Volk lehrte, sich nicht nur gen Mekka, sondern auch gen Westen zu orientieren, sicher sehr stolz gewesen wäre. Als Kind paukte sie Tag und Nacht, um die Aufnahmeprüfung an einer der wenigen Eliteschulen zu bestehen, an denen, je nach Ausrichtung, nur Englisch, Deutsch, Französisch oder Spanisch gesprochen wurde. Sie schaffte es auf die Schule, auf die alle wollten, und spricht heute so fließend Englisch, dass sie in dem britischen Unternehmen, dessen PR-Abteilung sie leitet, gern für eine Engländerin gehalten wird. Dabei zieht sie sich viel besser an: Gizem trägt Kleider aus Paris, Schuhe aus Italien und ein Kopftuch nur, damit im Cabrio die Frisur nicht zerzaust. Vielleicht ist ihr Lippenstift eine Nuance zu grell, die Garderobe eine winzige Spur zu aufreizend, ihr Lachen ein bisschen zu laut. Doch das alles wirkt nie aufdringlich und erfüllt seinen Zweck: Betritt Gizem einen Raum, dauert es keine zwanzig Sekunden, und die anderen können den Blick kaum noch von ihr wenden, wie gebannt hängen sie an ihren Lippen. Sehr wahrscheinlich täten sie das auch, wenn sie ungeschminkt und in Jeans und T-Shirt erschiene, nur würde es dann vielleicht ein paar Sekunden länger dauern, bis sie die ungeteilte Aufmerksamkeit genießt. Und Zeit ist knapp in einer Stadt wie Istanbul.
Kaum dass ich auf dem Beifahrersitz Platz genommen habe, gibt Gizem Gas. „Wo ist Salman?“, frage ich sie und erfahre, dass er bei Gizems Mutter ist und dort übernachtet. Gizem ist geschieden, Salman ihr vierjähriger Sohn. In Deutschland würde man sie als Alleinerziehende bezeichnen. Im Türkischen gibt es diesen Begriff nicht. Großeltern, Urgroßeltern, Tanten und Onkel sind für das Kind mindestens ebenso wichtige Bezugspersonen wie Mama und Papa. Hier ist kein Erziehender allein. In der letzten Woche verging kaum ein Nachmittag, an dem Salman nicht bei Oma Afifie, Onkel Yusuf oder Tante Nilgün war.
Im Stadtteil Beyoğlu, wo der Istanbuler schick ausgeht, parkt Gizem den Wagen in einer kleinen Seitengasse, die durch ihre steile Hanglage eindrucksvoll daran erinnert, dass Istanbul einst auf sieben Hügeln erbaut wurde. Doch Gizem will noch höher. Sie passiert einen unscheinbaren Hauseingang, holt per Knopfdruck einen klapprigen alten Aufzug und lässt ihn uns bis zur obersten Etage ziehen. Dort angekommen stockt mir der Atem. Man könnte es schnöde eine Panorama-Bar nennen, in der wir uns nun befinden – wenn nicht jede popelige Cocktailbar dieses Planeten, die mehr als zehn Meter über dem Asphalt liegt und ein Fenster hat, diese Bezeichnung für sich beanspruchen würde. Dies hier ist zweifelsohne die Mutter aller Panorama-Bars. Wie an einer Theke sitzen die Gäste direkt am geöffneten Fenster oder an der Brüstung der Terrasse, vis-à-vis der größten und schönsten Bardame der Welt namens Istanbul, die zwar keine alkoholischen Getränke, dafür aber berauschende Ausblicke serviert. Die Sonne ist gerade untergegangen, und der Himmel flimmert in allen Blautönen. Bis zum Horizont glitzert die Stadt, die der Bosporus gewaltig auseinanderschiebt. Nur die beiden mächtigen Brücken verbinden die Kontinente, wie zwei Arme, die den anderen im nächsten Moment am liebsten beherzt an sich drücken würden. Und die Istanbullu, die auf ihnen mal wieder oder immer noch im Stau stecken, hätten gegen eine solche Annäherung sicher nichts einzuwenden. Faszinierend: Der ganze Wahnsinn, der ganze Zauber Istanbuls auf einem Blick.
Während ich dieser üppigen Stadt unverhohlen ins Dekolletee schaue, erzähle ich Gizem von der Begegnung mit Frau Ö. und der Bedingung, die sie gestellt hat.
„Kannst du dir denn vorstellen hierzubleiben?“, fragt Gizem, als ich mit meinem Bericht fertig bin. Ich muss nicht lange überlegen. In diesem Moment kann ich mir keine aufregendere Stadt denken. Außerdem, verrate ich, reizt mich diese sture alte Dame, die ihr Land in einer Zeit verließ, als dies noch alles andere als üblich war, die Fremde wirklich fremd und der Muselmann bestenfalls eine Märchenfigur war. „Sie hat alles aufgegeben, Gizem, nur für einen Mann.“ Jetzt sind wir bei dem Thema, auf das zwei Frauen abends in einer Bar unweigerlich zu sprechen kommen müssen: Männer. Heute kann ich zumindest ein berufliches Interesse vorschützen. „Gizem“, frage ich sie, „was ist eigentlich dran am türkischen Mann?“
Bisher hatte ich vor allem eine Qualität feststellen können: Mit ihrer Hilfe kann man begriffsstutzigen Philosophie-Studentinnen sehr einleuchtend darstellen, was Sartre mit seiner Theorie vom „Blick der anderen“ gemeint hat. Man lasse sie einfach durch eine Ansammlung türkischer Männer laufen und am eigenen Leib erfahren, wie es ist, allein durch Blicke vom Subjekt zum Objekt degradiert zu werden – wobei die Blondinen eine besonders rasche Erleuchtung erleben dürften. So ungeniert schauen die Männer den Frauen hier hinterher, dass ich in einem schwachen Moment einem Souvenirhändler fast sein ganzes Sortiment an Nazaren abgekauft hätte – in der Hoffnung, die blau-weißen Glasaugen, die man sich hierzulande gern um den Hals oder an die Haustür hängt, schützen nicht nur vor dem bösen, sondern auch vor dem lästigen Blick. Doch selbst der Glasaugen-Verkäufer guckte so komisch.
Gizem zieht an ihrer Zigarette, schaut mich eine Weile nachdenklich an, dann beantwortet sie meine Frage geschickt mit einer anderen: „Was ist denn dran am deutschen Mann?“ Tom möge mir verzeihen, dass ich ins Grübeln komme. Aber schließlich ist er nicht der Prototyp, sondern die lange gesuchte Ausnahme.
„Siehst du, so einfach ist das nicht“, sagt Gizem. „Und deine alte Dame dürfte auf diese Frage auch nicht so schnell eine Antwort finden. Vermutlich wird sie dich eher zu Feldstudien auf die Straße schicken.“ Sie drückt ihre Zigarette aus und zuckt feixend die Achseln. „Keine schlechte Idee eigentlich.“ Ich schaue sie fragend an. Gizem lacht, fixiert mich belustigt, dann streckt sie mir fast feierlich die Hand entgegen: „Wetten, dass du in einem Jahr hier auf den Geschmack kommst? Dass mindestens ein türkischer Mann dich so verwirren wird, dass du wünschtest, deine Verlobung hätte nie stattgefunden?“
Die türkische Vorliebe für Wettspiele hatte ich schon in Kreuzberg beobachtet, wo es inzwischen mindestens so viele Wettstuben gibt wie Dönerbuden. Doch hatte ich den Türken etwas mehr Geschick unterstellt. Diese Wette würde ich selbstverständlich gewinnen. Siegessicher schlage ich ein. Dann erst fällt mir auf, was ich getan habe. Mit diesem Handschlag habe ich gleichzeitig eine Entscheidung getroffen, die den ganzen Tag über in mir gereift war. Ich würde also hierbleiben, ein Jahr in Istanbul. Mir wird etwas mulmig. Um auf andere Gedanken zu kommen, frage ich Gizem: „Was machst du eigentlich, wenn ich die Wette gewinne?“
„Vielleicht“, sagt sie und schlägt aufreizend ein Bein über das andere, „gehe ich dann mal mit einem deutschen Mann aus.“
Ich schaue auf die Uhr: „Dann solltest du dir schon mal notieren, dass du am 23. März nächsten Jahres um halb zehn ein Date hast.“
Sie zwinkert mir zu: „Du meinst, für deine Verlobung mit dem türkischen Traummann?“
April Über Nacht gelandet
„Eine Sprache, ein Mensch.
Zwei Sprachen, zwei Menschen.“
(TÜRKISCHES SPRICHWORT)
ICH KANN NICHTS DAFÜR, meine erste Vokabel heißt „Führer“. Wie ein Offizier vor seiner Truppe steht der Lehrer vor uns, breitbeinig und mit geradem Rücken, wuchtige Schnürstiefel an den Füßen, eine tannengrüne Cargohose und ein geschecktes Military-Hemd über dem muskulösen Körper. „Önder“ hat er an die Tafel geschrieben, dann den Blick über seine neuen Schüler schweifen lassen – außer mir sind nur noch drei Chinesen im Raum –, um dann für mich zu übersetzen: „Füüü-rer“.
Dies ist nicht, wie sein Auftritt nahelegt, die türkische Auffassung vom Lehrerberuf. Es ist sein Vorname. Und den übersetzt Önder nicht nur deshalb, weil wir uns hier in einem Sprachkurs befinden, wo jedes gesprochene Wort bilingual oder zumindest per Pantomime artikuliert werden muss. Er übersetzt ihn, weil Türken, die sich Fremden gegenüber vorstellen, in der Regel nur zu gern zum Besten geben, was ihr Name bedeutet. Genauso gern übrigens, wie sie dann auch gleich den Fußballclub erwähnen, den sie im Stadion, am Fernseher, vor dem Radio oder neuerdings auch über Handy-TV anfeuern. In meinem ersten Türkei-Urlaub vor fünf Jahren brauchte ich daher eine Weile, bis ich verstand, dass Beşiktaş, Fenerbahçe und Galatasaray keine gängigen türkischen Nachnamen sind, sondern die drei größten Fußballclubs Istanbuls.
„Leader“, übersetzt Önder für meine Mitschüler, und die drei Chinesen lächeln anerkennend. Natürlich. Sind sie doch sowohl mit Führern wie mit bedeutungsschwangeren Namen bestens vertraut. Und auch Uniformen in Klassenzimmern machen ihnen vermutlich genauso wenig Probleme wie allgegenwärtige Nationalflaggen. Während ich die türkische Fahne, vor der sich unser Lehrer postiert wie eine Bulldogge vor Herrchens Haus, noch mit leichtem Befremden anstarre, springen die drei schon unbeirrt an ihm vorbei zur Tafel, um dort ihre Namen zu hinterlassen und deren Bedeutung zu erklären. Zwar hatte bisher keiner ihrer Herrscher die komplizierten Schriftzeichen ihrer Sprache zu Gunsten der Völkerverständigung durch lateinische Buchstaben ersetzt, wie es in der Türkei einst geschah, aber eine lateinische Variante ihrer Namen haben sie immerhin parat. Und so kommt es, dass ich in den ersten Minuten meines Türkischkurses zunächst etwas Chinesisch lerne: Ich erfahre, dass Peng „großer Vogel“ heißt, Xiong 1 „männlich und mächtig“ und Hui „Güte und Freundlichkeit“. Nebenbei gibt es dann noch einen kleinen Einblick in die Mechanismen der Globalisierung: Peng arbeitet in der Immobilienbranche, Xiong an der Istanbuler Börse, und Hui, die einzige Frau in der Delegation aus China, ist auf dem Heiratsmarkt aktiv gewesen: Nicht wegen der Arbeit, sondern wegen eines Mannes kam sie nach Istanbul.
Ich muss an Frau Ö. denken, die andere Heiratsmigrantin. So nennt die Soziologie die Frauen, die außer Landes ihr Eheglück suchen. Frau Ö. möchte mich nicht sehen. Erst an dem Tag nach meinem ursprünglich geplanten Rückflug darf ich sie wieder besuchen. Vorher, so sagt sie, glaubt sie mir nicht, dass ich nicht doch noch in den Flieger steige, zurück zu Tom. Ich wollte ihr vorschlagen, mein Ticket vor ihren Augen in kleine Stücke zu reißen oder – besser noch – anzuzünden und in einer feuerfesten Schale zu verbrennen. Doch dann fiel mir ein, dass es ein E-Ticket ist, einzig im Rechner gespeichert und nicht als Papier greif bar. Der Fortschritt verhindert so manche große Geste.
Dann bin ich an der Reihe. Das Buchstabieren meines Namens ist nicht das Problem, seine Bedeutung ist es. Wo der Name „Cornelia“ herkommt – ich weiß es beim besten Willen nicht. Laut meiner Mutter kommt er von Cornelia Froboess, meiner Namensgeberin. Aber deren größten Hit aus den Sechzigern – „Zwei kleine Italiener“ – kennen meine drei Chinesen sicher nicht. Ich brauche eine bessere Erklärung und überlege. Cornelia – steckt da nicht ein Horn drin, lateinisch Cornus? Cornelia, die „Gehörnte“? Nein, dann schon besser: die mit den Hörnern. Also erkläre ich: „That means horn.“
„Horn?“ Die drei Chinesen schauen mich neugierig an. In ihrer unzertrennlichen und ständig lächelnden Art erinnern sie mich ein wenig an die drei bunten Köpfe vom missglückten Logo der Fußball-WM 2006.
„Yes, horn“, versuche ich es erneut, „like the Golden Horn.“
„Ah“, Önder nickt und zeigt in Richtung des Meeresarmes, der den historischen Teil der Stadt, Sultanahmet, von dem moderneren Beyoğlu, wo wir uns gerade befinden, trennt und den man vom Fenster aus sogar sehen könnte, wenn nicht so viele Häuser die Sicht versperrten. Haliç heißt der rund zehn Kilometer lange Seitenarm des Bosporus bei den Türken, was so viel heißt wie Meeresbusen. „Vergoldet“ haben ihn die Europäer, wenn auch nur namentlich. Denn mit Gold und Glanz hatte das in seiner Form leicht an ein Horn erinnernde Gewässer in den letzten Jahrhunderten nur wenig zu tun, flossen doch lange alle Abwässer der Stadt hier hinein. Eine übel stinkende Kloake war das „Goldene Horn“ über Dekaden. Umso hartnäckiger hielt sich der Glaube an vergangene wie künftige goldene Zeiten: Dass die Byzantiner kurz vor der Eroberung durch die Osmanen ihre ganzen Schätze in die Bucht gekippt haben, damit den Feinden nichts in die Hände falle, sagt man – und dass man nur danach tauchen müsse. Dass bei den Kämpfen in der Bucht zahlreiche Schiffe mit ihrer wertvollen Ladung untergingen – und dass man diese nur bergen müsse. Oder dass in die Fundamente aller historischen Gebäude in Ufernähe einst massenweise Gold eingearbeitet wurde – und man es nur ausbuddeln müsse. Das Volk glaubt bis heute an Legenden wie diese: Als Mitte der 1980er Jahre viele Fabriken in Ufernähe abgerissen wurden, sah man zahlreiche Goldsucher emsig über die Schutthaufen krabbeln. Und als eine Firma aus Japan einst anbot, das Goldene Horn völlig kostenfrei zu reinigen, wenn sie dafür alle Schätze behalten könne, die sie auf dem Meeresboden fände, schmetterte die Stadtverwaltung diesen Vorschlag entrüstet ab.
Doch was hat das Goldene Horn mit meinem Namen zu tun? Wieder diese erwartungsvollen Blicke. Ich versuche es erneut und bilde mit den Händen zwei Hörner über den Schläfen.
„The Devil?“, fragt Önder, und ich wehre entsetzt ab. Um die peinliche Stille zu überbrücken, die durch meine Ratlosigkeit entsteht, fragt mich der Lehrer schließlich nach meinem Job. Tamam, in Ordnung.
„Ghostwriter“, erkläre ich tapfer.
„Ghostrider?“, fragt der eine Chinese zurück, den meine Teufelshörnchen wohl so nachhaltig beeindruckt haben, dass er die Vorstellung, ich würde des Nachts als mit Mephisto verbündete Motorradbraut durch die Straßen jagen – wie der Ghostrider aus den amerikanischen Marvel Comics –, gar nicht so abwegig findet. „No“, belehrt ihn der andere trocken, „Goatrider.“





























