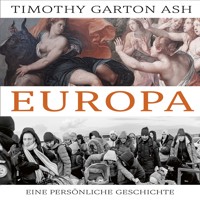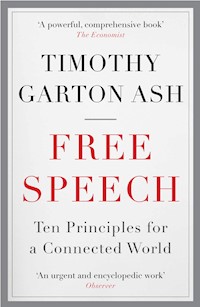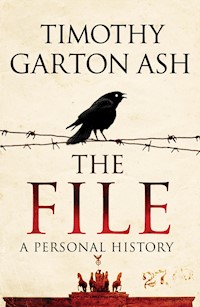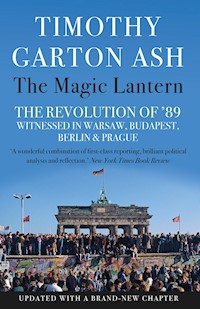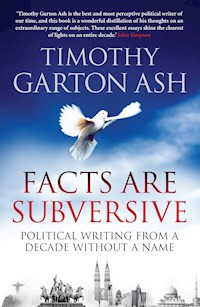Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
30 Jahre Mauerfall: Timothy Garton Ash „einer der einflussreichsten politischen Publizisten der Welt“ (titel thesen temperamente) zu den Hintergründen der Revolution ’89
Timothy Garton Ash zählt zu den wichtigsten Chronisten der europäischen Revolution von 1989. Schon Jahre zuvor war er in den Metropolen Mitteleuropas unterwegs und traf sich mit Dissidenten wie Lech Wa??sa und Václav Havel. Aus seinen Reportagen erfuhr der Westen, wie der Osten in Bewegung geriet. Und bereits im Herbst 1990 legte Garton Ash ein wichtiges Buch über diese Epochenwende vor: "Ein Jahrhundert wird abgewählt".
30 Jahre später hat Garton Ash noch einmal die Länder des ehemaligen Ostblocks besucht, um zu erkunden, was aus den damaligen Hoffnungen und Visionen geworden ist. Der Bericht seiner Reise vervollständigt die Neuausgabe dieses Klassikers der Zeitgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 734
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
30 Jahre Mauerfall: Timothy Garton Ash »einer der einflussreichsten politischen Publizisten der Welt« (titel thesen temperamente) zu den Hintergründen der Revolution ’89Timothy Garton Ash zählt zu den wichtigsten Chronisten der europäischen Revolution von 1989. Schon Jahre zuvor war er in den Metropolen Mitteleuropas unterwegs und traf sich mit Dissidenten wie Lech Wałęsa und Václav Havel. Aus seinen Reportagen erfuhr der Westen, wie der Osten in Bewegung geriet. Und bereits im Herbst 1990 legte Garton Ash ein wichtiges Buch über diese Epochenwende vor: »Ein Jahrhundert wird abgewählt«.30 Jahre später hat Garton Ash noch einmal die Länder des ehemaligen Ostblocks besucht, um zu erkunden, was aus den damaligen Hoffnungen und Visionen geworden ist. Der Bericht seiner Reise vervollständigt die Neuausgabe dieses Klassikers der Zeitgeschichte.
Timothy Garton Ash
Ein Jahrhundert wird abgewählt
Europa im Umbruch 1980—1990
Erweiterte Neuausgabe
Aus dem Englischen von Yvonne Badal und Andreas Wirthensohn
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Vorwort
Erster Teil: Früchte der Widerwärtigkeit
1 Skizzen aus einem anderen Deutschland
2 Der Papst in Polen
3 Die Tschechoslowakei unter Eis
4 Die »deutsche Frage«
5 Die Früchte der Widerwärtigkeit
6 Das Leben der Toten
7 Eine Lektion über Ungarn Budapest 1985
8 Ein paar Ideen — nichts Neues!
9 Ost-Westlicher Diwan
10 Mitteleuropa — aber wo liegt es?
11 Vorfrühling
12 Die Prager Warnung
13 Reform oder Revolution?
14 Notizbuch
Zweiter Teil: Wir das Volk
15 Augenzeuge und Geschichte
16 Warschau: Die erste Wahl
17 Budapest: Das letzte Begräbnis
18 Berlin: Die Mauer fällt
19 Die Revolution der Laterna Magica
20 Das Jahr der Wahrheit Bürgerfrühling
21 Dreißig Jahre danach — Zeit für eine neue Freiheitsbewegung?
Personenregister
ihnen allen
Vorwort
Dieses Buch ist von meinen eigenen Interessen geprägt, die eher Ideen als Armeen gelten, eher Kulturen als Wirtschaftssystemen, mehr den Nationen als politischen Systemen, vor allem aber den einzelnen Menschen, mehr als amorphen Kollektiven. Zufällig — und glücklicherweise — sind dies auch die Prioritäten der Debatte um Mitteleuropa, die in den achtziger Jahren wie ein geistreicher, aber zielloser Exilant durch Europa und Nordamerika wanderte. Fast alle der wesentlichen Themen jener Debatte finden sich in diesem Buch auf die eine oder andere Weise wieder, und ich hoffe, sie wurden mit Sympathie, aber auch mit angemessener Skepsis behandelt. Denn bei meinen Erforschungen des einstigen und zukünftigen Mitteleuropas habe ich meine Augen niemals vor den harten Wahrheiten des real existierenden Osteuropas verschlossen.
Meine größte Aufmerksamkeit während all dieser Jahre galt den Elementen des Aufbruchs — dem demokratischen Aufbruch —, den es in Opposition zu und trotz der allgemeinen bürgerlichen Ohnmacht immer gegeben hat. Und wie sich zeigen sollte, entstammten die neuen regierenden Eliten Ostmitteleuropas nach den revolutionären Ereignissen von 1989 genau diesen Oppositionskreisen und diesem Milieu. Viele von ihnen, die auch in der ersten Hälfte dieses Buches große Beachtung finden — Václav Havel zum Beispiel oder Adam Michnik —, spielten nun in der Wandlung ihrer Länder vom Kommunismus zur Demokratie eine entscheidende Rolle.
Ich möchte aber betonen, dass dies nicht der Grund war, weshalb ich zu jener Zeit über sie geschrieben habe. Wenn ich auch immer die These vertreten habe, dass ihre Schriften und Aktivitäten für die politische Zukunft ihrer Länder, ihrer Regionen und für Europa als Ganzes von außerordentlicher Bedeutung waren, so konnte ich mir doch nicht vorstellen — genauso wenig wie sie selbst —, dass die Machtlosen derart schnell zu Mächtigen und die Mächtigen derart machtlos werden würden. Ich hatte ganz und gar nicht geplant, mich »hinter den Gewinner zu stellen«. Im Gegenteil, während dieses Jahrzehnts war sicher so mancher zu dem Schluss gekommen, ich stünde hinter den Verlierern, wohingegen nicht wenige führende westliche Politiker mit ihrer Beharrlichkeit des ausschließlichen Interesses für die herrschenden kommunistischen Parteien in Osteuropa hinter den vermeintlichen Gewinnern standen. Heute brauchen die neuen demokratischen Regierungen Ostmitteleuropas jede nur erdenkliche Hilfe. Dem Historiker aber sei die Frage gestattet: Wie viele von jenen, die heute geflissentlich die neuen Herrscher feiern, hatten vor ein paar Jahren auch nur einen Gedanken an sie verschwendet — geschweige denn einen Finger für sie gerührt?
Ich schrieb über diese Menschen und Themen, weil ich sie interessant fand, lehrreich und oft auch bewundernswert. Gründe genug, wie ich meinte, um nicht auch noch ihre politische Zukunft ins Kalkül zu ziehen. Dementsprechend sollten auch die folgenden Seiten nicht teleologisch gelesen werden, selbst wenn viele Wurzeln von »89« in ihnen zu finden sind, sondern eher gegen die Tendenz, jenen Anteil der ostmitteleuropäischen Geschichte der achtziger Jahre zu vergessen, der nicht unmittelbar auf das Ende des Kommunismus im Jahr 1989 hingewiesen hat.
Eines der großen Themen Václav Havels in seinen ersten Wochen als Präsident der Tschechoslowakei behandelte die Art und Weise, mit der in gewissem Maße jeder zum Erhalt des kommunistischen Systems beigetragen hat, und sei es auch nur durch den scheinbar harmlosen Tribut an äußere Konformität und Heuchelei. (Ein Thema, das er natürlich schon in seinen früheren Schriften behandelt hat.) Einer der weniger schönen Aspekte der Revolution in der DDR war die Art und Weise, mit der alle Verantwortung für das vergangene System dem kleinen Kreis alter Männer um Erich Honecker zugeschrieben wurde. Es ist natürlich einer der ältesten Tricks von Nachfolgern, alle Schuld den Vorgängern in die Schuhe zu schieben. Doch hier waren es nicht nur die Nachfolger, hier war eine breite Öffentlichkeit daran beteiligt. Und was sich hinter dieser öffentlichen Reaktion verbarg oder, psychologisch gesehen, durch sie verdrängt wurde, war das Ausmaß der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für das ehemalige System.
Die Geschehnisse von 1989 sollten einen Autor davor warnen, über die Zukunft schreiben zu wollen. Der aufmerksame Leser wird bemerken, dass meine Prognosen zu Polen und Ungarn aus dem Jahr 1988 stellenweise entschieden zu pessimistisch waren (wiewohl sich erst noch erweisen muss, ob die eher skeptische Schlussfolgerung dieses Essays nicht doch gerechtfertigt war). Andererseits wurden die Analysen meiner Berichte aus Polen 1983 (S. 42 ff.) und der Tschechoslowakei 1984 (S. 60 ff.) durch die Entwicklungen von 1989 erfreulich pointiert.
Unter den unzähligen Fragen, die sich nun in größeren Zusammenhängen über die Zukunft dieser Region und die Zukunft der Menschen stellen, die in ihr leben, ist für mich persönlich jene am wichtigsten, die ich am Ende dieses Buches stelle. Es gab menschliche Qualitäten und Tugenden — um diesen altmodisch gewordenen Begriff hier zu gebrauchen —, die unter der politischen Widerwärtigkeit zum Blühen gekommen waren. Werden sie die Befreiung überleben können? Waren diese Qualitäten nur die »Früchte der Widerwärtigkeit«?
Die Anordnung der Essays, Skizzen und Berichte in diesem Buch ist chronologisch. Die Texte im ersten Teil des Buches wurden zuerst in der New York Review of Books veröffentlicht, im Spectator, Granta, der New Republic oder im Times Literary Supplement. Sie wurden zwar überarbeitet, doch ich habe keinen Versuch unternommen, ihnen im Rückblick mein späteres Wissen hinzuzufügen oder die Frische des gerade Beobachteten zu nehmen. Sie sind sowohl Geschichten, wie hoffentlich auch ein Beitrag zur Geschichte: zur Zeitgeschichte oder zur »Geschichte der Gegenwart«. Einige Reflexionen über die Situation des Augenzeugen in der Geschichte sind im einführenden Kapitel des zweiten Buchteils zu finden, das zwar neu geschrieben wurde, jedoch an vielen Stellen auf bereits zuvor veröffentlichten Arbeiten in der New York Review of Books und im Spectator basiert.
Allen, die in diesen Redaktionen meine Arbeiten betreut haben, bin ich zutiefst dankbar. Besonders hervorheben möchte ich Robert Silvers von der New York Review, Bill Buford von Granta und Charles Moore vom Spectator. Das Kapitel »Skizzen aus einem anderen Deutschland« basiert teilweise auf Materialien aus meinem Buch »Und willst du nicht mein Bruder sein …« Die DDR heute (1981). Ich danke Rudolf Augstein für die Genehmigung, sie hier nochmals verwenden zu können. Michael Krüger und Eginhard Hora waren überaus verständnisvolle und anspornende Partner im Hanser Verlag. Wie viel ich Yvonne Badal als Übersetzerin, Redakteurin und Ratgeberin schulde, kann nicht genug betont werden.
Aber auch all jenen, die mich in Oxford und Berlin das Handwerk des Historikers gelehrt haben, vielen Bekannten, Kollegen und Freunden aus dem akademischen Leben, aus Journalismus, Diplomatie und Politik, will ich meinen Dank ausdrücken. Sie alle haben mir mit Informationen, Ratschlägen und kritischen Gedanken geholfen. Außerdem seien hier noch jene beiden Institutionen genannt, ohne deren Hilfe die erste, englische Ausgabe dieses Buches nicht möglich gewesen wäre: die Ford Foundation, und hier besonders ihr International Program Director, Enid Schoettle, und mein altes wie neues College St. Antony’s in Oxford, vor allem sein Warden Ralf Dahrendorf, der mir großzügige intellektuelle wie organisatorische Unterstützung zukommen ließ. Meiner Familie verdanke ich immerwährenden Beistand und Ablenkung.
In größter Schuld aber stehe ich bei all den Menschen in Polen, in der Tschechoslowakei, in Ungarn, Österreich und Deutschland (Ost wie West), die durchlebt und getan haben, worüber ich nur unzulänglich berichten konnte. Ihnen allen sei dieses Buch gewidmet.
Timothy Garton AshOxford, April 1990
Erster Teil
Früchte der Widerwärtigkeit
Süß ist die Frucht der Widerwärtigkeit,
die, gleich der Kröte, hässlich und voll Gift,
ein köstlich Juwel im Haupte trägt.
William Shakespeare, Wie es euch gefällt, 2. Aufzug, 1. Szene
1
Skizzen aus einem anderen Deutschland
Diese Skizzen stammen aus einer Zeit, die man heute das letzte Jahrzehnt des Deutschlands hinter der Mauer nennen könnte.
Heimweh (1988)
Heimweh ist ein Gefühl, das für gewöhnlich kaum jemanden mit der DDR verbindet. Doch hier in Oxford, beim Betrachten kurzer Fernsehspots aus Dresden und Ost-Berlin, fühle ich einen seltsamen Stich in der Herzgegend.
In den späten siebziger Jahren hatte ich ausgiebige Reisen durch die DDR unternommen, und dann, 1980, bekam ich die seltene Chance, als Doktorand aus Oxford für neun Monate in Ost-Berlin zu leben, um die Geschichte Berlins unter Hitler zu recherchieren. Die Humboldt-Universität besorgte mir ein Zimmer in einem schäbigen wilhelminischen Mietshaus am Prenzlauer Berg, einem alten Arbeiterviertel, das zu dieser Zeit schon das Milieu der Dichterklausen, der Schauspieler, Maler und Studenten war, aus dem auch der exilierte Liedermacher Stephan Krawczyk hervorging. Und die evangelische Kirche bot bereits Zuflucht für freie Meinungsäußerung und offene Diskussion. In einer Kirche, erinnere ich mich, hing eine fast chinesisch anmutende Wandzeitung, mit der vollständigen und genauen Aufzählung sämtlicher nuklearer Waffen der NATO und des Warschauer Pakts. Die Friedensbewegung war gerade im Entstehen.
Mein Zimmer hatte einen Balkon, dessen Absturz unmittelbar bevorzustehen schien, und eine riesige, dunkle Anrichte. Das zweite Zimmer dieser Wohnung wurde von einem angolanischen Tierpräparator bewohnt. Oder vielleicht sollte ich sagen, von dem angolanischen Tierpräparator. Die DDR sorgte nun für seine Fortbildung — eine sanfte Version der »brüderlichen Hilfe«. Aber vielleicht habe ich das alles auch nur falsch verstanden, denn der Tierpräparator sprach kein deutsches Wort. Und sein Englisch hatte auch gewisse Grenzen. »Good night!«, sagte er jeden Abend, bevor er sich in sein Bett zurückzog. »Good night!«, begrüßte er mich am Morgen, »Good night!«, rief er mir fröhlich zu, falls wir uns mittags trafen.
Für einige Zeit arbeitete ich in der »Abteilung für spezielle Forschungsliteratur« in der ehemaligen Preußischen Staatsbibliothek Unter den Linden (heute die Deutsche Staatsbibliothek), vom Volksmund »der Giftschrank« getauft, weil dort all das verwahrt wird, was der Staat seinen gewöhnlichen lesenden Untertanen nicht zumuten möchte.
Die Abende verbrachte ich mit Freunden, im Kino oder im Theater — für gewöhnlich exzellent, bot es das zusätzlich prickelnde Vergnügen, »zwischen den Zeilen« verborgene Anspielungen auf die Gegenwart zu entdecken. Ich aß ausgezeichnet in meiner Eckkneipe, wo ich immer neue Bekanntschaften schloss, weil Einzeltische unüblich sind. Sobald die bona fides des Ausländers erst einmal außer Zweifel stand, ergoss sich ein Strom von Vertraulichkeiten. Manchmal geriet es ziemlich komisch, die guten Absichten nachzuweisen. »Na gut, Sie behaupten also, dass Sie Historiker sind«, schnauzte ein junger Arbeiter. »Dann sagen Sie mir, wo wurde Karl Marx geboren?« Glücklicherweise wusste ich die Antwort. »Und wer war 1930 Führer der KPD?« Wieder richtig. »Hmm, und wer brachte Hitler an die Macht? Und« — er konnte sich nicht länger beherrschen — »nun sag bloß nicht die scheiß Monopolkapitalisten.«
Einmal ging ich mit einem polnischen Freund ins Ballhaus Berlin, einem Tanzsaal mit Tischtelefonen wie ehedem (oh, ihr Geister Isherwoods). Wir spähten nach ein paar hübschen Mädchen aus und wählten ihre Nummer. Doch dies war Ost-Berlin. Also funktionierte das Telefon nicht. Zurück in meiner frostigen Behausung, stellte ich das Radio an, nur um schließlich den West-Berliner AFN zu empfangen, der die Ankunft von Joan Baez — jenseits der Mauer — ankündigte: »So come on folks. Saturday, March 22, Joan Baez hits the Wall!«
Unwirkliche Stadt. Am meisten aber begeisterten mich die Fahrten außerhalb Berlins. Anders als die akkreditierten Korrespondenten konnte ich frei in der DDR reisen, wohin ich auch wollte, ohne Überwachung: eine Möglichkeit, die ich bis an ihre Grenzen ausschöpfte. Nur wenige jüngere Menschen wissen, dass die DDR ein schönes Land ist. Oder vielleicht sollte ich besser sagen: Nur wenige Menschen wissen, welch schönes Land die DDR umgrenzt. Man könnte sogar von den schönen Ländern sprechen, denn die historischen Fürstentümer und Königreiche von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg sind im Grunde verschiedene Länder geblieben. Überall in Osteuropa hat die relative Rückständigkeit des Sozialismus vieles bewahrt, was der Kapitalismus andernorts zerstört hat. Ein guter Freund fuhr mich durch die Mark Brandenburg, mit Theodor Fontanes Wanderungen in der Hand, und es schien, als habe sich in hundert Jahren fast nichts verändert.
Mein Herz aber habe ich an Thüringen verloren, mit seinen lieblichen, bewaldeten Hügeln, seinen gotischen Kirchen und prachtvollen Städtchen. Vor allem an Weimar, das die große alte Dame der DDR-Literatur, Anna Seghers, unvergesslich als »der beste und der schlimmste Ort der deutschen Geschichte« bezeichnet hat.
Der beste natürlich wegen Goethe und Schiller und vielleicht auch wegen des Weimars des Bauhauses und der Weimarer Republik. Der schlimmste wegen Buchenwald, das sich noch immer oberhalb der Stadt verbirgt, auf ebenjenem Hügel, wo Goethe sein Wanderers Nachtlied dichtete:
Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest …
Gleich nach Thüringen nimmt Sachsen den zweiten Platz in meinem Herzen ein, selbst wenn sich die sächsischen Könige in Polen zuweilen erbärmlich verhalten haben. Man kann kaum bittere Gefühle für eine Dynastie hegen, deren letzter Vertreter angeblich mit den unsterblichen Worten abtrat: »Na, Kinder, dann macht euch euren Dreck alleene.«
Doch im Herzen von Sachsen klafft eine Wunde. Dresden. Ich war dort, am 13. Februar, dem Jahrestag des Bombardements. »Sind Sie von drüben?«, fragte eine Frau mittleren Alters. »Nein, ich bin Engländer.« »Ach, warum haben Sie es getan?« Nicht ein Moment des Zweifels, was »es« ist. Und ich empfand die Frage als gerechtfertigt. Tu quoque wäre keine Antwort.
In der restaurierten Kreuzkirche gab es eine würdige Andacht, und eine bewegende Aufführung von Dvořáks Requiem im Kulturpalast. Am Schluss standen die Zuhörer für eine Minute des Schweigens. Und genau zur Stunde des ersten Bombenabwurfs 1945 begannen die Glocken aller überlebenden Kirchen zu läuten: die Hofkirche sprach mit der Annenkirche, die Kreuzkirche zur Dreikönigskirche. Am beredtsten aber sprach die Frauenkirche — ein Grabhügel aus schweigendem Trümmergestein. Doch die Deutschen, die sich heute in der Kreuzkirche versammeln, sorgen sich mehr um die Lektionen heutiger Tage, um Frieden und Achtung der Menschenrechte in Ost wie West.
Am Ende meines Aufenthalts wurde ich von einem gewaltigen polnischen Strom fortgeschwemmt, Solidarność genannt. Kurze Zeit später schrieb ich für westdeutsche Leser ein kleines Buch über die DDR, in dem ich sie etwas unvorteilhaft mit Polen verglich. Einige meiner engsten Freunde in der DDR warfen mir vor, diese Vergleiche seien unfair. Vor Kurzem las ich das Buch wieder. Ich glaube, sie hatten recht. In Europas Haus sind viele Wohnungen. Lasst jedes Volk nach seiner eigenen Fasson selig werden.
Anstelle einer Dissertation über Berlin unter Hitler hatte ich also ein Buch über die DDR unter Honecker geschrieben. Damit konfrontiert — und auch noch mit einem Vorabdruck im Spiegel —, waren die DDR-Behörden verständlicherweise verschnupft. (Ich fürchte, mein Doktorvater in Oxford wird ähnliche Gefühle gehabt haben.) Sie riefen einen Diplomaten der britischen Botschaft zu sich und protestierten, dass dies ein Aufruf an die Arbeiter der DDR sei, dem polnischen Beispiel zu folgen. Diese interessante Rezension machte das Buch mit Sicherheit reif für den Giftschrank. Und setzte mich endgültig auf die schwarze Liste der unerwünschten Personen. Als ich einen Offizier am Berliner Grenzübergang S-Bahn Friedrichstraße um Erklärung für die Verweigerung meiner Einreise bat, antwortete er: »Eine Angabe von Gründen ist international nicht üblich.«
Carmen-Sylva-Straße (1981)
Carmen-Sylva-Straße, ein Abend im Frühling. Melancholische Stuckgesichter stieren von den bröckelnden wilhelminischen Fassaden. Auf den Balkonen entlang der engen Straßenschlucht blüht Wäsche. Die Bewohner lehnen an den Balustraden, trinken ihr Bier aus Flaschen und werfen träge kleine Boshaftigkeiten von Geländer zu Geländer. Auf dem Kopfsteinpflaster spielen Kinder. Ein zerlumpter, unrasierter alter Mann stochert sich von einem Häufchen Abfall zum nächsten. Irgendwo krächzt ein Grammophon Tanzrhythmen.
Nach acht, wenn die Haustüren verschlossen sind, beginnt der Chorus der Dämmerung. Junge Männer pfeifen von der Straße nach ihren Mädchen auf den Balkonen. Aus der Eckkneipe tönt trunkenes Gelächter, schwillt zum gelegentlichen Spektakel an. Die ganze Nachbarschaft ist da: der Schriftsteller, der Sportler, der Soldat, der Maurer, ein alter Herr im schäbigen Westen-Anzug mit Fliege, eine schnurrbärtige Frau, mindestens siebzig. »Junge Frau«, spricht die Kellnerin sie an.
Später, gegen elf, noch ein letztes »Halleluja«, ein kaum hörbares »Scheiße« aus einer Gruppe junger Leute, die über das Pflaster stolpern. Ein Rumpeln der letzten S-Bahn. Ihre Lichter fliegen für einen Augenblick am Ende der Straße vorbei. Dann Stille, völlige, umhüllende Stille, bis zum Brauereiwagen um sechs am nächsten Morgen.
Ich beschreibe eine Nacht im Jahre 1980. Und doch scheint hier seit 1930 nichts verändert. Um in diesem Teil Ost-Berlins anzukommen, muss man sich auf die Reise durch eine Radierung von Grosz, in eine Geschichte von Isherwood begeben. Dies hier ist Berlin: das Berlin, das man im Westen vergeblich sucht. Doch der Schein trügt.
Zuerst einmal haben sich die Namen verändert. Die Carmen-Sylva-Straße heißt heute Erich-Weinert-Straße, nach einem zweitklassigen, aber kommunistischen Dichter. Wenn es Morgen wird, sieht man auch die Hunderte von Kabeln, kreuz und quer über die Fassaden gespannt, über die Stuckgesichter, wie Falten des Alters: Antennenkabel zum Empfang der westlichen Sender. Auch der alte Mann ist kein Landstreicher, der nach Essbarem stöbert, sondern ein Rentner auf der Suche nach leeren Flaschen. Er verkauft sie dem Staat für zwanzig bis dreißig Pfennige in einem kleinen Laden direkt unter meinem Balkon und bessert damit seine Rente auf. Und heutzutage schimpfen die Arbeiter in der Kneipe über ihre »Prämien« und den Betrag, der ihnen für etwas, das sie »Soli« nennen, abgezogen wird: »Solidaritätsspende«, für Vietnam oder Angola.
Im November 1932, bei den letzten freien Wahlen vor Hitlers Machtübernahme, stimmte dieses zähe Arbeiterviertel mit überwältigender Mehrheit für die Kommunisten. Unter den Nazis war hier ein Zentrum des kommunistischen Widerstands. Noch nach vierzehntägigem SA-Terror, als Folge des Reichstagsbrands, gaben mehr als 44.000 Bürger in der Stadtverordnetenwahl vom 12. März 1933 den Kommunisten ihre Stimme.
Heute hebt sich dieses Viertel durch seine Weigerung, kommunistisch zu wählen, hervor. Laut offiziellen Angaben wurden bei den Kommunalwahlen vom 20. Mai 1979 ganze 5000 Stimmenthaltungen gezählt und 679 Stimmen gegen die Kandidaten der »Nationalen Front« (die die Kandidaten einer Anzahl von Marionettenparteien und der herrschenden Sozialistischen Einheitspartei einbezieht). Um diese Zahlen richtig werten zu können, sollte man wissen, dass der Stimmenanteil für die Nationale Front in der gesamten DDR mit 99,83 % bei einer Wahlbeteiligung von 98,28 %, angegeben wurde. In einem Wahllokal der DDR findet sich der Bürger vor einer Kommission von zwei bis drei Beamten ein, zeigt seinen Ausweis und nimmt sich einen Stimmzettel. Um für die Nationale Front zu stimmen, wirft er seinen Stimmzettel einmal gefaltet und unmarkiert in die Wahlurne. Möchte er seine Wahl aber anders treffen, muss er, quer durch den ganzen Raum, in eine Kabine gehen, neben der ein Vopo sitzt. Kaum hat er den ersten Schritt in diese Richtung getan, schon wird sein Name notiert. Ein Wähler unabhängiger Gesinnung beschrieb die wenigen Schritte bis zur Wahlkabine als »den längsten Gang meines Lebens«. Die Konsequenzen können bis zur Zurückstufung am Arbeitsplatz oder zur Exmatrikulation bei Studenten führen.
»Niemals in der deutschen Geschichte«, erklärte der Sohn des ersten Präsidenten der Weimarer Republik, Friedrich Ebert, während einer Wahlversammlung in Ost-Berlin, »sind Volksvertreter demokratischer gewählt worden.«
An einem kalten Januarabend besuchte ich meine Stadtbezirksabgeordneten, die rangniedrigsten Volksvertreter, in dem kargen, ungeheizten Hinterzimmer ihres Klubs der Nationalen Front. Ob sie gewählt wurden, fragte ich.
»Ja, natürlich.«
»Von einer großen Mehrheit?«
»Sehr groß.«
»Und sind Sie alle von verschiedenen Parteien?«
»Nein, zufällig sind wir von der gleichen Partei.« Der Sozialistischen Einheitspartei.
Sie sprachen eine Menge vom Plan, von dem sie mir eine Kopie gaben. Der »Volkswirtschaftsplan des Stadtbezirks Berlin-Prenzlauer Berg« ist eine Miniaturausgabe der zentralen Zahlenplanung, wie sie in den frühen dreißiger Jahren in der Sowjetunion eingeführt worden war: »Die Buchbestände in den Bibliotheken müssen von 350.000 auf 450.000 Bände erhöht werden. Die Zahl der Entleihungen ist auf 108,2 % zu steigern.« Nicht die Menschen sollen ermutigt werden, mehr Bücher aus den öffentlichen Bibliotheken auszuleihen, »die Zahl der Entleihungen ist auf 108,2 % zu steigern«. Ich stellte mir den Bibliothekar am Jahresende vor, wenn er feststellt, dass er nur 105 % erreichen konnte. »Verzeihung die Dame, haben Sie die Werke Schillers schon gelesen? Siebzig Bände — ich werde sie in Ihrem Namen vormerken.«
Mit dem sozialistischen Wettbewerb »Verschönerung unserer Hauptstadt Berlin: Mach mit« endet der Plan. Eine Ahnung von »Mach mit« bekam ich, als in meinem Hausflur ein Aushang die nächste »Mach-mit-Aktion« ankündigte. Beseitigung des Winterabfalls um elf Uhr am folgenden Samstag. Pünktlich war ich zur Stelle. Eine Viertelstunde ging vorbei. Eine halbe Stunde. Kinder linsten neugierig von der Straße durch die zerbrochenen Scheiben der Haustür. Niemand machte mit. Der Wintermatsch, alte Kippen, Kaugummipapiere, alles blieb liegen wie zuvor.
Hier, am Prenzlauer Berg, sah ich mit eigenen Augen, was ein begabter Beobachter einst die »Konterrevolution der Realität« genannt hat. Die DDR ist eindeutig ein totalitärer Staat, wo sie bestrebt ist, jeden wachen Moment ihrer Bürger zu beherrschen und zu dirigieren. Die Vorstellung von »Freizeit« ist jedem Möchtegern-Totalitarismus suspekt. »Im Sozialismus ist der für den Kapitalismus typische Gegensatz zwischen Arbeit und Freizeit aufgehoben«, erklärt das offizielle Kleine Politische Wörterbuch. Und weiter, »die Freizeit muss von allen Mitgliedern der sozialistischen Gesellschaft sinnvoll und effektiv genutzt werden«. Der Mobilisierung der Bevölkerung werden aus diesem Grund auch große Energien gewidmet. Schulkinder werden für »Tätigkeiten im produktiven Bereich« »gewonnen«. Jugendliche werden »überzeugt«, an Wehrkampfsport-Veranstaltungen teilzunehmen. Millionen rücken zur Mai-Parade aus. Soweit mobilisiert das Regime durchaus erfolgreich die Körper seiner Bürger. Doch nicht einmal die DDR ist noch imstande, ihre Herzen und Gedanken zu mobilisieren — wie es ihr zweifellos in den frühen Jahren des Aufbaus, nach dem Elend der Kriegszerstörungen, gelungen war.
Mir scheinen die DDR-Bürger am weitaus erfinderischsten zu sein, wenn es darum geht, sich von der kollektiven politischen Bühne in ihre eigenen apolitischen Nischen zurückziehen zu können. Doch die Kluft zwischen dem öffentlichen und dem privaten Ich, der offiziellen und der inoffiziellen Sprache, zwischen äußerlicher Konformität und innerem Dissens — kurz, das Doppelleben — ist ein Phänomen aller Ostblockländer. Der Wechsel von einer Person zur anderen vollzieht sich wie von selbst, auch schon bei Vierzehnjährigen. Dieses Doppelleben bedarf natürlich auch einer Doppelmoral: Öffentlich applaudiere ich staatlichen Entscheidungen, die ich im privaten Bereich niemals billigen würde.
Der typische, wahrhaft unpolitische DDR-Bürger ist jener, der jährlich an den Demonstrationen teilnimmt, seine kleine Fahne am Nationaltag hisst und zur Wahl geht. Paradoxerweise sind es gerade die politisch bewussten Menschen, die den Wahlen fernbleiben. So basiert auch der bemerkenswerte Anteil von Stimmenthaltungen in meinem Viertel, Prenzlauer Berg, auf einer langen Tradition des Protests und gewiss auch auf einem ungebrochenen Stolz der Arbeiterklasse: »Wat, ick soll zu diese Posse jehn?«, so ein Bauarbeiter. Hier flackert noch ein letzter Schimmer von jenem altmodischen Ideal, nach dem das öffentliche Verhalten des Bürgers in realer Relation zu seinen privaten Überzeugungen stehen sollte. Hier, in dieser verkehrten Welt, sind es die Nichtwähler, auf die es ankommt.
Vor fünfzig Jahren wählte die Carmen-Sylva-Straße aus Protest die Kommunisten; heute stimmt die Erich-Weinert-Straße aus Protest gegen sie. Vor fünfzig Jahren hatten ihre Bewohner kaum Geld, um etwas zu kaufen; heute gibt es kaum etwas zu kaufen. Vor fünfzig Jahren demonstrierten sie am 1. Mai ihre Solidarität mit den Arbeitslosen, die von der unmenschlichen kapitalistischen Wirtschaft geschaffen wurden. Heute versuchen sie, sich von den obligatorischen Mai-Demonstrationen der »Soli« in die Welt der privaten Vergnügungen, in ihre Schrebergärten oder Autos zurückzuziehen. Vor fünfzig Jahren lebten sie in quälender Unsicherheit; heute leben sie in quälender Sicherheit.
Innere Emigration (1984)
Buchenwald blickt auf Weimar. Der Rauch aus den Verbrennungsöfen des Konzentrationslagers zog über das kulturelle Leben im Weimar der Kriegszeit hinweg, über das klassische Theater, die Dichterlesungen und die Kammerkonzerte. Die Weimarer Frage — wie war diese Barbarei im Herzen eines zivilisierten Landes möglich? — ist die Frage der jüngeren deutschen Geschichte. Weshalb hatte Deutschlands kultiviertes Bürgertum versagt, das sogenannte Bildungsbürgertum, weshalb hat es den Nazismus weder verhindert noch ihm widerstanden? Wie war es möglich, dass Kommandanten der Vernichtungslager Bach lauschten, bevor sie wieder die Arbeit in den Gaskammern überwachten? Können wir noch glauben, dass Humanismus humanisiert?
Im Mai 1945, in einer Rede über »Deutschland und die Deutschen« vor amerikanischem Auditorium, suchte Thomas Mann eine Antwort auf die, wie er es nannte, »melancholische Geschichte« der deutschen Innerlichkeit: Von Luther bis Goethe seien deutsche Intellektuelle durch den »deutschen Bildungsbegriff« daran gehindert worden, das »politische Element« in sich aufzunehmen und »Politik« mit dem »ideellen und geistigen Bestandteil des sittlichen und menschenanständigen Teils ihrer Natur« zu verbinden. Das »Missverhältnis von äußerem und innerem Freiheitsbegriff« prägte ihre fehlgeleitete Vorstellung, dass die innere, geistige Freiheit der Kultur von der äußeren, politischen Freiheit getrennt werden könne. In ihrer »musikalisch-deutschen Innerlichkeit und Unweltlichkeit« hatten sie die wesentlichen, äußeren und im weitesten Sinne »politischen« Obligationen wahrer Humanität missachtet — das vollkommen »Menschheitliche«. Es sei dieses schicksalhafte Vermächtnis gewesen, das — weit über alle Vorstellungskraft hinaus vereinfacht und verhärtet — eine der fortgeschrittensten »zivilisierten« Nationen dieser Welt zum Einverständnis mit dem »Barbarischen« führen konnte.
Manns These hat mit dem Abrutsch ins Klischee den Preis ihres Einflusses bezahlt, auch wenn sie durch George Steiner und andere fortgesetzt und weiterentwickelt wurde. Es bleibt eine klassische These.
Als ich in die DDR kam, um dort unter anderem den geistigen Widerstand gegen den Nazismus zu erforschen, interessierte es mich vor allem, ob die besondere deutsche kulturelle Tradition — diese bewusste Kultivierung innerer Vergeistigung und diese kulturelle Abstinenz vom politischen Leben — unter der heutigen DDR-Intelligenz überlebt hat. Immerhin sind auch sie von einer deutschen Diktatur herausgefordert, wenn auch keiner, die die Extreme der Nazi-Unmenschlichkeit anstrebt. (Buchenwald wurde noch einige Jahre von den Sowjets als Internierungslager genutzt. Doch heute ist es ein wohlorganisiertes, wenn auch tendenziös gestaltetes Museum.) Wie mir schien, ist diese Tradition noch sehr lebendig.
Viele unter den gebildeten Deutschen, die ich am besten kennengelernt habe, leben in einer klassischen »inneren Emigration«. Sie nähren sich von deutscher Musik (dieser mysteriösesten, zweideutigsten, neutralsten unter den Künsten — jene Kunst, die Mann für seinen Doktor Faustus gewählt hat), von europäischer Malerei, Dichtung und Bildhauerei. Sie lieben Ernst Barlach und verehren seine rätselhaften Skulpturen, Produkte seiner eigenen inneren Emigration im »Dritten Reich«. Sie übertönen den Ruf der Parolen mit der Musik Bachs. Doch auch wenn sie den Staat so weit wie möglich ignorieren, so zollen sie in den Universitäten oder am Arbeitsplatz dennoch den gebotenen Tribut an die äußere Konformität. Falls aufgefordert, werden sie in der Öffentlichkeit Dinge sagen und beschwören, die sie insgeheim verabscheuen.
Innere Emigration ist die intellektuelle Art des Doppellebens. Natürlich ist dieses Phänomen in allen unfreien Gesellschaften Europas zu finden. Doch es scheint mir, als werde es mehr und intensiver im unfreien Teil Deutschlands praktiziert als in Ungarn, Polen oder in der Tschechoslowakei. Vielleicht lässt sich dies mit jener besonderen deutschen Errungenschaft, der Innerlichkeit, erklären. Ein beträchtlicher Anteil der DDR-Literatur reflektiert und nährt diese »Wendung nach innen«. Und tatsächlich ist diese Art der Literatur in den letzten zehn Jahren stark angewachsen, nachdem viele Schriftsteller an dem Versuch verzweifelt waren, ihre Gesellschaft zu verändern, indem sie über sie schrieben.
»Wir haben alle viel verloren«, beginnt ein bewegendes Gedicht von Eva Strittmatter: »täusch dich nicht: auch ich und du. / Weltoffen wurden wir geboren. / Jetzt halten wir die Türen zu / vor dem und jenem.«
Interessant ist, dass die melancholische Individualistin Eva Strittmatter vom offiziellen literarischen Establishment der DDR nicht nur publiziert, sondern sogar hoch gelobt wird, obwohl ihre Prämissen alles andere als »sozialistisch« sind. Das ausdrückliche politische Engagement für den »sozialistischen Realismus« wird offenbar nicht mehr eingefordert. Vor fünfundzwanzig Jahren (auf der Bitterfeld-Konferenz) befahl die Partei ihren Schriftstellern, über das Leben der Arbeiter zu schreiben. Heute ist sie ziemlich erleichtert, wenn sie es nicht tun. Die neue Literatur der Innerlichkeit, ohne Bedrohung für den Staat, ist eine akzeptable Alternative zu einer Literatur, die sich kritisch mit den äußeren Realitäten des Lebens in der DDR auseinandersetzt. Davon will die Partei nichts mehr wissen.
Im Dezember 1972 hatte der neue Parteivorsitzende Erich Honecker erklärt, dass es keine Tabus in den Bereichen Kunst und Literatur geben dürfe, was Fragen des Inhalts ebenso wie des Stils betreffe. Jüngere DDR-Schriftsteller nahmen ihn beim Wort und begannen offen über ihre eigenen Erfahrungen zu schreiben: auch Menschen in kommunistischen Ländern seien imstande, Verbrechen zu begehen, unglücklich zu sein, ihre Frauen zu schlagen, westliche Musik zu genießen. All dies beschrieben sie und gestanden es zum ersten Mal ein — wenn auch indirekt, wenn auch in kleinen Auflagen, doch immerhin. Älteren Autoren wie Reiner Kunze und Stefan Heym wurde die Veröffentlichung von Arbeiten gestattet, die bisher in den Schubladen liegen bleiben mussten oder nur im Westen veröffentlicht werden konnten. Jüngere Schriftsteller wie Volker Braun und Jurek Becker betraten die Szene wie von selbst. Es gab die gleiche »Explosion« neuen Schreibens wie in Polen. Was zwei junge polnische Kritiker in einem 1974 veröffentlichten Buch »die unbeschriebene Welt« genannt hatten, wurde jetzt zumindest beschrieben.
Das Ende dieses literarischen Frühlings ist sehr genau zu datieren. Am 16. November 1976 wurde dem Liedermacher Wolf Biermann während eines Konzerts im Westen die Staatsbürgerschaft der DDR aberkannt. Zwölf führende Schriftsteller schrieben einen offenen Protestbrief an die DDR-Führungsspitze. Wenigstens hundert weitere unterzeichneten ihn. Das Honecker-Regime reagierte bösartig. Jeder der Unterzeichner wurde auf die eine oder andere Weise bestraft. Christa Wolf, die vielleicht beste Schriftstellerin des Landes, wurde aus dem Berliner Schriftstellerverband ausgeschlossen. Ab dann wurden die Schriftsteller, die während des kurzen Frühlings ohne »Tabus« ermutigt, gepriesen und veröffentlicht worden waren, entmutigt, denunziert und für Veröffentlichungen gesperrt. Sie erfuhren am eigenen Leib, was man in Westdeutschland Berufsverbot nannte — aber, anders als in der Bundesrepublik, ein totales Berufsverbot. Denn in der DDR hat der Staat das Monopol auf das gedruckte Wort.
Nun schieden sich die Wege der Schriftsteller in der DDR und in Polen. In Polen reagierten die besten, kritischsten und tapfersten auf den offiziellen Bann mit einer klaren Herausforderung an das Staatsmonopol und publizierten im Samizdat. Während der nächsten vier Jahre entwickelten sie eine vollständige Gegenkultur, mit unabhängigen Verlagen, rivalisierenden Verlagshäusern und literarischen Zeitschriften wie Zapis und Puls. In der DDR aber wanderten die Schriftsteller aus. Sie emigrierten nach innen, wie Eva Strittmatter, oder nach außen, in den Westen. Unter den Prominenten, die für immer gingen, waren die Dichter Reiner Kunze und Sarah Kirsch, der Bühnenautor Thomas Brasch und der Prosaschriftsteller Hans Joachim Schädlich. Kunze (der durch seine tschechische Frau außerordentlich vom Prager Frühling beeinflusst war) verließ das Land besonders widerstrebend und erst, nachdem offiziell sanktionierte Belästigungen sein Leben unerträglich gemacht hatten. Ein hochrangiger Funktionär hatte ihm bedeutet, er würde »nicht überleben«, was man für ihn in petto halte. Ende der siebziger Jahre wurde das Honecker-Regime wieder etwas nachgiebiger. Es hatte den Schaden erkannt, den es seiner internationalen Reputation zugefügt hatte, und erlaubte Autoren wie Jurek Becker, Klaus Schlesinger und dem besonders populären Günter Kunert im Westen zu leben, ohne die Staatsangehörigkeit der DDR aufgeben zu müssen.
Wie schon andere literarische Umsiedler zuvor, produzierten die DDR-Schriftsteller, die nun im Westen lebten, eine besondere Art von Literatur. Ich nenne sie die Literaturschule der »Eule der Minerva«. Wie die Eule der Minerva im Flug in die Dämmerung, so machen sie im Flug aus dem System ihre Abrechnung mit ihm. Aus dieser Generation existiert nichts, was auch nur annähernd vergleichbar wäre mit der Bedeutung und Tiefgründigkeit eines Deutschen Tagebuchs von Alfred Kantorowicz, oder Czesław Miłosz’ Verführtes Denken, zwei großartige Beispiele der Eule-der-Minerva-Literatur aus den fünfziger Jahren. Dennoch gehören die Eule-der-Minerva-Bücher aus den siebziger Jahren zum Besten, was die deutschsprachige Literatur in den vergangenen zehn Jahren aufzubieten hatte. Darunter Reiner Kunze, ein Beispiel für die höchste Qualität deutscher Literatur aus der DDR. Seine Sprache ist von außergewöhnlicher Reinheit, in scharfem (und bewusstem) Kontrast zur verschnörkelten und schwülstigen Staatssprache. Seine kurzen Prosastücke sind das geschriebene Äquivalent zu Zeichnungen von Grosz oder Hockney, ohne einen einzigen überflüssigen Strich. Wort-Zeichnungen. Seine Themen sind von evidenter Bedeutung — die systematische Korruption der Jugend in den Schulen der DDR, die Herabsetzung tschechischer Schriftsteller zu »Unpersonen«. Seine moralische Eindeutigkeit hätte selbst den Apostel Paulus zufriedengestellt.
Doch seit er 1977 in den Westen kam, hörte Kunzes Werk auf, zu seinen Lesern in der DDR zu sprechen. Und was für Kunze gilt, gilt mehr noch für seine Mit- oder Halbexilierten. Weshalb?
Natürlich gibt es schlicht praktische Schwierigkeiten. Ihre Bücher sind in Buchläden der DDR nicht mehr zu erhalten, und westdeutsche Ausgaben müssen eingeschmuggelt werden. Dennoch, verglichen mit polnischen, tschechischen oder ungarischen Schriftstellern im Exil, ist die Lage der (ost)deutschen Autoren im (Halb-)Exil technisch gesehen wesentlich besser. Ihnen stehen alle Möglichkeiten des westdeutschen Fernsehens und Radios zur Verfügung, um ihr Volk im Osten zu erreichen. Um ihre Arbeiten reißen sich die westlichen Verleger, und Tausende Westdeutscher kaufen ihre Bücher, um sie dann an ihre Freunde oder Verwandte jenseits der Grenze weiterzugeben.
Die Erklärung muss also tiefer liegen. Mag dies auch ein trügerischer, spekulativer Grund sein, so glaube ich doch, künstlerisch betrachtet, dass ihnen die Herausforderung eines repressiven Systems fehlt. Christa Wolf, die in Ost-Berlin geblieben ist, hörte man im privaten Kreis sagen, dass sie bezweifle, ob sie ohne die konstante Reibung, der ein Schriftsteller im Kommunismus ausgesetzt ist, leben könne. Paradoxerweise kann Zensur ein Schriftstellerleben ebenso leichter wie schwieriger machen. Die ganze Energie des Schriftstellers konzentriert sich auf ein Ziel, anstatt sich an die vielen zu verlieren, die in einer offenen Gesellschaft nach Aufmerksamkeit schreien. Er muss sein ganzes Talent aufbieten, um seine Botschaften an den literarischen Grenzpatrouillen vorbeizuschmuggeln, unter dem Deckmantel der Fabel oder im doppelten Boden des allegorischen Gepäcks. Diese Einschränkungen können, wie die Einschränkungen durch traditionelle Stile — durch das Sonett oder die Ballade —, von künstlerischem Vorteil sein. Und schon allein die Tatsache, dass es ihm geglückt ist, seine Botschaften am Zensor vorbeizuschmuggeln, sichert ihm den Applaus der Leser.
Dann, plötzlich, kann er alles über alles schreiben. Er erfährt den »Schock der kulturellen Freiheit«. Auch diese Erfahrung machen natürlich nicht nur die Schriftsteller aus der DDR. Man denke an die Verwirrung so manches polnischen Schriftstellers um 1981 herum. Aber durch ein starkes, tatsächlich fast übermächtiges Verständnis ihrer traditionellen Rolle als moralische und politische Mentoren der Nation bleiben polnische Schriftsteller im Exil von diesem Schock zumeist verschont. Die großen romantischen Dichter Polens lebten im Exil, und doch wurden sie die »geistige Regierung« genannt. In der deutschen Literatur gibt es, trotz Heine, keine vergleichbare Tradition. Ja, es gibt die Beispiele der deutschen Emigrationsliteratur im »Dritten Reich«: Thomas Manns berühmtes »Wo ich bin ist Deutschland«. Doch wer diesen Vergleich zieht, muss auch die Unterschiede sehen.
Mann bemerkte einmal, dass die Nazizeit eine »moralisch gute Zeit« gewesen sei. Ich nehme an, er wollte damit sagen, dass die moralische Wahl zu jener Zeit absolut eindeutig — Schwarz war Schwarz und Weiß war Weiß — und die moralische Pflicht des Schriftstellers einfach zu erkennen war. Die Gegenwart ist keine (in Manns ironischem Sinne) »moralisch gute Zeit« in Deutschland. Die Wahl ist nicht eindeutig, und die politische und moralische Aufgabe des Schriftstellers ist weit davon entfernt, einfach zu sein. Brecht schrieb über die »finsteren Zeiten«, in denen »ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist / weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt«.
Doch sind die »Untaten« des Honecker-Regimes wirklich so, dass sie einer konzertierten künstlerischen Aktion der exilierten Schriftsteller bedürften? Viele meiner Freunde in der DDR würden darauf mit Nein antworten. Tatsächlich würden sie lieber ein Gespräch über Bäume führen.
Das amerikanische Exil von Mann und Brecht war gleichzeitig total und temporär. Sie waren deutsche Schriftsteller, auf einen anderen Kontinent verschlagen, in eine fremde Kultur, die darauf warteten, nach Hause zurückkehren zu können. Sie hatten weder die Perspektive noch den Vorsatz, amerikanische Schriftsteller zu werden. Das Exil von Kunze oder Kirsch ist halb und permanent zugleich. Es bestehen kaum Aussichten für sie, je »nach Hause« zurückkehren zu dürfen. Und doch sind sie noch immer in Deutschland, deutsche Schriftsteller, die unter deutschen Lesern leben. Czesław Miłosz oder Milan Kundera können keine »west-polnischen« oder »west-tschechoslowakischen« Schriftsteller werden — diese Begriffe sind bedeutungslos —, aber ostdeutsche Schriftsteller können hoffen, westdeutsche Schriftsteller zu werden.
Bedauerlicherweise scheinen die meisten von ihnen jetzt in einer besonderen Art der Vorhölle zu leben — sie sprechen nicht mehr zur lesenden Öffentlichkeit in der DDR, sie sprechen aber auch noch nicht zu den Westdeutschen. Im Osten konnten sie nichts veröffentlichen und hatten doch alles, worüber zu schreiben es sich lohnte. Im Westen können sie alles veröffentlichen und finden doch nichts, worüber zu schreiben ihnen lohnenswert erscheint. Keiner von ihnen spricht mehr zum eigenen Volk, so wie Mann und Miłosz aus dem kalifornischen Exil immer wieder zu ihren Völkern sprachen. Wenn wir »das Richtige« mit rein künstlerischen Kriterien messen, dann sind es Autoren wie Christa Wolf und der große alte Fuchs der DDR-Literatur, Stefan Heym, die die »richtige« Entscheidung getroffen haben — weiter im Osten zu leben, aber im Westen (wenn notwendig) zu veröffentlichen. (Doch unsere Kriterien für »das Richtige« sind nicht allein künstlerischer Natur.) Hier soll nicht das vereinfachende Argument bekräftigt werden, dass Repression gute Literatur hervorbringt. Doch bisher war zu beobachten, dass dieses seltsame deutsche Halbexil einige der besten Schriftsteller Deutschlands offenbar eher gelähmt als inspiriert hat.
Dr. Faust in Schwerin (1981)
In Schwerin hat es den Anschein, als seien die Herzöge von Mecklenburg gerade erst abgereist. Das großherzogliche Schloss aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist in »meinem Windsor-Castle-Stil«, wie es der Architekt beschrieben hat, auf einer Insel gebaut. Mit seinen ziegelroten Türmchen und Spitzen erinnert es jedoch eher an ein viktorianisches Sanatorium. Aber die herrliche Seenkette um das Schloss herum, die prächtige und unverfälschte Gotik des Doms am anderen Ufer, die organische Einheit der alten Stadt verleihen dem Gesamtbild eine altertümliche Würde. Die Stadt ist wundervoll erhalten, so, als seien die Uhren lange vor der »Stunde der Befreiung« im Mai 1945 stehengeblieben. Hier war eines der frühesten Zentren des deutschen Christentums und Sitz der Herren von Mecklenburg, seit sie das Wasserschloss von den heidnischen Wenden im 12. Jahrhundert erobert hatten. Nur die rote Fahne auf den Zinnen erinnert heute daran, dass Schwerin nicht mehr die Hauptstadt eines freien Staates ist.
Inmitten der verblichenen Pracht des Staatstheaters, überladen mit vergoldeten und rosafarbenen Stuckbüsten, wird Goethes Faust gegeben. Der Regisseur verspricht eine »revolutionäre« Inszenierung. Am Ende der Aufführung, so das Programm, wird Faust zur Inkarnation des bourgeoisen Arbeitgebers geworden sein. Und Mephistopheles verkörpert die »teuflische« Lebensweise der Bourgeoisie. Goethe »konnte sich natürlich nicht bewusst sein«, dass diese bürgerlich-kapitalistische Sozialordnung nur die Vorbedingung für eine »dritte Phase« der »wahrhaft frei und universell entwickelten Individuen« gewesen sei. Der absurd herablassende Inhalt dieser Anmerkung bereitet mich auf das Schlimmste vor. Es kommt. Da gibt es der Reihe nach vier verschiedene Fausts. Der letzte schließlich gerät zur aufgeblasenen Parodie eines Kapitalisten, mit riesiger Zigarre, goldener Uhrkette und Spitzbauch: Faust als Citizen Kane.
Er donnert seinen Text ins Publikum, doch selbst ihm gelingt es nicht, Goethes großartiges Motto für einen freien Menschen in einem unfreien Staat gänzlich zu verstümmeln: »Ja! Diesem Sinne bin ich ganz ergeben, / Das ist der Weisheit letzter Schluss: / Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, / Der täglich sie erobern muss!«
Später werde ich mit Freunden aus Berlin eingeladen, bei Dr. Faust Nummer eins zu übernachten, eine imposante Erscheinung selbst dann noch, als er die schwarze Robe mit Jeans vertauscht hatte. Er erzählt interessant und nicht ohne Kritik von der Inszenierung. Doch als wir aufbrechen, flüstert jemand: »Seid vorsichtig! Faust arbeitet für die Stasi.«
Als wir durch die verlassenen Straßen gehen, bemerke ich Fausts zwanghafte Eigenart, jeden Satz mit »Pardon« oder »Entschuldige« zu beginnen. »Entschuldige«, als er uns allen große Martinis einschenkt, sich selbst aber ein kleines Bier, »ich kann euch nur den Fußboden zum Schlaf anbieten.« Die Mansardenwohnung ist gemütlich, die Kerzen brennen, die Gläser sind gefüllt. »Nicht viel zu tun im Moment?«, wendet er sich an meinen Freund, seinerseits Schauspieler. »Entschuldige, ich nehme an, du denkst daran, im Westen Arbeit zu finden?« Als mein Freund zurückhaltend bleibt, wendet sich Dr. Faust an mich. »Und du bist von der ausländischen Presse?«
»Entschuldigung«, sagt er. Wir reden, bis der Hahn kräht.
Am nächsten Tag kehren wir nach Berlin zurück. Dr. Faust hat eine funkelnagelneue Dreizimmerwohnung (Staatseigentum, natürlich), was ein außergewöhnlicher Luxus für einen Junggesellen seines Alters ist. Und wesentlich wertvoller als dreißig Silberstücke.
»Das ist unser Alltag«, erklärt mein Freund, »wären wir nicht gewarnt worden, hätten wir über Flucht in den Westen gesprochen.«
Dies war eine schöne Gelegenheit, um, wie es das Theaterprogramm empfahl, das klassisch humanistische Menschenbild mit dem zeitgenössischen zu vergleichen, in dieser glorreichen »dritten Phase« der wahrhaft frei und universell entwickelten Individuen, die Goethe — armer, rückständiger, unaufgeklärter Goethe — sich niemals hätte vorstellen können.
In der DDR mag Mephistopheles noch immer für den Teufel arbeiten. Dr. Faust aber arbeitet für die Stasi.
Bibliotheken eines entschwundenen Staates (1984)
(voulez-vous soupé à Sanssouci), schrieb Friedrich der Große an Voltaire, der pfiffig darauf antwortete »G a« (j’ai grand appetit). Dort würde dieser Puzzle-Poetaster, dieser König und selbsternannte »Philosoph von Sanssouci« Voltaire in schlechtem Französisch mit den neuesten Erwerbungen seiner königlichen Bibliothek erfreuen. Doch unklugerweise setzte er auch noch die Dichtung höchst eigener Gnaden der Kritik aus. »Seht«, sprach Voltaire, »welche Mengen seiner schmutzigen Wäsche der König mir zu waschen schickt.« Es konnte nicht von Dauer sein. Voltaire bekam einen kühlen Abschied und einen Band königlicher Dichtung. In Frankfurt wurde er von preußischen Geheimpolizisten festgenommen, für 12 Tage (so berichtet uns Macaulay) in einem abgewrackten Hotelzimmer eingesperrt und schließlich auch den kostbaren Band wieder los.
So ging es zu im alten Preußen. Aber so ging es auch der Kurfürstlichen Bibliothek, 1661 gegründet, der Königlichen Staatsbibliothek von 1701 und der Preußischen Staatsbibliothek von 1918: Was der Staat mit der einen Hand gegeben, nimmt er mit der anderen wieder fort. Was unter staatlicher Schirmherrschaft geschaffen, wird mit staatlicher Politik wieder zerstört. Zerstört, wie die Preußische Staatsbibliothek — geteilt, wie Deutschland selbst, zwischen Ost und West.
In Ost-Berlin steht die ursprüngliche Bibliothek, wie sie vor 1914 war. Ein riesiges Quadrat aus grauem Sandstein, mit pompösen historizistischen Details, von Hitler in Mein Kampf als beispielhaft für jene Architektur hervorgehoben, die er bewunderte. Heute wird die gehobene Aufmerksamkeit des Besuchers auf Lenin gelenkt: Wladimir Iljitsch Lenin in Berlin und als Leser der Königlichen Bibliothek, der heutigen Staatsbibliothek — ein ergreifendes historisches Ereignis, broschiert in der Garderobe zu erwerben: Greift zu, solange der Vorrat reicht! Lenin in der Hand geht man an einem mürrischen Portier vorbei (Ausweis bitte), die blankpolierten Steintreppen hinauf, durch einen Korridor in ockerfarbenem Ölanstrich, wo es nach billigem Desinfektionsmittel riecht, und erreicht endlich den Katalograum.
Die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in West-Berlin ist ein großes, glänzendes, ultramodernes Gebäude, von Hans Scharoun als Schwester der nahen Philharmonie entworfen. Wie bei der Philharmonie, so ist auch die äußere Form der Bibliothek als »organischer« Ausdruck ihrer inneren Funktion gedacht. Rigoros und aufrührerisch asymmetrisch, als sei es bewusste Opposition zur öden Symmetrie des Ost-Berliner Gegenstücks, enthüllt das Innere eine ansteigende Flucht großer, lichter, weiträumiger Säle, durchgängig mit Velour bespannt, die Wände béton brut. In den Lesesälen sind die Bücher sorgfältig in kleinen Gruppen angeordnet, als solle der Blick des Studierenden nicht daran gehindert werden, in den Gesichtern all der schönen Menschen von Abteilung Ostasien bis Osteuropa lesen zu können. Falls man des Lesens aber müde wird, kann man sich Bücher ausleihen oder kopieren lassen, ganz nach Belieben, oder sie als Gesprächsaufhänger in der eleganten Kantine mit ihrer fabelhaften Aussicht auf die Mauer nutzen.
Im puritanischen Osten gibt es derartige Ablenkungen nicht. Und der Puritanismus erstreckt sich bis auf die Auswahl der Bücher. Geht man die Karteikarten durch, so stolpert man vielleicht sogar über »Bahro, Rudolf, ›Die Alternative: Zur Kritik des real existierenden Sozialismus‹«, oder über »Stone, Norman, ›The Eastern Front‹«. Doch neben der Signatur des Letzteren heißt es »W«, neben Bahro »ASF«. »W« bedeutet »wissenschaftliche Benutzung«, was in der Praxis heißt: ausschließlich für wissenschaftliche Forschungszwecke. Und »ASF«? Die »Abteilung für spezielle Forschungsliteratur« ist ein diskreter, kleiner Leseraum, der all das enthält, was dem Staat besonders »gefährlich« erscheint. Der »Giftschrank« also. Nur ganz besonders vertrauenswürdigen Personen oder bereits vergifteten ausländischen Besuchern wird der Zugang gewährt. In Glasvitrinen stehen der komplette Völkische Beobachter neben gebundenen Ausgaben von Spiegel und Stern, Bahros Alternative einträchtig neben Hitlers Mein Kampf und John Tolands Hitlerbiographie neben Stefan Heyms Novelle über den Stalinismus in der DDR.
Als ich mich dort für meine Dissertation an grauen Winternachmittagen bedrückt Seite um Seite durch Nazizeitungen arbeitete, saß nur ein kommunistischer Professor aus Indien am Nebentisch, einsam in den letzten Ausgaben der Times blätternd (Gift!). Manchmal gesellte sich ein höherer Offizier des Wachregiments »Feliks Dzierzynski« zu uns — dem Wachregiment des Ministeriums für Staatssicherheit. Konzentriert las er stapelweise hochglänzende westliche Militärzeitschriften, Farbmagazine und Waffenbroschüren. Hin und wieder leckte er sich die Lippen, die Knie fest aneinandergepresst, wie ein in die Jahre gekommener Bankangestellter im Pornoladen. Als ich dieses Jahr in die Bibliothek zurückkehrte, nun als ausgewiesener Journalist, fragte ich einen der höheren Bibliotheksangestellten, welchem Zweck die »ASF«-Klassifizierung diene. »Nun, ich gebe Ihnen ein Beispiel«, sagte er, »erst kürzlich erhielten wir ein Buch über sexuelle Perversionen. Und die Herausgeber haben selbst darum ersucht, dieses Buch nicht generell zugänglich zu machen. Für solche Sachen ist die ›ASF‹ …«
Die Kataloge in West-Berlin enthalten keine derartigen heimlichen Abartigkeiten. Bis vor Kurzem enthielten sie allerdings auch nicht einmal ihre eigenen Bestände. Bei einer dieser nervenzermürbenden Absurditäten, wie der Berliner Ausleihprozedur, mussten die Bibliothekare ihre Kollegen in Ost-Berlin anrufen, um die Signatur des Bandes aus ihrem eigenen West-Berliner Bestand zu erfahren — die alten Kataloge waren auch im alten Gebäude verblieben. Mittlerweile hat West-Berlin die Rekatalogisierung der ausgelagerten Bände beendet, und der gesamte alte alphabetische Katalog — bis 1974 — wird bald auf Mikrofilm verfügbar sein.
Was ging alldem voraus? Als 1940 die britischen Bombenangriffe auf Berlin begannen, entschied die Preußische Staatsbibliothek, ihre wertvollsten Bestände zu evakuieren und in sicheren Plätzen überall im Reich auszulagern. Bei Ende des Krieges existierten 29 Evakuierungsstellen, von denen sich nun sechs auf westlich besetztem Territorium, dreiundzwanzig aber auf östlichem befanden. Etwa 1,7 Millionen Bände »fanden ihren Weg nach West-Berlin«, wie es die Bibliotheksbroschüre formuliert — und ein Bild von lauter Flüchtlingen vor der Roten Armee heraufbeschwört: erschöpfte alte Baedeker in zerlumpten roten Gewändern, wie sie sich über die Hügel des Harz schleppen; die Brüder Grimm, wie sie ihren Nachlass in einem Karren hinter sich herziehen; der vornehme von Wilamowitz-Moellendorff, mit nichts als seinen Appendizes … irgendwie fanden sie ihren Weg, durch Marburg und Tübingen, bis zu Hans Scharouns Gebäude im Tiergarten, kaum einen Kilometer von ihrer alten Heimstätte Unter den Linden entfernt. Und hier, jedenfalls für den Moment, scheinen ihre Wanderjahre ein Ende gefunden zu haben.
Ost-Berlin möchte sie zurückhaben. Unbeeindruckt von den 6,5 oder mehr Millionen Bänden, die in Berlin geblieben waren oder aus östlichen Evakuierungsstellen zurückgebracht wurden, reklamiert die »Deutsche Staatsbibliothek« die 1,7 Millionen Flüchtlinge als ihre Bürger, widerrechtlich von West-Berlin zurückgehalten. Ihre eigene anachronistische Bezeichnung »Deutsche Staatsbibliothek« unterstreicht diesen Anspruch (denn wo ist denn der deutsche Staat?). Ihre Anwälte berufen sich auf eine UN-Resolution, die besagt, dass verschlepptes Kulturgut an seinen Vorkriegsstandort zurückgeführt werden soll. Die westlichen Anwälte parieren, dass Deutschland nicht gegen Deutschland gekämpft habe und somit diese Resolution nicht anwendbar sei. Stattdessen werden die umstrittenen Bücher in Verwahrung gehalten, ebenso wie alle ehemaligen »preußischen Besitztümer« durch die »Stiftung Preußischer Kulturbesitz« in West-Berlin. Von daher auch die mindestens ebenso anachronistische Bezeichnung »Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz«. Wenn Deutschland wiedervereinigt ist, dann werden auch die Bestände wiedervereinigt sein.
Bis dahin leben sie in friedlicher Koexistenz. West-Berlin hat die Gutenberg-Bibel, die prächtige Sammlung orientalischer Manuskripte und, nicht ohne Ironie, einen großen Bestand an osteuropäischer Literatur. Ost-Berlin hat ein Fragment der ersten Lateinischen Bibel, den Churfürstlichen Atlas und eine große Anzahl allgemeiner Bücher und Nachschlagewerke aus der Vorkriegszeit. West-Berlin konnte viele seiner Lücken durch antiquarische Ankäufe oder Faksimile-Bände füllen und ist vorzüglich mit Nachschlagewerken aus der Nachkriegszeit bestückt. Damit liegt Ost-Berlin ziemlich zurück, denn der Staat kann sich die nötige harte Währung zum Ankauf nicht leisten (wie Friedrich der Große gibt auch Honecker zu viel für seine Armee aus). Doch Ost-Berlin kann seine einstigen Schätze im auswärtigen Leihverkehr borgen und gibt sie, ungeachtet seiner Rechtsansprüche, gewissenhaft zurück. West-Berlin gilt als Zentrum der ISBN-Aufstellung — einschließlich der für die DDR. Die rivalisierenden Ansprüche sind zwar unüberbrückbar, aber Leben und Forschung müssen weitergehen. Also haben sich Preußens Erben wenigstens auf einen Modus Vivendi geeinigt.
Es gibt jedoch noch eine weitere Verflechtung in dieser mitteleuropäischen Familiengeschichte. Sie betrifft eine der wertvollsten Auslagerungen der Evakuierungszeit — 505 Kisten mit etwa einem Viertel aller bekannten Urschriften der gesamten Musik Mozarts, mit der Partitur von Beethovens Neunter Symphonie, den Schriften Alexander von Humboldts, der Varnhagen-Sammlung und vieles mehr. 1945 war bekannt, dass diese Kisten in einem Benediktiner-Kloster im oberschlesischen Grüssau gelagert waren. Dann verschwanden sie. Drei Jahrzehnte lang jagten Wissenschaftler kreuz und quer durch Mitteleuropa nach ihnen. (Die Geschichte dieser Jagd wurde spannend in Nigel Lewis’ Paperchase beschrieben.) Dann, in den frühen siebziger Jahren, sickerten erste Andeutungen über dieses letzte Geheimnis der Bibliothek durch. Die unbezahlbaren Bestände waren 1945 allem Anschein nach von der vorrückenden polnischen Armee aus dem deutschen Kloster fortgebracht worden — und die Polen hielten ihren Fund gut vor der Welt versteckt. Warum?
»Immerhin«, so Dr. Bernard Vesper, Generaldirektor der West-Berliner Staatsbibliothek, »wenn sie 1945 gesagt hätten, ›wir nehmen es uns als Wiedergutmachung für die schrecklichen Gräuel, die ihr Polen angetan habt‹, hätte kein aufrechter Mensch protestieren können.« (Eine Bemerkung, die man in Ost-Berlin nicht hören könnte — wo der Verwalter der Staatsbibliothek sich weigerte, überhaupt über dieses Thema zu sprechen.) Dr. Vesper vermutet, dass die Polen ihren Fund nicht so sehr vor dem Westen als vor der Sowjetunion geheim halten wollten — so, wie es ihnen auch sonst zur Gewohnheit wurde, nach den besten »Reparationen« selbst zu schnappen.
Was auch immer der Grund gewesen sein mag, jedenfalls war es erst 1977, als die Polnische Presse Agentur mit der ihr eigenen Aufrichtigkeit ankündigte, dass »die systematische und gewissenhafte Suche kürzlich von Erfolg gekrönt wurde«. Im Mai des Jahres flog Edward Gierek nach Ost-Berlin, um einen Freundschaftsvertrag zu unterzeichnen. Er brachte sieben Partituren aus der »kürzlich entdeckten« Sammlung mit, darunter Die Zauberflöte und Beethovens Neunte. »Alle Menschen werden Brüder«, war die Schlagzeile im Neuen Deutschland, als Gierek diese Meisterwerke des sozialistischen Humanismus »zurückgab«. Die Bibliothekare Unter den Linden vermaßen den Platz für den restlichen Schatz. Doch sie warten noch immer. Vielleicht hielten (halten?) die Polen ihn zum Austausch gegen polnische Nationalschätze zurück. Vielleicht liegt es aber auch nur an der dramatischen Verschlechterung der Beziehungen zwischen Polen und der DDR seit dem Entstehen von Solidarność. Jedenfalls steht der Rest aus den 505 Kisten mittlerweile den Lesern der Jagiellonischen Bibliothek in Krakau zur Verfügung, zur Freude auch vieler westlicher Wissenschaftler und zum stillen Zorn der Ost-Berliner Bibliothekare. Die Bundesrepublik hat Polen formell von ihrem Anspruch und Interesse an diesen preußischen Relikten in Kenntnis gesetzt. Jetzt könnte Polen die preußischen Erben gut gegeneinander ausspielen. Alle Menschen werden Brüder, fürwahr.
2
Der Papst in Polen
Dies ist eine analytische Reportage aus dem Jahr 1983 über den Papstbesuch in Polen, seinem zweiten.
Tschenstochau
Sie pilgerten von überall aus Polen in stillen Märschen durch die Nacht hierher. Jetzt sammeln sie sich auf der Wiese vor den ziegelroten Festungswällen des Klosters Jasna Góra. Zwischen den religiösen Insignien auf den flatternden Fahnen über ihren Köpfen ist überall das unverkennbare rote Buchstabengewirr von Solidarność zu sehen. Und nicht nur der Name der verbotenen Bewegung, sondern eine ganze Ansammlung von Variationen zum Thema: Das T des päpstlichen Mottos Totus Tuus bildet die polnische Fahne; »Ihr unterstützt die Studenten von Gdańsk« (»Studenten« in der Kalligraphie von Solidarność geschrieben); »Wir grüßen die Verteidiger der Menschenrechte«. Dies ist ein Treffen der Jugend aus der Solidarność-Generation, doch nirgendwo ist jene lockere, festliche Fröhlichkeit zu spüren, wie sie vor vier Jahren geherrscht hatte. Die Gesichter im kalten Wind sind angespannt und voller nervöser Erwartung.
Plötzlich ist er bei ihnen, hoch oben auf dem riesigen weiß-goldenen Podium, das vor den Klosterzinnen errichtet wurde. Minutenlang ertränken sie ihn in Wogen des Applauses. Wieder und wieder, einmal aus dieser und einmal aus jener Ecke, kommen ihre rhythmischen Rufe: »Lang lebe der Papst, lang lebe der Papst«; »Der Papst ist bei uns, der Papst ist bei uns«. Politische Schlachtrufe, keine religiösen Gesänge, Rhythmen, wie sie schon am ersten Abend des Besuchs zu hören waren, als Zehntausende von der Warschauer Kathedrale am Hauptsitz der Kommunistischen Partei vorbeimarschierten und riefen: »So-li-dar-ność, So-li-dar-ność«, »Lech-Wa-łę-sa, Lech-Wa-łę-sa«, »De-mo-kra-cja, De-mo-kra-cja«, »Un-ab-hän-gig-keit, Un-ab-hän-gig-keit …«
Endlich dringt seine Stimme durch die Lautsprecher: »Ich möchte euch fragen, ob eine gewisse Person, die heute aus Rom zu euch gekommen ist, zu euch sprechen darf.« »Nur zu, nur zu«, rufen sie. Und dann, »näher zu uns, näher zu uns« … »Hört ihr mich?«, antwortet er in den Tumult hinein. »Ich komme näher.« Und die weiße Figur kommt ihnen auf den roten Treppen entgegen. Ein Mönch mit einem Mikrophon in der Hand stolpert dem Papst hinterher. »Danke, danke«, brüllt die Menge. Und dann: »Stuhl für den Papst, Stuhl für den Papst.« Noch ein Mönch stolpert die Treppen hinunter. Als der Papst stehen bleibt, ist er noch immer fünfzig Meter vom nächststehenden Pilger entfernt. Doch mit dieser einzigen theatralischen Geste ist er ihnen nähergekommen. Zum ersten Mal während dieses Besuches hat er, wie schon vor vier Jahren, jenen magischen, spontanen Kontakt mit der unüberschaubaren Menge hergestellt. Er spricht zu ihnen. Sie sprechen zu ihm.
Und dann ist die Menge auf einmal ehrfurchtsvoll still, eine halbe Million Menschen lauscht mit einer solchen Aufmerksamkeit, dass man das Klicken eines Rosenkranzes hören könnte. Er hält eine große, schlichte und moralische Predigt, keine politische Rede. Er predigt Liebe, die »größer als all die Erfahrungen und Enttäuschungen ist, die das Leben für uns bereithalten kann«. Er zeigt ihnen, dass er ihre Enttäuschungen kennt und teilt, ohne dass er das Kriegsrecht direkt ansprechen muss. Er sagt ihnen, sie müssten mit der Reformation ihrer selbst beginnen, die jeder sozialen oder politischen Reform vorangehen muss; auf ihr Gewissen hören; »Gut und Böse beim Namen nennen«. »Es liegt an euch«, sagt er, »eine feste Barriere gegen die Demoralisierung aufzurichten.« Dann, und erst dann erwähnt er zum ersten Mal das Wort Solidarność. Er lässt es leise in die schweigende Menge einsickern. Nicht über Solidarität, die verbotene Bewegung, spricht er, sondern über »die grundlegende Solidarität zwischen Menschen«.
Natürlich folgt sofort stürmischer Applaus. Aber es ist nicht mehr das heftige Tosen wie noch vor einer Stunde. Es klingt freundlicher, erwachsener. »Es wäre schwierig«, fährt er fort, »all die Ängste hier aufzuzählen, die jene und ihre Familien umgeben, die interniert, gefangen und von ihren Arbeitsplätzen entlassen wurden. Ihr kennt sie besser als ich. Ich erhalte nur sporadische Nachrichten darüber …« Schließlich, als richte er sich direkt an die Ikone der Schwarzen Madonna im Kloster hinter ihm, appelliert er: »Mutter von Jasna Góra, du, die du uns durch die Vorsehung zur Verteidigung der polnischen Nation gegeben wurdest, nimm diesen Ruf der polnischen Jugend gemeinsam mit der polnischen Hoffnung an, und hilf uns, die Hoffnung zu bewahren.«
Während er langsam vom Podium schreitet, nach links und rechts winkend, schicken sie ihm noch eine letzte emotionale Botschaft: »Bleib bei uns, bleib bei uns, bleib bei uns …«
Am späteren Abend demonstriert eine kleinere Solidarność-Gruppe in der Stadtmitte, doch die riesige Menge hat sich friedlich zerstreut. Er hat die Katharsis vollbracht, hat Sturmböen in Hymnen verwandelt. Doch vielleicht hat er ihnen auch einen »Ausweg« gewiesen, einen Ausweg aus Umständen, aus denen viele keinen Ausweg mehr zu erkennen glaubten.
Krakau
»Bleib bei uns, bleib bei uns«, rufen auch hier die unüberschaubaren, freundlichen Massen in stürmischer Liebe. Und jede einzelne Geste des Papstes wirkt, als wollte er sagen: Wenn ich nur könnte, wenn ich nur könnte. Das Flugzeug, das sich vergangenen Donnerstagnachmittag über die Wiesen seines geliebten Krakaus erhob, brachte einen sehr heimwehgeplagten Mann nach Rom zurück. Aber es ließ eine Gesellschaft im festen Glauben daran zurück, dass diese zweite große Pilgerreise des Karol Wojtyła in sein Heimatland, von der er engen Freunden gegenüber zuvor als der schwierigsten seiner Reisen (Nicaragua eingeschlossen) gesprochen hatte, ein Triumph gewesen war.
Die Berichte der westlichen Presse haben bewiesen, dass seine Aussagen ausländischen Zeitungslesern nicht vermittelbar sind. Es ist unmöglich, denn er spricht zu den Polen in einer Sprache aus historischen, literarischen, philosophischen und mariologischen Symbolen und Anspielungen, die alle ein ganzes Kapitel an Erklärungen erfordern würden. Es ist unmöglich, weil so vieles von jener Theatralik des Vortrags abhängt, die John Gielgud einmal »perfekt« nannte. Es ist unmöglich, denn die Poesie ist es, die in einer Übersetzung verloren geht.
Aber versuchen wir das Unmögliche. Beginnen wir mit dem, was der Papst nicht gesagt hat. In scharfem Kontrast zu seinem letzten Besuch sagte er nichts über eines der Leitmotive seines Pontifikats: über die Zukunft der Kirchen in Osteuropa und die besondere Mission des slawischen Papstes, die Einheit des christlichen Europas vom Atlantik bis zum Ural einzufordern. Das war die große Konzession des Vatikans an Moskau. Andererseits aber hat er der sowjetischen Presse auch keine Geschenke gemacht, obwohl er viel zum Thema Frieden gesagt hat. In seiner einzigen Stellungnahme zur atomaren Abrüstung erinnerte er an ein Memorandum der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften über die Folgen eines Atomkriegs, das sowohl an die Sowjetunion wie an die Vereinigten Staaten geschickt worden war. Alles in allem aber predigte er diesmal als Pole den Polen über Polen.
Was er dem polnischen Volk vor allem mitteilte, war, wie sehr er ihre Enttäuschungen und Leiden durch das Kriegsrecht teilt. Er zeigte es ihnen durch sein gebeugtes Haupt und seine schwermütige Miene von dem Augenblick an, an dem er die Rollbahn des Warschauer Flughafens betrat. »Er ist traurig«, sagte die alte Frau neben mir. »Sehen Sie, er versteht.« Er zeigte es ihnen in seiner ersten Predigt in der St. Johannes-Kathedrale in Warschau: »Gemeinsam mit all meinen Landsleuten — besonders mit denen, die die Bitternis der Enttäuschung am schlimmsten erleiden müssen, die erniedrigt werden, die leiden, die ihrer Freiheit beraubt sind, die verleumdet werden, deren Würde mit Füßen getreten wird — stehe ich unter dem Kreuze Christi …« Und er zeigte es ihnen, als er vom »Primas des Millenniums« sprach, von Kardinal Stefan Wyszyński: »Göttliche Vorsehung ersparte ihm die schmerzlichen Vorkommnisse, die mit dem Datum des 13. Dezember 1981 verbunden sind.« Zehntausende, die sich in den Straßen der Altstadt um die Kathedrale herum versammelt hatten, applaudierten. Bislang haben die Zensoren diesen Satz überall gestrichen, selbst in der nur wenig verbreiteten katholischen Presse. Aber jeder hat ihn gehört.
Sein großes Thema aber war der Sieg. Diese politische Niederlage, rief er sie auf, müsse in einen moralischen Sieg verwandelt werden. Ein Sieg, der auch ein innerlich-geistiger sein müsse: »Der Mensch ist zum Sieg über sich selbst aufgerufen«, zum Sieg des Martyriums, zum Sieg des Kreuzes. »Es sind die Heiligen und die Geschlagenen«, erklärte er