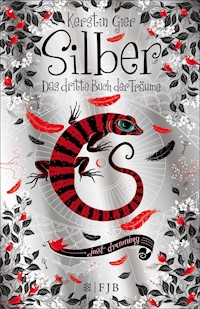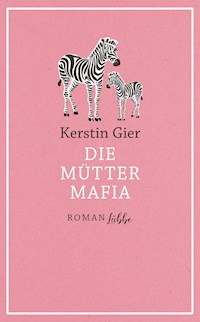Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Sehr ärgerlich: Seine Söhne haben die dreißig schon überschritten, aber immer noch ist kein Enkelkind in Sicht. Fritz, verwitwet, tyrannisch und außerordentlich geizig, ist eine Plage für die Schwiegertöchter. Und dann scheint der alte Herr völlig verrückt geworden: Damit die Söhne endlich begreifen, was sie an ihren Frauen haben und wie gut sie zueinander passen, sollen sie ein halbes Jahr die Partner tauschen. Die verträumte Olivia zieht einfach mal zu Bastian ins schicke Stadtappartment, die ehrgeizige Conny zu Stephan in die alte Gärtnerei. Damit alle bei diesem absurden Spiel mitmachen, winkt Fritz mit Geld. Mit viel Geld ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:4 Std. 27 min
Sprecher:Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Kerstin Gier, Jahrgang 1966, lebt mit ihrer Familie in einem Dorf in der Nähe von Bergisch Gladbach. Sie schreibt mit großem Erfolg Romane. Ihr Erstling MÄNNER UND ANDERE KATASTROPHEN wurde mit Heike Makatsch in der Hauptrolle verfilmt. EIN UNMORALISCHES SONDERANGEBOT wurde 2005 mit der „DeLiA“ für den besten deutschsprachigen Liebesroman ausgezeichnet. FÜR JEDE LÖSUNG EIN PROBLEM wurde ein Bestseller und mit enthusiastischen Kritiken bedacht.
www.kerstingier.com
K e r s t i n G i e r
EIN
UNMORALISCHES
SONDERANGEBOT
Roman
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Für die Originalausgabe
Copyright © 2004/2023 by Kerstin Gier undBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Covergestaltung: Kristin Pang unter Verwendung von Motiven von © shutterstock.com (Piyapong89; Romanova Ekaterina)
E-Book-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-0068-7
luebbe.de
lesejury.de
Für Michaela
Einen Mann zu heiraten ist wie etwas zu kaufen, das man seit langem in einem Schaufenster bewundert hat. Vielleicht magst du es sehr, wenn du es nach Hause bringst, aber es passt nicht unbedingt zu allem anderen.
Jean Kerr
Prolog
Die milchige Flüssigkeit im Standmixer schimmerte hellrot im Licht der Kerzen, als Gernod Scherer – seines Zeichens Bankdirektor a. D. – sie in vier Gläser umfüllte. Dabei murmelte er, wie es das Ritual erforderte: »Männer, das ist das Blut, das uns unsterblich macht.«
Doktor Peter Berner, der pensionierte Chefarzt einer renommierten Privatklinik, seufzte, als er sein Glas entgegennahm. »Unsterblich! Schön wär’s ja. Aber geht es nicht etwas weniger pathetisch? Zum Beispiel einfach: Das ist der Tomatensaft, der uns gesund erhält?«
»Wie würde das klingen!«, sagte Scherer empört. »Das wäre wohl kaum einer Geheimloge würdig. Außerdem ist da mehr drin als nur Tomatensaft. Aloe-vera-Frischpflanzensaft, Eiweißpulver, Vitamin C und E …«
»… und Wodka«, ergänzte Fritz Gaertner, der mit seiner stattlichen Körpergröße von einem Meter fünfundachtzig und dem vollen, schneeweißen Haar die beeindruckendste Erscheinung unter den alten Herren darstellte. Die letzten zwanzig Jahre bis zu seiner Pensionierung hatte er einen namhaften Automobilkonzern geleitet. »Der Wodka ist noch das Beste daran, wenn ihr mich fragt.«
»Das Blut, das uns unsterblich macht«, wiederholte Hubert Rückert, ehemaliger Rektor des Johannes-Gutenberg-Gymnasiums und Erbe der berühmten Rückert-Millionen. »Wenn ich es nur oft genug höre, dann glaube ich auch daran.«
Doktor Berner seufzte wieder. »Die Gesundheit ist wohl das Einzige, das man für Geld nicht kaufen kann«, sagte er und trank seinen Tomatenshake mit Todesverachtung aus. »Und natürlich Glück und Liebe. Und – wohl am wenigsten – das Glück unserer Kinder.«
Scherer brummte amüsiert. »Du wirst deiner Tochter wohl den Rest deines Lebens übel nehmen, dass sie einen Metzger geheiratet hat!«
»Das kannst du mir glauben!« Doktor Berner goss sich Wodka nach und nahm einen langen Zug. »Da hat das Mädchen Medizin studiert, und ich hatte für sie schon eine wunderbare Stelle gefunden, und was macht sie? Sie heiratet jemanden, der mit beiden Armen in Tiergedärmen herumwühlt, und will fortan nur noch an seiner Fleischtheke arbeiten. Was, bitte, nutzt mir hier mein ganzes Geld? Jedes Mal, wenn ich sie sehe, bricht sie mir das Herz mit ihrem: Darf’s noch ein bisschen mehr sein, Papa?«
Fritz Gaertner lachte. »Ich bin sicher, wenn du nur genug hinblätterst, würde sie ihre Leberwurst sausen lassen.«
»Niemals.« Doktor Berner schüttelte überzeugt den Kopf. »Sie ist so stur, und sie schert sich einen Dreck um Geld, wirklich. Ich bin’s aber auch selber schuld: Ich habe sie ein Leben lang Bescheidenheit gelehrt. Und den Sturkopf hat sie von mir geerbt.«
»Vielleicht müsstet du einfach dem Schwiegersohn das Geld anbieten«, schlug Rückert vor. »Damit er deine Tochter aus seiner Metzgerei wirft.«
»Nein, nein, das würde nicht funktionieren«, sagte Doktor Berner. »Die Kinder machen doch immer nur, was sie wollen. Ich bleibe dabei: Seine Kinder kann man nicht mit Geld kaufen.«
»Meine schon«, sagte Fritz Gaertner mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Aber dafür war mir mein Geld immer zu schade. Sonst hätte ich wohl verhindert, dass meine Söhne so alberne Berufe ergreifen, sich bis über beide Ohren verschulden und die falschen Frauen heiraten.«
»Ich weiß gar nicht, was du hast. Stephans Frau, das Lockenköpfchen, ist doch ganz entzückend«, sagte Scherer. »Ich habe erst heute meine Balkonbepflanzung bei ihr in Auftrag gegeben, und ich finde, sie hat ein wirklich bezauberndes Lächeln.«
»Aber sie ist nicht die richtige Frau für Stephan«, sagte Fritz. »Die beiden sind so verschieden wie Tag und Nacht. Und obwohl sie schon seit zehn Jahren verheiratet sind, gibt es immer noch keinen Nachwuchs. Ebenso wenig wie bei meinem Ältesten. Ich frage mich manchmal, ob die jungen Leute von heute überhaupt wissen, wie man das macht: Nachwuchs zeugen!«
»Wenn du unbedingt Enkelkinder von deinen Söhnen willst, dann versuch doch mal, dir welche von ihnen zu erkaufen«, schlug Doktor Berner augenzwinkernd vor.
»Das wäre kein Problem«, sagte Fritz ungerührt. »Für Geld würden die alles tun. Aber ehrlich gesagt ist mir mein Geld dafür zu schade. Ich war immer der Ansicht, dass ich mich nicht krumm gelegt habe, damit meine Kinder das Geld zum Fenster hinausschmeißen. Außerdem sollten sie ihre eigenen Erfahrungen sammeln – auch schlechte. Kurzum, mein Geiz hat verhindert, dass meine Söhne das tun, was mir gefällt. Natürlich ist es nicht nur eine Frage des Geizes, sondern sozusagen ein Erziehungskonzept. Aber es hat gründlich versagt, wie man sieht.«
»Blödsinn«, widersprach Berner. »Das sagst du nur, weil du genau weißt, dass deine Söhne sich genauso wenig kaufen lassen wie meine Tochter.«
»Blödsinn? Weißt du, was die für Schulden haben? Die würden sofort nackt Straßenbahn fahren, wenn ich ihnen dafür was zahlte.«
Berner beugte sich interessiert vor. »Na ja, so viel gehört da nicht dazu in heutigen Zeiten. Aber würden sie auch etwas wirklich Verrücktes tun?«
»Alles«, sagte Fritz überzeugt. »Wenn ich nur genug zahle.«
»Niemals«, hielt Berner dagegen. »Du bist größenwahnsinnig, wenn du das glaubst.«
»Wollen wir wetten?«, fragte Fritz und beugte sich ebenfalls vor. Man merkte dem alten Herrn an, dass er an der Diskussion Spaß zu finden begann. »So komme ich wenigstens billiger dabei weg, wenn ich endlich mal in meine Kinder investiere.«
»Oh ja, eine richtige Wette«, freute sich auch Scherer. »Eine geheime, interne Wette, exclusiv für unsere Loge. Wir bieten alle mit. Wo es mit den Aktien doch jetzt keinen richtigen Spaß mehr macht …«
»Kinder sind nicht käuflich. Ich setze auf den Doktor«, sagte Rückert. »Vorausgesetzt, es fällt uns etwas richtig Verrücktes ein.«
»Tja, Fritz, die Wette wirst du wohl verlieren.« Berner streckte die Hand aus. »Ich habe da nämlich schon eine Idee, bei der deine Kinder keinesfalls mitmachen, nicht mal für eine Million …«
Fritz nahm Berners Hand und schüttelte sie förmlich. »Das wollen wir doch mal sehen«, sagte er. »Ich habe bisher noch nie eine Wette verloren.«
»Ich setze auf den alten Fritz«, sagte Scherer. »Unterschätze nie die Magie des Geldes …«
Und dann steckten die vier alten Männer die Köpfe zusammen, um sich etwas wirklich Verrücktes auszudenken.
1. Kapitel
Es war wie jeden Sonntag: Ich stand nackt vor meinem Kleiderschrank und wusste nicht, was ich anziehen sollte. Nicht, dass der Schrank leer gewesen wäre, aber alle in Frage kommenden Klamotten waren offensichtlich gerade in der Wäsche – wie immer. Es gibt wohl Dinge, die lernt man nie, egal, wie alt man wird.
Im Spiegel auf der Innenseite der Schranktür betrachtete ich missmutig mein Gesicht. Im Großen und Ganzen sah ich mit dreiundreißig nicht anders aus als mit dreiundzwanzig. Aber diese drei Querfalten auf meiner Stirn, die waren vor zehn Jahren noch nicht da gewesen. Wahrscheinlich hatte ich sie beim Grübeln vor diesem Kleiderschrank bekommen. Diese ewige Kleiderfrage war aber auch wirklich zum Stirnrunzeln. Ich musste mir unbedingt eine Antifaltencreme zulegen. Allerdings würde die Anschaffung einer Antifaltencreme, die wirklich gegen Falten half, uns endgültig in den finanziellen Ruin treiben. Von neuen Klamotten ganz zu schweigen.
»Olli!«, brüllte Stephan von unten. »Beeil dich gefälligst ein bisschen.«
»Ich habe aber nichts zum Anziehen«, brüllte ich zurück. Vor lauter Schreck bröselte der Putz von der Decke. Ich registrierte es mit einem Achselzucken. Machte nichts. Alles was von allein hinunterfiel, brauchte nicht mühsam abgeschlagen zu werden. Allerdings war es, wenn man es genau nahm, ein Wunder, dass überhaupt noch etwas an der Decke klebte, denn in diesem Haus bröselte der Putz ungefähr schon seit 1950, was in etwa auch das Jahr war, in dem es erbaut wurde. Es war das einzige Haus, das ich je gesehen hatte, das sozusagen übergangslos vom Rohbauzustand in den Ruinenzustand gewechselt hatte. Dabei war es – kaum zu glauben – die ganze Zeit über bewohnt gewesen. Und niemand der Bewohner hatte auch nur irgendetwas annähernd Geschmackvolles in diesem Haus hinterlassen. Neben den diversen Gebäudeschäden gab es eine Vielzahl grell gemusterter Fliesen (überwiegend osterglockengelb und jägergrün), Tapeten (überwiegend großgeblümt) und PVC-Verkleidungen (überwiegend dunkelbraunes Eichenimitat) zu bestaunen. Die Räume waren allesamt so scheußlich, dass man sich nicht einmal an den Anblick gewöhnen konnte, sondern sich jeden Morgen aufs Neue wunderte und schüttelte.
Es gab so viel zu tun, dass man gar nicht wusste, wo man mit der Renovierung eigentlich anfangen sollte. Das war vielleicht der Grund dafür, dass wir noch nicht damit angefangen hatten. Aber der eigentliche Grund war natürlich, dass wir absolut und vollkommen pleite waren.
Das ganze Haus erinnerte mich fatal an den Marmorkuchen, den meine Schwiegermutter immer gebacken hatte. Sehr, sehr krümelig und leider absolut geschmacklos. Man hatte ihn nur mit viel Kaffee herunterspülen können, diesen Marmorkuchen. Manchmal vermisste ich ihn irgendwie trotzdem. Seit meine Schwiegermutter gestorben war, kaufte mein Schwiegervater nämlich den Kuchen immer beim Konditor. Sahnetorte vom Vorvortag gab es dort zum halben Preis. Mein Schwiegervater kaufte nur Sonderangebote, da war er konsequent. Dabei hatte er es im Gegensatz zu uns wirklich nicht nötig zu sparen, der alte Geizkragen.
»Olli?! Bist du vor dem Kleiderschrank eingeschlafen?«, schrie Stephan von unten.
»Ich suche nur was zum Anziehen«, wiederholte ich. Bröckel, bröckel.
»Herrgott, das ist nur ein Frühstück mit der Familie, kein Galadinner«, rief Stephan. »Zieh einfach irgendwas an!«
Das war leichter gesagt als getan. Ich gab mir wirklich Mühe, etwas zu finden, aber es war nun mal zu warm für den braunen Wollpullover mit Fellkragen und zu kalt für das himbeerfarbene Spaghettiträgerkleid. In grauen Jogginghosen konnte ich wohl ebenso wenig bei meinem Schwiegervater auftauchen wie in meinem perlenbestickten Brautkleid, das samt Reifrock unter einer Plastikhülle hing und mich irgendwie melancholisch stimmte. Der Rest der Klamotten gehörte in die Altkleidersammlung oder in die Karnevalskiste. Ich beschloss, mich in allernächster Zukunft ans Aussortieren zu machen. Am besten gleich morgen früh. Die Zeit, die ich vor dem Kleiderschrank verbrachte, konnte ich doch viel besser nutzen – zum Beispiel, um eine Fremdsprache zu lernen. Ich versuchte nachzurechnen, wie weit ich mittlerweile gekommen wäre, wenn ich, statt vor dem Kleiderschrank herumzustehen, Italienisch-Vokabeln gelernt hätte. Incredibile!
»Olli!«, schrie Stephan von unten. »Ich zähle jetzt bis zehn, und wenn du bis dahin deinen Hintern nicht zum Auto bewegt hast, reiche ich gleich morgen die Scheidung ein. Eins …«
Meine Frau findet nie was zum Anziehen – war das ein zugelassener Scheidungsgrund? »Komm doch hoch, und sieh selbst nach, wenn du mir nicht glaubst!«
»Drei, vier …«
Ich öffnete hektisch die Kommodenschublade, um wenigstens schon mal die Unterwäsche anzuziehen. Da war mein schwarzes Lieblingshöschen, aber wo war der dazu passende BH?
»Fünf, sechs …«
»Nicht so schnell!«
»Sieben, acht – ich mein’s ernst, Olli. Wenn ich die Zeit, die ich auf dich gewartet habe, zusammenrechne, dann sind das bestimmt Jahre meines Lebens! Du bist so was von lahmarschig, das hält kein Mensch aus!«
Lahmarschig! So etwas durfte man mir aber nicht ungestraft nachsagen. Ich zerrte ein Oberteil und eine Jeans aus dem Schrank und schlüpfte in Rekordzeit hinein. Wenn es irgendetwas gab, was ich nicht war, dann lahmarschig!
»Neuneinhalb, zehn!«, rief Stephan, als ich die Treppe heruntergerast kam und triumphierend vor ihm stehen blieb.
»Ich bin nicht lahmarschig«, keuchte ich, während ich mir mit einiger Mühe die Hose zuknöpfte. »Nimm es also zurück.«
Stephan sah mich mit offenem Mund an. Aber selbst wenn er so blöd guckte wie jetzt, war er immer noch der allerschönste Mann auf Erden. Mit seinen blonden, kurz geschnittenen Locken und der leicht gebräunten Haut sah er aus wie ein Brad-Pitt-Double. Und da war dieses gewisse Etwas in seinem Blick und in jeder seiner Gesten, das ihn einfach unwiderstehlich machte. Es gab nicht ein einziges Mädchen im ganzen Kreisgebiet, das nicht irgendwann mal scharf auf ihn gewesen wäre. Und erst die Mädchen an der Uni! Er hätte wirklich jede haben können. (Und soviel ich wusste, hatte er wohl nur wenige Angebote ausgeschlagen. Aber das war vor meiner Zeit.) Ich war immer noch beinahe täglich erstaunt und dankbar darüber, dass er ausgerechnet mich geheiratet hatte. Mich, die kleine, unspektakuläre Olivia, die nicht mal ihren Kleiderschrank in Ordnung halten konnte. Ich hatte noch nie etwas im Leben so sehr gewollt wie diesen Mann. Den Rat meiner Pflegemutter – »Von einem schönen Teller isst man nicht« – hatte ich bedenkenlos in den Wind geschlagen. Es war nur eine Schande, dass ich so wenig Ähnlichkeit mit Jennifer Aniston hatte. Ich sah mehr aus wie – nun, wenn ich’s mir recht überlegte, sah ich keiner berühmten Persönlichkeit irgendwie ähnlich. Es gab allerdings Tage, an denen ich aussah wie ein Blumenkohl. Das lag an meinen hellblonden Naturlocken, um die mich eigenartigerweise manche Menschen beneideten.
»Herrgott, willst du wirklich so gehen?«, fragte Stephan.
»Du hast es ja nicht anders gewollt.« Ich zog mir meine Schuhe an. »Von mir aus können wir los!«
»Mir soll’s egal sein. Du bist diejenige, die sich blamiert, nicht ich.« Stephan wandte sich kopfschüttelnd ab und suchte nach seinem Autoschlüssel. Er war wie immer tadellos gekleidet, in Jeans und Polo-Shirt, beides mit prestigeträchtigen Labels versehen. Stephan ließ sich sein gutes Aussehen gerne etwas kosten. Mit einem bisschen guten Willen und dem Geld, das er für seine Schuhe hingeblättert hatte, hätte man vermutlich das Schlafzimmer renovieren können. Wobei ich fairerweise hinzufügen muss, dass er sich in den anderthalb Jahren, in denen wir die Ruine bewohnten, genauso wenig neue Schuhe gekauft hatte wie ich. Wovon auch? »Wo ist der verdammte Schlüssel?«
»Ha, ha, du Lahmarsch«, sagte ich. »Ich zähle bis zehn, und wenn du bis dahin die Schlüssel nicht gefunden hast, reiche ich morgen früh die Scheidung ein …«
Später im Auto tat es mir Leid, dass ich mich so hatte hetzen lassen. Ich konnte mir jetzt schon die befremdeten Blicke meiner Schwägerinnen vorstellen, die eine wie immer von Kopf bis Fuß in gebügeltem Pastell, die andere in Designerschwarz. Ich war ganz sicher die Einzige, die sich in eine viel zu enge Jeans gequetscht hatte und ein ebenso enges T-Shirt mit der Aufschrift: »Ich bin dreißig – bitte helfen Sie mir über die Straße« trug.
Nun ja, aber dafür war ich erwiesenermaßen kein Lahmarsch.
2. Kapitel
Im Gegensatz zu unserem Haus war das Haus meines Schwiegervaters in allerbestem Zustand. Es war eine rosafarbene Villa, in allerschönstem Zuckerbäckerstil, mit viel Stuck, Erkern, Rundbogenfenstern, Türmchen und – als Krönung – zwei dicken, verschmitzt grinsenden Engelchen über dem Eingangsportal. Die Villa war nicht antik, sondern in den Sechzigerjahren für den hiesigen Sparkassendirektor erbaut worden, der, wie sich später herausstellte, das Geld für den Prachtbau hinterzogen hatte. Statt ins Gefängnis war der Direktor aber nur für ein paar Jahre in die Psychiatrie gewandert, was meinen Schwiegervater nicht weiter verwunderte. »Dass der Mann vollkommen irre war, sieht man ja an dem Irrenhaus«, pflegte er zu sagen. Meine Schwiegermutter hatte auf dem Erwerb des irren Hauses bestanden, als es zur Versteigerung anstand, und es war eine der wenigen Angelegenheiten, in denen sie ihre Wünsche durchgesetzt hatte. Irre hin, irre her, es war ein wunderbares Haus, um eine Schar Kinder darin großzuziehen und eine Menge Gäste zu empfangen. Mein Schwiegervater konnte es nicht ausstehen, er nannte es »diese grässliche geschmacklose Marzipanhochzeitstorte, in der ich gezwungen bin zu hausen«. Aus irgendeinem Grund behielt er die Hochzeitstorte aber, obwohl sie für ihn allein viel zu groß war und ihre Instandhaltung weit mehr kostete, als der alte Geizkragen eigentlich zu zahlen bereit war.
Wie jeden Sonntag war Stephans gesamte Familie vollzählig angetreten. Stephans jüngere Schwester Katinka (in Pastellrosa, passend zum Außenputz) arrangierte in der Küche Aufschnitt auf einem Teller, während ihre Kinder versuchten, meinen Schwiegervater zu erklettern, der wie ein Eisberg auf seinem Lieblingssessel saß und die Sonntagszeitung las. Die Kinder hießen Till, Lea und Jan, was eigentlich knapp und einprägsam war, aber mein Schwiegervater nannte sie trotzdem nie anders als »Dings, »Dings« und »Dings«, wenn er sie denn überhaupt nannte.
Wie immer ignorierte er seinen Besuch so lange wie möglich. Außer zu seiner Familie pflegte er nur noch Kontakt zu einer Hand voll Herren seines Alters, die Stephan den »Club der scheintoten Geizhälse« nannte. Ich vermutete, dass sie zusammen Doppelkopf spielten, Asbach Uralt tranken und sich gegenseitig mit den vielen, vielen Nullen ihres Gesamtvermögens beeindruckten. Aber Stephan meinte, dass sich die ehemaligen Direktoren, Chefärzte und Firmenbosse zu konspirativen Treffs zusammenfanden, bei denen sie über Mittel und Wege nachsannen, die Langeweile des Pensionsalters zu überbrücken, am liebsten, ohne Geld auszugeben.
»Es fehlt ihnen einfach, dass sie nun keine Leute mehr herumkommandieren und schubsen können«, sagte er. »Besonders meinem Vater.«
»Aber dafür hat er doch uns«, sagte ich.
»Uns hat er doch auch vorher schon herumgeschubst«, meinte Stephan da. Das stimmte allerdings. Der Mann war der geborene Herumschubser. Und im Beleidigen war er auch sehr gut. Eigentlich hat er nur ein einziges Mal etwas Nettes zu mir gesagt, und auch das war im Grunde noch beleidigend gewesen. Am Tag meiner Hochzeit hatte er mir mit einem ziemlich grimmigen Lächeln links und rechts einen Kuss auf die Wangen geknallt und dabei gesagt: »Nun, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, kann dich wohl auch in unserer Familie willkommen heißen. Meine liebe, äh, Dings, äh, Schwiegertochter, äh, Olga, auch, wenn du nicht die richtige Frau für Stephan bist, kann ich ihn irgendwie verstehen: Du hast wirklich beeindruckend viel Holz vor der Hütten. Und soweit ich das so erkennen kann« – hier hatte er etwas glasig in mein Dekolleté gestarrt – »ist es kolossal gut abgelagert, beste Qualität, eins a gestapelt.«
»Ich wusste gar nicht, dass du so ein Brennholzexperte bist, Fritz«, hatte ich verunsichert geantwortet. »Aber ich heiße Olivia, nicht Olga.«
»Namen kann ich mir grundsätzlich nicht merken«, hatte Fritz nur erwidert, und soweit ich mich erinnerte, hatte er mich seither auch nur »Schwiegertochter« genannt. Oder »Dings«. Im Grunde musste ich noch dankbar sein, dass er seine Meinung über mein Holz vor der Hütten nicht in seiner Rede an die Festgemeinde untergebracht hatte. Das wäre für uns beide wohl gleichermaßen peinlich gewesen.
Seither hatten wir glücklicherweise nie wieder über Brennholz gesprochen. Und Komplimente hat er mir auch keine mehr gemacht.
»Hallo, Fritz«, sagte ich zu ihm. Ich erwartete keine Antwort, da er den Gruß gewohnheitsgemäß nie erwiderte. Erst bei Tisch pflegte er mit uns zu reden, und das war auch früh genug, wenn man mich fragte.
Die Kinder aber ließen sich von seiner starren Miene nicht beirren.
»Opa, Opa, liest du uns eine Geschichte vor?«
»Opa, willst du nicht endlich mal das Bild sehen, das ich dir gemalt habe?«
»Opa, hoppe, hoppe Reiter machen.«
»Runter hier«, knurrte Fritz. »Und Pfoten weg von der Zeitung. Die muss ich teuer bezahlen.«
Katinka strahlte uns an. »Ist das nicht süß? Der Opa mit seinen drei Enkelchen. Ich hab erst gestern wieder mal gelesen, dass Kinder wissenschaftlich gesehen ein richtiger Jungbrunnen sind.«
»Ja, ja, vor allem für die Mütter, die jahrelang keinen Schlaf bekommen«, murmelte ich. »Von all den anderen Entbehrungen ganz zu schweigen.«
»Na, du weißt doch gar nicht, wovon du sprichst, Olivia!«
Es war also wieder mal so weit. Katinka hätte so nett sein können, wenn sie nicht ständig das Gespräch auf Kinder im Allgemeinen und unsere Kinderlosigkeit im Besonderen gebracht hätte. Ich warf einen Hilfe suchenden Blick zu Stephan hinüber, aber der war mit den Kindern beschäftigt, die von ihrem Opa abgelassen hatten und sich stattdessen auf ihren Onkel stürzten.
»Ich sag ja nicht, dass es nicht anstrengend ist, Kinder großzuziehen«, sagte Katinka. »Aber dafür bekommt man auch alles tausendfach zurück. An eurer Stelle würde ich mir das nicht entgehen lassen.« Hier machte sie eine bedeutungsschwangere Pause, bei der ihr Blick vielsagend auf meiner »Ich bin dreißig, bitte helfen Sie mir über die Straße«-Brust verweilte. »Beeilt euch lieber, bevor es zu spät ist. Ach, und wir haben übrigens eine Überraschung für euch.«
Katinka waren alle Frauen über dreißig, die sich nicht der Brutpflege widmeten, suspekt. Irgendwas stimmte mit unseren Hormonen nicht. Und dann war da noch der gesellschaftlich-soziale Aspekt: Sollten etwa Katinkas Kinder für unsere Rente aufkommen? Das fand Katinka nicht gerecht.
Ich konnte mir schon denken, was die Überraschung war (nicht umsonst war Stephans Spitzname für sie »Der Schnelle Brüter«), und flüchtete in den Wintergarten, bevor sie damit herausplatzen konnte.
Der Frühstückstisch war stets im Wintergarten gedeckt, egal, ob Winter oder Sommer. Stephans großer Bruder Oliver und seine Frau Evelyn saßen dort bereits mit Eberhard, Katinkas Mann. Eberhard war eine echte Landplage. Es war mir ein Rätsel, was Katinka jemals an ihm gefunden hatte oder gar noch fand. Während sie sich nach jeder Schwangerschaft wieder in Größe 38 zurückhungerte, hatte er mit jedem Kind etwas Bauch und ein Kinn dazubekommen, aber komischerweise war sein unerschütterliches Selbstwertgefühl mit jedem Kilo noch gewachsen. »Frauen müssen auf ihre Figur achten, Männer müssen nur auf ihre Frauen achten«, pflegte er zu sagen und dabei sein merkwürdiges, keckerndes Lachen hören zu lassen.
»Alle schon versammelt für den sonntäglichen Untergang der Titanic?«, sagte ich zur Begrüßung, aber nur Oliver sah zu mir hin, die beiden anderen waren schon in den ersten sonntäglichen Disput verwickelt.
»Hallo, Blumenköhlchen«, sagte Oliver.
»Hallo, alter Blumenkohl«, sagte ich.
Das war ein bisschen albern, aber so lauteten nun einmal unsere Spitznamen füreinander, weil wir dasselbe Haarproblem hatten. Oliver sah nicht so spektakulär gut aus wie Stephan. Seine Augen waren nicht so blau, sein Lächeln nicht so umwerfend charmant und seine Haare nicht so blond wie Stephans. Dafür kräuselten sie sich noch stärker als meine, so stark, dass Oliver sie nur streichholzkurz tragen konnte, wenn er nicht aussehen wollte wie ein Blumenkohl, der die Nacht mit den Fingern in der Steckdose geschlafen hatte. Außerdem war er zu schlaksig und zu groß, um an Stephan und Brad Pitt heranreichen zu können. Dafür war allerdings seine Frau Evelyn – so ungerecht geht es in der Welt zu! – eindeutig ein Jennifer-Aniston-Typ, nur dass sie nicht so sympathisch lachen konnte. Genau gesagt konnte Evelyn vermutlich überhaupt nicht lachen. Man sah sie jedenfalls höchstens lächeln, und auch das noch ziemlich säuerlich. Allerdings tat das ihrer Schönheit keinen Abbruch. Sie war in irgendwas Schickes, Schwarzes, sicher sehr Teures gehüllt und machte ein Gesicht, als ob sie schlimme Zahnschmerzen hätte. Vielleicht lag es an Eberhard, vielleicht aber auch daran, dass sie wirklich Zahnschmerzen hatte.
Oliver musterte interessiert meinen Busen. »Was, bist du tatsächlich schon dreißig, Blumenköhlchen?«
Ich nickte betreten.
»Und zwar schon ein paar Jahre, nach der Staubkante im T-Shirt zu urteilen«, sagte Evelyn spitz.
»Oha«, grunzte Eberhard und starrte mit amüsiert-überheblichem Gesichtsausdruck auf die Staubkante. So was gab’s natürlich zu Hause bei Katinka nicht. »Nicht schlecht, Herr Specht. Du lieber Herr Gesangverein.«
Ich wusste nie so recht, was ich auf Eberhards merkwürdige Floskeln antworten sollte. »Ich hab’s noch nie getragen, weil’s so klein ist«, sagte ich, weil ich mir plötzlich nicht mehr sicher war, wer mir das blöde T-Shirt damals eigentlich zum Geburtstag geschenkt hatte. Am Ende möglicherweise Eberhard und Katinka? Ich war versucht hinzuzufügen, dass ich nicht etwa dicker geworden war, sondern dass weder das T-Shirt noch die Jeans je gepasst haben. Ja, ich wage sogar zu behaupten, dass sie eine von den völlig fehlgeschnittenen Hosen war, die keinem Menschen in diesem Sonnensystem passen würde, nicht mal Heidi Klum aus Bergisch Gladbach. Die Hose war ein Sonderangebot gewesen, so günstig, dass ich versäumt hatte, sie anzuprobieren. Dummer Fehler.
»Man kann von dir sagen, was man will, aber mutig bist du«, sagte Evelyn. Ich musterte sie verstohlen von Kopf bis Fuß, aber es war hoffnungslos: An ihr war einfach kein Makel zu finden. An die teuren Klamotten kam sie als Einkäuferin für Damenoberbekleidung einer großen Kaufhauskette natürlich sehr günstig heran, aber sie war auch ohne Kleider eine wahre Augenweide. Mittelgroß, sehr schlank, mit halblangen, goldbraunen Haaren, die aussahen, als würden sie von ganz allein mit diesem weichen Schwung in ihre Stirn fallen. An der ganzen Frau war nirgendwo eine Problemzone zu entdecken, wohingegen mein Körper an manchen Tagen sozusagen eine einzige Problemzone darstellte. Kennen Sie das auch? Die Haare sehen aus wie ein Kohlkopf, die Tränensäcke sind eine Hommage an Derrick, und auf dem Kinn wächst ein Pickel, mit dem man nur noch schwer durch die Tür kommt. Aber solche Tage waren Evelyn völlig fremd. Ihre Augen waren braun, von langen, gebogenen Wimpern umrahmt, und die randlose, kleine Brille, die sie trug, störte kein bisschen, im Gegenteil. Selbst die Sommersprossen saßen genau an den richtigen Stellen auf der Nase, auf der man selbst mit der Lupe keinen einzigen Mitesser gefunden hätte. Ihre Hände waren so sorgfältig gepflegt, dass ich meine Gärtnerhände sofort in den Hosentaschen versenkte, bevor Evelyn einfiel, eine Bemerkung darüber zu machen. Da die Jeans viel zu eng war, wurde die Blutzufuhr zu meinen Händen sofort unterbrochen.
Glücklicherweise beschloss Evelyn aber, nicht weiter auf meiner Aufmachung herumzuhacken, sondern stattdessen auf Eberhard.
»Schön, dass du da bist«, sagte sie. »Eberhard hat nämlich gerade wieder mal ausführlich über das Fernsehprogramm der Woche referiert, obwohl wir ihm gesagt haben, dass uns das einen Scheiß interessiert.« Das Wort Scheiß betonte sie so auffällig, dass ich nicht umhinkam, ihren erhöhten Aggressionsspiegel zu bemerken. Ich tippte auf prämenstruelles Syndrom. Oder es waren doch Zahnschmerzen.
»Oha«, sagte Eberhard, kein bisschen gekränkt. »Alles klärchen oder was! Es sollte dich allemal interessieren, was im Glotzophon so alles läuft, denn wer immer schön Zahlemann und Söhne macht, sollte wenigstens wissen wofür. Sonst – aus die Maus.«
»Ich gucke die Tagesschau und Friends, wenn ich dienstags meine Bügelwäsche erledige«, sagte Evelyn gereizt, während ich noch überlegte, was Eberhard eigentlich gesagt hatte. Es war, als würde er eine andere Sprache sprechen. »Ansonsten höre ich Radio. Das sind mir meine Rundfunkgebühren allemal wert. Und wenn sie Friends jemals absetzen, lasse ich auch das Bügeln sein, so einfach ist das.«
»Oha, da brat mir aber einer ’nen Storch«, sagte Eberhard spöttisch. »Jetzt hast du dich aber in die Nesseln gesetzt. Die Sendungen deines Ehemannes mutest du deinen Guckerchen wohl nicht zu, was?«
Oliver arbeitete in der Nachrichtenredaktion eines kleinen Regionalsenders, und er war dort mehrmals in der Woche zu sehen, als »unser Korrespondent vor Ort, Oliver Gaertner«. Ich war richtig stolz, mit ihm verwandt zu sein, und verpasste kaum eine seiner Sendungen. Für den Rest der Familie hatte sein Beruf längst an Faszination eingebüßt, zumal sie fanden, dass Oliver nach all den Jahren endlich mal da sein sollte, wo wirklich was los war: in London, New York oder Afghanistan. Aber Oliver blieb immer im Land, er übernahm die Reportagen, die am nächsten zum Sender lagen. Meist zerzauste ihm der Wind das streichholzkurze Haar, wenn er etwa sagte: »Neben mir steht der Einsatzleiter der örtlichen Feuerwehr. Herr Kowalski, wie lange werden die Löscharbeiten voraussichtlich noch dauern?«
»Ich muss mir das nicht angucken, weil Oliver mir nachher sowieso alles haarklein erzählt«, sagte Evelyn, und es klang so, als könne sie sich wahrlich Schöneres vorstellen.
»Oha!«, machte Eberhard. Oliver sagte nichts, bedachte Evelyn aber mit einem ziemlich finsteren Blick.
Oha, dachte ich, genau wie Eberhard.
»So, jetzt aber die Überraschung!« Katinka kam mit der Aufschnittplatte herein, gefolgt von Stephan und den Kindern.
Stephan humpelte. Till hatte sich an sein linkes Bein geklammert, Lea an sein rechtes, und Jan rannte heulend hinterher und schrie dabei: »Daßß ißß undereßßt! Ißß will auch ein Bein haben!«
Katinka lachte glockenhell. »Ist das nicht süß? Der Onkel mit seinen Neffen und Nichten!«
Und Eberhard sagte: »Keine Panik auf der Titanic, Jan, du musst nicht weinen, ihr könnt euch doch abwechseln. Immer Ruhe mit den jungen Pferden.«
»Jetzt wird aber erst mal gefrühstückt«, sagte Stephan und versuchte sich zu setzen. Widerwillig ließen Lea und Till seine Beine los.
»Fehlt nur noch Opa«, stellte Katinka fest, als Jan in seinem Kinderstühlchen verstaut war und alle saßen. »Und dann haben wir für euch alle eine große Überraschung.«
Stephan, Oliver, Evelyn und ich tauschten einen kurzen Blick. Die Überraschung war wohl für niemanden von uns eine Überraschung, schon gar keine große. Katinkas idiotisches, triumphierendes Lächeln konnte nur eins bedeuten: Kind Nummer vier war unterwegs. Ganz ehrlich: Wir hatten schon vor Monaten damit gerechnet, denn Jan kam diesen Sommer schon in den Kindergarten, und so viel Zeit hatte Katinka noch nie zwischen zwei Schwangerschaften verstreichen lassen.
»Jan, du sollst das Ei nicht mit der Schale essen, das weißt du doch. Und warte, bis alle am Tisch sitzen! Opa! Opaaaa! Frühstück ist fertig!«
Vom Ohrensessel drinnen hörte man ein geknurrtes »Ja, ja«.
Evelyn bestaunte die Aufschnittplatte. »Na so was! Das ist ja wirklich eine Überraschung. Haben die bei Aldi ihr Sortiment erweitert?«
Katinka schüttelte den Kopf. »Das ist nicht von Aldi, das ist vom Metzger. Jan! Die Serviette kann man nicht essen! Und du sollst warten, bis alle am Tisch sitzen.«
»Metzger?«, wiederholte Oliver fassungslos. »Ist Vati krank?«
»Keine Sorge, mein Junge«, sagte Fritz von der Tür her und ließ sich mit einem Ächzen auf seinen Stammplatz an der Stirnseite des Tisches nieder. Sofort nahmen wir eine aufrechte Haltung an. Achtung, Kapitän auf der Brücke! »Aber ab und an gehe ich auch mal woanders einkaufen als bei Aldi. Da ist es neuerdings immer so voll! Und was für ein Pack da einkaufen geht, unfassbar. Möchte nicht wissen, was für Krankheiten man sich dort einfängt. Bei Metzger Sendmann ist es immer schön ruhig.«
»Bei Metzger Sendmann!«, sagte Stephan staunend. »Solltest du auf deine alten Tage etwa noch zum Verschwender werden?«
»Metzger Sendmann ist Doktor Berners Schwiegersohn«, erklärte mein Schwiegervater. Doktor Berner war einer der scheintoten Geizhälse seiner Doppelkopfrunde. »Deshalb behandelt man mich dort besonders zuvorkommend. Auch wenn ich nur die Sonderangebote nehme. Den Aufschnitt vom Vortag packt man dort nämlich bunt durcheinander in eine Tüte, und die ganze Tüte kostet weniger als eine Lage Schinken. Und was da alles drin ist: Mailänder Salami, Schwarzwälder Schinken, Fleischwurst, Sülze, Leberwurst – alles vom Feinsten.«
Evelyn, die sich gerade eine Scheibe Schinken auf ihr Brötchen legte, ließ die Gabel sinken. Auch Oliver, Stephan und Katinka hielten inne. Nur Eberhard ließ sich nicht stören und biss herzhaft in ein Leberwurstbrötchen. »Was uns nicht umbringt, macht uns stark. Wurst ist Wurst, da beißt die Maus keinen Faden ab.«
»Vati, dieser Aufschnitt in Tüten ist nicht vom Vortag, sondern eher von der Vorwoche«, sagte Oliver, und Stephan setzte hinzu: »Und er ist für Leute mit Hunden gedacht!«
»Ihr bekommt Marmelade«, sagte Katinka besorgt zu den Kindern. »Wegen der Salmonellengefahr …« Dann aber kehrte ihr Lächeln zurück. Richtig, da war ja noch etwas … »Und jetzt hört mal alle zu. Wir bekommen – Lea!!«
Lea hatte ihr Milchglas umgeworfen. Das machte sie jeden Sonntag, und Katinka tupfte blitzschnell und routiniert das Tischtuch ab und goss neue Milch ins Glas.
»Blödsinn«, sagte Fritz derweil. »Für Hunde haben die dort die Innereien. Obwohl ich das auch für Verschwendung halte. Weiß der Himmel, warum heute keiner mehr leckere Nierchen zu schätzen weiß.«
Wir hatten zu Hause noch nicht gefrühstückt, aber das Schinkenbrötchen lockte inzwischen nicht mehr. War da nicht so ein seltsamer grüner Schimmer auf dem Schwarzwälder? Ich hielt mich sicherheitshalber an meinem Kaffee fest. Morgen wollte ich sowieso mit einer Diät beginnen. Ich hatte zwar nicht zugenommen, aber Stephan nannte mich seit neuestem Pummelchen oder Molli-Olli, was mir überhaupt nicht gefiel. Er vertrat die These, dass sich das Körpergewicht bei Frauen über dreißig anders verteile als vorher – und zwar nachteilig anders.
»Jetzt seid doch mal leise.« Katinka klopfte mit dem Eierlöffel an ihre Kaffeetasse.
»Schscht«, machte ich. Katinka tat mir allmählich Leid, weil sie ihre »Überraschung« einfach nicht loswerden konnte.
»Vielen Dank, Tochter«, sagte Fritz in das darauf folgende Schweigen und wandte sich seinen Söhnen zu. »Also, was gibt’s Neues bei euch?« Das fragte er jeden Sonntag, und es war jeden Sonntag der Auftakt zu einem handfesten Familienstreit. Na ja, man kann sich an alles gewöhnen.
»Bei Ebi und mir gibt es wunderbare Neuigkeiten«, machte Katinka einen verzweifelten Versuch, den Familienstreit zu verhindern, aber Fritz unterbrach sie rüde: »Dich habe ich nicht gemeint, Tochter. Du erzählst mir ja sowieso jeden Tag, was es Neues gibt.« Das stimmte sicher, denn Katinkas und Eberhards Reihenhaus lag nur zwei Straßen weiter, und Katinka ließ es sich nicht nehmen, täglich mit den Kindern einen Spaziergang zu Opa zu machen. Und das gar nicht mal aus purem Eigennutz, denn während die Kinder spielten, kümmerte sich Katinka um Fritzens Wäsche, obwohl er behauptete, sehr gut allein zurechtzukommen. Wirklich zu stören schien ihn Katinkas Anwesenheit bei aller Knurrigkeit aber nicht, denn er hatte tatsächlich ein Schaukelgerüst und einen Sandkasten in seinem Garten für Dings, Dings und Dings aufgestellt. Beides Sonderangebote vom Baumarkt und außerdem leicht beschädigt, aber immerhin. Für einen Mann, der vor lauter Geiz beim Metzger Hundeaufschnitt für sich und seine Familie kaufte, sich die Haare selber schnitt und seit 1979 denselben Mercedes fuhr, war es eine überaus großzügige Geste.
Katinka sah zu Recht beleidigt aus.
»Ich wollte, dass deine Brüder mir etwas von ihrem Elend berichten. Erst die schlechten, dann die guten Nachrichten«, sagte Fritz beschwichtigend und wandte sich an Stephan: »Also: Was macht der Umsatz? Und wie geht es eurer Bruchbude?«
»Welche Bruchbude meinst du? Das Haus oder die Gärtnerei?«, fragte Stephan zurück.
»Beide«, sagte Fritz.
Stephan und ich hatten das Wohnhaus und die Gewächshäuser vor eineinhalb Jahren gekauft und die alte Gärtnerei übernommen. Wir hatten einen hohen Kredit aufnehmen müssen, so hoch, dass nicht nur Fritz meinte, die Bank hätte ihn nie bewilligen dürfen. Natürlich hatte er keinerlei Anstalten gemacht, uns mit etwas Geld unter die Arme zu greifen oder gar einen günstigeren Kredit anzubieten als die Bank. »Ich war immer dafür, dass meine Kinder die Suppe, die sie sich einbrocken, auch selber auslöffeln sollen«, pflegte er seinen Geiz pädagogisch-blumig zu umschreiben. »Aber sagt hinterher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.« Ich hatte den Verdacht, dass er nur darauf wartete, dass wir Konkurs anmeldeten. Aber noch hatte ich die Hoffnung, dass er vergeblich warten würde. Die alte Gärtnerei mit ihren fünf riesigen Glasgewächshäusern befand sich zwar wie das Wohnhaus in ziemlich desolatem Zustand, aber das Grundstück war über vierzehntausend Quadratmeter groß, und der Boden war hervorragend, ideal für die Baumschule, die wir aufziehen wollten. Irgendwann würde sich die hohe Investition auszahlen, da war ich sicher. Und bis dahin gab es eben keine neuen Klamotten und teure Antifaltencremes. Lieber würde ich verschrumpeln, als dass mein Schwiegervater am Ende Recht bekäme.
»Na ja«, sagte Stephan. »Man merkt, dass es Frühling ist: Die Leute kaufen palettenweise Begonien und Neu-Ginuea-Dings, äh fleißige Lieschen …« Er warf einen Blick zu mir hinüber, weil er wusste, dass ich beide Pflanzen nicht ausstehen konnte. Ich war gelernte Staudengärtnerin, und in einer Gewächshausecke zog ich seltene Stauden, deren Samen ich mir aus England schicken ließ. Stauden, Rosen, wilde Clematissorten und Formschnittgehölze waren meine Leidenschaft, und ich war sicher, dass man damit eine Menge Geld verdienen konnte, wenn man es nur richtig anfing. Stephan war anderer Ansicht. Er hatte seine Gärtnerlehre nur angefangen, um die Wartezeit auf seinen Studienplatz in BWL zu überbrücken, und er hatte sie nach einem Jahr wieder abgebrochen, ohne von dieser gewissen Leidenschaft gepackt zu werden, die einen süchtig macht nach dem Geruch von Erde und frischem Grün. Eine Leidenschaft, die dafür sorgt, dass man nie wirklich gut manikürt aussieht, egal, was man auch tut.
Immerhin hatte sein kurzes Gastspiel als Gärtnerlehrling dazu geführt, dass wir uns kennen lernten. Zweieinhalb Jahre später, als Stephan sein Vordiplom in der Tasche hatte, heirateten wir auch schon. Ich hatte es gar nicht erwarten können, endlich den Namen Gaertner anzunehmen. Nicht nur, dass er hervorragend zu meinem Beruf passte, nein, ich konnte jetzt endlich aufhören, den Leuten meinen Nachnamen zu buchstabieren. »Wie der Gärtner, nur mit ae«, das ging einem doch sehr lässig von den Lippen, und jeder wusste gleich Bescheid. Mein Mädchenname war Przbylla gewesen, und ich argwöhnte, dass meine Vorfahren aus einer besonders vokalarmen Gegend Polens stammten. Jedenfalls hatten die Leute immer »Gesundheit« gesagt, wenn ich mich vorgestellt hatte, und wenn es einmal jemand schaffte, den Namen richtig auszusprechen, musste ich mir immer dessen Spucke aus dem Gesicht wischen. Diese Zeiten lagen glücklicherweise lange hinter mir. Nächstes Jahr würden wir unseren zehnjährigen Hochzeitstag feiern.
Wir ergänzten uns prima. Ich hatte die Ideen und Stephan den Sinn für die Realität. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht erklärte er mir leider ständig, dass mit meinen Träumen kein Geld zu verdienen sei. Vielmehr musste ich mich mit der Idee anfreunden, dass wir – zusätzlich zu den eigenen – billige Pflanzen aus Holland importierten und mit Gewinn weiterverkauften. Offensichtlich funktionierte das. Im Dezember waren wir das erste Mal aus den roten in die schwarzen Zahlen gerückt, und zwar durch den Verkauf von eingetopften Weihnachtssternen, die mit den widerlichsten Glitzersprays bearbeitet worden waren. Bitte keine Missverständnisse: Wir waren um genau einen Euro und neunzig Cent in die Gewinnzone gerutscht, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das war ein Erfolg, zumindest verglichen mit den Monaten davor, in denen wir nicht annähernd kostendeckend gearbeitet hatten und sich die Schulden auf unheimliche Weise vergrößert hatten. Die fleißigen Lieschen und Begonien würden uns voraussichtlich einen ähnlichen Erfolg bescheren wie die Weihnachtssterne.
»Zu meiner Zeit kamen die fleißigen Lieschen nicht aus Neu-Guinea.« Fritz schüttelte missbilligend den Kopf, und nur Eberhard fasste die Bemerkung als Scherz auf und ließ sein keckerndes Lachen hören. Fritz fuhr auf seine übliche Art und Weise fort: »Und zu meiner Zeit verdiente sich ein anständiger Mann auch seinen Lebensunterhalt nicht mit Blumenverkaufen! Wozu haben wir dich denn studieren lassen?«
Auch das fragte er jeden Sonntag. Ich sah verstohlen in die Runde. Oliver machte ein ernstes Gesicht, wohl weil er wusste, dass ihm diese Frage nachher auch noch blühte, Evelyn betrachtete ihre Fingernägel, Katinka seufzte, und Eberhard feixte.
Stephan versuchte, sich souverän zu geben. »Ich hatte diese Woche ein sehr vielversprechendes Gespräch mit dem Beerdigungsinstitut Sägebrecht. Die wollen vielleicht von Blumen Müller zu uns wechseln. Grabbepflanzung ist ein ausgesprochen lukratives Thema.«
»Aber hallo«, sagte Eberhard und keckerte wieder.
»Grabbepflanzung!«, schnaubte Fritz. »Damit kann ein anständiger Mann doch keine Familie ernähren. Ich könnte dir jederzeit einen Job in meiner alten Firma besorgen.«
»Stephan hat doch einen Job«, sagte ich.
»Das nennst du Arbeit?«, rief Fritz. »Wovon wollt ihr denn euren Kindern die Ausbildung finanzieren?«
»Äh, wir haben doch keine Kinder«, wagte ich es einzuwerfen.
Fritz runzelte die buschigen Augenbrauen. »Jawohl«, polterte er. »Und warum nicht? Weil ihr es euch nicht leisten könnt, darum nicht. Das ist auch der Grund, warum meine Schwiegertochter Sachen aus dem Altkleidersack tragen muss.«
Ich wollte empört aufspringen und rufen, dass die Sachen keinesfalls aus dem Altkleidersack stammten, sondern aus meinem Kleiderschrank. Aber dann hielt ich inne, weil mir klar wurde, dass keine wirklich gravierenden Unterschiede zwischen Sack und Schrank bestanden.
»Wir könnten es uns leisten, Kinder zu bekommen«, log Stephan tapfer. »Aber wir wollen keine Kinder. Jedenfalls noch nicht.«
»Genau«, sagte ich, um wenigstens etwas zu sagen. Wir waren uns darüber einig, dass wir nicht für Kinder geschaffen waren. Und Kinder nicht für uns.
»Oha«, sagte Eberhard. Er konnte dem sonntäglichen Familienstreit immer ganz entspannt lauschen, weil er das Glück hatte, Fritzens Anerkennung zu genießen. Als Ausbilder bei einem großen Automobilhersteller (demselben, bei dem Fritz bis zu seiner Pensionierung die zweithöchste Position bekleidet hatte) verdiente er nicht nur eine Menge Geld, sondern er hatte nebenbei noch die Zeit gefunden, seiner Frau alle zwei bis drei Jahre ein Kind zu machen. Wie jeden Sonntag wünschte ich mir einen Gummihammer herbei, um auf ihn einzudreschen. Oder einen Baseballschläger oder eine geladene Schrotflinte oder …
»Blödsinn!«, rief Fritz und schlug dabei mit der Faust auf den Esstisch, dass die Kaffeetassen nur so schepperten. »Das ist doch ein verdammter Blödsinn. Jede Frau wünscht sich Kinder, und jeder