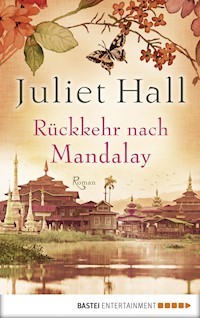4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Tess kann es nicht fassen. Warum hat ihre Mutter nie über ihre sizilianische Heimat gesprochen? Warum hat sie nie gesagt, woher sie stammt?
Auch jetzt, wo Tess eine zauberhafte Villa in Cetaria geerbt hat, schweigt Flavia. Tess fühlt sich sofort geborgen, doch sie spürt auch: Es liegt ein Geheimnis über dem Ort, ein Geheimnis, das auch mit ihrer Familiengeschichte zu tun hat ...
Ein sommerlich leichter Roman über eine Villa am Meer, einen geheimnisvollen Schatz und ein lange gehütetes Familiengeheimnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 696
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
Dank
Über die Autorin
Juliet Hall
EINVERZAUBERTERSOMMER
Roman
Aus dem Englischen vonBarbara Röhl
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2012 by Juliet Hall
Translated from the English: »The Villa«
First published in the United Kingdom by Quercus Publishing
under the pseudonym of »Rosanna Ley«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Birgit Volk, Bonn
Titelillustration: © getty-images/Adrian Pope
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Datenkonvertierung E-Book:
Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-1553-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
1. Kapitel
Tess öffnete den Umschlag erst, als sie am Strand saß. Bis dahin hatte sie ihn glatt vergessen.
Heute Morgen war sie spät dran gewesen und auf dem Weg zur Arbeit fast mit dem Postboten zusammengestoßen.
»’tschuldigung, junge Frau.« Er hatte ihr den dicken, cremeweißen Umschlag gereicht, doch sie hatte kaum einen Blick darauf geworfen, bevor sie ihn in ihre Tasche schob und ihrer Tochter einen Abschiedskuss gab. Ginny brach zum College auf und Tess zum Wasserwerk. Tess arbeitete bei der Kundeninformation, einer schmeichelhaften Bezeichnung für die Beschwerdeannahme, denn wer brauchte schon Informationen über Wasser? (Dreh den Hahn auf, und es kommt heraus; noch besser ist es aber, es aus Flaschen zu trinken.)
Jetzt hatte sie Mittagspause, und wie so oft war sie ans Meer zur Pride Bay gefahren, die nur fünf Autominuten entfernt lag, um ihr Sandwich zu essen. Es war einer der ersten Frühlingstage und windig. Zwischen der Reihe pastellfarbener Umkleidehäuschen hinter ihr und den hoch aufgehäuften rosigen Kieseln vor ihr, aus denen dieser Teil von Chesil Beach, West Dorset, bestand, kam sie sich selbst vor wie der Belag in einem Sandwich. Obwohl ihr der Blick auf die Wellen verstellt war, war sie so wenigstens teilweise vor dem Wind geschützt. Sie brauchte erst um halb drei zurück zu sein. Gleitende Arbeitszeit ist doch eine wunderbare Erfindung, dachte sie.
Der Umschlag hatte es sich zwischen ihrem abgeschabten Schminktäschchen und ihrem Handy gemütlich gemacht. Sie zog ihn heraus. Las ihren Namen, Ms. Teresa Angel, und ihre Adresse in kräftigen, selbstbewussten Schreibmaschinenbuchstaben. Frankiert und abgestempelt in London. Hmmm. Sie schob den Daumen unter die Klebekante und riss den Umschlag auf. Ein einzelnes Blatt Papier. Sie zog es heraus. Es wirkte so dick und cremig, dass sie beinahe das Gefühl hatte, es essen zu können.
Sehr geehrte Ms. Angel, las sie. Wir wenden uns an Sie, um Ihnen mitzuteilen … bla, bla … in der Folge des Ablebens von Edward Westerman. Edward Westerman? Tess runzelte die Stirn. Kannte sie einen Edward Westerman? Nein. Hatte sie jemanden gekannt, der vor Kurzem verstorben war? Nein. Ob die Leute an die falsche Teresa Angel geschrieben hatten? Wohl kaum. Sie las weiter. Bezüglich des Nachlasses … bla, bla. Nachlass? Unter der Bedingung, dass … Moment mal. Sizilien? Mit freundlichen Grüßen und so weiter.
Hmmm. Tess las den Brief zu Ende und überflog ihn dann noch einmal. Sie sah einen Moment aufs Meer hinaus, und dann kam ihr der Gedanke, dass sie vielleicht träumte. Also las sie ihn ein weiteres Mal durch. Den Blick immer noch aufs Meer gerichtet, aß sie ihr Sandwich und spürte plötzlich eine Art nervöses Flattern wie von Mottenflügeln, gefolgt von einem Aufwallen – prickelnder Erregung … Das konnte doch nicht stimmen – oder?
Sie dachte an ihre Mutter. Was würde sie dazu sagen? Tess schüttelte den Kopf. Besser, sie dachte nicht darüber nach. Stattdessen dachte sie wie so oft leidenschaftlich, betrübt und sehnsüchtig an Robin, ihren verheirateten Freund. Nein. Da war jemandem ein Fehler unterlaufen. Ganz bestimmt handelte es sich um einen Irrtum.
Der Wind peitschte die Wellen zu grünlich grauen Brechern auf. Die Wolken zogen sich zusammen, und bald würde ihr trotz ihres schwarzen Blazers und des Wolltuchs, das sie um die Schultern geschlungen hatte, als sie den Wagen am Hafen stehen gelassen hatte, kalt werden. Sie sollte aufbrechen.
Wenn das stimmte … Wenn das kein Scherz war, dann … Sizilien. Tess hatte die Verbindung sofort gezogen. Aber was genau würde dann passieren? Wieder spürte sie diesen Adrenalinstoß. Herrgott! Sie steckte den Umschlag wieder in die Tasche und stand auf. Es war nicht einfach, in High Heels über den Strand zu gehen, aber Tess war daran gewöhnt.
Tess’ Mutter Flavia war Sizilianerin. Das war die Verbindung. Tess wusste, dass ihre Mutter ihr Heimatdorf mit dreiundzwanzig Jahren verlassen hatte. Sie wusste ebenfalls, dass die Familie ihrer Mutter für jemanden gearbeitet hatte, der in einem großen Haus wohnte – ihre Mutter nannte es immer die »Große Villa« –, während ihre Familie selbst in einem kleinen Häuschen auf dem Anwesen lebte. Flavia Angel sprach selten von Sizilien, und sie war nie mit ihrer Tochter dorthin gefahren. Aber das hieß nicht, dass Tess nicht fasziniert von diesem Ort gewesen wäre. Und jetzt das. Sie ließ alles noch einmal Revue passieren. Edward Westerman – falls er dieser Jemand war – hatte ein biblisches Alter erreicht. Möglich war das schon …
Aber warum? Sie zupfte ihr Tuch zurecht und ging zurück zum Hafen, vorbei an den fröhlich geschmückten und, wie sie fand, geschmacklosen Kiosken, an denen Fisch und Pommes frites, Zuckerwatte und Eis verkauft wurden, vorbei an den Fischerbooten und den Netzen, die zum Trocknen aufgehängt waren und in deren Nähe der starke, unangenehme Geruch des ausgenommenen Fischs schwer in der Luft hing. Trotz seines stolzen Namens war Pride Bay kein Nobelstrand. Aber er war Teil ihrer Kindheit, und er war ihr Zuhause. Und was das Beste für Tess war: Dort war das Meer. Das Meer hatte sie im Blut, sie war geradezu süchtig danach.
Auf dem Weg zum Auto rekapitulierte sie den Inhalt des Briefs noch einmal, und kaum dass sie auf dem Fahrersitz ihres Fiat 500 saß, zog sie ihn wieder hervor, strich ihn glatt und griff nach ihrem Handy. Es gab nur eine Möglichkeit, herauszufinden, ob es stimmte.
»Hier ist Teresa Angel«, erklärte sie der Frau am anderen Ende der Leitung. »Sie haben mir geschrieben.« Sie nannte das Geschäftszeichen. »Ich möchte einen Termin vereinbaren. Aber vorher hätte ich noch ein paar Fragen zu diesem Erbe, das Sie erwähnten …«
Wie in Trance fuhr sie zurück zur Arbeit. Wahrscheinlich war dies eines dieser Ereignisse, die ein Leben verändern konnten. Ihr Leben. Diese Vorstellung jagte ihr schreckliche Angst ein. Sie war neununddreißig. Einerseits sehnte sie sich nach einer Veränderung, andererseits auch wieder nicht. Was, wenn Robin die kühle, labile Helen niemals verließ, obwohl er es ständig versprach? Was, wenn Ginny Hunderte von Meilen entfernt studieren wollte und anschließend nach Katmandu zog? Oder wenn sie selbst für den Rest ihres Lebens in der Kundeninformationsabteilung des Wasserwerks arbeiten musste? Das war unvorstellbar. Manchmal fragte sie sich, warum sie nicht schon längst durchgedreht war. Und jetzt das.
2. Kapitel
Tess fuhr am Marktplatz von Pridehaven vorbei, den Holzbänke und Blumenkübel mit roten und weißen Pelargonien zierten und um den sich das Beach and Barnacle Café, der Feinkostladen und das Kunstzentrum gruppierten. Dieser Ort wirkte vielleicht ein wenig schäbig, aber er wurde jeden zweiten Samstag durch den Markt und die Morris-Tänzer zum Leben erweckt. Früher war die Stadt ein Zentrum der Seiler-Industrie gewesen, aber inzwischen waren die meisten der alten Fabriken zu Wohn-und Bürogebäuden umgebaut worden. Und zu Antiquitätenläden, dachte sie, als sie langsamer fuhr und den Antiquitätenladen an der Ampel passierte, vor dem sich eine Kommode aus Kiefernholz, ein Tisch mit ausklappbaren Seitenteilen und ein grün-goldener Lloyd-Loom-Stuhl hoffnungsvoll auf dem Gehsteig ausbreiteten.
Sizilien … Ungläubig und immer noch grinsend, schüttelte sie den Kopf. Die Erste, die sie anrufen sollte, war natürlich ihre Mutter.
Sie bog nach links in die Saviour Street ein, parkte hinter dem Wasserwerk und ging um das Gebäude herum. Vor dem Haupteingang zog sie ihr Handy wieder aus der Handtasche hervor und wählte Robins Nummer. Ihrer Mutter konnte sie das nicht am Telefon sagen. Aber sie musste jetzt einfach jemandem davon erzählen.
»Hallo, du …«
Tess liebte es, wie sich seine Stimme veränderte, wenn er mit ihr sprach. Sie klang dann intim, leise. So, als habe er vor, sie gleich ganz langsam auszuziehen. Sie erschauerte. »Du errätst nie, was passiert ist«, sagte sie.
»Was denn?« Er lachte.
»Ich habe heute Morgen einen Brief bekommen. Von einem Anwalt in London.«
»Wirklich? Gute oder schlechte Nachrichten?«
Tess holte tief Luft. Sie würde Robin nach der Arbeit treffen, weil heute Donnerstag war und Ginny dann spät vom College nach Hause kam. Zweimal pro Woche war Durchschnitt, dreimal gut und viermal noch nie dagewesen. All ihre Begegnungen waren gestohlene Zeit. Wenn sie keine Gleitzeit hätte, dachte Tess manchmal, würden sie und Robin nie Zeit füreinander haben, dann gäbe es keine späten Mittagessen am Montag (wenn sie miteinander schliefen) und auch nicht den frühen Abend am Donnerstag (dito). Was würden sie dann tun? Aber damit mochte sie sich jetzt nicht beschäftigen.
»Gute«, sagte sie. »Glaube ich.«
»Ich mag gute Nachrichten«, sagte er. »Was ist es?« Sie sah vor ihrem geistigen Auge, wie er in seinem schwarzen Terminplaner herumkritzelte, ein Fischgesicht mit Blasen malte. Angefangen hatte er damit, als sie sich für ihren ersten Tauchkurs angemeldet hatte. Es verriet ihr, dass er ein wenig eifersüchtig war, was sie ganz gern mochte.
»Ich habe ein Haus geerbt«, erklärte sie. Jetzt konnte sie es laut aussprechen. Sie wollte es laut aussprechen. Sie setzte sich auf die Mauer neben die Pelargonien. Der Wind hatte eine frische Note, die ihr gefiel – eine Art Weckruf: Hey, es ist Frühling. Etwas muss sich verändern …
»Was?«, fragte er.
»Ich habe ein Haus geerbt«, sagte sie noch einmal. »Auf Sizilien.« Ja, es stimmte wirklich.
»Sizilien?«, wiederholte er.
Sie konnte es ihm nicht verübeln, dass er verblüfft war. Sie konnte es ja selbst noch nicht ganz glauben. Warum sollte Edward Westerman ihr sein Haus vermachen? Sie hatte ihn nicht einmal gekannt. Es war erstaunlich, wirklich erstaunlich. Und was sollte sie mit einer Villa in Sizilien anfangen? Dafür war gar kein Platz in ihrem Leben. Ihr Leben fand in Dorset statt – oder? Bei Ginny, bei Muma und Dad, die ebenfalls in Pridehaven lebten, nur ein paar Straßen entfernt von Tess’ viktorianischem Haus. Und bei Robin – jedenfalls so weit möglich. Ihr Leben hatte sich immer in Dorset abgespielt, abgesehen von Campingurlauben in Frankreich, einem kurzen Intermezzo in London, das sie bald beendet hatte (sie war, wie sie feststellte, keine Großstadtpflanze), und sechs Wochen als Kindermädchen bei einer Familie, die den Sommer auf Mallorca verbrachte.
»Ja«, sagte sie, »eine Villa auf Sizilien.« Die Große Villa. Aber wie groß genau war groß?
»Du nimmst mich auf den Arm, Tess.«
»Nein, das tue ich nicht«, gab sie zurück. »Ich weiß, es klingt komisch, aber jemand hat sie mir in seinem Testament vermacht.«
»Wer in aller Welt …?«, fragte er. »Ein alter Verehrer?«
Robin war zehn Jahre älter als sie. War er auch ein alter Verehrer? Ginny wäre dieser Meinung. Wenn sie davon wüsste.
»Ein Mann, dem ich nie begegnet bin. Edward Westerman.« Sie sprach den Namen fast genießerisch aus. Er klang ziemlich romantisch. Sie erzählte Robin das Wenige, was sie bisher wusste.
»Ja, da will ich doch verdammt sein, Süße«, sagte er.
»Und das ist noch nicht alles.« Tess rutschte auf der Mauer herum und dachte widerwillig an ihren Posteingangskorb. »Es gibt eine Bedingung.« Alles im Leben hatte einen Haken. Man bekam beispielsweise ein Kind von einem Mann, dem man vertraute, und prompt verließ er einen und wanderte nach Australien aus. Oder man begegnete einem Mann, der hinreißend, sexy und witzig war, und verliebte sich in ihn, und er war verheiratet – mit einer anderen.
»Und die wäre?« Robin klang immer noch genauso verwirrt, wie Tess sich fühlte.
»Ich muss hinfahren.«
»Hinfahren?«
»Ich muss das Anwesen besuchen. Bevor ich …« Sie zögerte. Darüber verfügen, so hatte der Anwalt es ausgedrückt. »Bevor ich es verkaufen kann«, erklärte sie. Wie viel würde das einbringen? Was für ein Haus war die Große Villa? Würde der Erlös ausreichen, um ihre Hypothek abzubezahlen? Für einen oder zwei Urlaube? Um ihr Leben zu verändern?, meinte sie eine leise Stimme flüstern zu hören.
»Wer sagt, dass du das musst?«, fragte Robin.
»Edward Westerman, wie es aussieht. Es ist eine Testamentsklausel. Ich muss das tun.« Muss. Und doch, Sizilien. Es schien beinahe nach ihr zu rufen. Für jemand anderen wäre das vielleicht nichts Besonderes gewesen, aber sie war von einer sizilianischen Mutter großgezogen worden, die kaum von ihrem Heimatland sprach und deren Augen sich vor Schmerz oder Zorn oder beidem verdunkelten, wenn man sie nach ihrer Kindheit, ihren Eltern, ihrem Leben dort fragte. Bis man es schließlich akzeptierte. Sizilien war tabu. Das Problem war nur: Tess hatte sich nie damit abgefunden. Und plötzlich stieg ein Gedanke, eine Hoffnung, eine Idee in ihr auf. Sie spürte die Welle der Nervosität zurückkehren, die mottenflügelschlagende Aufregung, den Erregungsschauer.
»Herrgott!«, sagte Robin.
Tess beobachtete eine Biene. Zielgerichtet flog sie auf die gelben Schlüsselblumen zu, die vor den Pelargonien wuchsen, und stürzte sich Hals über Kopf hinein. Sie wusste, wie das Tier sich fühlte. »Ich weiß«, sagte sie. Es war überwältigend, fast unglaublich. Aber andererseits war es wahrscheinlich auch nicht eigenartiger, als einem Katzenasyl oder etwas Ähnlichem Geld zu vermachen. Da war allerdings dieser geheimnisvolle Unterton. Die Klausel. Sie musste die Villa aufsuchen, bevor sie ihr wirklich gehörte.
»Dann fliegst du nach Sizilien?«
»Hmmm.« Eigentlich gab es nichts, was sie davon abhalten konnte – abgesehen von dem, was Muma sagen würde natürlich. Sie hatte noch Urlaub, und Ginny … Nun ja, Ginny würde sich wahrscheinlich darüber freuen, das Haus eine Woche lang für sich zu haben. Kurz stellte sie sich das Bild vor: Ginnys Musik voll aufgedreht, Ginnys Freunde, wie sie in das Haus einfielen, und Ginny, die ausging, wann und so lange sie wollte, obwohl sie eigentlich lernen sollte. Aber Lisa würde sie im Auge behalten. Wenn Lisa und ihre Eltern in der Nähe waren, konnte doch nichts allzu Dramatisches passieren, oder? Eines Tages, dachte sie, würde sie sich vielleicht keine Sorgen mehr um ihre Tochter machen müssen; Ginny würde glücklich und ausgeglichen und erwachsen sein. Aber im Moment fiel es ihr schwer, sich das vorzustellen.
»Bald?« Robins Stimme klang plötzlich anders, so, als nähme er sie plötzlich ernster.
Sie fragte sich, was ihm gerade durch den Kopf ging. Robin konnte romantisch sein. Manchmal machte er ihr wunderhübsche Geschenke: eine antike Buntglaslampe, die wie ein präraffaelisches Gemälde leuchtete, wenn das Licht hindurchschien, einen Ring mit einem blitzenden quadratisch geschliffenen Saphir, den sie am Mittelfinger trug, oder eine herzförmige Wärmflasche für die Nächte, in denen er nicht bei ihr war, also alle. Sie war sich sicher, dass hinter jeder romantischen Geste ein Hintergedanke steckte, aber sie liebte ihn deshalb nicht weniger.
»Ja, das nehme ich an.« Einige Raucher waren aus dem Eingang des Gebäudes getreten und zündeten ihre Zigaretten an.
Tess warf einen Blick auf die Uhr. Sie hatte keine Lust, zurück zur Arbeit zu gehen. Und dieser neue Ernst bei ihm machte sie leichtsinnig. »Könntest du dir vorstellen …?« Sie ließ den Satz unvollendet. Wenn der Geliebte verheiratet ist, kann er niemals mit einem wegfahren, jedenfalls nicht ohne Planung und Lügen. Das wusste sie. Wenn man einen verheirateten Geliebten hatte, konnte man sein Leben nicht mit ihm teilen. Er teilte es bereits, und zwar mit einer anderen. Er gehörte einem nie allein, nicht einmal in diesen kurzen, erregenden Momenten, wenn man daran glaubte. Wer etwas anderes behauptete, hielt sich nur selbst zum Narren. Das machte sie doch auch, oder?
»Vielleicht«, sagte Robin. »Vielleicht kann ich ja mitkommen.«
Tess’ Herz tat einen Sprung. »Das wäre großartig«, meinte sie. Sie konnte die Aufregung nicht aus ihrer Stimme verbannen, und einer der Raucher warf ihr einen neugierigen Blick zu. Sie wandte sich ab und sah in die Pelargonien. »Das wäre einfach perfekt. Eine Villa in Sizilien. Und sie gehört mir, Robin … Sie zusammen mit dir anzusehen wäre etwas ganz, ganz Besonderes.« Achtung, Tess, du wirst überschwänglich. Geliebte müssen immer cool bleiben. Das ist der Deal. Aber trotzdem …
»Das wäre fabelhaft, Süße.« Robins Stimme war wieder leise geworden. »Nichts täte ich lieber.«
Tess wartete auf das Aber, doch es kam nicht. »Also, könntest du?« Sie hielt den Atem an. Wartete. Sie hatte nicht vorgehabt, sich in ihn zu verlieben. Natürlich nicht. Sie hatten sich in dem Café am Marktplatz kennengelernt, wo der Kaffee stark und das Gebäck zum Sterben gut war. Er fiel ihr auf, weil er attraktiv war – wenn auch für ihren Geschmack einen Hauch zu konservativ gekleidet –, und wegen seiner Stimme. Sie klang leise und sexy, als er mit der Kellnerin sprach. Aber sie war nicht auf der Suche nach einer Beziehung, ermahnte sie sich. Sie war eine unabhängige Frau, die für eine Tochter zu sorgen hatte, und Ginny hatte allerhöchste Priorität. Sie hatte nur ihre Mutter. Sie hatte erlebt, wie Freundinnen versucht hatten, einen neuen Mann in diese Konstellation aus alleinerziehender Mutter und Kindern einzuführen, und sie hatte sie leiden sehen, als sie versuchten, die Ansprüche der Kinder mit denen des neuen Mannes zu vereinbaren. Sie hatte miterlebt, wie die alleinerziehenden Mütter, die Kinder und die neuen Männer sich in diesem Machtkampf fast zugrunde richteten. Es funktionierte nicht, daher würde sie es auch nicht versuchen. Wenn Ginny von zu Hause auszog, dann vielleicht. Aber bis dahin hatte Tess Verabredungen, und sie hatte männliche Freunde. Aber feste Beziehungen? Nein danke.
Trotzdem aß sie zweimal in der Woche in dem Café zu Mittag, und er anscheinend auch. Sie hatte immer ein Buch dabei, er eine Zeitung. Zweimal ertappte sie ihn dabei, wie er sie ansah, statt zu lesen, und einmal lächelte er.
Dann kam der Tag, an dem kein Tisch mehr frei war und er mit einem Cappuccino, einem getoasteten panino und einem entschuldigenden Lächeln an ihrem Tisch auftauchte. »Darf ich mich setzen? Ich störe Sie auch nicht.«
Das tat er dann aber doch. Ziemlich bald tauschten sie Anekdoten über ihre Arbeit aus. Robin war bei der Finanzgesellschaft tätig, die zwei Gebäude neben den Wasserwerken in der Saviour Street residierte – nein, keine Ahnung, warum die Straße »Heiland« heißt. Sie erzählten einander auch von ihren Kindern. Er hatte zwei, Lydia und Lionel – seine Tochter war an der Uni, und sein Sohn würde das Studium nächstes Jahr aufnehmen. Lionel war sogar genauso alt wie Ginny.
Seine Frau erwähnte er nicht, nicht an diesem Tag. Aber er schlug ein weiteres Treffen zum Mittagessen vor (weil wir so viel gemeinsam haben, nicht nur panini und dieses Café), und zwar am kommenden Freitag, dieses Mal in dem Pub weiter unten an der Straße. Warum eigentlich nicht, hatte Tess gedacht. Sie hatte seine Gesellschaft genossen. Und es war nur ein Mittagessen.
Tess sah zu, wie die Raucher ihre Stummel auf den Boden warfen und austraten. Immer noch plaudernd, verschwanden sie durch die gläsernen Schwingtüren, und sie war wieder allein. Erneut sah sie auf die Uhr. Sie sollte hineingehen. Aber das hier war wichtig. Vielleicht war es das, worauf sie schon so lange wartete.
»Hmmm …«, sagte er.
Ich werde mein Bestes tun, würde er sagen. Das sagte er nämlich immer, wenn sie vorschlug, ins Konzert oder ins Theater zu gehen oder anderswo zu essen als in ihrer Wohnung. Und dann folgte immer das Gleiche: Ich habe es versucht, aber es ist schwierig, Süße. Helen stellt so viele unangenehme Fragen, und ich will sie nicht anlügen.
Mit der Fingerspitze wischte Tess Wasser von einer knospenden Hortensie. Vorhin hatte es geregnet, ein plötzlicher Wetterumschwung, ein verirrter Schauer, der fast schon vorüber war, ehe er begonnen hatte, ein kurzer Spülgang des Himmels.
Nach dem Treffen im Pub hatte er vorgeschlagen, einmal abends nach der Arbeit etwas trinken zu gehen, und nach dem Drink hatte er sie geküsst. Einige Zeit später hatte sie für ihn gekocht: Hühnchen mit Pistazien. Sie war nicht umsonst die Tochter ihrer Mutter. Er hatte sie auf der Couch verführt, denn Ginny übernachtete bei einer Freundin. Anschließend hatte er ihr erklärt, er sei verheiratet.
Zu diesem Zeitpunkt war sie schon halb in ihn verliebt. Er hatte sich heimlich in ihr Herz gestohlen. Es war ein altes Klischee, aber sie hätte nicht mehr zurückgekonnt, selbst wenn sie es gewollt hätte.
Aber dieses Mal, während sie sich den Türen des Wasserwerks näherte und sich widerwillig anschickte, wieder in die Arbeitswelt einzutauchen, reagierte er anders. »Warum nicht?«, fragte er. »Warum sollte ich nicht mit dir nach Sizilien fliegen? Das ist so großartig. Und du hast es verdient, Süße, wirklich verdient.«
Allerdings, dachte Tess ziemlich erstaunt. Das habe ich verdammt noch mal verdient. Mir steht ein größeres Stück von dir zu.
Sie grinste wie eine Idiotin, als sie das Handy wieder in die Handtasche gleiten ließ. Sie stürmte in das Gebäude und stürzte in den Aufzug. Drückte auf »5«. Es würde wirklich passieren. Sie hatte eine Villa in Sizilien geerbt. Und sie würde hinfliegen. Mit Robin. Ihr Lächeln verblasste, als der Lift »pling« machte und die Türen aufglitten. Jetzt musste sie die Neuigkeiten nur noch Muma beibringen.
3. Kapitel
Das verstehe ich nicht.« Schwer ließ sich Flavia auf den Stuhl sinken. Sie hatte immer so viel Energie gehabt, aber mittlerweile gaben ihre Beine manchmal ohne Vorwarnung nach, und es machte ihr Angst, dass sie sich so schwach fühlte. Sie wurde alt, natürlich. Tatsächlich war sie zweiundachtzig. Sie fand, das war ein lächerliches Alter, weil sie sich nämlich nicht alt fühlte. Und genau deshalb gefiel es ihr auch nicht, dass sie sich an manches nur mit Mühe erinnern konnte. Für sie musste immer alles klar und eindeutig sein.
Flavia versuchte, ihre Gedanken zu ordnen, aber es fiel ihr nicht leicht, weil Tess sie mit diesem ihr eigenen forschenden Blick ansah.
Bewusst atmete sie ruhiger. Edward Westerman war also tot. An und für sich war das nicht erstaunlich. Er musste weit über neunzig gewesen sein. Er war der Letzte gewesen. Zuerst war Mama gestorben, dann Papa und dann, vor zwei Jahren, Maria. Den Kontakt zu Santina hatte sie abgebrochen. Sie hatte keine andere Wahl gehabt, als sie loszulassen. Und jetzt existierte auch ihre letzte Verbindung zu Sizilien nicht mehr. Sie fasste sich an den Kopf; Schweißtropfen standen ihr auf der Stirn. Die letzte Verbindung. Sie spürte Panik in sich aufsteigen.
»Geht’s dir gut, Muma?« Plötzlich war Tess ganz die besorgte Tochter. Sie trat zu Flavia, die auf dem alten, hölzernen Küchenstuhl am Tisch saß, beugte sich vor und legte Flavia sanft die Hand auf die Schulter. »Es tut mir leid. Ich hatte ja keine Ahnung, dass dich das so aufregen würde. Habt ihr beide euch nahegestanden?«
Flavia schüttelte den Kopf. »Nein«, erklärte sie. »Eigentlich nicht.« Ihr Arbeitgeber war Engländer gewesen und sie ein junges sizilianisches Mädchen. Und es war so lange her. Obwohl da eine Verbindung gewesen war … Edward war der erste Mensch gewesen, der Englisch mit ihr gesprochen hatte, und Edward hatte es ihr damals ermöglicht, nach England zu gehen. Genau wie sie hatte sich Edward in seiner Heimat fremd gefühlt, und daher war er nach Sizilien gezogen, obwohl es Jahre dauern sollte, bis sie begriff, warum. Puzzles waren nun einmal so. Manchmal hatte man alle Teile direkt vor sich und sah trotzdem nicht das ganze Bild.
»Was dann?«, fragte Tess.
Flavia fuhr mit der Handfläche glättend über ihre Schürze. Bügle alle Falten weg, und alles wird gut … Sie hätte nicht genau sagen können, was sie so getroffen hatte. Vielleicht lag es daran, dass sie Edwards Namen gehört hatte, oder es waren die Erinnerungen oder der Umstand, dass er tot war.
Dann wurde ihr schlagartig klar, was genau der Grund war. »Warum haben diese Anwälte wegen seines Todes Kontakt zu dir aufgenommen?«, fragte sie. »Das verstehe ich nicht. Was hat das mit dir zu tun?«
Tess stand neben ihr. Sie schien ganz aus langen Beinen und wildem dunkelblonden Haar zu bestehen. Sie sah genauso aus wie damals als Kind. »Er hat mir sein Haus vermacht, Muma.«
Flavia blinzelte und runzelte die Stirn. »Was?«
Tess wiederholte ihren Satz, was Flavia Zeit ließ, sich zu fassen und über seine Beweggründe nachzudenken. »Warum sollte er so etwas tun?«, fragte sie schließlich. »Ausgerechnet er …« Er hatte verstanden, wie Flavia empfand. Schließlich hatte er selbst mit England gebrochen, oder? Oder?!
»Ich habe nicht die geringste Ahnung«, gab Tess zurück. Sie hakte die Daumen in die Gürtelschlaufen ihrer Jeans. »Aber ich dachte, du wüsstest es vielleicht.«
Langsam stand Flavia auf. Das Abendessen musste gekocht werden, eine willkommene Ablenkung. Zum Kochen war sie nicht zu alt. Dazu war man nie zu alt; obwohl sie sich heutzutage auf einen Gang und gelegentlich ein dolce beschränkte. Sie mochten in einem modernen englischen Dreizimmerhaus in einem Komplex aus identischen Häusern ein wenig außerhalb der Stadt leben (sehr schick und ordentlich, liebste Flavia, hatte Lenny damals zu ihr gesagt), und vielleicht war hier alles ganz anders als in Sizilien (das war es auch), aber die cucina war trotzdem der wichtigste Raum. Ihre Küche und ihr Essen vermochten ihr immer wieder ein Gefühl von Sicherheit zu geben.
»Also, so etwas«, sagte sie. Jedes Mal in ihrem Leben, wenn sie geglaubt hatte, Sizilien losgeworden zu sein, hatte ihre Heimat sie wieder eingeholt. Jetzt waren es Edward und die Villa Sirena, das Haus ihrer Kindheit, obwohl Flavia und ihre Familie natürlich nicht in der großen Villa selbst gelebt, sondern das Hausmeisterhäuschen auf der Rückseite des Anwesens bewohnt hatten.
Was sollte sie sagen? »Er hatte keine Kinder. Vielleicht hatte er das Gefühl …« Ja, was hatte er empfunden? Verantwortung? Hatte er ihrer Tochter die Villa vererbt, um Wiedergutmachung zu leisten, weil er glaubte, etwas falsch gemacht zu haben? Sie zuckte mit den Schultern, denn sie war sich bewusst, dass diese Erklärung Tess nicht zufriedenstellen würde. Tess war schon neugierig auf die Welt gekommen und gab niemals Ruhe, wenn ihr etwas Rätsel aufgab. Und jetzt das. Es war, als hätte Edward gewusst, was für ein Mensch Tess werden würde. Und natürlich stellte sie Fragen.
»Aber er muss doch Verwandte gehabt haben, Muma.« Dieser unschuldige Blick aus blauen Augen …
»Vielleicht nicht.«
Seine Schwester Bea war vor einigen Jahren gestorben, und sie war ebenfalls kinderlos gewesen. Dank Bea hatten Flavia und Lenny das Restaurant Azurro in Pridehaven aufmachen können; sie hatten es geführt, bis sie vor gerade mal zehn Jahren in Pension gegangen waren. Die Arbeit fehlte ihr. Aber jeder musste irgendwann kürzertreten.
»Oder Freunde?«
»Wer weiß?« Flavia begann, die Auberginen zu schneiden. Widerstandslos glitt das Messer durch die glatte dicke Haut und das schwammige Fruchtfleisch. Man musste sie mit Salz bestreuen und eine Weile ziehen lassen, sonst wurden sie bitter.
Edward hatte Freunde gehabt, natürlich. Freunde aus der Kunstszene, vor allem männliche Freunde. Irgendwann hatte sie begriffen, warum sie sich als Mädchen in Edwards Gesellschaft immer so unbefangen gefühlt hatte, sogar wenn sie allein mit ihm war. Ihr wurde auch klar, was es bedeutete, dass man sie überhaupt mit ihm allein gelassen hatte. Heutzutage hätte um seine Homosexualität niemand mehr ein großes Aufheben gemacht, aber damals … In England wären seine Handlungen illegal gewesen, aber auf Sizilien, in einem kleinen Dorf mit einer großen Villa, konnte man sich leicht verstecken. Hier war man in Sicherheit. Es war einfach, jede Menge Hausgäste einzuladen und Partys zu geben. Exzentrische Engländer war man hier gewohnt, wenn man sie auch nicht verstand. Edwards Angestellte waren ihm treu ergeben gewesen, denn die Arbeit bei ihm sicherte ihren Lebensunterhalt, und er behandelte sie gut.
»Vielleicht ist er am Ende ja so etwas wie ein Einsiedler gewesen«, sagte sie ausweichend. Möglich, dass er einsam gewesen war. Das konnte sie sich vorstellen. »So etwas kommt vor, besonders bei Künstlern und Dichtern.«
Tess, die gerade den Wasserkessel füllen wollte, warf ihr einen ungläubigen Blick zu und schnippte sich eine verirrte Locke aus dem Gesicht. »Und die Menschen, die ihn am Ende gepflegt haben?«, fragte sie. »Irgendjemand muss doch Tante Marias Nachfolge angetreten haben.«
Maria … Das Messer blieb über der violetten Auberginenhaut in der Luft hängen. Der plötzliche Tod ihrer Schwester hatte Flavia erschüttert. Sie hatten einander nicht nahegestanden, was sie den Verlust aber noch stärker empfinden ließ. Denn jetzt war es zu spät für eine Versöhnung.
Maria war nur einmal in England gewesen. Damals war Tess achtzehn. Der Besuch war nicht unkompliziert verlaufen. Wahrscheinlich lag es daran, dass ihr Leben so unterschiedlich war; sie hatten sich in grundverschiedene Richtungen entwickelt. Flavia hatte sich schon vor langer Zeit vollständig integriert; inzwischen dachte sie sogar auf Englisch.
Maria war schüchtern gewesen, dunkel und wachsam wie ein Luchs. Die Art, wie Flavia ihre Tochter großzog, schockierte sie. Du erlaubst ihr, allein auszugehen? Zum Tanzen? Argwöhnisch betrachtete sie Flavias Beziehung zu Lenny, ihre beiläufigen Neckereien, den Umstand, dass Flavia ihm nach dem Essen seelenruhig den Abwasch überließ. Und sie konnte nur schwer akzeptieren, dass Flavia jetzt eine Geschäftsfrau war, die ihr eigenes kleines Restaurant leitete, die Buchführung erledigte und ihr Personal dirigierte.
»England ist eben anders als Sizilien«, hatte sie Maria erklärt, wieder und wieder, wie es ihr vorkam. »Wenn du länger bleiben würdest, könntest du es herausfinden. Hier herrscht eine Freiheit, wie du sie dir nie hast träumen lassen.«
»Ja, vielleicht.« Die arme Maria seufzte, runzelte die Stirn und rang die Hände. »Aber Signor Westerman ist allein. Er braucht mich.«
Flavia vermutete, dass Maria eine solche Freiheit in Wirklichkeit gar nicht wollte. Ihre Schwester war nicht mit Kindern gesegnet und hatte vor vielen Jahren ihren Mann bei einem Verkehrsunfall verloren. Sein Motorroller war eines Abends auf einer Kreuzung in Palermo niedergemäht worden.
»Was hat er da nur gemacht?«, klagte sie Flavia bei ihrem Besuch in England mehr als einmal ihr Leid. »Ich werde es nie erfahren.«
Vielleicht, hatte Flavia gedacht, ist das auch besser so. Schließlich lebten sie immer noch in Sizilien.
»Unsere Familie hat sich so viele Jahre lang um Edward gekümmert«, sagte Flavia jetzt mit bewusst gleichmütiger Stimme und warf die runden Auberginenscheiben in ein Sieb, um sie zu salzen. Zuerst Mama, Papa und sie selbst, dann Maria und Leonardo. »Wahrscheinlich ist es seine Art, seine Wertschätzung zu zeigen.« War das wirklich der Grund? Oder hatte Edward Westerman gewusst, wie sehr sie das belasten würde? Sie vermutete, dass es ihm klar gewesen war.
Tess gab Teebeutel in zwei Tassen und sah Flavia fragend an. »Muma?«
»Bitte.« Es hatte zwanzig Jahre gedauert, bis Flavia die englische Tradition des Nachmittagstees verinnerlicht hatte. Jetzt war sie regelrecht süchtig danach. Sie fand allerdings, dass es keinen Unterschied machte, ob man seinen Tee um vier, um fünf oder um sechs Uhr trank. Er würde einen nie so aufmuntern wie ein Espresso, aber er war schon für manches gut.
»Warum hat er das Haus dann nicht dir vererbt?«, beharrte Tess. »Du hast ihn wenigstens gekannt. Ich bin ihm nie begegnet.«
»Pffft.« Flavia tat ihren Einwand ab. »Ich bin eine alte Frau. Wahrscheinlich dachte er, ich sei schon tot.«
»Muma!«
Flavia schüttelte den Kopf. Sie wollte dieses Gespräch nicht führen. Sie hatte versucht, Sizilien hinter sich zu lassen, und war nie mit ihrer Tochter dorthin gefahren. Zuerst, weil es zu schmerzhaft gewesen wäre zurückzukehren, ein zu großes Zugeständnis. Später dann natürlich auch, weil sie sie bestrafen wollte: ihren Vater, dem sie nie verziehen hatte, ihre Mutter, die in ihren Augen einen fast genauso großen Verrat begangen hatte, und sogar die arme Maria, weil sie genau wie die beiden war, weil sie nie verstehen konnte, dass man nur etwas verändern konnte, wenn man kämpfte.
»Muma?« Tess umarmte sie. Flavia roch das Parfüm ihrer Tochter, so süß wie Honig, und in ihrem Haar den schwachen Duft von Orangenblüten. »Du weinst ja.«
»Das kommt von den Zwiebeln.« Mit dem Handrücken wischte sich Flavia über die Augen. »Du weißt doch, dass ich beim Zwiebelschneiden immer weinen muss.«
»Das sind nicht nur die Zwiebeln.«
Ihre Tochter war so einfühlsam. Einen Moment lang schloss Flavia die Augen, um ihre Nähe zu genießen. Die ungezähmte, schöne Tess, der genau wie Flavia in ihrer Jugend in der Liebe übel mitgespielt worden war. Die zu leidenschaftlich liebte, die immer zu viel erwartete. Und die selbst eine unbezähmbare junge Tochter hatte. Aber sie hatte keinen Mann, mit dem sie ihr Leben teilte. Robin zählte für Flavia nicht. Sie mochte nicht einmal an ihn denken. Immer wenn sie an Robin dachte, dachte sie auch daran, ihn mit bloßen Händen zu erwürgen.
»Nein«, pflichtete sie ihr bei. »Es sind nicht nur die Zwiebeln.« Es war die Vergangenheit, es war immer die Vergangenheit. Sizilien war ein dunkles Land. Und wenn es einem im Blut lag, ließ es einen nie wieder richtig los.
»Hattest du Edward Westerman gern?« Tess, die sogar in Jeans feingliedrig und elegant wirkte, ließ ihre Mutter los, um kochendes Wasser über den Tee zu gießen.
Flavia fuhr fort, Zwiebeln, Knoblauch und Chilischoten zu hacken. Sie bereitete eine Tomatensauce für ihre melanzane parmigiana zu, eines der Lieblingsgerichte ihrer Enkelin. »Ja.« Sie hatte ihn gemocht, weil er unkonventionell war. Und er hatte ihr neue Möglichkeiten aufgezeigt.
»Du hast aber nie viel von ihm erzählt.« Der herausfordernde Blick, den Tess ihrer Mutter zuwarf, besagte, dass Flavia über keinen der Menschen aus ihrer Vergangenheit viel erzählt hatte.
Auch das stimmte. Sie hatte Tess weder verraten, warum sie 1950 mit dreiundzwanzig Sizilien verlassen hatte, noch, warum sie niemals dorthin zurückkehren würde. Sie hatte den Erinnerungen an ihre Jugend nicht erlaubt, an die Oberfläche zu steigen und in ihr englisches Leben einzusickern. Sie hatte nicht verzeihen können. Flavia hielt sich einen Moment an der Arbeitsplatte fest, um durchzuatmen.
»Ich helfe dir, Muma.« Tess stand wieder neben ihr.
»Ich bin noch nicht vollkommen hinfällig«, sagte Flavia zu ihr und spürte, wie sich ihr Atem wieder normalisierte. Sie gab das Öl in die Pfanne. »Noch gehöre ich nicht zum alten Blech, weißt du.«
»Eisen«, murmelte Tess und stellte die Teetassen auf den Tisch.
»Eisen, Blech, was auch immer«, grummelte Flavia und gab Knoblauch, Zwiebeln und Chili hinzu. Ihre Tochter war zu pedantisch, das war die Engländerin in ihr. Sie nahm einen Topf und goss das Öl für die melanzane hinein. Sie hatte ihre eigenen Methoden, ihre eigene Arbeitsweise. Sie arbeitete wie eine gut geölte Maschine, pflegte Lenny zu sagen. Und natürlich gab es einige Gebiete, auf denen Sizilien England immer überlegen sein würde. Olivenöl gehörte zum Beispiel dazu. Auf Sizilien war das beste Öl hell und goldfarben, hier war es grün und stärker aufbereitet. Hier fanden die Leute einen seltsam, wenn man Brot oder Toast damit bestrich. Sie zogen tierische Fette vor. Aber in dieser Hinsicht hatte sich Flavia nicht an englische Traditionen angepasst.
Tess beobachtete ihre Mutter. Sie schien unruhig zu sein; ihre langen Finger spielten erst mit den Knöpfen an ihrer Bluse und dann mit dem Teelöffel. »Kannst du mir denn gar nichts anderes über meinen Wohltäter sagen?«, fragte sie vorwurfsvoll.
Flavia schnalzte mit der Zunge. Das Öl in der Pfanne hatte die richtige Temperatur erreicht, und sie ließ die Auberginen hineingleiten. In den anderen Topf gab sie die Tomaten, die sie vorhin geschnitten hatte. Was man nicht wusste, konnte einem nicht schaden. Aber wahrscheinlich verdiente ihre Tochter es, wenigstens etwas zu erfahren. »Wenn du mir etwas parmigiano reiben könntest …«, sagte sie über die Schulter zu Tess.
»Okay.«
Flavia seufzte. »Er hat mir immer vorgelesen«, sagte sie. »Gedichte.«
»Seine eigenen?« Tess drehte sich zu ihr um.
Wieder spürte Flavia diese Schwäche in sich aufsteigen. »Ja, und die von anderen Dichtern. Er mochte Byron und D. H. Lawrence.« Sie lächelte. Edward Westerman hatte ihr von diesen Autoren erzählt, und die junge Flavia hatte ihm staunend zugehört. Ganz offensichtlich hielt Edward viel von Byrons Lebensstil. Oh ja, er hatte Flavia in eine Welt eingeführt, die eine Million Meilen von ihrem Leben auf Sizilien entfernt war. Sie schickte sich an, süß duftendes Basilikum in den Topf zu werfen, hielt dann inne und hörte wieder, wie Edward mit leiser, melodischer Stimme Worte intonierte, von denen sie die Hälfte nicht verstand. Aber die Melodie der Worte – die hatte sie verstanden.
»Klingt, als wäre er ein interessanter Mensch gewesen.« Tess hatte den Käse aus Flavias altmodischer Speisekammer geholt (für manche Lebensmittel ist es im Kühlschrank zu kalt) und rieb ihn auf einen kleinen weißen Teller. »Reicht das?«
»Ja, das ist genug.«
Tess wickelte den Parmesan wieder in das Wachspapier und reichte ihrer Mutter den Teller.
Flavia bemerkte den träumerischen Gesichtsausdruck ihrer Tochter. »Was ist?«, fragte sie.
Tess setzte sich und umschloss die Teetasse mit beiden Händen. »Ich sehe dich nur gerade als junges Mädchen vor mir, nichts weiter.« Zum ersten Mal, doch das sprach sie nicht laut aus. Aber sie streckte die Hand aus, und Flavia spürte, wie ihre Tochter ihr sanft über den Arm strich. »Das ist schön.«
Ja, ja, das wusste sie. Lenny erzählte es ihr ständig. Es ist unfair, ihr nicht zu erzählen, was passiert ist. Es ist deine Geschichte, und sie ist deine Tochter. Das alles ist lange her. Kannst du ihr die Geschichte nicht einfach erzählen und es dann gut sein lassen? Aber Flavia war sich nicht sicher, ob sie je in der Lage sein würde, die Geschichte zu erzählen. Und wie sollte sie sie loslassen?
Mit dem Älterwerden wurde alles komplizierter. Was früher schwarz und weiß gewesen war, hatte viele verschiedene Grautöne angenommen. Sie holte tief Luft. »Edward hat mir geholfen, nach England zu kommen«, erklärte sie. »Vielleicht hat er dir das Haus deswegen vermacht.«
Tess runzelte die Stirn. »Um mich zu ermuntern, England zu verlassen?«
Etwas in Flavia geriet in Panik. »Das würdest du doch nicht tun, oder?« Sie starrte ihre Tochter an.
»Nei … nein.« Tess schaute durch das Fenster in ihren kleinen Garten, in dem es Gartenmöbel, ein Stück Rasen, Sträucher und einjährige Pflanzen gab, also alles, was, wie Flavia vor langer Zeit gelernt hatte, für einen englischen Garten unbedingt erforderlich war. Sie interessierte sich nicht sonderlich für den Garten, denn dafür war Lenny zuständig, der auch jetzt irgendwo da draußen herumwerkelte. Das Fenster stand halb offen, und in der Brise flatterte der gelbe Vorhang wie ein Vogelflügel.
Flavia erkannte den Blick ihrer Tochter, und er gefiel ihr nicht. Sie war in Gedanken weit weg und stellte sich vor, irgendwo anders zu sein. Warum? War sie nicht glücklich hier in Pridehaven?
»Aber …«
»Was, aber?« Die Auberginen waren kurz davor anzubrennen. Automatisch fuhr Flavia herum und hob sie aus dem Öl. Das war noch einmal gut gegangen. Sie legte sie zum Abtropfen auf Küchenpapier und kostete die brodelnde Tomatensauce, während sie immer noch auf eine Antwort von ihrer Tochter wartete. Sie bereitete all ihre Saucen aus frischen Tomaten zu. Bis sie ihr Restaurant aufgegeben hatten, hatte sie sie größtenteils selbst gezogen, in zwei riesigen Gewächshäusern, die sie bei einem Bauern in der Nähe gemietet hatte. Bei Tomaten hing die Qualität vom Boden und vom Klima ab. Wenigstens waren sie hier am Meer; das Salz im Boden hob die Süße der Tomaten hervor. Und Flavia verarbeitete ihre Tomaten erst, wenn sie richtig reif und so rot wie die untergehende Sonne waren. Ah! Ihre Mutter hatte sie gelehrt, dass es für eine gute Küche auf zweierlei ankam: auf Einfachheit und auf die besten, frischesten Zutaten. Das hatte sie nie vergessen. Und trotzdem …
»Aber?«, fragte sie noch einmal.
»Aber ich würde das Haus natürlich gerne einmal sehen«, gab Tess zurück. »Vor allem jetzt, wo es mir gehört.« Sie drehte sich zu Flavia um. »Und ich würde gern sehen, wo du groß geworden bist, Muma.«
Wütend rührte Flavia in der Sauce. Als sie mit Tess schwanger war, hatte sie den Morgen, an dem die Wehen einsetzten, damit verbracht, einen riesigen Topf Bolognese-Sauce zu kochen. »Nestbauinstinkt«, hatte die Hebamme gesagt, als sie ihr davon erzählte. Davon verstand Flavia nichts, aber sie war sicher, dass an dem Tag, an dem sie einmal sterben würde, ein abgedeckter Teigklumpen griffbereit daliegen und darauf warten würde, ausgerollt zu werden. Und ein paar reife Tomaten und Basilikum wären auf halbem Weg in einen Topf.
»Ich verstehe …« Sie versuchte, nicht barsch und gereizt zu klingen, nicht so, als würde sich ihr Herz zusammenkrampfen. »Natürlich.« Warum sollte Tess sich die Villa nicht ansehen? Wovor hatte Flavia solche Angst? Dass Sizilien eine riesige Klaue ausstrecken und ihre Tochter in seine grausame, pechschwarze Mitte ziehen würde? Sie entschied, dass sie eine törichte alte Frau war.
»Außerdem muss ich sogar fahren«, erklärte Tess. Sie schien nicht zu merken, was ihre Worte in ihrer Mutter ausgelöst hatten.
Flavia stand am Herd und war nicht einmal in der Lage, sich umzudrehen. »Warum?« Ihr Herz klopfte zum Zerspringen. Die Knie gaben fast unter ihr nach, und sie hielt sich am Herd fest. Nur eine Sekunde. Gleich würde es wieder vorbei sein. »Warum musst du hinfahren?«
»Es gibt eine Klausel im Testament. Ich muss das Haus erst besuchen, bevor ich entscheiden kann, was ich damit anfange.«
Bevor sie entschied, was sie damit anfangen sollte? Ihre Panik wuchs, aber Flavia rührte weiter. Die Sauce hatte eine schöne Farbe. Ihr ganzes Leben lang hatte das Kochen ihr geholfen; es hatte sie gerettet. Die Tomaten waren eingekocht, ihr Aroma hatte sich intensiviert, und aus dem Topf stieg der köstliche Duft von Tomaten und Chili auf. »Ich verstehe«, sagte sie leise. Und sie begann tatsächlich zu begreifen.
»Ich habe mir die Gegend auf Google Earth angesehen«, erklärte Tess nüchtern, als redete sie von einem Tagesausflug nach Weymouth. »Sie ist wunderschön. Du hast nie erzählt, wie schön es dort ist.«
Flavia stöhnte auf. Sie hatte auch nie erzählt, wo ihr Heimatort lag, oder? Sie zog eine Auflaufform aus dem Schrank. Ihr wurde klar, dass sie früher oder später noch einiges mehr würde erklären müssen.
»Ist es doch, Muma, oder?« Tess’ Stimme klang flehend.
»Ja, es ist schön.« Sie begann, die Form zu füllen: eine Schicht Sauce, dann Parmesan, dann Auberginen. Sauce, Parmesan, Auberginen … Nicht daran denken … Nicht daran denken … Nicht daran denken …
»Ich behalte Ginny im Auge«, hörte Flavia sich sagen, »wenn du die Villa Sirena sehen willst.« Sie hielt kurz inne. »Bevor du sie verkaufst.« Sauce, Parmesan …
»Danke, Muma.« Tess’ Stimme klang jetzt beruhigter.
Denn wenn deine Tochter hierbleibt, wirst du zurückkommen. Doch Flavia sprach es nicht laut aus. Sie öffnete die Tür des Backofens und schob die melanzane parmigiana hinein.
Als Tess und Ginny nach dem Abendessen heimgegangen waren, schmiegte sich Flavia unter ihrer rosa Bettdecke an Lenny. Sie hatten den ganzen Abend über andere Dinge gesprochen, aber Flavia war in Gedanken immer noch in der Vergangenheit gewesen. Jetzt erzählte sie ihrem Mann von dem Gespräch mit Tess.
»Ja, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt.« Auch Lenny war überrascht. »Sie hat gerade ein Haus in Sizilien geerbt und kein Wort davon gesagt?«
»Weil sie es Ginny noch nicht erzählt hat, deswegen.« Lennys Körper fühlte sich warm und tröstlich an. So war es immer gewesen. Flavia fragte sich, was aus ihr geworden wäre, wenn sie Lenny nicht kennengelernt hätte. Er hatte sie immer geliebt, trotz allem.
»Und warum hat sie ihr nichts gesagt?«
»Keine Ahnung.« Vielleicht hatte Tess ja die geheimnistuerische Art ihrer Mutter geerbt. Oder … Flavia erschauerte und spürte, wie Lenny sie fester umarmte. Trotz seiner neunundsiebzig Jahre war er immer noch kerngesund. Gott sei Dank. »Vielleicht wartet sie auf den richtigen Zeitpunkt«, sagte sie.
»So wie du?« Seine Worte waren kaum hörbar, aber Flavia wusste schon, was er sagen wollte, bevor er sie ausgesprochen hatte.
»Ich hatte meine Gründe«, gab sie zurück.
»Und was willst du jetzt tun?«
Flavia schmiegte sich enger an ihn. Bei Lenny fühlte sie sich geborgen, hier war der Platz, wo sie genau richtig war. Lenny kannte sie so gut. Er hatte instinktiv erkannt, dass sich etwas verändert hatte.
»Sie fliegt hin«, erklärte sie. »Ich kann sie nicht davon abbringen.«
Lenny streichelte ihr übers Haar. Heute war es schneeweiß, aber früher war es einmal fast schwarz gewesen. »Für sie ist dieser Ort nicht mit schlimmen Erinnerungen behaftet, Schatz«, sagte er. »Es ist deine Vergangenheit, nicht die von Tess. Sie will nur sehen, wo du groß geworden bist. Das ist vollkommen normal.«
Flavia seufzte. Wenn man es so betrachtete, hatte er natürlich recht. Aber noch etwas anderes war wahr: Ein Ort konnte einen festhalten, verändern und beeinflussen. Und Siziliens Geheimnisse reichten weit zurück. Ob sie unter Verfolgungswahn litt? Vielleicht. Irgendwo hatte sie gelesen, dass niemand so empfindsam war und so feine Antennen für andere hatte wie jemand, der leicht paranoid war. Ach ja, sie war alt. Was wusste sie schon?
»Wovor hast du so große Angst?« Lenny blieb beharrlich. »Was in aller Welt glaubst du, könnte ihr passieren, Liebes?«
»Ich weiß es nicht.« Flavia lachte, doch es klang ein wenig hysterisch.
»Hast du Angst um sie?« Lennys Hand auf ihrem Haar wirkte beruhigend.
Sie spürte, wie sie sich entspannte und den Gedanken losließ.
»Oder um dich selbst?«
Kurz bevor sie einschlief, wurde ihr bewusst, dass er recht hatte. Um dich selbst … Wenn sie etwas tun wollte, musste sie es bald tun. Wie lang hatte sie noch Zeit? Sie musste sich dieser Sache stellen. Tess ging nach Sizilien. Es war so weit.
4. Kapitel
Ginny war scharf auf ihren Friseur. Sie sah ihn nicht so oft, wie ihr lieb gewesen wäre, obwohl sie auch noch zwischen den normalen Terminen zum Haareschneiden im Salon vorbeischaute, um sich gratis den Pony nachschneiden zu lassen. Jetzt sah sie im Spiegel zu, wie er eine ihrer dunklen Haarsträhnen nahm, betrachtete und die Stirn runzelte.
»Was?«, fragte sie und überlegte, ob er sich die Augenbrauen zupfte. Erstaunen würde sie das nicht. Sie hatten eine perfekte Halbmondform.
»Hast du mal eine Haarkur benutzt, wie ich es dir empfohlen habe?« Er verdrehte die Augen, während er die Locke zwischen Daumen und Zeigefinger rieb, und sie kicherte.
Er hatte irre Augen. Irre im Sinne von »Wahnsinn«. Fast dunkelblau. Und er hatte fast schwarzes Haar. Seine Fingernägel, die jetzt durch ihr langes Haar fuhren, waren in einem metallischen Grün lackiert. Es war so eine grauenvolle Verschwendung, dass er schwul war.
Die attraktivsten Jungs waren schwul, das war eine bekannte Tatsache. Sie und ihre beste Freundin Becca mochten bei Männern beide den gleichen Stil und führten eine Liste: Männer mussten gut riechen, vorzugsweise nach Jean Paul Gaultier for men. Sie mussten dunkles Haar haben, am besten mit einem langen Pony, der ihnen bis über die Augen hing und erforderte, dass sie ihn gelegentlich zurückwarfen. Sexy. Vorzugsweise trugen sie Eyeliner, leicht verwischt und verrucht. Sie mussten die richtigen Klamotten tragen, und zwar solche mit Klasse. Und sie mussten groß sein.
Ginny war einszweiundachtzig in Turnschuhen, Becca einssiebenundachtzig. Das war alles andere als komisch. Bis vor Kurzem hatte Ginny beim Gehen die Schultern rund gemacht und nur Ballerinas getragen. Aber seit sie im College Becca kennengelernt hatte, waren hochhackige Schuhe das Größte – je höher und schmaler die Absätze, umso besser. Gemeinsam gehörten die beiden einer höheren Lebensform an. Kriegerinnen. Amazonen.
»Hmmm«, meinte Ginny. Ben hatte das Thema gewechselt und erzählte jetzt von Freitag, als er abends im The Church gewesen war. »Klingt cool.« Sie lächelte und spürte jedes Mal, wenn er ihr Haar berührte, einen köstlichen Schauer.
In solchen Momenten vergaß Ginny die Kugel beinahe. Aber nicht ganz. Die Kugel war sehr fest und saß unterhalb ihrer Kehle und über ihrem Brustbein. Wie etwas Verfilztes. Sie war sich nicht sicher, wie lange sie schon da war. Ungefähr ein Jahr vielleicht. Manchmal schien sie ein wenig zu schrumpfen, bis sie sich nur noch wie Sodbrennen anfühlte und sie schon glaubte, ein paar Rennies könnten damit fertig werden. Aber bei anderen Gelegenheiten wuchs sie und rollte herum, als wolle sie Moos ansetzen oder Schwung sammeln. In solchen Momenten konnte Ginny kaum noch sprechen oder atmen. Dann bekam sie regelrecht Angst.
Sie hatte ihrer Mutter nicht von der Kugel erzählt. Sie hatte keine Lust, zum Arzt geschleppt zu werden, um über Perioden, Sex oder etwas ähnlich Peinliches zu reden. Ihre Mutter würde vermuten, dass sie Bulimie hatte, auf Droge war (zwei der Lieblingsthemen ihrer Mutter) oder einfach verrückt war. Man würde sie untersuchen, ihr vielleicht Glückspillen verschreiben. Nein, sie wagte nicht, etwas zu sagen. Wenn sie die Kugel verdrängte und so tat, als wäre sie nicht da, würde sie vielleicht weggehen.
»Bist du schon mal da gewesen?«, fragte Ben. »Im The Church?«
»Nööö. Ist mir ein bisschen zu prollig.« Becca war immer noch siebzehn. Mit ihrem gefälschten Schülerausweis würde sie nicht in einen Club kommen, der von einem Freund ihres Dads geleitet wurde. Und es waren wirklich nur lauter Prolls da. Jungs in Kapuzenshirts und übergewichtige tätowierte Mädchen in Minitops, aus denen überall weißes Fleisch hervorquoll. Keine Klasse, kein Stil. Sehr, sehr traurig.
»Yeah.« Ben schnipselte weiter. »Da hast du recht.«
Das fühlt sich gut an, dachte Ginny bei sich. Nett.
Sie wäre Ben gerne einmal beim Ausgehen begegnet. Tatsächlich hing sie sogar regelmäßig Fantasien darüber nach. Darin trug sie ihr enges schwarzes Minikleid mit dem breiten Reißverschluss vorn, der vom Ausschnitt bis zum Saum reichte und perfekt zu ihren roten Stilettos passte. Ihre Mutter hatte dieses Kleid als »witzig« bezeichnet und zweifelnd dreingeschaut. Zweifellos hatte sie sich vorgestellt, wie viele Männer an diesem Abend versuchen würden, den Reißverschluss zu öffnen. In Ginnys Fantasie staunte Ben über ihre Verwandlung von der schlaksigen Schülerin zur rassigen, weltgewandten Schönheit. Du bist so toll, murmelte er, während er sich vorbeugte, um ihr ins Ohr zu atmen. So heiß … Ach ja, und in ihrer Fantasie war er nicht schwul.
Aber Ginny konnte nicht so oft ausgehen, wie sie wollte, weil sie fürs College lernen musste und ihre Mum in Bezug auf die Frage, an welchen Abenden sie ausgehen durfte und an welchen sie zu Hause bleiben musste, eine recht altmodische Einstellung vertrat.
Sie rutschte ein bisschen in ihrem Sessel herum. Ihre Beine waren heute Nachmittag nackt. Sie waren das Beste an ihr. Daher hatten sie und Becca sich für hoch ausgeschnittene Jeans-Shorts entschieden, und sie wollte nicht, dass ihr etwas Peinliches passierte, wie zum Beispiel an dem schwarzen Leder festzukleben. Sie hatte ihre Beine eine Stunde lang rasiert, bis sich die Haut wund anfühlte, daher war sie ziemlich zuversichtlich, dass keine Stoppeln zu sehen waren. Ihre Achselhöhlen allerdings fühlten sich verdächtig feucht an. Sie musste auf alle Fälle daran denken, die Hände nicht höher als bis zur Taille zu heben.
»Und? Was hast du sonst noch so gemacht?«, fragte sie, auch wenn er ein hoffnungsloser Fall war.
»Party, schätze ich«, antwortete er. »Ich hab letzte Woche mit meiner Freundin Schluss gemacht, und mein Kumpel Harley hat aus dem Anlass eine Riesenparty geschmissen.«
»Wie bitte?« Sie hatte wohl nicht richtig gehört. Freundin …? Ginny klammerte sich an die Armlehnen.
Er wiederholte seinen Satz.
»Cool.« Innerlich kreischte Ginny geradezu. Er hatte eine Freundin gehabt. Er war nicht schwul, wenigstens momentan nicht. Es sei denn, er gestand es sich nicht ein. Das war jedenfalls eine großartige Nachricht. Sie konnte es kaum erwarten, Becca davon zu erzählen. »Gib mir fünf«, murmelte sie.
»Bitte?« Er beschäftigte sich konzentriert mit dem Haar in der Nähe ihres Ohrs. Hoffentlich waren ihre Ohren sauber.
»Nichts.« Sie versuchte, ihn nicht anzustarren, aber etwas musste man ja ansehen, wenn man die Haare geschnitten bekam, und allzu viel Auswahl hatte sie nicht. Spiegel. Haarprodukte. Ihr eigenes Gesicht. Ben war bei Weitem die beste Aussicht. »Tut mir leid wegen deiner Freundin«, setzte sie hinzu.
»Mir nicht.« Er grinste sie an.
Ginny zog den Bauch ein. Die Kugel lag immer noch auf der Lauer. Aber wenigstens war sie geschrumpft. Und wenn man ihrer Mutter glauben wollte, hatte sie Nonnas »schwarze sizilianische Augen« geerbt. Die wenigstens mussten doch sexy sein, oder? Leute sagten ihr ständig, sie solle Model werden, und wenn sie Mut hätte, würde sie das wahrscheinlich tun. Sie sollte das College verlassen (obwohl ihre Mutter sie dann wahrscheinlich umbringen würde), nach London ziehen und sich bei einer Agentur anmelden. Das konnte doch nicht so schwierig sein.
Aber sie würde es nicht tun. Ginny versuchte zu schlucken und spürte den gewohnten Kloß in der Kehle. Sie würde es nicht tun, weil sie so etwas einfach nicht tun konnte. Sie würde zur Uni gehen müssen, weil … na ja, weil alle das von ihr erwarteten.
Schnipp, schnipp. Ben betrachtete sie im Spiegel. Ginny wurde es heiß. Was stimmte bloß nicht mit ihr? Jetzt, wo er nicht mehr schwul war, konnte sie nicht mal mit ihm reden. Seine Finger streiften ihren Nacken, und eine Gänsehaut lief über ihren ganzen Körper, wobei sie, wie jeder hätte zugeben müssen, eine ziemlich lange Strecke zurücklegen musste. Also, war ihr jetzt heiß oder kalt oder was? Alter Finne, wahrscheinlich »oder was«.
Zum millionsten Mal fragte sie sich, wie es wohl war. Wie war es, wenn man es machte? Es richtig mit einem Jungen machte? Die meisten ihrer Freundinnen hatten wenigstens schon mehr oder weniger ernsthaft herumgeknutscht; Becca hatte es schon gemacht. Aber Becca war Mums Meinung nach auch ein wenig freizügig. Oder, wie Mum sich ausgedrückt hatte, ordinär. Sie war nicht dünn, ganz im Gegenteil, aber dafür hatte sie etwas, was Ginny sich mehr als alles andere wünschte, sogar noch mehr als Bens Hände auf ihrem Hals, wenn auch nicht mehr, als dass die Kugel verschwand: Brüste.
Ginny hatte eine private Theorie, dass ernsthaftes Herumknutschen intimer war, als es richtig zu machen, aber sie wollte das nicht laut sagen. Es konnte ja sein, dass es noch etwas gab, was sie nicht wusste. Aber solange man noch nicht beides gemacht hatte … War sie eigentlich unter den Mädchen ihres Alters in Pridehaven das einzige, das noch Jungfrau war? Manchmal hielt sie das für sehr wahrscheinlich. Und es war ihre eigene Schuld, weil sie sofort wegrannte, sobald sie nur den Hauch einer Gelegenheit bekam. Es war einfach so, dass alle Jungs … Nun, sie stand eben auf keinen von ihnen.
Sie mochte sich wirklich nicht bildlich vorstellen, wie Becca … Aber andererseits konnte man manchmal, wenn man Becca ansah, nicht anders. Das war es wahrscheinlich, was ihre Mutter gemeint hatte. Ginny wollte es dennoch hinter sich bringen. Wahrscheinlich wollte sie es einfach wissen. Ahnungslosigkeit war so bemitleidenswert.
»Vielleicht«, sagte Ben, als hätte er ihre Gedanken gelesen, »könnten wir beide ja mal was trinken gehen.«
Hatte er sie gerade um eine Verabredung gebeten? Dieser traumhafte Kerl, der einen Mund hatte wie Joker aus Batman und an dem sogar ein metallic-türkiser Eyeliner ausgesprochen männlich wirkte? Ginny versuchte, ruhig zu bleiben. Aber plötzlich hatte sie ein Gefühl, als hätte ihr jemand all das geschenkt, was sie sich auf der Welt am meisten wünschte, alles in einem einzigen, herrlichen Schwung – diese Jeans bei Top Shop, die sie sich nicht leisten konnte, Schokoladenkekse von M & S; Kentucky Fried Chicken im Brötchen und Eis mit Kuchenteiggeschmack. Okay, das waren größtenteils Sachen zum Essen, aber hey, das war ihr Problem, und sie würde damit schon klarkommen. Und all das hatte sie am Hide Beach bekommen, bei strahlendem Sonnenschein, an einem Tag, an dem sie keine Pickel im Gesicht hatte, ihren Zebra-Bikini trug und sich TOLL fühlte. Wenn nur …
»Yeah«, gab sie zurück. »Könnten wir wohl.«
Er schnitt einen kleinen Zacken an ihrem Pony ab. »Cool. Lass uns mal die Handynummern austauschen.«
»Okay.« Ginny sah zu, wie er ihr Haar mit den Fingern auflockerte. »Ich gebe bald eine Fete«, fügte sie plötzlich hinzu. Ihre Mutter hatte ihr erst gestern Abend gesagt, dass sie verreisen würde. Aber wie lange brauchte man schon, um eine Party zu planen? In diesem Fall ungefähr zwanzig Sekunden.
»Kommst du auch zurecht, Ginny?«, hatte ihre Mutter gefragt. »Es ist nur für eine Woche. Nonna und Pops wohnen in unserer Straße, und Lisa ist gleich nebenan. Wenn du nicht allein sein willst, kannst du auch bei Nonna übernachten.«
Na toll. Was glaubte sie, wie alt Ginny war? Zehn? Sie liebte es, das Haus für sich zu haben, obwohl das nicht oft vorkam. Ihr Problem würde ja gerade sein, dass Nonna und Pops in ihrer Straße wohnten (obwohl sie süß waren und Nonna eine tolle Köchin war) und dass Lisa gleich nebenan lebte.
»Mit wem fährst du denn in Urlaub?«, hatte sie ihre Mutter gefragt und ihre Unschuldsmiene aufgesetzt.
Wie beabsichtigt löste sie damit Schuldgefühle bei dieser aus. »Ach, Ginny, ich würde dich so gern mitnehmen. Aber du hast ja noch so viel für deine Prüfungen zu lernen …«
»Ist schon okay.« Ginny zuckte mit den Schultern. »Aber vielleicht lade ich abends mal ein paar von den Mädels ein. Das ist doch okay, oder? Wir würden wahrscheinlich Pizza bestellen und einen Film ansehen.« Falls die Party außer Kontrolle geriet (was wahrscheinlich war) oder einer ihrer Aufpasser merkte, dass sie außer Kontrolle geraten war, dann würde die Sache viel leichter zu erklären sein, wenn ihre Mutter wusste, dass sie Freunde einladen wollte. Energisch unterdrückte sie den Anflug von schlechtem Gewissen, der immer auftauchte, wenn sie ihre Mutter belog. Ginny liebte sie, natürlich. Und sie wusste, wie viel ihre Mutter für sie getan und was sie geopfert hatte. Aber manchmal hatte sie trotzdem Lust, sie zu bestrafen. Einfach weil … Ach, wegen nichts eigentlich. So war das nun mal.
»Natürlich ist das in Ordnung.« Ihre Mutter wirkte zerstreut. »Und wen …?«
»Was sagtest du noch, mit wem du fliegst?«, schnitt Ginny ihr das Wort ab.
»Ach, ich bin mir nicht sicher«, antwortete ihre Mutter ausweichend, was bedeutete, dass sie mit Robin fliegen wollte. »Vielleicht allein.« Was ebenfalls bedeutete, dass sie vorhatte, Robin mitzunehmen, diesen Loser.
Aus irgendeinem für Ginny nicht ganz nachvollziehbaren Grund war ihrer Mutter nicht klar, dass sie über Robin Bescheid wusste. Dabei hatte sie ihn ihr sogar vorgestellt, als Lisa und Mitch dabei waren, und zwar auf die ihrer Mutter eigene vorsichtige Art, als könne Ginny statt Hallo einfach Wer zum Teufel sind Sie denn? sagen und damit ihre Mutter für alle Ewigkeit blamieren. Obwohl die Vorstellung reizvoll gewesen war, hatte sich Ginny höflich verhalten und sämtliche vorhersehbaren Fragen über College und Uni beantwortet, ohne ein einziges Mal aus der Rolle zu fallen. »Was für ein nettes Mädchen«, hatte er gesagt, und sie konnte den erleichterten Seufzer ihrer Mutter beinahe hören. Bastard!
Ihre Mutter ahnte nicht, dass Ginny es bemerkte, wenn Robin am Nachmittag da gewesen war. Sie wusste, wann sie das Bett genommen hatten, dann waren nämlich die Vorhänge in Mums Schlafzimmer viel zu ordentlich zurückgezogen, und es standen zwei Weingläser auf dem Nachttisch. Wenn sie es auf dem Sofa gemacht hatten, waren die Kissen aufgeschüttelt, der Couchtisch war leicht verrückt, und es standen zwei schmutzige Kaffeetassen darauf. Über letztere Variante dachte Ginny allerdings nicht gern nach.