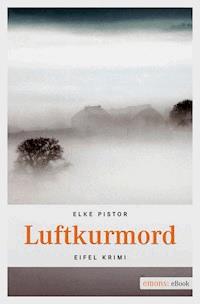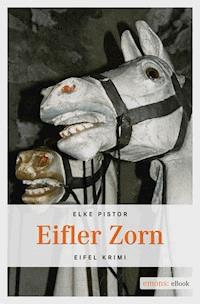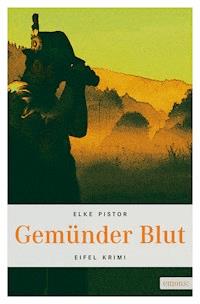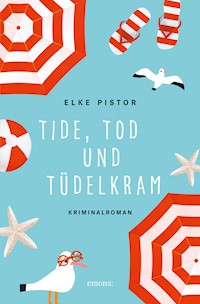Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein Cosy-Krimi mit ganz viel Herz und Humor. Den Geist der Weihnacht hatte sich Josefine Jeschiechek ganz anders vorgestellt. Dass er in Form ihrer ermordeten Schwester im glitzernden Engelskostüm vor ihr steht, irritiert sie noch mehr als der Umstand, deren florierende Weihnachtsmann-Agentur geerbt zu haben. Aber auch hier ist nicht alles Lametta, was glänzt. Warum verschwindet ein Mitarbeiter nach dem anderen,und wer verbirgt sich hinter dem Decknamen »Zwarte Piet«? Schnell wird Josefine klar: Jemand hat es auf die Agentur abgesehen – und auf ihr Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elke Pistor, Jahrgang 1967, studierte Pädagogik und Psychologie. Seit 2009 ist sie als Autorin, Publizistin und Medien-Dozentin tätig. 2014 wurde sie für ihre Arbeit mit dem Töwerland-Stipendium ausgezeichnet und 2015 und 2023 für den Friedrich-Glauser-Preis in der Kategorie »Kurzkrimi« nominiert. Elke Pistor lebt mit ihrer Familie in Köln.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung der Motive von shutterstock.com/ekler, shutterstock.com/Srithana – studio
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-124-9
Ein Weihnachtskrimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln.
Gibt es eine bessere Form, mit dem Leben fertig zu werden, als mit Liebe und Humor?
Charles Dickens
1
Zu sterben war für Beate Silberzier ein vollkommen neues Erlebnis. Ein Aspekt, den sie unter anderen Vorzeichen sicherlich begrüßt hätte, denn sie war ein von Natur aus vielseitig interessierter und durchaus auch wagemutiger Mensch. Zumindest hätte sie sich, wäre sie darum gebeten worden, so beschrieben. Ansonsten hätte sie sich vor sechs Jahren bestimmt nicht darauf eingelassen, einen vor sich hin dümpelnden Weihnachtsmann-Mietservice zu übernehmen. In einem Alter, in dem andere bereits sehnsuchtsvoll auf den Silberstreif der Rente am Zehnjahreshorizont blickten, war sie zur Jungunternehmerin geworden. Auch wenn sich das »jung« definitiv auf die Agentur und nicht auf ihre Person bezog. Mit vierundfünfzig war man nicht mehr jung. Man fühlte sich höchstens so oder redete es sich ein. In diesem Alter auf das Äußere bezogene Adjektive wie »flott« und »frisch« oder Zuschreibungen wie »Weltenkenntnis« und »Erfahrungsvielfalt« waren bei genauerer Betrachtung keine Komplimente.
Wobei, wenn sie ehrlich zu sich war, war das Ganze damals ohnehin kein auf Erfahrung und Kenntnis aufbauendes Geschäftsunternehmen gewesen, sondern eine spontane Aktion, bei der eine rasch eskalierende Party und erhebliche Mengen an prickelndem Prosecco eine Rolle gespielt hatten. Was musste sie sich auch immer auf idiotische Wetten einlassen? Sich schneller als der Wettgegner aus dem Weihnachtsmannkostüm heraus- und in ein Engelskostüm hineinzuwurschteln, brachte in der Regel keine Vorteile im Leben.
Aber da Beate seit jeher lieber auf die Ausnahme statt auf die Regel setzte, hatte sie nicht nur die Wette, sondern auch den Einsatz gewonnen. Sie hegte allerdings den dringenden Verdacht, dass der Verlust für ihren Wettgegner gar keiner gewesen war, vor allem, als sie die Geschäftsberichte sah. Überhaupt machte er einen sehr erleichterten Eindruck, als er ihr den Schlüssel übergab und erklärte, erst einmal für ein paar Monate ins Ausland zu verreisen. Die kleine Miete für Laden und Wohnung solle sie auf ein Konto auf den Seychellen überweisen. Und nein. Eine Nachsendeadresse gebe es nicht.
Was sie hingegen sehr überrascht hatte, war der Erfolg. Nach einem frischen Anstrich für die Büroräume, der Umbenennung der Agentur von »Weihnachtsmann-Mietservice« in »Ho! Ho! Ho! – Die Leihnachtsmänner« und einigen Flyern in den Briefkästen von Titzelsee hatten sich die Auftragsbücher in erstaunlich kurzer Zeit gefüllt. Möglicherweise trug auch eine kreative Erweiterung des Portfolios dazu bei. Dem saisonal gebundenen Angebot »Traditioneller Weihnachtsmann«, das es mit und ohne Geschenkeservice gab, hatte sie die Figur »Lieblicher Rauschgoldengel« zur Seite gestellt, für die sie nur echte Blondschöpfe engagierte. Darüber hinaus standen nun auch »Feen«, »Elfen« und »Hexen« – wie auch die Engel jeweils als Männlein oder Weiblein – sowie eine »Ruprechtine« im eher knappen Gewand, aber niemals ohne Rute zur Auswahl. Letztere wurde ebenso wie der »Wichtel«, den es sowohl in einer Version für Kindergeburtstage als auch für Junggesellinnenabschiede gab, ganzjährig gut gebucht.
Den Start ins Geschäftsfrauenleben auf jeden Fall erleichtert hatte die tatkräftige Unterstützung von Bernhard Rösner, seines Zeichens ihr dienstältester Weihnachtsmann-Darsteller. Ihn hatte sie vom Vorbesitzer der Agentur übernommen, weil man nun mal Weihnachtsmann-Darsteller brauchte, wenn man den Weihnachtsmann darstellen wollte. Darüber hinaus war Bernhard Rösner die beste aller möglichen Besetzungen. Der Urvater aller Weihnachtsmann-Lookalikes sozusagen. Er brauchte weder ein Kissen unter dem roten Mantel noch künstliches Wangenrot, um dem apfelbäckigen Klischeebild des Santa Claus hundertprozentig zu entsprechen. Seine tiefe, dröhnende Stimme ließ die Kinder schon beim ersten »Ho!« vor Ehrfurcht erstarren, und sein langer weißer Bart hielt jeglicher Zugprobe durch patschige kleine Hände stand. Einmal konnte sie ihn sogar überzeugen, sich als vom Kunden gewünschter Wikingerkönig zu verdingen, und auch da hatte er – mit braunem Fell statt rotem Mantel, schwarz umrandeten Augen und vielen Flechtzöpfen im Bart – einen beeindruckenden Auftritt hingelegt.
Dass Mut, Ideenreichtum und gutes Aussehen allerdings nicht alles waren, was eine erfolgreiche Geschäftsfrau brauchte, musste Beate Silberzier etwa vier Monate nach der Agenturübernahme erfahren. Denn obwohl sie auf diese drei Dinge im Übermaß zurückgreifen konnte, ließ sich das Finanzamt davon nicht beeindrucken. Es wollte Zahlen. Am besten aktuelle, korrekte und diese auch noch prompt. Die sehr höfliche, aber gleichermaßen bestimmte Dame am anderen Ende der fiskalischen Telefonverbindung verweigerte rigoros jegliche Diskussion darüber, ob sich diese Zahlen gegebenenfalls im Laufe der nächsten Monate nachreichen ließen.
So stieß Candan Aydin zu den Leihnachtsmännern, und Beate befand bereits nach zwei Wochen, sie sei ein Geschenk. Nicht nur, weil die junge Frau das Zahlenwerk so meisterlich beherrschte, wie das Finanzamt es verlangte, sondern weil sie mit ihrer freundlichen und fröhlichen Art jeden zum Strahlen brachte. Es dauerte zwar fast genauso lange, bis alle in der Lage waren, ihren Vornamen richtig auszusprechen – mit weichem »Dj« am Anfang statt eines harten K –, aber Candan erwies sich diesbezüglich als sehr geduldig und zudem überaus freundlich schwierigen und/oder begriffsstutzigen Zeitgenossen gegenüber, was vermutlich auch die Basis ihres versierten Umgangs mit den Steuereintreibern war.
Vervollständigt wurde das Personalportfolio durch Bärbel Rosenbusch, ihres Zeichens begnadete Märchenerzählerin, Vorleserin und Puppenspielerin. Sie war der Star auf unzähligen Schul- und Gemeindefesten und auf Geburtstagen von Kindern, deren Eltern mehr Wert auf Dickens als Disney legten. Gemeinsam stellten sie, Bärbel, Candan Aydin und Bernhard Rösner das Kernteam der Agentur. Hinzu kam eine je nach Jahreszeit unterschiedlich große Menge an Studierenden, Hausfrauen und -männern sowie Rentnerinnen und Rentnern, die mit Darsteller-Jobs ihre Kassen aufbesserten.
Beate Silberzier war mit sich, der Agentur und ihrer allgemeinen Situation sehr zufrieden. Nach Jahren des rastlosen Suchens hatte sie endlich eine Aufgabe gefunden, die ihr Spaß machte. Mehr noch und viel wichtiger: eine Aufgabe, die sie nicht langweilte. Und darüber hinaus noch so etwas wie eine Ersatzfamilie. Für ein selbst produziertes Grüppchen in der Eltern-Kind-Version hatte sich in ihrem Leben nie die richtige Gelegenheit ergeben, was Beate in ihren seltenen sehr stillen Momenten bedauerte, aber niemals als Manko betrachtete.
Und so freute sie sich bereits sehr auf ihren sechzigsten Geburtstag, den sie drei Tage vor Heiligabend mit einer grandiosen Party im erweiterten Kreis ihrer Lieben, Angestellten und der Kundschaft zu zelebrieren beabsichtigte.
Ihr Tod war zu diesem Zeitpunkt Ende Oktober also nicht nur unerwartet, sondern, wie Beate befand, auch außerordentlich ärgerlich und vor allem ganz und gar nicht akzeptabel, weswegen sie ihn einfach ignorierte.
EINKAUFSLISTE:
Vogelsand
Kolbenhirse
Kressekörbchen
2 Äpfel
2 x weißer Joghurt
½ Pfund Graubrot
3 Scheiben Holländer
2 Scheiben gek. Schinken
6 Eier
2 x Hühnersuppe (kleine Dosen/Angebot?)
Gesichtscreme (günstig)
Gartenhandschuhe
Kreuzworträtselheft
1 Flasche Sekt
1 Piccolo
1 Liter Apfelsaft
Schokolade
Möhren
»Ja. Natürlich habe ich dafür Verständnis, Florian.« Josefine Jeschiechek klemmte ihr Mobiltelefon zwischen Ohr und Schulter und versuchte, mit beiden Händen die Blumenzwiebeln wieder einzusammeln, die aus dem umgestürzten Eimer gerollt waren. »Ja, Schatz. Kein Problem, wenn es Clara zu viel ist, einen Gast aufzunehmen mit dem Baby. Du musst da auf deine Frau Rücksicht nehmen. Ihr könnt mich im Sommer besuchen kommen. Das wäre schön. Die Kleine wächst so schnell, und sie soll ihre Oma doch kennenlernen.« Sie beugte sich vor, um eine weiter entfernte Zwiebel zu erreichen, verlor das Gleichgewicht und landete mit dem Knie in einer matschigen Erdvertiefung. Das lehmige Wasser drang kalt und nass durch ihre Gartenhose. »Mist.«
Sie rappelte sich hoch.
»Was?« Sie hatte Mühe, das Handy nicht zu verlieren. »Nein. Das galt nicht dir, mein Junge. Ich bin im Garten.« Mit der freien Hand versuchte sie, den gröbsten Dreck abzuwischen, erreichte aber nur das Gegenteil. »Deine Schwestern? Sarah ist doch mit ihrem Freund in den USA. Die Reise haben sie schon so lange geplant und mussten sie immer wieder verschieben. Hat sie dir das nicht erzählt?«
Josefine Jeschiechek beschloss, die klamme Kälte an ihren Beinen auszuhalten. Es gab Schlimmeres. Die Tatsache zum Beispiel, dass ihre jüngste Tochter, Lea, es vorzog, Weihnachten bei ihrem Vater und dessen ehebrecherischer Freundin zu verbringen. Sie hatte sich erstaunlich schnell an die veränderten Umstände gewöhnt. Immerhin war Christian erst im letzten Jahr ausgezogen. Zwei Wochen vor Weihnachten hatte er ihr nach dreißig Jahren und drei Kindern einseitig die Ehe aufgekündigt, um zu seiner neuen »Partnerin«, wie er es formulierte, zu ziehen. Er wolle das Leben noch genießen.
Dass sein Zukunftsplan ihre, Josefines Beteiligung ausschloss, bedauerte sie weniger, als sie erwartet hätte. Im Gegenteil. Sie empfand es als Erleichterung, sich nicht mehr nach seinen Launen und Bedürfnissen richten zu müssen, und hatte endlich ihre Ruhe. Wenn keines der Kinder sie zu Weihnachten besuchen würde, müsste sie auch nicht den Aufwand mit der Dekoration betreiben. Christian hatte immer sehr viel Wert auf Weihnachtsschmuck gelegt. Schon im Advent sollten Kränze, Kerzen und Kiefernzapfen an roten Schleifen nach und nach die Wohnung erobern. Natürlich lag das in ihrer Verantwortung, auch wenn sie diesem Dekokram noch nie etwas hatte abgewinnen können. Weihnachten war für sie in erster Linie ein Fest für die Kinder. Wenn sie ehrlich war, mochte sie es im Grunde genommen gar nicht.
»Lea feiert mit eurem Vater in irgendeinem angesagten Skiresort. Er hat sie eingeladen, sagt sie.« Josefine nahm den Eimer und den Spaten und ging ein paar Schritte weiter. Auch hier konnte der Garten noch einen kleinen Farbfleck fürs Frühjahr vertragen. »Euch hat er doch den Kinderwagen bezahlt und Sarahs Reisekasse kräftig aufgefüllt.«
Christian und sie hatten immer darauf geachtet, die Kinder gleichzubehandeln. Das hatte sich auch nach der Trennung nicht geändert. Dass sie ihren Exmann nun reflexartig gegen den etwaigen, noch nicht einmal ausgesprochenen Vorwurf des Ungerechtbehandeltwordenseins ihres Erstgeborenen verteidigt hatte, ärgerte sie jedoch. Sollte er sich doch selbst mit den Ansprüchen seines Nachwuchses auseinandersetzen.
»Ich muss jetzt auch weitermachen, sonst schaffe ich meine Arbeit nicht. Ich habe sehr viel zu tun.«
Sie beendete das Telefonat und schob ihr Handy in die Jackentasche. Letzteres war schlicht gelogen gewesen. Sie hatte nicht viel zu tun. Genau genommen hatte sie fast gar nichts zu tun, aber das wollte sie Florian nicht unbedingt wissen lassen. Der Grund für ihre Untätigkeit schmerzte sie mehr als das Ende ihrer Ehe, und beides war durchaus vergleichbar: Ihr Chef hatte sie vor einer Woche in sein Büro gebeten, ihr für ihre langjährige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit gedankt und ihr dann mit großem Bedauern die Kündigung auf den Tisch gelegt, weil der Betrieb zum Jahresende geschlossen werden würde.
Sie hätte es kommen sehen müssen. Immerhin herrschte sie schon länger über die Buchhaltung der Firma, als sie mit Christian verheiratet war. Sie hatte die Zahlen also im Blick gehabt, und die waren nicht gut, aber auch nicht hoffnungslos gewesen. Es durfte nur nichts Unerwartetes geschehen, damit das klapprige Gerüst aus Aufträgen, Außenständen und Liquidität nicht in sich zusammenstürzte. Den Ausschlag gegeben hatte schließlich, dass der potenzielle Nachfolger ihres Chefs abgesprungen war, nachdem der Letzte der Großkunden vor zehn Tagen seinerseits Insolvenz anmelden musste. Und so hatte ihr Chef zumindest seine Schäfchen für den Ruhestand ins Trockene bringen wollen und machte kurz entschlossen Nägel mit Köpfen und die Firmentür dicht. Letzte buchhalterische Abwicklungsarbeiten würde der Steuerberater der Firma erledigen. Für sie gab es nichts mehr zu tun. Als sie ihr Büro zum letzten Mal verließ, hatte sie weinen müssen.
Im Anschluss hatte Josefine sich zwei Tage der Trauer gestattet, in denen sie aus dem Fenster der Küche gestarrt und ihren Tee hatte kalt werden lassen. Danach war sie wieder aktiv geworden, denn sie wollte und musste ihr eigenes Geld verdienen und durfte sich auf keinen Fall gehen lassen. Christians Großzügigkeit schloss sie nicht mit ein. Er hatte ihr zwar generös das Haus überlassen, allerdings nur zur kostenlosen Nutzung. Im Grundbuch standen sie nach wie vor gemeinsam. Darüber hinaus hatte sie nach Ablauf des Trennungsjahres keine Chance auf Unterhalt von ihm. Also hatte sie angefangen, ihre Bewerbungsunterlagen zusammenzustellen.
»Einundzwanzigtausend Tage.« Josefine Jeschiechek lauschte dem Klang der Worte hinterher. Auch wenn ihr bis zu diesem einundzwanzigtausendsten Tag noch ein gutes halbes Jahr fehlte, wusste sie, dass das Geburtsdatum in ihrem Lebenslauf sie nicht zu einer Kandidatin der ersten Wahl machte. »Siebenundfünfzig Jahre, fünf Monate und vier Wochen, Stand heute.«
So hörte es sich noch erschreckender an. Rein statistisch blieben ihr noch sechsundzwanzig Jahre bis zum Ableben, die sie irgendwie sinnvoll füllen musste, wobei die Perspektive, am ersten Oktober des Jahres 2033 in den Rentenstand überzugehen, etwas Struktur versprach. Doch um in die Rente zu wechseln, brauchte sie erst einmal wieder eine Arbeitsstelle.
Josefine Jeschiechek stemmte die Hände auf die Stelle ihres Körpers, an der die Natur eigentlich eine Taille vorgesehen hatte. Noch eine der Baustellen, denen sie sich widmen musste. Ihr Nervenkostüm war deutlich dünner als ihre Statur. Aber täglich frisch und gesund für eine einzelne Person zu kochen, wenn diese Person nur sie selbst war, erschien ihr übertrieben. Fertiggerichte sparten Zeit, Aufwand und die Beschäftigung mit der Frage, warum sie sich beides nicht wert war. Leider wimmelten sie auch vor Kohlenhydraten und Kalorien.
Sie stellte den Eimer ab, ging in die Hocke und rammte die Grabgabel in die lehmige Erde. Der Boden fühlte sich an wie Beton. Energisch stach sie erneut hinein, konnte aber nur ein kleines Stück herausbrechen. Wütend schlug sie gegen den Griff des Werkzeugs. Hatte sich jetzt auch noch ihr Garten gegen sie verschworen? Sie schloss die Augen, atmete tief ein und aus und legte den Kopf in den Nacken.
»Das ist kein Grund, die Beherrschung zu verlieren, Josefine«, murmelte sie.
Wie zur Antwort raschelte es im Gebüsch neben ihr. Sie blinzelte, schaute in die Richtung und versuchte, in dem Dickicht etwas zu erkennen. Wieder ein Rascheln, dann eine Bewegung. Ein Tier. Eine Ratte? Josefine lächelte, als sie erkannte, dass es keine Ratte, sondern eine Katze war, die da auf sie zukam und sich mit einer Armlänge Abstand vor ihr auf den Boden setzte. Das Tier fixierte sie mit grünen Augen, blinzelte mehrfach und schnurrte. Es klang wie ein Motor mit Startproblemen. Josefine erwiderte automatisch das Blinzeln, dann zögerte sie, sah genauer hin. Das konnte doch nicht sein.
Die Katze hob die Pfote, putzte ihre Schnurrbarthaare und schaute Josefine interessiert an, bevor sie aufstand, an Josefines Beinen entlangstrich, ohne sie zu berühren, und wieder im Unterholz verschwand. Josefine sog scharf die Luft ein, starrte dem Tier hinterher. War vielleicht doch alles etwas zu viel für sie? Beeinflusste seelischer Stress die Wahrnehmung?
Sie dachte an die Visitenkarte der Psychologin in ihrer Handtasche. »Anpassungsstörung« hatte die es genannt. Sie war genau dreimal dort gewesen. Einmal zu einem Vorgespräch, einmal zu einem regulären Termin und das letzte Mal, um der Psychologin zu sagen, dass sie ihre Probleme immer noch am besten allein in den Griff bekam. Womöglich war das ein Fehler gewesen.
Sie kannte das Tier. Ein Kater, unverwechselbar mit seinem halben Ohr und der abgeknickten Schwanzspitze. Beides Resultate heftiger Kämpfe mit seinen Artgenossen. Wilhelm war ein Kater, wie er im Buche stand. Gewesen. Bis zu seinem Tod vor mehr als fünf Jahren. Sie hatte um ihn getrauert wie um ein Kind, hatte tagelang geweint und noch Wochen später bei dem Gedanken an ihn einen dicken Kloß im Hals verspürt. Christians Unverständnis hatte sie verletzt, aber nicht verwundert. Er bezeichnete sich zu Recht als eher sachlichen Typ. Nüchtern hätte es auch getroffen oder, wie sie es heute formulierte, kalt und herzlos.
Vom Haus drang das dumpfe Geräusch der Türklingel zu ihr herüber. Mehrfach hintereinander, so als wäre es nicht der erste Versuch desjenigen, der da Einlass wünschte. Es dauerte einige Sekunden, bis Josefine in der Lage war, seine Bedeutung zuzuordnen. Sie riss sich vom Anblick des Strauchs, in dem der Kater verschwunden war, los, wandte sich ab und ging zur Terrassentür. Bestimmt hatte sie das Tier verwechselt. Wilhelm war nicht der einzige rote Kater mit Kampfverletzungen. Sie schüttelte den Kopf, streifte ihre Gartenschuhe ab und betrat auf Socken das Wohnzimmer.
»Sitz, Hasso!«, rief sie dem Wellensittich zu, der in seinem bodentiefen Käfig über die Stangen randalierte, während sie zur Haustür eilte. Zumindest ihn bildete sie sich nicht ein. Der Letzte in einer langen Reihe von »Tiere-sind-gut-für-die-Entwicklung-der-Kinder«-Hausgenossen. Sie liebte ihn nicht nur wegen der vielen schönen Erinnerungen, auch wenn er eine Menge Dreck und Arbeit machte. Sie musste unbedingt daran denken, für ihn eine kleine Auswahl an frischem Obst einzukaufen.
»Ja bitte?«
Der Mann riss den Blick von der Fußmatte los und sah sie an. Er trug einen dunklen Wollmantel und hatte eine Aktentasche unter den Arm geklemmt.
»Frau Josefine Jeschiechek?«
»Was möchten Sie?«
»Ich konnte Sie leider nicht telefonisch erreichen, und auf meine Mails wurde ebenfalls nicht reagiert.« Er streckte ihr seine Hand entgegen. »Mein Name ist Kessler von der Erbenermittlung Kessler und Maierbrink.«
Josefine überlegte. Der Name der Firma kam ihr bekannt vor. Sie hatte die Betreffzeilen der E-Mails nur flüchtig gelesen, bevor sie sie in den Spamordner verschoben hatte. Wirres Zeug von irgendwelchen Erbschaften plötzlich aufgetauchter Verwandter. Im nächsten Schritt hätte man sie sicher um die Überweisung einer im Vergleich zur Erbschaft lächerlich kleinen Summe gebeten, damit der unermessliche Reichtum auch den Weg zu ihr finden würde. Und natürlich hatte sie nicht zurückgerufen. Unbekannte Rufnummern mit fremden Vorwahlen ignorierte sie grundsätzlich. Aber dass jetzt auch noch jemand vor ihrer Haustür aufkreuzte, setzte dem Ganzen die Krone auf. Die Betrüger wurden immer unverschämter.
»Sind Sie denn Frau Jeschiechek?«
2
Der Mann stellte ihr die Frage ohne Pause und mit einer Dienstbeflissenheit, die auf einschlägige Erfahrung seinerseits schließen ließ. Das ausgesuchte Betrugsopfer nicht zu Wort oder, noch besser, nicht zum Nachdenken kommen lassen. Josefine holte tief Luft, während sie gleichzeitig ihren Fuß hinter die halb geöffnete Tür schob. Man musste mit allem rechnen.
»Wer will das wissen?« Das hatte sie immer schon mal sagen wollen. Erst im nächsten Moment fiel ihr ein, dass der Mann sich ja bereits vorgestellt hatte. Ihr Gegenüber ließ sich aber weder von der Frage noch von ihrer augenscheinlichen Vergesslichkeit irritieren. Vermutlich freute er sich darüber und glaubte nun, mit ihr ein leichtes Spiel zu haben. Er lächelte.
»Mein Name ist Kessler von der Erbenermittlung Kessler und Maierbrink«, wiederholte er im exakt gleichen Tonfall, ergänzte seine Vorstellung aber diesmal um eine kleine angedeutete Verbeugung.
Er griff in die Innentasche seines Mantels, zog eine Visitenkarte hervor und überreichte sie ihr mit großer Geste. Josefine nahm das Kärtchen mit spitzen Fingern entgegen, warf einen kurzen Blick darauf und stopfte es dann in eine der zahlreichen Taschen ihrer Gartenhose.
»Ich hoffe, ich habe Sie nicht gestört.«
Wieder dieses festgeklebte Lächeln. Josefine blickte an sich hinunter. Der Matschfleck auf ihrem Knie wurde langsam hart. Kleine Bröckchen Erde fielen auf die Fußmatte.
»Doch.« Sie schob die Tür ein Stück zu. »Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe für so etwas keine Zeit.« Sie schloss die Tür.
Umgehend klingelte es erneut. Dreist, unverschämt und lästig. Sie riss die Tür wieder auf. Herr Kesselbrink oder wie er hieß stand an derselben Stelle wie zuvor. Nur sein Lächeln hatte leicht an Spannkraft verloren.
»Es wäre gut, wenn Sie mir kurz die Möglichkeit geben könnten, Ihnen die Angelegenheit zu erläutern.«
»Ich schließe keine Geschäfte an der Haustür ab. Bitte gehen Sie jetzt, sonst rufe ich die Polizei.«
Herr Maierle-Kessel-und-so-weiter ächzte leise. »Ich verstehe, dass mein Besuch unerwartet für Sie kommt, und Sie sind nicht die Erste, die so reagiert.«
Jetzt klang er flehentlich. Josefine verspürte Mitleid mit ihm. Aber nur beinahe. Der angebliche Erbenermittler stellte seine Aktentasche vor ihr auf den Boden, ließ die Verschlüsse aufklacken und nahm ein mit einer Klarsichthülle geschütztes Blatt heraus. Er reichte es Josefine. »Unsere Agentur wurde vom Nachlasspfleger in dieser Sache beauftragt, mögliche Erben der Verstorbenen zu ermitteln.«
»Ist für Erbschaften nicht das Nachlassgericht zuständig?«, fragte Josefine und ärgerte sich im selben Moment, sich nun doch in ein Gespräch hineinmanövriert zu haben. Sie hielt die Klarsichthülle achtlos in der Hand.
»Ja, das stimmt«, Herr Kesselmayer zeigte wieder Zähne, »aber die Gerichte haben oft weder die Zeit noch die technische Ausstattung, selbst die Erben zu ermitteln. Deswegen ernennen sie Nachlasspfleger, und die wiederum wenden sich an uns. Die Ermittlung von Erben ist oft eine sehr langwierige Sache, sie kann sich über Monate, wenn nicht Jahre hinziehen.«
»Monate?«
»Jahre.«
»Und wie lange haben Sie gebraucht, um mich zu finden?« Josefine hob das Blatt und wedelte damit vor dem Gesicht des Erbenermittlers herum. Die Kunststoffhülle knisterte.
»Zwei Wochen.«
»Zwei Wochen?«
»Ganz recht.«
»Das ist nicht sehr lang.«
»Es hat uns auch überrascht. Wissen Sie, oft haben wir es mit internationalen Erbangelegenheiten zu tun, die nicht bei einem deutschen Nachlassgericht anhängig sind, und die sind alles andere als einfach zu bearbeiten«, redete der Mann sich in Rage. Josefine erkannte Begeisterung und Leidenschaft in seinen Augen. Wie schön, wenn jemand in seinem Beruf aufging. Auch wenn es nur das Betrügen vorgeblich hilfloser Hausfrauen war.
So langsam machte die Sache Josefine Spaß. Was sprach eigentlich dagegen, diesen Herrn hier noch ein wenig zu beschäftigen? Der Garten wäre auch in einer Stunde noch da. Genau genommen tat sie damit ein gutes Werk. Solange er mit ihr redete, konnte er niemand anderen belästigen.
»Aha.« Sie bemühte sich um einen neugierigen Gesichtsausdruck. »Und meine Sache, ist sie auch international? Die berühmte Erbtante aus Amerika?« Sie grinste.
»Nein. Keine Tante.« Er machte eine Pause, räusperte sich und eröffnete ihr dann: »Eine Schwester.«
»Sehr interessant. Nein, kreativ. Eine Schwester. Aha.« Josefine unterdrückte die weitere Erwiderung, die ihr auf der Zunge lag und in der die Wörter »für wie blöde« eine Rolle spielten. »Mal angenommen, Sie hätten recht, und ich wäre die Erbin meiner Schwester. Wie würde es dann weitergehen?«
»Gut, dass Sie fragen, Frau Jeschiechek. Die Sache verhält sich so. Das Nachlassgericht bezahlt unsere Dienste nicht. Es ist üblich, mit den Erben eine Vereinbarung zu schließen. Die Höhe unserer Honorare richtet sich nach dem Wert des Erbanteils. Wir bekommen also eine Art Provision. Selbstverständlich nur, wenn Sie auch Geld oder andere Vermögenswerte aus dem Erbe bekommen.«
»Das klingt ja ungeheuer vertrauenswürdig.«
»Ist es auch.« Er nickte eifrig. »Auf diese Weise müssen Sie nichts im Voraus an uns zahlen. Wir tragen sämtliche Kosten, die für die Erbenermittlung angefallen sind, und unser Honorar wird erst fällig, wenn das Erbe zur Auszahlung gekommen ist«, fuhr der Erbenermittler mit ungebrochener Begeisterung fort. Entweder ignorierte er die Ironie in Josefines Einwurf, oder er erkannte sie nicht.
»Was ich geerbt habe, werden Sie mir zweifellos erst sagen, nachdem ich bei Ihnen unterschrieben habe.«
»Richtig.«
»Und auch den Namen und die Adresse des Erblassers erfahre ich erst nach Vertragsabschluss.«
»Ganz genau.«
»Und woher weiß ich dann, dass ich keinen Haufen Schulden erbe?«
Herr Kessler von der Erbenermittlung neigte den Kopf zur Seite und schmunzelte vertraulich. »Unser Honorar bemisst sich nach der Höhe Ihrer Erbschaft. Aus einem negativen Nachlass oder, wie Sie das nennen, einem Haufen Schulden können wir kein positives Honorar berechnen. Das, meine liebe Frau Jeschiechek, würde sich schlicht nicht für uns lohnen.«
»Also lohnt es sich für Sie in meinem Fall.«
»Ja. Und dementsprechend auch für Sie.«
»Aber Sie können mir nicht sagen, was oder wie viel ich von wem geerbt habe.«
»Bedauerlicherweise nein.«
Josefine betrachtete ihren Besucher. Ein Gefühl der Enttäuschung breitete sich in ihr aus. So machte das keinen Spaß. Eine Schwester? Wie einfallslos. Und keine Auskunft über das vermeintliche Erbe. Sie sollte die sprichwörtliche Katze im Sack kaufen. Mit Brief und Siegel beziehungsweise Honorarvereinbarung. Natürlich. Der feine Herr Betrüger gab sich keine große Mühe, ihr die Sache angemessen zu verkaufen.
»Lassen Sie mich kurz nachdenken, Herr Kesselbrink.«
»Kessler.«
»Was?«
»Mein Name ist Kessler von der Erbenermittlung Kessler und Maierbrink.«
»Lassen Sie mich kurz nachdenken, Herr Kessler.« Josefine legte mit übertriebener Geste einen Finger an die gespitzten Lippen und schaute angestrengt nach oben. Dann wandte sie sich mit gespielter Überraschung wieder an ihn. »Wissen Sie, was mir gerade einfällt? Ich habe gar keine Schwester.« Wieder schaute sie angestrengt nach oben. »Doch, doch. Ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Vor allem in der Kindheit. So ein zweites Kind nimmt einiges an Platz in Anspruch. Suchen Sie sich jemand anderen für Ihre Betrügereien. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte.« Josefine trat einen Schritt zurück, schloss die Haustür und ging wieder in den Garten. Auf dem Weg dorthin warf sie die Klarsichthülle samt Papier in den Müll. Sollte Herr Kessler von der Erbenermittlung Kessler und Maierbrink weitere Klingelattacken starten, würde sie das geflissentlich ignorieren.
Eine Schwester. So einen Unsinn hatte man ihr schon lange nicht mehr aufgetischt.
Zwei Stunden später hatte sie in einer Ecke am Zaun einen großen Laubhaufen für die Igel zusammengefegt, alles Fallobst aufgesammelt und die Fruchtmumien von den Bäumen entfernt. Der Teich, von Algen und Laub befreit, wartete mit frisch geschnittenen Uferpflanzen auf. In der Mitte dümpelte ein Eisfreihalter aus Styropor, den sie zwar ausgesprochen hässlich, aber auch sehr nützlich fand. Christian hatte ihn vor Jahren im baumarktlichen Angebot erstanden und jeden ästhetischen Einwand ihrerseits abgeschmettert. Seither erwies sich das Teil als unkaputtbar, und Josefines Umweltgewissen schlug ohnehin Alarm bei dem Gedanken, das Plastikteil vor Ablauf seiner Nutzungsdauer auf den Müll zu werfen. Wobei der Eisfreihalter vermutlich eine längere Nutzungsdauer aufwies als sie selbst. Sollten sich doch die Kinder irgendwann damit herumschlagen.
Herr Kessler von der Erbenermittlung Kessler und Maierbrink hatte keinen weiteren Versuch gestartet, sie zu belästigen. Oder sie hatte es im hinteren Teil des Gartens überhört. Egal. Hauptsache, sie war ihm nicht auf den Leim gegangen. Eine Schwester. Was für ein Blödsinn. Josefine war das einzige Kind ihrer Eltern und eines von zwei Enkelkindern ihrer Großeltern mütterlicherseits. Auf der Seite ihres Vaters hatte es eine eher unüberschaubare Menge an Cousins und Cousinen gegeben, was der beeindruckenden Geschwisterschar ihres Vaters zuzurechnen war. Aber die kannte sie alle, wenn sie über die Jahre auch nicht zu allen Kontakt gehalten hatte.
Josefine drehte den Gartenwasserhahn auf und hielt die Harke darunter, bis alle Reste von Erde und Schlamm entfernt waren. Den Spaten unterzog sie der gleichen Prozedur und stellte beide Gerätschaften an die Schuppenwand. Hier, unter dem kleinen Dachüberstand, konnten sie trocknen.
Welche Möglichkeiten gäbe es denn für die Existenz einer Schwester? Ein außereheliches Kind ihres Vaters? Das Resultat eines Fehltritts? Nein. Sicher nicht. Ihre Eltern waren einander immer sehr zugeneigt gewesen. Eine Geliebte passte da nicht ins Bild. Oder vielleicht doch? Josefine ging durch den Garten, kontrollierte, ob sie irgendwo eine Gartenschere, eine Rolle Rosendraht oder eine Verpackung der Blumenzwiebeln liegen gelassen hatte. Und ihre Mutter? Sie erinnerte sich an die Begeisterung, mit der sie in fremde Kinderwagen geschaut hatte. Stets hatte auch ein Hauch von Wehmut in ihrem Blick gelegen. Josefine hatte gedacht, die Mutter wünschte sich, dass sich bei ihnen ein Schwesterchen oder Brüderchen ankündigte. War es keine Hoffnung, sondern Trauer um etwas Verlorenes gewesen? Denn wenn Herr Kessler kein Betrüger war und es diese Schwester vonseiten der Mutter wirklich gegeben hatte, musste sie aus der Zeit vor der Ehe ihrer Eltern stammen. Josefine bückte sich, um einen winzigen Fitzel Pappe aufzuheben, und sah sich um. Bis zum Frühjahr stand nun bis auf gelegentliches Laubfegen nichts mehr an. Wieder etwas mehr, das sie nicht zu tun hatte.
Sie stopfte das Pappestückchen in die Hosentasche. Nur keine trübsinnigen Gedanken aufkommen lassen. In dem großen Haus würde sich sicher auch in den langen Wintermonaten etwas finden, womit sie sich beschäftigen konnte. Der Keller vertrug auch noch einen vierten Entrümpelungsdurchgang, und dem Speicher fehlte nach wie vor ein stringentes Ordnungssystem. Was stand eigentlich auf dem Blatt Papier, das der Erbenermittler ihr in die Hand gedrückt hatte? Sie könnte auch die Zimmer der Kinder gründlich putzen, damit alles vorbereitet wäre, wenn sie zu Besuch kämen, obwohl gerade nichts darauf hindeutete, dass dies der Fall sein würde. Weder jetzt noch in näherer Zukunft. Und wenn auf dem Papier Erklärungen standen? Eine Schwester. Sie hätte immer gerne eine Schwester gehabt. Früher als Kind eine Spielkameradin. Als Teenager eine Verbündete gegen die ungerechte Allmacht der Eltern. Und vor ein paar Jahren, als die Eltern beide Pflege benötigten und schließlich kurz hintereinander verstarben, als Unterstützung und Trost. Eine Schwester. Sie wäre nicht allein gewesen. Nicht damals und auch nicht heute. Wobei das genau genommen nicht stimmte. Denn selbst wenn es eine Schwester gegeben hatte – jetzt war sie tot. Und an Josefines Zustand des geschwisterlosen Daseins würde sich nichts ändern.
Josefine blieb stehen und horchte in sich hinein. Machte es einen Unterschied, ob man keine oder eine tote Schwester hatte? Würde sich allein durch das Wissen um deren Existenz ihr Leben ändern? »Meine tote Schwester«, das klang wie ein kitschiger Buchtitel oder der Name eines mit Schauspielerinnen und Schauspielern der C-Riege besetzten Low-Budget-Heulfilms. Josefine ging zur Terrassentür, streifte die Gartenschuhe von den Füßen und eilte in die Küche. Die Klarsichthülle hatte verhindert, dass das Papier den Saft aus den Orangenschalen gesogen hatte, auf denen es gelandet war. Josefine nahm den Spülschwamm aus dem Ständer, hielt ihn kurz unter heißes Wasser und wischte die Hülle sauber, bevor sie sie umdrehte.
»Honorarvertrag«, stand mittig oben. Darunter, ebenfalls mittig gesetzt, die Adresse der Agentur als Auftragnehmer und ihr Name samt vollständiger Adresse als Auftraggeberin. Es folgten jede Menge Absätze mit Rechten und Pflichten beider Vertragspartner. Keine Hinweise auf den Namen oder den Wohnort der Erblasserin. Die wussten schon, wie sie die Leute hinters Licht führten. Josefine lehnte sich an die Küchenzeile, ließ das Blatt sinken. Andererseits, so suspekt alles auf den ersten Blick schien, so korrekt las sich der Vertrag. Keine Vorkasse, das Honorar wurde nur fällig bei Erfolg. Wenn sich herausstellen würde, dass sie doch nicht erbberechtigt war, hätte sie keine Verpflichtungen. Das finanzielle Risiko lag allein bei der Agentur. Nach Betrug sah das nicht aus. Es sei denn, sie übersah etwas – was sie nicht grundsätzlich ausschließen wollte.
Josefine legte den Vertrag auf die Arbeitsfläche und verschränkte die Arme vor der Brust. Mal angenommen, es ging dort alles mit rechten Dingen zu, die Agentur war seriös und die Schwester nicht erfunden. Was hätte das für Konsequenzen? Würde sie einfach einen Batzen Geld in noch zu definierender Höhe überwiesen bekommen, und die Sache hätte sich erledigt? Oder würde mit dem Erbe auch Arbeit auf sie zukommen? Man kannte das doch. Ein Mensch verstarb einsam und ohne Freunde und Verwandte zwischen Müllbergen und Dreck, und irgendwer musste sich darum kümmern, dass die Bude ausgeräumt wurde. Sie stellte sich vor, zwischen stinkenden Türmen gehorteter Habseligkeiten zu stehen, und schüttelte sich.
Mit geschlossenen Augen horchte sie in die Stille des Hauses. Nichts rührte sich. Wollte sie diese Ruhe gegen einen unkalkulierbaren Aufwand eintauschen, ohne zu wissen, was auf sie zukam? Dann stutzte sie, lauschte erneut. Es war ruhig. Zu ruhig. Josefine stieß sich von der Arbeitsfläche ab und ging ins Wohnzimmer. Auch hier: Stille. Es dauerte einen Moment, bis sie es begriff. Sie spürte einen Kloß in ihrer Kehle, und Tränen lauerten in ihren Augen, als sie langsam zum Vogelkäfig ging. Hasso lag auf dem Rücken, die Flügel ausgebreitet. Sein Kopf hing zur Seite, die Augen waren halb geöffnet. Josefine öffnete das Türchen, griff hinein und stupste Hasso an. Vielleicht war er nur bewusstlos, würde im nächsten Moment losflattern und ihr entwischen, wie schon viele Male zuvor.
»Komm schon, alter Junge«, flüsterte sie und strich mit der Fingerspitze sanft über den Brustkorb des Wellensittichs. Nichts. Schließlich nahm sie ihn behutsam auf und hielt ihn in ihren Händen wie in einer Schale. Sie legte einen Finger an den Schnabel, rüttelte ihn vorsichtig. Hasso rührte sich nicht.
Josefine ging vor dem Käfig auf die Knie, setzte sich mit dem Vogel in den Händen auf den Boden und wiegte ihn, während sie sich im Raum umsah, ohne etwas zu sehen. Tränen brannten in ihren Augen. Sie küsste den toten Vogel sanft auf das Köpfchen, schmiegte ihre Wange an ihn. Die weichen Federn streichelten ihre Haut. Er fühlte sich noch warm an.
»Auf Wiedersehen, alter Freund«, flüsterte sie und verstummte. Sie hörte nichts außer ihrem eigenen Atem. Minuten verstrichen. Die Leere und Stille des Hauses drückten sie nieder. Sie war endgültig allein. Niemand brauchte sie mehr. Egal, was sie sich an Arbeiten vornahm, irgendwann wäre alles getan, und dieses Irgendwann war nicht mehr weit entfernt. Sie musste sich nichts vormachen. Es war bereits da. Die Kinder lebten ihr eigenes Leben. Ihren Job war sie los, und in ihrem Alter standen potenzielle Arbeitgeber nicht gerade Schlange. Selbst Frau Riechers, ihre langjährige Nachbarin, für die sie regelmäßig eingekauft und kleinere Besorgungen gemacht hatte, war in ein Betreutes Wohnen gezogen. Wieder streichelte sie den Vogel. Mit Hasso war das letzte Puzzleteil ihres Lebens als Mutter und Familienfrau verloren gegangen. Ein Lebensabschnitt unwiederbringlich vorbei. Ab heute war es egal, ob sie sich hier oder woanders aufhielt. Es war egal, ob sie ihre Pflichten erfüllte, denn sie hatte keine. Es war egal, welcher Arbeit sie nachging, ob sie überhaupt einer nachging. Im Zweifel, wenn sie genügsam lebte, reichten ihre Ersparnisse bis zur Rente. Aber die Vorstellung, mit siebenundfünfzig im Sessel zu sitzen, die Wände anzustarren und auf etwas zu warten, das nicht kam, erschreckte sie zutiefst. Dann konnte sie Hassos Grab der Einfachheit halber groß genug machen und sich direkt mit hineinlegen. Nein. Sie wollte etwas tun. Und wenn es die Abwicklung des Erbes einer ihr gänzlich unbekannten Schwester war.
Josefine suchte eine kleine Schachtel, legte Hasso auf eine dunkelblaue Serviette gebettet mit seinem Lieblingsspielzeug hinein und trug die Kiste in den Garten. Den Spaten würde sie ein zweites Mal säubern müssen, aber das machte nichts. Nachdem sie an einer hübschen Stelle ein Loch ausgehoben hatte, grub sie eine der frisch gesetzten Zwiebeln wieder aus und legte sie mit in Hassos Grab. Über ihr in den Bäumen zwitscherte ein Vogel. Sie schaute hoch. Im Ast ganz oben saß ein Wellensittich, der Hasso bis auf die Flügelspitze glich. Er neigte den Kopf zur Seite, beobachtete sie aus einem Auge und flog schließlich fort. Josefine schaute ihm hinterher, winkte, bis sie ihn nicht mehr sehen konnte. Dann zog sie die Visitenkarte aus ihrer Hosentasche.
3
»Titzelsee? Wo liegt das?« Josefine hatte noch nie von diesem Ort gehört.
»Hier.« Herr Kessler von der Erbenermittlung Kessler und Maierbrink drehte seinen Laptop so, dass sie den Bildschirm sehen konnte, und zeigte auf einen Punkt auf der Karte. »Die nächste große Stadt ist Iwersingen.«
»Und woraus genau besteht das Erbe? Beim ersten Erklären sind noch etliche Fragen bei mir offengeblieben.« Sie zog nachdenklich an ihrem Ohrläppchen. Sie hatte den Abend am Rechner verbracht und alles gelesen, was sie über Erbenermittlung im Allgemeinen und über das Unternehmen Kessler und Maierbrink im Besonderen hatte finden können. Die Erbenermittlung hatte eine ordentliche Webseite, auf der es einen FAQ-Reiter mit Antworten auf all die Fragen gab, die sie sich auch gestellt hatte. Mit ihrem Misstrauen schien sie nicht allein zu sein. Der Hinweis, man empfehle den Kunden einen Anruf beim Nachlassgericht, um die Richtigkeit der Sache zu bestätigen, und die Auskunft, die sie dort erhalten hatte, hatten sie schließlich überzeugt.
Herr Kessler griff in seinen Aktenkoffer, nahm einen schmalen Ordner heraus und legte ihn in die Mitte des Tisches. »Hier sind alle Unterlagen, die mit Ihrem Erbe in Zusammenhang stehen. Selbstverständlich sende ich Ihnen das alles auch noch einmal als PDF-Datei, aber wir wissen aus Erfahrung, dass die Kunden besonders am Anfang gerne alles schwarz auf weiß vorliegen haben.« Er schlug den Ordner auf. »Die Erblasserin Frau Beate Silberzier war die Inhaberin der Agentur ›Ho! Ho! Ho! – Die Leihnachtsmänner‹, ein Mietservice für Weihnachtsmänner und andere Eventfiguren.«
»Weihnachtsmänner mieten?«
»Ganz richtig.«
»Das kann ich mir ja noch vorstellen, aber was sind Eventfiguren?«
»Hier.« Herr Kessler nickte und tippte den Namen der Firma in seinen Laptop. Eine Webseite öffnete sich, ein lautes »Ho! Ho! Ho!« ertönte, und auf dem Bildschirm schleppte eine Horde gezeichneter Rentiere vor nächtlichem Himmel einen bimmelnden und leuchtenden Schlitten hinter sich her, auf dem ein, wie Josefine fand, ausgesprochen übergewichtiger Weihnachtsmann durch seinen mächtigen weißen Bart grinste. Nachdem er samt Entourage vorbeigezogen war, erschien der Schriftzug »Die Leihnachtsmänner« in Rot, Weiß und Grün, ebenfalls blinkend.
Herr Kessler drückte auf eine Taste, das Bild erstarrte, und an der linken Seite ploppte mit einem hellen Glockenton eine von Efeu- und Mistelranken umkränzte Menü-Leiste auf. Wenn diese Homepage dem Geschmack ihrer unbekannten Schwester entsprochen hatte, war Josefine jetzt bereits klar, dass große Ähnlichkeiten nicht unbedingt vorhanden gewesen sein konnten.
»Da.« Es blinkte, glitzerte und bimmelte, und ein Weihnachtsmann erschien auf dem Bildschirm. Nicht gezeichnet, sondern als Foto, aber nicht weniger umfangreich und ebenfalls mit einem stattlichen Bart. »Die Agentur bietet in der Hauptsache einen Weihnachtsmann-Mietservice an. Weihnachtsfeiern, Geschäfte, Familienfeiern. Aber eben nicht nur Weihnachtsmänner, sondern auch …« Er schob die Zunge zwischen die Lippen, während er konzentriert auf den Bildschirm schaute. »… Rauschgoldengel, Wichtel, Elfen und eine …«, wieder zögerte er, »… eine Ruprechtine. Was auch immer das sein soll.« Er räusperte sich. »Außerdem offeriert die Agentur eine Märchenerzählerin.«
»Ist auf dieser Seite auch ein Bild von Frau Silberzier?«, wollte Josefine wissen. Das Wort Schwester kam ihr nach wie vor sperrig vor.
»Ich konnte eines auf der Webseite finden. Aber nur im Kostüm.« Herr Kessler wiegte unschlüssig den Kopf hin und her, ehe er das Foto aufrief. Ein Rauschgoldengel mit einer Flut goldblonder Haare und Flügeln mit Zwei-Meter-Spannweite erschien. Die Frau strahlte in die Kamera, perfektes Make-up, phantastische Figur und die Haarpracht allem Anschein nach echt.
»So jung?« Josefine beugte sich vor. »Diese Frau ist doch höchstens Ende zwanzig.« Die Anmerkung, dass sie bildschön war und so viel Ähnlichkeit mit ihr aufwies wie eine Rose mit einer Stinkmorchel, verkniff sich Josefine ebenso wie ihre logische Schlussfolgerung. Mal angenommen, der Rauschgoldengel war Anfang dreißig, was ihr in Anbetracht der strahlenden Haut und der Haare schon hochgegriffen erschien, bedeutete es, dass ihr Vater nach langen Jahren glücklicher Ehe fremdgegangen sein musste. Denn eine Schwangerschaft ihrer Mutter wäre zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht unbemerkt geblieben. Wenn sie denn überhaupt noch möglich gewesen wäre. Ihre Mutter hatte sich zu dem Zeitpunkt definitiv in den Wechseljahren befunden.
»Nein. Bitte entschuldigen Sie. Nicht der Engel ist Ihre Schwester, sondern da … äh … sie stellt den Wichtel dar.« Herr Keller verzog bedauernd die Mundwinkel.
Erst jetzt sah Josefine den Weihnachtswichtel hinter dem Rauschgoldengel. Er lugte unter dem linken Flügel hervor, die rote Zipfelmütze tief in die Stirn gezogen. Sein dickes grünes Wams, die graue Hose und die spitzen Stiefel ließen keine eindeutigen Rückschlüsse auf eine wie auch immer geartete Figur zu. Ein breites sympathisches Lachen dominierte das Gesicht, und Josefine reagierte spontan mit einem Lächeln. Auch wenn der Kopf im Schatten des Flügels und eher unscharf war – diese Frau war definitiv nicht mehr Ende zwanzig.
»Wie alt war Frau Silberzier?«
»Neunundfünfzig. Am 21. Dezember hätte sie ihren sechzigsten Geburtstag gefeiert.«
»Knapp drei Jahre älter als ich.« Josefine betrachtete ihre Hände. Unter der Haut zeichneten sich Adern ab, und wenn sie sie ausstreckte, durchzogen Falten den Handrücken. »Meine Eltern haben ein Jahr vor meiner Geburt geheiratet. 1965.« In ihrer Erinnerung tauchte das Hochzeitsbild auf. Eine Schwarz-Weiß-Fotografie im typischen Stil der Sechziger. Ihre Mutter trug ein weißes Minikleid, der Vater einen Anzug. Das Bild war vor dem Eingang der Kirche aufgenommen worden. Die Familie, ihre Großeltern und die Geschwister des Vaters, posierten hinter dem Brautpaar. Alle lachten in die Kamera. »Dann muss sie 1963 geboren sein.«
Herr Kessler nickte und schaute Josefine abwartend an.
»Möchten Sie die genauen Zusammenhänge wissen?«, fragte er. »Wir haben natürlich alles sehr sorgfältig recherchiert und überprüft.« Er strich mit den Fingerspitzen über den Ordner. »Aber manchmal wollen unsere Kundinnen und Kunden die Details gar nicht erfahren«, sagte er mit weicher Stimme. Josefine erwiderte seinen Blick, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Sie hörte die Stimme ihrer Mutter, das Lachen ihres Vaters. Einer von beiden hatte dieses Geheimnis mit sich herumgetragen. Ein fortgegebenes Kind. Wusste der jeweils andere davon? Hatten sie sich offenbart und die Last gemeinsam geschultert?
»Ist die Agentur ein Ein-Frau-Unternehmen, oder gibt es Angestellte?« Sie schob das Bild ihrer Eltern zur Seite. Nicht jetzt. Eine Sache nach der anderen.
»Die Agentur arbeitet mit einer ganzen Reihe an freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber es gibt auch zwei Festangestellte.« Er blätterte im Ordner. »Eine Dame für die Verwaltung und einen Herrn, der Hauptweihnachtsmann sozusagen. Die beiden kümmern sich auch weiter um die Geschäfte, bis klar ist, was mit der Agentur geschehen soll.«
»Heißt das, sie ist nicht geschlossen worden?«, fragte Josefine verwundert. Sie wusste nicht, was sie erwartet hatte, aber in ihrer Vorstellung starb ein Geschäft mit dem Tod des Besitzers. Auch wenn das bei genauerer Betrachtung Unsinn war, wie ihr jetzt klar wurde.
»Nein. Wir haben den 25. November, und es ist Hauptsaison. In Absprache mit dem Nachlasspfleger wurde entschieden, das Geschäft aufrechtzuerhalten, bis die Erbangelegenheit geklärt wurde.« Er wies mit der Hand in Josefines Richtung. »Womit wir ja nun ein gutes Stück weitergekommen sind.«
»Bedeutet das, ich muss entscheiden, was mit der Firma geschieht?«
»Letztlich ja. Aber nicht sofort. Vielleicht möchten Sie das Geschäft ja übernehmen?«
Josefine lachte laut auf. Was für eine abstruse Vorstellung. Sie mochte Weihnachten nicht. Sie mochte keinen Kitsch und erst recht kein übertriebenes Getue und Gewese. Auf keinen Fall all das Geblinke, Geblitze und Gebimmele. Unter allen möglichen Tätigkeiten war die des Betriebs eines Weihnachtsmann-Verleihs die allerletzte, die sie ausüben würde. »Ein Verkauf kommt wohl eher in Frage.«
Ihr Tonfall klang selbst in ihren Ohren schroffer, als sie es beabsichtigt hatte. Das war Herrn Kessler gegenüber nicht fair. Er gab sich alle Mühe, sie in dieser Situation zu unterstützen.
»Alles ist denkbar.« Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Wir empfehlen in solchen Fällen immer, nichts übereilt zu entscheiden. Lassen Sie sich Zeit. Denken Sie in aller Ruhe nach. Manchmal hilft es auch, sich persönlich ein Bild der Lage zu machen.«
»Nach Titzelsee fahren?«
»Das wäre eine Möglichkeit.«
Josefine zögerte. Die Abwicklung des Erbes hatte sie sich anders vorgestellt. Eher bürokratisch als praktisch. Mehr Formulare als Handeln. Nach Titzelsee zu fahren bedeutete, in die Privatsphäre einer ihr unbekannten Person einzudringen. Sie würde in Unterlagen, Papieren und persönlichen Dingen herumkramen, ein fremdes Leben betrachten, ohne den Menschen dahinter gekannt zu haben. Das Leben ihrer fremden Schwester.
»Wieso war sie meine Schwester?« Sie wollte es nicht wissen, ihr Bild von der heilen Welt ihrer Eltern nicht zerstören, nicht das Geheimnis lüften, das ihr Leben bestimmt hatte, ohne dass sie es ahnte. Aber sie brauchte die Antwort. Sie kannte sich. Die Frage würde ihr keine Ruhe mehr lassen.
Herr Kessler zog den Ordner zu sich heran und blätterte darin, bis er zu einem amtlich aussehenden Papier kam. »Ihre Schwester, genau genommen Ihre Halbschwester, wurde am 21. Dezember 1963 als uneheliches Kind einer gewissen Christel Werstall geboren. Vater unbekannt. Christel Werstall ehelichte 1964 einen gewissen Werner Silberzier, später erfolgte die sogenannte Einbenennung des Kindes. Was bedeutet, dass Ihre Schwester Beate den Namen ihres Stiefvaters erhielt.«
Christel Werstall. Josefine hatte diesen Namen noch nie gehört. »Hat er sie adoptiert?«
»Nein. Sie bekam nur seinen Namen.«
»Weshalb?«
»Über die damaligen Beweggründe können wir nur spekulieren. Für uns ist die Konsequenz daraus interessant.«
»Die lautet?«
»Hätte Herr Silberzier Ihre Schwester Beate adoptiert, säße ich jetzt nicht hier. Denn mit einer Adoption erlöschen alle leiblichen Verwandtschaftsverhältnisse, in Folge auch die Erbberechtigung.«
»Die Eltern sind also auch tot?«
»Christel Silberzier ist bereits verstorben. Werner Silberzier lebt noch, ist aber aus den eben erläuterten Gründen nicht erbberechtigt.«
»Wie sind Sie dann auf mich gekommen?«
»Wir haben uns natürlich mit Herrn Silberzier unterhalten. Auch er wusste nicht, wer der leibliche Vater seiner Tochter war, weil es ihn, wie er uns versicherte, nie interessiert hat. Allerdings hatte er private Unterlagen seiner verstorbenen Frau aufbewahrt. Dort sind wir dann fündig geworden.«
»Wusste mein Vater von seinem Kind?«
»Nicht zum Zeitpunkt der Geburt.«
Josefine versuchte sich vorzustellen, was gewesen wäre, wenn ihr Vater von der Schwangerschaft gewusst hätte. Sie kannte ihn nur als ausgesprochen rechtschaffenen Mann, der Gesetz und Ordnung immer hochgehalten hatte. Hätte er diese Christel Werstall geheiratet? Wenn nicht aus Liebe, so doch aus Pflichtgefühl? Ja. Das hätte er. Selbst wenn er gezögert hätte, der Druck auf ihn wäre sicherlich groß gewesen. Josefine rief sich ihren Großvater in Erinnerung. Ein strenger Mann, der über seine Familie regierte wie ein kleiner König. Niemals hätte er zugelassen, dass der Sohn nicht die Konsequenzen seiner Taten trug.
Hätte Christel Werstall nicht angegeben, den Vater ihrer neugeborenen Tochter Beate nicht zu kennen, wäre ihr, Josefines Leben ganz anders verlaufen. Nein, halt, das stimmte nicht. Es wäre nicht anders, es wäre gar nicht verlaufen. Sie wäre schlicht nie geboren worden. Und infolgedessen gäbe es auch Lea, Sarah und Florian und das Baby nicht. In Gedanken schickte sie einen stummen Dank an Christel Silberzier, der sie auf gewisse Weise ihre Existenz zu verdanken hatte.
Den Dank konnte sie aber umgehend wieder relativieren, denn ohne das alles stünde sie jetzt auch nicht vor der Frage, wie sie mit dem Erbe ihrer Schwester umgehen sollte.
Erst jetzt fiel ihr die Formulierung auf, die Herr Kessler eben genutzt hatte.
»Sie sagten gerade ›Nicht zum Zeitpunkt der Geburt‹. Was bedeutet das?«
»Die Vaterschaft wurde 1977 nachträglich anerkannt. Es fand sich eine entsprechende Urkunde in den Unterlagen von Christel Silberzier. Da war Ihre Schwester bereits ein Teenager.«