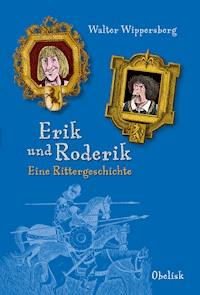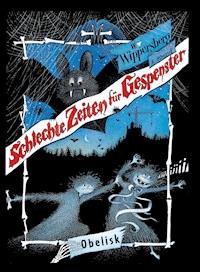Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müller, Otto
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Der biblische Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, ist vom Menschen geschaffen. Nach dem eigenen Bild und den eigenen Bedürfnissen. Wie sich diese im Laufe der Zeit wandelten, so hat sich auch Gott gewandelt. Immer wieder und radikal. Mit umfassender Kenntnis erläutert Walter Wippersberg, wie zwei große Religionen entstanden, die jüdische und die christliche. Er räumt Mystifikationen und Dogmen-Schutt beiseite und öffnet den Blick auf eine nachvollziehbare historische Entwicklung. Die Existenz von Gott Jahwe und Jesus verleugnet er keineswegs. Es gibt sie: in den heiligen Büchern als literarische Gestalten. Sie existieren in den Köpfen ihrer Anhängerschaft - und von dort wirken sie in die Welt hinaus. In seinem Essay zeigt Walter Wippersberg religionsgeschichtliche Zusammenhänge auf, die sich sonst nur dem erschließen, der eine unüberschaubare Menge an Fachliteratur zu studieren bereit ist. Für manche ist das Ergebnis eine Provokation. Aber vor allem ist dieses Buch für jene, die lieber verstehen wollen, als einfach zu glauben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 537
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Wippersberg
Einiges über den lieben Gott
Walter Wippersberg
Einiges über denlieben Gott
Wie er erfunden wurdeund wohin das geführt hat
O T T O M Ü L L E R V E R L A G
www.omvs.at
ISBN-10: 3-7013-1123-4ISBN-13: 978-3-7013-1123-1eISBN: 978-3-7013-6123-6© 2006 Otto Müller Verlag Salzburg/WienAlle Rechte vorbehaltenSatz: Media Design: Rizner.at, SalzburgUmschlaggestaltung: Ulli LeikermoserDruck und Bindung: CPI Moravia Books GmbH
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Anhang
1
Wirklich ist, was wirkt.
Den Gott, an den ich nicht glaube, gibt es natürlich. Himmel und Erde hat er wohl nicht erschaffen, und alles an ihn gerichtete Flehen und Lobpreisen bleibt ungehört. Aber er existiert, der heute sogenannte liebe Gott, der in seinen Anfängen gar nicht lieb war. Wenigstens in den Köpfen seiner Anhänger existiert er. Dort wirkt er – und von dort wirkt er hinaus und in die Welt hinein.
Also gibt es ihn, denn wirklich ist, was wirkt.
Wir wissen über diesen zuerst hebräischen, dann jüdischen, später auch christlichen und islamischen Gott nur, was in den heiligen Büchern über ihn geschrieben steht. Und so verhält es sich auch mit jenem anderen, dem auschließlich christlichen Gott. Dieser eine alte und dieser eine jüngere Gott, der angeblich der Sohn des alten ist, sind also literarische Figuren. Wer mag, kann noch mehr in ihnen sehen, aber das sind sie auf jeden Fall. Judentum, Christentum und Islam sind Buchreligionen, ihr gemeinsamer Gott ist demnach eine Gestalt der Literatur. Eben darin können auch individuelle Gotteserfahrungen begründet sein, denn die Lektüre belletristischer Literatur bewirkt ja in aller Regel subjektives Erleben, das von realer Erfahrung kaum zu unterscheiden ist.
Für mich ist der jüdisch-christlich-muslimische Gott eine Erfindung, an der viele Menschen mitgewirkt haben, zu sehr unterschiedlichen Zeiten, in sehr unterschiedlichen historischen Situationen, oft wohl aus großer existentieller Not heraus. Gerade als menschliches Konstrukt, als literarische Gestalt interessiert mich dieser Gott. Warum Menschen ihn offenbar haben erschaffen müssen, das vor allem interessiert mich – und natürlich auch, welche Folgen daraus für andere Menschen erwachsen.
Ich denke in diesem Buch nach über diesen Gott und schreibe dabei die Reste meines Kinderglaubens fort. Natürlich empfinde ich das auch als Verlust. Die Instanz, bei der ich etwas erbitten könnte, fehlt mir durchaus nicht. Daß Gebete erhört würden, glaube ich schon lange nicht mehr; das hab ich vielleicht – ich halte es für möglich – nie geglaubt. Eher fehlt mir eine Instanz, bei der ich mich bedanken könnte. Daß es mir gut geht, besser jedenfalls als den meisten Menschen auf der Welt, das ist, falls überhaupt, nur zum winzigen Teil mein Verdienst. Ich wurde in Mitteleuropa geboren und nicht im Sudan oder sonst einer Weltgegend, wo die Menschen Hungers verrecken. Natürlich ist das Zufall, wie es eben auch Zufall ist, daß ich in eine Zeit hineingeboren wurde, in der es, wenigstens in meinem allerengsten Umfeld, nun schon seit sechzig Jahren keinen Krieg mehr gibt. Denke ich an all das, spüre ich Dankbarkeit. Aber wem gegenüber? Glaubte ich an einen Gott, so könnte ich mich bei ihm bedanken. Hier fehlt er mir wirklich.
Worin mein Kinderglaube einmal bestanden haben mag, weiß ich nicht mehr genau. An etwas erinnere ich mich aber gut: Als ich vielleicht acht oder neun Jahre alt war, da habe ich zu Gott gebetet, er möge mir einen kleinen Hinweis darauf zukommen lassen, daß er wirklich existiere. Ich war Ministrant (in der Kleinstadt Steyr, in der Kirche zu Sankt Michael), ich kniete vorm Hochaltar, und ein plötzliches helles Aufflackern einer der Kerzen hätte mir als Zeichen durchaus genügt.
Übrigens war bei den Gottesdiensten, an denen ich teilnahm, vom Alten, von Gottvater, nicht viel die Rede; das Vaterunser wurde immerhin zu ihm gebetet, und besungen wurde er: Großer Gott, wir loben dich; Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.
Viel geredet wurde hingegen über unsern Herrn Jesus, gefeiert auch als Christkönig. Die Wunder, die man ihm nachsagte, haben mich beeindruckt. Wasser in Wein zu verwandeln, na immerhin! Und Tote auferwecken! Gern hörte ich auch Jesu Gleichnisse. Daß im Weinberg des Herrn allerdings für eine Stunde Arbeit der gleiche Lohn ausbezahlt werden sollte wie für die Schufterei eines ganzen Tages, das fand ich ungerecht. Daß Jesus die Sünden der Welt auf sich genommen hat und dafür am Kreuz gestorben ist, dafür dankte ich ihm von Zeit zu Zeit. Er hatte ja auch meine Sünden auf sich genommen, doch schien mir als Sühne dafür der Kreuzestod allzu hart. Es mochte, das räumte ich ein, noch schlimmere Sünden geben, als ich sie beging. Doch hätte Gottvater sie nicht einfach auch vergeben und verzeihen können, anstatt seinen eingeborenen Sohn quälen zu lassen auf eine so erbärmliche Art, wie es auf den Kreuzweg-Bildern zu sehen war? Diese Einwände, derer ich mich gut entsinne, wogen indes nicht schwer. Es war, wie es eben war, der Himmel würde schon wissen, warum es so sein mußte. Ich wollte gewiß nicht rütteln an ewigen Wahrheiten, und wir Kinder würden manches ja auch erst viel später verstehen.
Später habe ich mich gelegentlich als ganz normal katholizismusgeschädigt bezeichnet, doch ist das der Koketterie näher als der Wahrheit. Traumatisiert hat mich diese katholische Kindheit im damals noch katholischeren Österreich gewiß nicht. Als ich mich lange schon von der katholischen Kirche getrennt hatte, dachte ich eine Weile, ich könnte mir irgendeine Art von Glauben an den »lieben Gott« bewahren. Er interessierte mich, und je mehr ich mich mit ihm beschäftigte, umso mehr interessierte er mich, doch verlagerten sich die Schwerpunkte meines Interesses. Irgendwann in den 1970er Jahren dann eine wirkliche Entdeckung: Die Religionswissenschaft gehe, so las ich damals, lange schon davon aus, daß der Glaube der Hebräer durchaus nicht von Anfang an monotheistisch gewesen sei, der Monotheismus vielmehr eine kulturelle Errungenschaft erst des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts. Da wurde mir bald klar: Wer nicht den Theologen auf den Leim gehen will, der muß, wenn er sich mit diesem Gott beschäftigt, die hebräische Bibel (von den Christen das Alte Testament genannt) gründlich lesen. Der Erkenntnisgewinn meines ersten Versuchs war freilich gering, zurück blieb zunächst ein Erschrecken über einen Gott, der hartnäckig auf der Ausrottung ganzer Völker besteht. Und zurück blieb einige Verwirrung. So hatte vor dem nächsten Versuch eine ausführliche Beschäftigung mit hebräischer Geschichte zu stehen… Manch ein Gedankenschritt ist mir in den darauffolgenden Jahren gar nicht leicht gefallen. Manch eine Schlußfolgerung habe ich nur zögernd gezogen. Der aus hebräischer Bibel und religionswissenschaftlicher Literatur rekonstruierbare Gott erwies sich nicht als der, an den zu glauben ich als Christ verhalten gewesen wäre, na schön. Eine Weile dachte ich, ich könnte diesen Gott wenigstens so sehen, wie die Liberaleren unter den heutigen Juden ihn sehen. Ich konnte es nicht.
Übrigens kenne ich ein paar (wenige) Menschen, die recht genau Bescheid wissen über das historisch Bedingte dieses Gottes und die dennoch an ihn glauben. Aber meine Sache ist das credo quia absurdum nicht. Ich dachte nach über diesen Gott – und fand eines Tages, daß ich ganz gut ohne ihn leben konnte. Mein Interesse an ihm erlosch deshalb nicht.
Ich versuche ihn mir vorzustellen, diesen jüdisch-christlich-islamischen Gott. Nehme ich ernst, was in der »Genesis« steht, daß er nämlich den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen habe, dann muß ich ihn mir menschenähnlich vorstellen. Die heiligen Bücher, deren Protagonist er ist, beschreiben ihn als Mann. Deshalb lasse ich feministische Versuche, ihn zur Göttin zu machen oder wenigstens geschlechtsneutral zu sehen, außer acht. Man mag sich – aus verständlichem Protest gegen das Männerbündische des Judentums, des Christentums und des Islams – wünschen, diese Figur wäre besser als Frau, als Göttin, erfunden worden, aber so ist es eben nicht. Heute sehen viele nur mehr irgendein »höheres Wesen« in ihm, das kann sich, wer will, natürlich auch als Frau vorstellen. Aber der biblische Gott war und ist ein Mann. Ob er je, wie manche seiner frühen Anhänger dachten, eine Gemahlin hatte, interessiert mich allenfalls am Rande; daß er der Vater eines Sohnes sein soll, ist kompliziert genug.
Ein Mann also, ein alter Mann. Selbst für einen Gott ist er nun schon alt. Es hat Götter gegeben, deren Lebens- oder Amtszeit er noch nicht erreicht hat, ägyptische zum Beispiel, aber alt ist er. Ein alter Mann mit wallendem weißen Bart? Warum eigentlich nicht? Als Ministrant zu Sankt Michael hab ich ihn mir so vorgestellt, und die Naiveren unter seinen Anhängern sehen ihn heute noch so. Zu seinen Anfängen paßt dieses Aussehen ja. Damals hat ein Gott um ein paar Nomaden geworben. Man wird ihn sich wohl wie einen besonders würdevollen patriarchalen Stammesführer vorgestellt haben. Damals war er jedenfalls den Menschen sehr nahe, ein fast privater Gott; noch lange kein Kriegsgott, noch lange kein Schöpfergott und erst recht noch lange kein abstraktes »höheres Wesen«. Mit Abraham hat er gegessen, mit Jakob eine Nacht lang gerungen.
Es gab freilich – Jahrhunderte später – auch eine Zeit, da machte er viel Wind um seine Erscheinung. Auch buchstäblich: Ein Sturmwind kündigte ihn an. Viel Feuerzauber wurde dann veranstaltet. Aus einem brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch heraus redete er. In einer Feuersäule zog er seinem Volk voran durch die Wüste. Und es hieß damals plötzlich, daß niemand seinen Anblick ertragen könne.
Manchmal fragt er sich heute wohl, welcher von den beiden, der menschennahe oder der Feuer-Gott, er nun wirklich am Anfang war, ganz tief drinnen nämlich. Aber es sind ja viele in ihm. Das wird er, stelle ich mir vor, selbst am allerbesten wissen. Und all die Veränderungen, die er erfahren hat müssen, werden ihm zu schaffen machen. Von so bescheidenen Anfängen her zu einem Schöpfergott zu werden und dann sogar noch zum angeblich einzigen Gott überhaupt, allmächtig auf einmal und allwissend und allgütig dazu! Diese Entwicklung seiner Person wird ihm, dessen bin ich sicher, selbst ganz unglaublich vorkommen. Vorauszusehen war sie jedenfalls nicht.
Über all das denkt er, vermute ich, oft und oft nach. Da heute, anders als in seinen Anfängen, niemand mehr von ihm erwartet, daß er sich ins Tagesgeschäft auf Erden einmischt, hat er nun viel Zeit. Und zurückzublicken gehört ohnehin zum Alter, wahrscheinlich auch bei einem Gott. So wird er sich ein ums andere Mal fragen, wie das alles gekommen ist mit ihm, wie das alles angefangen und wohin es geführt hat.
Nie hat er es leicht gehabt mit den Menschen. Zuerst die Schwierigkeiten, überhaupt ein paar Anhänger zu finden! Und die er schließlich hat gewinnen können, die liefen noch für lange Zeit zu anderen Göttern über, wann immer sie nur konnten. Das hat sich geändert. Heute bekennen sich unendlich viele zu ihm. Ob sie ihn freilich wirklich meinen, die Person nämlich, die er ist, die er so mühsam geworden ist, daran zu zweifeln hat er allen Grund. Viele sehen heute etwas ganz und gar Undefinierbares in ihm. Das wird ihn ärgern, denn wer läßt sich schon gern seine Persönlichkeit absprechen, zumal das eine in all ihren phantastischen Widersprüchen doch ganz einzigartige Persönlichkeit ist.
Über seine allerersten Anfänge weiß er wohl selbst nur wenig. Zu lange vergangen das alles und zu alt er selbst. Manches ahnt er, manches reimt er sich zusammen, aber verläßlich, das ist seine literarische Natur, weiß er über sich ja auch nur, was geschrieben steht über ihn. So wird er gelegentlich, wenn er nachdenkt über sich, in der Thora blättern. Um die Zeitenwende herum glaubten jüdische Rabbinen gewußt zu haben, daß Gott (wie sie es selber taten) täglich in der Thora lese. Er wird, nehme ich an, diese Gewohnheit beibehalten haben bis heute, denn immer noch wird er in den fünf alten Büchern manchen Grund finden, sich über sich selber zu wundern.
Die Vorstellung, Himmel und Erde, Pflanzen, Tiere und Menschen erschaffen zu haben, das wird ihm nicht immer gefallen; an manchen Tagen aber wohl doch. Daß er damals, am Anbeginn der Welt, schon allwissend gewesen wäre, daß das jemand glauben mag, das wundert ihn sehr, dessen bin ich mir sicher. Die Menschen hätten ihn, wäre er je allwissend gewesen, nicht so sehr enttäuschen können, daß er sie zum Beispiel vom Angesicht der Erde meinte tilgen zu müssen in der großen Flut – den einen aufrechten Noach und seine Familie ausgenommen. Ein solcher Neubeginn ist nur nach einem mißglückten Versuch notwendig, daran ist nicht zu rütteln. Mit dem Noach habe er dann – glaubt er der Thora – ein Bündnis geschlossen. Ein mißglückter Versuch auch dies, muß er annehmen, weil später mit einem gewissen Abram (von da an Abraham genannt) ein neues Bündnis vonnöten war. Und dann mit dem Mose und den von ihm geführten Scharen noch einmal eins; immer noch, so wird behauptet, nicht das letzte.
Warum so umständlich? wird Gott der Herr sich manchmal fragen und keine Antwort wissen. Evident ist: Denen er sich als ihr Gott angeboten hat, die haben über Jahrhunderte hin nicht viel von ihm wissen wollen. Und evident ist auch: Er hat die Versprechungen, die er ihnen gemacht hat, nie eingehalten. Hat er nicht gekonnt oder nicht gewollt? Egal, es hat ihm nicht geschadet. Im Gegenteil: Wenn er seinen Verpflichtungen aus dem Bund mit seinem Volk nicht nachgekommen ist, gerade dann ist die ihm zugeschriebene Macht wieder ein Stück gewachsen. Und da er oft versagt hat, ist die Macht, die man ihm zuschreibt, nun schier unendlich.
Freilich bleibt bei all dem das Dilemma aller literarischen Gestalten bestehen: Sie wirken zwar aus den Büchern heraus in die Menschen hinein, sie können aber die Bücher nicht verlassen. Einmal aber wäre das unbedingt notwendig gewesen.
Er wird nicht alles glauben, was über ihn geschrieben steht, so wird er, darf angenommen werden, daran zweifeln, daß er – oder ein Teil von ihm – schon einmal Mensch geworden sei vor zweitausend Jahren. Vor wenigen Jahrzehnten aber hätte er inkarnieren müssen. Am Bündnis mit seinem auserwählten Volk kann und will er nicht zweifeln, also hätte er – und sei es Fleisch, also Mensch geworden – dieses sein Volk vor dem Holocaust bewahren und retten müssen. Oder mit ihm darin umkommen.
2
Im Getto von Wilna, in der Zeit des großen Schlachtens, haben sie ihm den Prozeß gemacht: Zur Zeit des schlimmsten Nazi-Terrors saßen die Rabbinen eine Nacht lang zu Gericht über Gott und verurteilten ihn, weil er sein auserwähltes Volk verraten und im Stich gelassen habe.
Und als das Urteil gesprochen und die Nacht zu Ende war, trat einer von ihnen ans Fenster und sah die Sonne aufgehen und sagte: Es ist Zeit fürs Morgengebet.
3
Viel Blut fließt, wenn er waltet.Kann aus so einem noch je ein lieber Gott werden?
Wie ernst soll man nehmen, was in der Bibel geschrieben steht? Was ist wortwörtlich zu verstehen und was nur im übertragenen Sinn? Von Radikal-Fundamentalisten abgesehen, geht man mit diesen Fragen heute pragmatisch um. Oft auch opportunistisch, wenn man Schockierendes mit dem Hinweis abzumildern versucht, das dürfe man nicht so wörtlich nehmen.
Wenigstens ein Jahrtausend lang war die Christenheit das zu glauben verhalten: Gott selbst habe die Bibel von der ersten bis zur letzten Zeile diktiert. Das wurde vom Zeitalter der Aufklärung an bezweifelt, aber noch das Erste Vatikanische Konzil dekretierte 1870, daß sämtliche Bücher der Heiligen Schrift mit allen ihren Teilen »unter Eingebung des Heiligen Geistes geschrieben sind und Gott zum Verfasser haben«. Heute (seit ein paar Jahrzehnten erst) räumt man ein, nicht alles müsse ganz wörtlich verstanden und geglaubt werden, die Schöpfungsgeschichte etwa. Daß Gott die Welt buchstäblich in sechs Tagen erschaffen hat, darf also auch der fromme Jude und der gläubige Christ als eher symbolisch gemeint verstehen. Wesentliche Teile der Bibel aber erzählen von Gottes Wirken in der Geschichte seines auserwählten Volkes. Wer diese Schriften nicht ernst nimmt, wertet die hebräische Bibel als Ganzes ab – zu einer Sammlung teils sehr schöner, aber doch ganz unverbindlicher alter Geschichten. Sieht man mehr darin, entdeckt man durchaus schockierende Züge im Charakter ihres Protagonisten.
Zu einer bestimmten Zeit ist dieser (heute: jüdisch-christlich-islamische) Gott, so steht es in der Bibel, alles andere als ein »lieber Gott«. Unbarmherzig ist er gegen die Feinde seines Volkes, unbarmherzig oft genug auch gegen sein eigenes Volk. Viel Blut fließt, wenn er waltet. Früh schon tötet er Menschen in großer Zahl – in der Sintflut oder als er Feuer und Schwefel über die Städte Sodom und Gomorra regnen läßt. Doch diese Erzählungen gehören zu den Anfangsteilen der Bibel, die man heute nicht mehr wortwörtlich verstehen muß, also läßt sich hier manches relativieren. Gerade jene Teile der Bibel aber, die von Israels Frühgeschichte berichten, erzählen von einem Gott, der zum massenhaften Töten neigt – noch deutlicher gesagt: zum Massenmord. Es sind vielleicht – später mehr darüber – zwei verschiedene Götter, aber blutrünstig sind sie beide, wenn auch in unterschiedlicher Weise. Der eine frühe, der seinen Namen nicht nennen will, tötet Menschen zwar in großer Zahl, allerdings – so heißt es – nur wegen der Schlechtigkeit dieser Menschen. Der andere, der sich Jahwe nennt, tötet (eigentlich mordet) auch, nur um zu beweisen, daß er es kann.
Der ägyptische Pharao will zuerst die Hebräer nicht aus seinem Land fortziehen lassen, nach all den bekannten ägyptischen Plagen ist er aber bereit dazu. Da »verhärtet« ihm Jahwe »das Herz«. Warum? Er könnte sonst seine Macht nicht zeigen auf die blutrünstigst denkbare Art: »Es war Mitternacht, als der Herr alle Erstgeborenen in Ägypten erschlug, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, und jede Erstgeburt beim Vieh.« (Ex 12,29) Da werden Unschuldige, vor allem auch Kinder, zu Opfern einer mutwilligen Machtdemonstration.
Und bald schon bringt Jahwe tausende und abertausende Hebräer um. Als Mose mit den Gesetzestafeln vom Berg Sinai herunterkommt, hat sich das Volk längst von Jahwe abgewandt und tanzt um das sprichwörtlich gewordene Goldene Kalb. Die Folgen sind in Exodus 32, 26–28 so beschrieben: »Mose trat [auf Gottes Geheiß] an das Lagertor und sagte: Wer für den Herrn ist, her zu mir! Da sammelten sich alle Leviten um ihn. Er sagte zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Jeder lege sein Schwert an. Zieht durch das Lager von Tor zu Tor! Jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund, seinen Nächsten. – Die Leviten taten, was Mose gesagt hatte. Vom Volk fielen an jenem Tag gegen dreitausend Mann.«
Interessant ist, daß Gott dieses Gemetzel anrichtet bzw. von den Leviten ausführen läßt, nachdem er am Sinai gerade ein Tötungsverbot erlassen hat. Es gilt für alle, nicht für ihn. Als später einmal das aus Ägypten herausgeführte Volk über die Mühen der langen Wüstenwanderung murrt, schickt Jahwe »Giftschlangen unter das Volk. Sie bissen die Menschen, und viele Israeliten starben« (Num 21, 6). Und dann – immer nur herumirrend – kommt man nach Schittim, einer Stadt etwa fünfzehn Kilometer nördlich des Toten Meeres. Da »begann das Volk mit den Moabiterinnen Unzucht zu treiben. […] So ließ sich Israel mit Baal-Pegor [einem lokalen Gott] ein. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und der Herr sprach zu Mose: Nimm alle Anführer des Volkes und spieße sie für den Herrn im Angesicht der Sonne auf Pfähle, damit sich der glühende Zorn des Herrn von Israel abwendet.« (Num 25, 1-5)
Ein furchtbarer Gott ist dieser Jahwe, so steht es in der Bibel. Und sein Blutdurst nimmt erschreckende Dimensionen an. Als die aus der ägyptischen Knechtschaft befreiten Israeliten das Land Kanaan erobern, da ordnet dieser Gott die vollständige Vernichtung der Kanaanäer an. Wenn er zu Mose sagt, er wolle Israels Erzfeind, die Amalekiter, austilgen unter dem Himmel, so daß keiner mehr ihrer gedenke (Ex 17, 4), dann ist hier – so vorsichtig man mit bestimmten Wörtern auch umgehen soll – von Völkermord, von einem beabsichtigten Genozid die Rede. Und wenn Jahwe anordnet, daß alle aus einem besiegten Volk zu töten, also ihm zu opfern seien, dann meint er auch wirklich ausnahmslos alle.
Die »Landnahme« erfolgt denn auch, glaubt man der Bibel, mit äußerster Brutalität. Beschrieben wird ein Vernichtungskrieg gegen die einheimische Bevölkerung. Eine Stadt nach der anderen wird erobert, und ein Volk nach dem anderen dem »Untergang geweiht« und ausgerottet. In ungefähr dreißig kanaanitischen Städten läßt Josua, der jetzt die Hebräer anführt, schreckliche Blutbäder anrichten, so liest man es in der Bibel (im Buch Josua). Alles wird umgebracht »mit der Schärfe des Schwertes«. Ein einziges Mal werden die Bewohner einiger Städte nur versklavt.
Was ich hier nacherzähle, wird als Teil der jüdischen Frühgeschichte verstanden. Ob zu recht oder zu unrecht, wird noch zu überlegen sein. Aber daß Gott Jahwe sein auserwähltes Volk aus der ägyptischen Knechtschaft heraus und ins gelobte Land Kanaan hineingeführt habe, das haben fromme Juden zu glauben und fromme Christen auch. Und in den ihnen heiligen Büchern, die davon erzählen, wird Jahwe als Schlächter beschrieben. Als Anstifter zu Massenmord und Genozid.
Da liegt die Frage nahe: Kann ein Gott, der in seiner Frühzeit so blutrünstig war, noch je ein »lieber Gott« werden?
4
»Allgemeingültigkeiten müßten besser untersucht werden.«Michel de Montaigne
Denkverbote wirken lange nach.Von der Notwendigkeit, aber auch der Schwierigkeit,die hebräische Bibel zu lesen.Und: Was so geworden ist, das kann auch anders werden.
Ich denke nach über diesen Gott. Ich bedenke, was in den heiligen Büchern über ihn geschrieben steht, was die beamteten Heilsverwalter der verschiedenen Konfessionen darüber gesagt haben. Und was unbefangenere Menschen zu verschiedenen Zeiten davon gehalten haben. Daß ich diesen Gott für nichts als eine literarische Figur halte (was nicht so wenig ist), gerade das hilft mir beim Nachdenken über ihn. Die Angst vor dem Glaubensverlust trübt jedenfalls nicht meinen Blick.
Anders als in der von den klerikalen Machthabern vorgeschriebenen Art über diesen Gott nachzudenken, war im christlichen Abendland lange sehr gefährlich. Wer es wagte, war bis weit in die Neuzeit hinein an Leib und Leben bedroht. Und später, noch im Zeitalter der Aufklärung, gefährdete etwa ein Professor damit seine akademische Existenz.
Solche Denkverbote wirken lange nach. Oft in subtiler Weise. Gerne werden heute die Kirchen, die sogenannten »Amtskirchen«, kritisiert und gar überhaupt in Frage gestellt. Hingegen findet sich auch bei sehr gebildeten Menschen eine erstaunliche Scheu, die Existenz Gottes anzuzweifeln. Daß es »etwas Höheres« geben müsse, diese Meinung ist fest verankert im abendländischen Menschen – teils als unreflektierte Folge dieses über mehr als tausend Jahre hin wirksamen Zwanges, teils auch aus psychologischen Gründen. Denn der Gedanke an einen Gott, der dazu noch ein »lieber Gott« sein soll, ist allemal tröstlich. Weit verbreitet ist die Ansicht, die abendländischen Gottesvorstellungen seien einfach die natürlichen. Das ist im Grunde erstaunlich, denn bei näherem Hinsehen ist dieser jüdisch-christliche Gott nicht weniger bizarr als beispielsweise die furchterregende indische Göttin Kali. Aber der monopolisierte Monotheismus hat alle anderen Götter ausgerottet und andere Götterkonzepte in Vergessenheit geraten lassen. Wenn man von sehr vielen (vielleicht sogar gleichwertigen) Möglichkeiten nur eine kennt, dann neigt man eben dazu, diese eine für die »ganz natürliche« zu halten. Die Alternativen, von denen viele irgendwann immerhin doch hören, sind entweder, weil vom Christentum verteufelt und verboten, zu rein historischen Konzepten geworden, oder sie kommen von so weit her, daß wir Abendländer geneigt sind, sie als exotisch und »unterlegen« abzutun.
Tausend Jahre lang hatte das Christentum Zeit, mit viel Überzeugungsarbeit und, mehr noch, mit rabiatem Druck in den Köpfen der Europäer diese Vorstellung zu verankern: An diesem Gott dürfe, ja könne gar nicht gezweifelt werden. Alle Predigt und alle Drohung hätten freilich kaum zum gewünschten Ergebnis geführt, gäbe es da nicht im Menschen diese tiefeingewurzelte Bereitschaft, eben so etwas zu glauben. Dieses Glauben-Wollen fehlt mir ganz und gar. Darum habe ich mir, nachdem dieser eine Gott für mich seine Transzendenz verloren hatte und bloßes menschliches Konstrukt geworden war, auch kein Ersatz-Konstrukt zurechtgebastelt.
In Heraklion auf Kreta liegt an der alten Stadtmauer der große Dichter Nikos Kazantzakis begraben. Die orthodoxe Kirche, heißt es, habe ihm, obwohl oder vielleicht gerade weil er ein tiefer religiöser Denker war, ein »christliches« Begräbnis verweigert. Also haben die Bürger seiner Vaterstadt für eine würdige Bestattung gesorgt. Auf seinem Grabstein steht seinem Wunsch gemäß dieser Satz, den ich oft zitiere: »Ich erhoffe nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei.« – Bis einer im Abendland das aussprechen durfte, war es ein langer Weg.
Das Glauben-Wollen – erzwungen oder aus tiefer Seele erwünscht – hinderte übrigens auch viele große Denker daran, radikal genug über diesen Gott nachzudenken. Sogar Voltaire ist an dieser Hürde gescheitert. Und Kant hat sie auch nicht übersprungen. Erst im 19. Jahrhundert wurde klar und deutlich ausgesprochen, was doch so nahe liegt: Nicht Gott hat den Menschen nach seinem Bild erschaffen, sondern umgekehrt der Mensch nach seinem Bild den Gott. (Eben das gedacht und endlich formuliert zu haben, halte ich übrigens für eine der ganz großen Kulturleistungen der Menschheit. Vergleichbar – und das klingt paradoxer, als es ist – fast nur jener, die etwa zweieinhalbtausend Jahre früher stattgefunden hat, der Erfindung des Monotheismus nämlich.)
Leichter denkt jedenfalls über Gott nach, wer ohnehin nicht mehr an ihn glaubt. Und unbefangener denkt über ihn und alles mit ihm Zusammenhängende nach, wer – so wie ich – kein Theologe ist. (Daß gerade auch Nicht-Theologen es tun, scheint vonnöten, denn natürlich sind die Fragen der Religion zu wichtig, als daß man sie ganz den Theologen überlassen dürfte. Die Beurteilung bestimmter Entwicklungen kann nicht ausgerechnet jener Berufsgruppe vorbehalten sein, die sie verursacht hat, sonst dürften über vergangene Kriege nur die Politiker und Generalstabsoffiziere schreiben.) Natürlich habe ich in den dreißig oder fünfunddreißig Jahren, in denen ich mich nun schon mit dem Thema dieses Buches beschäftige, auch reichlich Theologie gelesen. Mir ist das meiste von dem bekannt, was einer, der Theologie studiert, an der Universität zu lesen hat, und dazu noch sehr vieles, was man den Theologiestudenten nicht zur Lektüre empfiehlt. Ich habe, was ich gelesen habe, ohne Anleitung gelesen, was bedeutet: Mein Urteilsvermögen war von Obrigkeiten nie eingeschränkt. Auch stand meine Beschäftigung mit diesen Dingen nie im Zusammenhang mit meinem beruflichen Fortkommen, also drohte mir im Fall des Selber-Denkens auch kein Jobverlust. Die Voraussetzungen waren also nicht schlecht, und doch verdanke ich für dieses Buch der theologischen Lektüre recht wenig, viel weniger jedenfalls als der ausführlichen Beschäftigung mit der religionswissenschaftlichen Literatur.
Die Frage, ob es einen Gott gibt, wird auch in meinem Buch nicht beantwortet werden. Alle Versuche, seine Existenz zu »beweisen«, sind kläglich gescheitert. Noch kläglicher müßte scheitern, wer beweisen wollte, daß es so etwas wie einen Gott nicht gibt. Schon den Gesetzen der Logik gemäß kann einfach nicht bewiesen werden, daß etwas (was auch immer) nicht existiert. Freilich ist in diesem Buch nicht die Rede von irgendeinem höheren Wesen oder irgendeinem höheren Prinzip. Von der Entwicklung zweier göttlicher Personen werde ich vielmehr hier erzählen, ihre Biografien nachzeichnen, dabei zum Beispiel auch darstellen, daß oft eine sehr konkrete politische Situation – in einem sehr kleinen Land im Nahen Osten oder später im römischen Reich – sie so hat werden lassen, wie man sie heute sieht.
Vom alten Gott erzähle ich zuerst. Fast alles, was man über ihn erfahren kann, erfährt man aus der hebräischen Bibel, von den Juden »Tanach«, von den Christen »Altes Testament« genannt. Das sind nicht nur zwei verschiedene Namen, sondern zwei durchaus verschiedene Versionen der hebräischen Bibel. Verschieden im Umfang und in der Aussage.
Die katholische Version (erst 1545 vom Konzil von Trient endgültig festgelegt) umfaßt (nach der Zählweise der Einheitsübersetzung) 46 Bücher, um sieben mehr als die jüdische; die Makkabäer-Bücher etwa gelten nach strengen jüdischen Maßstäben nicht als kanonisch. Von den Katholiken werden diese sieben Schriften »deuterokanonisch« (einem zweiten Kanon zugehörig) genannt, von den Protestanten hingegen »apokryph«. (Martin Luther hat sich bei seiner Bibelübersetzung an den Tanach gehalten, die »überzähligen« Bücher fügte er zwischen dem Alten und dem Neuen Testament ein – und bemerkte: »Das sind Bücher, so der Heiligen Schrift nicht gleichgehalten und doch nützlich und gut zu lesen.«) Daß die Katholiken aus dem alten jüdischen Erbe mehr Bücher für unverzichtbar halten als die Juden selbst, scheint verwunderlich – doch nur auf den ersten Blick: In diesen deuterokanonischen Schriften haben katholische Theologen nämlich Textstellen gefunden, die »beweisen« sollen, daß christliches Gedankengut (etwa die Sakramentenlehre oder die Lehre vom Fegefeuer) recht eigentlich schon im Judentum angelegt oder vorbereitet gewesen sei.
Noch schwerwiegender als im Umfang unterscheiden sich Tanach und Altes Testament darin, wie die drei Hauptteile der hebräischen Bibel gereiht sind. Im Tanach folgen auf die fünf Bücher Mose, Thora genannt, die »Propheten«, Nebi’im, und dann die »Schriften«, Ketubim. (TaNaCh ist eine Art Akronym aus den drei hebräischen Titeln.) Im Alten Testament hingegen stehen große Teile der Propheten-Schriften nicht in der Mitte, sondern am Schluß – weil, nicht schwer zu erraten, manche Propheten-Aussprüche als Ankündigung des Christus gedeutet werden sollen. Das hat schwerwiegende Folgen: Der Tanach soll als ein in sich abgeschlossenes Werk verstanden werden, das Alte Testament aber hat – allein dadurch, daß die einzelnen Bücher anders gereiht sind – einen offenen Schluß, soll somit auf etwas noch Kommendes verweisen, wird damit zur Vorstufe des Neuen Testaments erklärt. So wie den Christen das Judentum als eine (überwundene) Vorstufe ihres eigenen Glaubens gilt.
Die Christen lesen, wenn überhaupt, das Neue Testament, das von Jesus Christus, ihrem eigentlichen Gott, erzählt. Nur sehr wenige Christen haben das Alte Testament gelesen, daraus läßt sich ihr oft unreflektiertes Verhältnis diesem jüdisch-christlich-islamischen Gott gegenüber erklären. Sie wissen kaum etwas über seine erstaunliche Entwicklung, über seine vielfältigen Verwandlungen. Das erfährt man nur aus der hebräischen Bibel, aber sie wird eben kaum gelesen – außer von frommen Juden und jenen Christen, die von Berufs wegen dazu verpflichtet sind. Ich kenne viele, die »hineingelesen« haben in die hebräische Bibel. Manche sagen, sie hätten sie »fast ganz« gelesen. (Übrigens weiß ich aus vielen Gesprächen, daß auch manch ein katholischer Theologie-Dozent, wenn das Alte Testament nicht gerade sein Spezialgebiet ist, die hebräische Bibel nur recht oberflächlich kennt.)
Einzelne biblische Geschichten kennt fast jeder, die Geschichte von der Erschaffung der Welt in sechs Tagen etwa, die Geschichte vom Sündenfall und von der Vertreibung aus dem Paradies, Kain und Abel, Noach und die Sintflut, der Turmbau zu Babel. Dann die Geschichte, wie Mose das Volk der Israeliten trockenen Fußes durchs Meer führt. Wie Mose auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln empfängt. Die Geschichte, wie die Israeliten ums Goldene Kalb tanzen. Von David und Goliat haben viele schon gehört. Und vom sagenhaft reichen und weisen Salomo. Von Ijob (Hiob). Von Daniel in der Löwengrube vielleicht noch und von Simson und Delila und möglicherweise auch von Judit und Holofernes. Wer nur diese »Highlights« kennt und auch sie womöglich nur aus Nacherzählungen oder aus Bibel-Verfilmungen, der wird leicht glauben, der Gott, der in all diesen Geschichten eine Rolle (ein paarmal sogar die Hauptrolle) spielt, sei immer der gleiche von allem Anfang an und bis in alle Ewigkeit. Tatsächlich aber erzählt die hebräische Bibel genau das Gegenteil.
Sich im Tanach oder im Alten Testament auch wirklich zurechtzufinden, das ist – ich weiß es aus Erfahrung – nicht leicht. Das liegt nicht zuletzt an der Verschiedenartigkeit der Texte. Wunderbare Erzählungen, Meisterwerke der antiken Literatur, finden sich neben Passagen, die man nur zu gerne überblättert – lange Listen etwa, wer wen gezeugt hat und welche Könige wo wie lange regiert haben. Oder ausführliche Anweisungen, wie Opfer darzubringen seien. Oder Gesetzessammlungen von ermüdender Ausführlichkeit…
Extrem schwierig ist es manchmal, sich anhand der biblischen Texte in der hebräischen Geschichte zu orientieren. Was über die Vor- und Frühgeschichte erzählt wird, ist noch recht einfach zu lesen. Dann wird es in der Tat kompliziert. Wer etwa wissen will, was die hebräische Bibel über das Babylonische Exil des Volkes Israel erzählt, der muß sich das aus einer Vielzahl biblischer Bücher zusammensuchen: aus zwei »historischen« (2. Buch Könige und 2. Buch Chronik), aus mehreren Prophetenschriften (Jeremia, Ezechiel, Sacharja, Jesaja, Daniel) und schließlich noch aus dem Buch Esra. Die Reihenfolge der Texte folgt aber weder im Tanach noch im Alten Testament der Chronologie der dargestellten Ereignisse. Da muß viel geblättert werden. Dieses »Durcheinander« ist freilich niemandem anzulasten. Die verschiedenen Texte in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen, wurde erst notwendig, als im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung die Codices erfunden wurden, also das, was wir heute unter Büchern verstehen: beschnittene und an einer Seite zusammengeheftete Blätter. Zuvor wurden die Texte als Schriftrollen aufbewahrt – wie sie zu rituellen Zwecken bei den Juden immer noch in Verwendung stehen. Ein großes Werk bestand eben aus vielen Schriftrollen, aus denen eine bestimmte Auswahl traf, wer über ein bestimmtes Thema lesen wollte. Diese Schriftensammlung war für ein Nebeneinander, nicht für ein Nacheinander konzipiert. Man hätte sie für die Herausgabe als Codices auch anders als jetzt gebräuchlich reihen können, eine leicht zu durchschauende »Ordnung« wäre in keinem Fall entstanden, hat einfach nicht entstehen können.
Das ergibt Denkfallen, in die nur der nicht tappt, der schon vorinformiert ist. So sagt etwa die Stellung eines biblischen Textes in den heutigen Buchausgaben oft nichts über sein Alter aus, nicht im Tanach und noch weniger im Alten Testament. Das Buch Ijob (Hiob) findet man ungefähr in der Mitte der christlichen Ausgaben. Wer sich nicht mit der Entstehungsgeschichte der hebräischen Bibel beschäftigt hat, kann nicht wissen, daß Ijob eines der jüngsten Bücher ist. Hier ist die jüdische Gottesvorstellung fast schon ganz ausdefiniert – ganz im Gegensatz zu den Schriften etwa des Propheten Jeremia, der noch nichts davon wußte, daß Jahwe der einzige Gott sei. Jeremia aber ist im Alten Testament viel später, viele Seiten nach Ijob zu finden…
Das alles bedeutet: Wer die hebräische Bibel liest, wie man Bücher eben liest, mit der ersten Seite beginnend und mit der letzten endend, dem können sich die wirklich interessanten Zusammenhänge bei der ersten Lektüre nicht erschließen. Liest man aber parallel, was zeitlich zusammengehört, und interessiert man sich schließlich auch dafür, welche Teile wann entstanden sind, dann läßt sich aus dieser hebräischen Bibel vor allem das sehr klar herauslesen, was so viele Christen einfach nicht wissen: Dieser Gott ist nicht unwandelbar, er wächst allmählich, er verändert sich, oft ganz radikal. Er war nicht zu allen Zeiten der gleiche. Das aber bedeutet: Was geworden ist, muß nicht notwendigerweise so bleiben, wie es jetzt ist. Das kann sich wieder verändern, kann wieder anders (gemacht) werden. Etwas ist entstanden, war also nicht immer da, es ist nicht ewig, es wird (oder kann jedenfalls) einmal auch wieder vergehen.
5
»Dinge zu bezweifeln,die ganz ohne weitere Untersuchung geglaubt werden,das ist die Hauptsache überall.«Georg Christoph Lichtenberg
Wie lange es diesen Gott nun schon gibt, ist nicht ganz klar. Seine heutigen Anhänger meinen, immer schon. (Und sie berufen sich dabei auf die hebräische Bibel.) Das mag glauben, wer will; ich glaube es nicht. (Und ich berufe mich dabei ebenfalls auf die hebräische Bibel.) Dreitausend, höchstens dreieinhalbtausend Jahre mag er alt sein. Vom zweiten nachchristlichen Jahrhundert an hat er Weltkarriere gemacht – und ist dabei paradoxerweise gleichzeitig in den Hintergrund getreten, in den Schatten gestellt worden. Ganz am Anfang interessierte sich nur ein sehr kleines Volk im Nahen Osten für ihn – und sah viele Jahrhunderte lang in ihm nur einen Gott unter vielen. (Was keine Behauptung von mir ist, sondern genau so in der Bibel zu lesen steht.) Aber diese Menschen definieren ihn nach und nach, und sie definieren sich selbst damit allmählich zu einem ganz besonderen Volk. So spricht denn manches dafür, daß ich mich, ehe ich mich mit diesem Gott beschäftige, mit diesem kleinen Volk befassen sollte, das man später die Juden nennen wird. Die Vor- und Frühgeschichte dieses Volkes lasse sich, so glauben sehr viele, aus der hebräischen Bibel rekonstruieren. So werde ich denn ausführlich zitieren – und zwar aus der sogenannten Einheitsübersetzung, obwohl sie an die sprachliche Schönheit der Luther- oder gar der Buber-Rosenzweig-Übersetzung nicht heranreicht. Aber es wird behauptet, sie sei »richtiger«, was ich freilich nicht überprüfen kann. Konsequenterweise folge ich auch bei der Schreibweise der biblischen Namen der Einheitsübersetzung.
So wie wir die Bibel heute kennen, erzählt sie ganz am Beginn von der Erschaffung der Welt und des Menschen, vom Paradies, vom »Sündenfall« der beiden ersten Menschen, und wie sie daraufhin aus dem Paradies vertrieben wurden. Sie erzählt, wie Kain den Abel erschlug, sie erzählt von Noach und der Sintflut, vom Turmbau zu Babel und von der Sprachenverwirrung, und wie die Menschen über die ganze Welt zerstreut wurden.
Darauf folgt eine Zäsur, eine Art Erzählpause. Überbrückt wird sie durch eine Liste der männlichen Vorfahren des Abraham, mit dem der zweite große Erzählblock beginnt; er soll von Noachs Sohn Sem abstammen. Nur Namen werden aufgezählt, wir erfahren nichts über das Leben oder das Schicksal der aufgelisteten Männer.
Über Abraham, seinen Sohn Isaak und seinen Enkel Jakob hingegen, die Patriarchen, die »Erzväter«, erfahren wir viel – und das auf einmal in einem ganz anderen Erzählstil. Die Menschen aus dem allerersten Teil der Bibel sind eher Typen denn individuelle Charaktere; wir lesen von ihnen karge Berichte, nicht viel mehr als ihre Namen und was sie eben tun. Die Geschichten von den Patriarchen aber werden auf einmal farbig und detailreich ausgeführt. Freilich bricht die Erzählung sehr plötzlich ab. Wiederum eine Zäsur. Jakobs Clan, so lesen wir, ist nach Ägypten übersiedelt. Seine Nachkommen werden dort ein paar hundert Jahre zubringen, die Bibel weiß es ganz genau: »Der Aufenthalt der Israeliten in Ägypten dauerte vierhundertdreißig Jahre.« (Ex 12, 40) Was in dieser Zeit geschieht, wird nur in ein paar Sätzen zusammengefaßt: Die Nachkommen Jakobs (nach dessen zweitem Namen auch die »Kinder Israels« genannt) seien in Ägypten zu einem großen Volk herangewachsen und von den Ägyptern versklavt worden.
Wie Mose dieses Volk aus der ägyptischen Knechtschaft herausführt, das wird dann wieder ausführlich erzählt. Vierzig Jahre führt Mose die Kinder Israels durch die Wüste. Dann erobern sie, geführt von Josua, dem Nachfolger Moses, das Land Kanaan für sich. Die zwölf Stämme (gemeint sind die jeweiligen Nachkommen der zwölf Söhne des Jakob) teilen das Land unter sich auf und leben zunächst gute zweihundert Jahre nur locker untereinander verbunden. Schließlich wollen sie aber wie die Völker ringsum auch einen König haben. Der erste heißt Saul, sein Nachfolger David schafft – sagt die Bibel – ein großes Reich, das sein Sohn Salomo noch halten kann. Nach dessen Tod aber zerfällt es in zwei Teile, das Nordreich Israel und das Südreich Juda… Hier halte ich vorläufig einmal an, bis hierher ist alles, was die Bibel uns darüber erzählt, recht einfach zu verstehen. Mit diesem abgesteckten Zeitabschnitt werde ich mich zunächst beschäftigen.
Religionswissenschaftlich gesehen kann man diese hier skizzierten ersten Abschnitte der Bibel in einen mythologischen, einen legendären und einen (mit Vorbehalt) historischen Teil gliedern. Mythologisch sind die Erzählungen von der Erschaffung der Welt an bis zu Noach und zum Turmbau von Babel (durchaus verwandte Mythen finden sich in anderen heiligen Büchern anderer Religionen). Legendär sind jedenfalls die Patriarchen-Geschichten. Der historische Teil beginnt für viele mit Mose und dem Auszug der Kinder Israels aus Ägypten. Ich zähle mit guten Gründen, die ich erläutern werde, diese Episode wie auch alle »Berichte« über die Eroberung Kanaans noch zum legendären Bereich. Erst von der Zeit der ersten hebräischen Könige an wird einiges, was die Bibel erzählt, auch historisch überprüfbar. Alten Sagen, die im legendären Teil vielleicht verarbeitet wurden, mag da oder dort durchaus ein historischer Kern zugrunde liegen. Alle Versuche, ihn herauszuschälen, sind aber gescheitert.
Wer immer die Verfasser der alten Texte gewesen sein mögen, wir kennen nicht einen einzigen Namen. Inspiriert waren sie gewiß – von religiösen Ideen und vermutlich noch mehr von politischen Ideen. Und sehr oft dürfte das eine vom anderen nicht zu trennen gewesen sein. Es gibt starke Hinweise darauf, daß das, was uns die hebräische Bibel über die hebräische Vor- und Frühgeschichte erzählt, fast nichts über historische Fakten sagt – aber sehr viel mehr darüber, wie Hebräer vom siebten vorchristlichen Jahrhundert an sich ihre Vor- und Frühgeschichte gewünscht hätten. Meine These ist (und ich werde sie mit Argumenten belegen): Man hat sich zu einem ganz bestimmten historischen Zeitpunkt eine ganz bestimmte Vergangenheit erfunden. Und einen Gott, der dazu paßt.
Aus bald einsichtigen Gründen nehme ich aber vorläufig einmal ernst, was die hebräische Bibel darüber erzählt, und ignoriere versuchsweise all die guten Einwände, mit denen ich mich später noch werde beschäftigen müssen. Und ich beginne mein Nachdenken über diesen Gott, indem ich ihn zunächst außer acht lasse.
6
Was die Menschen sich alles einreden lassen,darüber wundert er sich immer noch.
Die hebräische Vorgeschichte betrachtend, wie die Bibel sie uns erzählt, werde ich Gott vorläufig also ausklammern. Doch soll nicht vergessen werden, daß er da ist. Was macht er gerade? – Die Antwort ist simpel: Er denkt in einem fort, sonst kann er ja nicht viel tun. Gewiß denkt er nicht oder nur zufällig einmal darüber nach, worüber ich hier gerade nachdenke. Er hat wie alle guten literarischen Figuren ein Eigenleben. Wer je einen Roman geschrieben hat, kennt das: Sind die Figuren erst gut genug definiert, so verselbständigen sie sich. Dann tun und denken sie, was ihnen gefällt. Man sieht und hört ihnen zu, schreibt auf, was sie tun und sagen. Eine literarische Gestalt ist ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr als das, was der Autor ihr gegeben hat. Sie rundet sich selber ab oder zeigt von sich aus Widersprüche, an die der Autor gar nicht gedacht hat. Weder erfahren wir bei Cervantes alles über jenen Alonso Quijanos, der sich dann Don Quixote nannte, noch bei Shakespeare alles über Hamlet oder Richard III. Vieles steht noch zwischen den Zeilen, manches nicht einmal dort – und ist doch da. So eigenständig werden literarische Figuren, daß sie, wenn sie denn gut sind, nicht mehr ihrem Autor, was Hervorbringer heißt, allein gehören. Eine literarische Figur kann weitergeschrieben, auch umgeschrieben werden. Das ist dem Ödipus passiert, dem Faust, dem Don Juan, der Jeanne d’Arc. Und gerade diesem Gott ist das sehr oft passiert.
Aber darf ich ihn weiterschreiben, darf ich hier zum Beispiel erzählen, worüber Gott vielleicht gerade nachdenkt? Wäre das nicht die pure Blasphemie? Ich glaube, ich darf. Zum einen kann blasphemisch nur ein Glaubender sein. Zum anderen: Wenn ein ziemlich ungehobelter, rüpelhafter Schafhirte wie der als Prophet bekannte Amos sagen darf »So spricht der Herr!«, dann werde ich auch schreiben dürfen: So denkt Gott.
Wie denkt er also, was denkt er gerade? – Auch hier ist die Antwort nicht schwer. Er denkt über die Menschen nach. Und dabei, notgedrungen, auch über sich selbst. Worüber denn sonst? Ohne die Menschen wäre er nichts, ohne die Menschen gäbe es ihn gar nicht, er hätte ohne sie auch gar keinen Sinn. Seit wenigstens dreitausend Jahren kennt er sie nun schon. Es ist nicht seine Art, die Jahre zu zählen. Sind für ihn, wie oft behauptet wird, hundert oder tausend Jahre wie ein Tag? Aber nein! Er zählt die Jahre einfach nicht und übernimmt die menschliche Zählart nur, wenn er sonst die Orientierung in der Zeit verlöre. Er habe gar kein rechtes Zeitgefühl, glaubt er manchmal. Fest steht jedenfalls, daß er die Menschen schon sehr lange kennt. Er hat seine Erfahrungen mit ihnen gemacht, und er wundert sich immer noch über sie.
Gerade jetzt versucht er wieder einmal, sich ganz andere Menschen auszudenken. Das tut er oft. Aber leicht ist es nicht, denn der Möglichkeiten sind zu viele. Fast alles, was den Menschen ausmacht, ließe sich auch ganz anders denken. Hätte er den Menschen wirklich geschaffen, so hätte er ihn, das steht fest, ganz anders gemacht. Aber wie? Sich das auszumalen, das kann ihm noch eine ganze Weile die Zeit vertreiben und die Langeweile, die ihn so oft quält.
Um den Gegenstand seiner Überlegungen einzugrenzen, stellt er eine Liste auf, was er alles, wäre er ein Mensch, einfach nicht glauben würde. Was Menschen sich einreden lassen, beschäftigt ihn oft. Und jedes Mal wieder staunt er.
Darüber zum Beispiel staunt er sehr: Einerseits stellen sie ihn, ihren Gott, nun immerhin schon seit mehr als zweitausend Jahren als unwandelbar dar und glauben andererseits doch, er hätte zu unterschiedlichen Zeiten höchst unterschiedliche Gebote erlassen. Einmal habe er, behaupten sie, vom Blut der Opfertiere nicht genug bekommen können und immerzu verbranntes Fleisch riechen wollen, dann habe er plötzlich Liebe gewollt statt der Brandopfer. Glauben sie, sein Geschmack habe sich geändert? Dann müßten sie aber seine Unwandelbarkeit anzweifeln.
Er als Mensch würde das tun, und er als Mensch würde zum Beispiel fragen: Warum hat dieser Gott nicht von Anfang an gesagt, was er will? Hat er es selbst nicht gewußt? Der Verdacht liege nahe, würde er als Mensch überlegen, daß dieser Gott alles, also auch sich selbst, immer erst an den Menschen hat ausprobieren müssen. Selten nur scheint er die Auswirkungen seines Tuns vorhergesehen zu haben. Wie ist das aber mit seiner behaupteten Allwissenheit zu vereinbaren? Das zum Beispiel würde er als Mensch fragen. Die Antworten der Theologen auf solche Fragen kennt er natürlich, aber er würde sich, wäre er ein Mensch, damit einfach nicht zufriedengeben.
Heute glauben sehr viele Menschen, es mißfiele ihm, dem Gott, wenn Menschen andere Menschen versklaven. Wenn es denn so wäre, warum hat er das nicht schon früher gesagt? Warum hat er die Sklaverei zugelassen über viele Jahrhunderte hin? Warum hat er, noch ganz am Anfang, genaue Anweisungen gegeben, wie mit Sklaven zu verfahren sei? Dieser Gott hat einmal sogar die Möglichkeit in Betracht gezogen, also gebilligt, daß einer seine Tochter als Sklavin verkauft. Hat Gott das wirklich gewollt, daß Menschen Besitz und Eigentum anderer Menschen sind, und sich erst später eines Besseren, Menschlicheren besonnen? Fragen über Fragen würde er stellen, wäre er ein Mensch.
Heute behaupten die Christen wie die Juden, Gott wolle Monogamie. Warum hat er dann den Juden so lange die Vielweiberei nicht verboten? Er hätte doch dem Abraham oder wenigstens später dem Mose sagen können: Eine Frau pro Mann, mehr nicht! Warum hatte ihn an Salomos riesigem Harem nur gestört, daß etliche Weiber darunter waren, die andere Götter und nicht ihn verehrten? Hat er je gewollt, daß Mann und Frau gleichberechtigt seien? Und wenn ja, so stellt sich wieder diese eine Frage: Warum hat er das nicht von Anfang an gesagt?
Andererseits: Warum steht er nicht mehr zu dem, was er, glaubt man den alten Büchern, sehr wohl einmal verlangt hat? Daß etwa eine Hexe nicht am Leben zu lassen und jeder, der mit einem Tier verkehrt, mit dem Tod zu bestrafen sei. Auch jeder, der mit einer Frau während ihrer Menstruation verkehrt. So steht es geschrieben und ist nie ausdrücklich widerrufen worden. Auch der Geschlechtsverkehr eines Mannes mit seiner Schwiegertochter war einmal, dem Wunsche dieses Gottes gemäß, ein todeswürdiges Verbrechen. Und es steht geschrieben: Wenn sich die Tochter eines Priesters als Dirne entweihe, so entweihe sie ihren Vater und solle deshalb im Feuer verbrannt werden. Dies alles hat dieser Gott einmal angeordnet, warum besteht er nun nicht mehr darauf, daß seinen Anordnungen Folge geleistet werde?
Hat Gott dazugelernt, ist er milder und nachsichtiger geworden über die Jahrhunderte hin?
Hätte er nicht wenigstens die simpelsten Menschenrechte schon zu Beginn deklarieren und dekretieren können? Statt dessen hat er selbst Ijobs Kinder wie dessen Besitz behandelt und sie, um Ijob zu prüfen, umgebracht, als hätten sie keine andere Funktion, als Ijobs Besitz zu sein, nicht viel mehr wert als sein Vieh.
Er würde, wäre er ein Mensch, den Verdacht laut aussprechen, daß ihm, dem Gott, einfach in den Mund gelegt worden sei, was den Menschen, einzelnen von ihnen, den Machthabern, nützlich und vorteilhaft erschien. Gott habe auf den historischen Entwicklungsstand seiner Anhänger Rücksicht nehmen wollen oder müssen, diesen Einwand würde er, wäre er ein Mensch, als blanken Unsinn glatt zurückweisen. Er hat den Menschen ungemein vieles zugemutet, äußerst komplizierte Speisevorschriften etwa, er hätte ihnen auch zumuten können, wahrhaft menschlich miteinander umzugehen. Und keinesfalls hätten spätere neue Gesetze und Gebote das Gegenteil manch eines alten sein dürfen, wie dies da und dort durchaus der Fall ist. Einmal hat er verlangt, daß ganze Völker mit der Schärfe des Schwertes umgebracht werden, heute, so wird behauptet, verabscheue er derlei Greuel. – Wieso nehmen die Menschen das einfach so hin, wieso lassen sie sich mit den windigen Erklärungsversuchen abspeisen, die Theologen ihnen darbieten?
Und wie es mit den Forderungen ist, so ist es mit seinen Versprechen: Warum, würde er als Mensch fragen, hat dieser Gott nie wirklich eindeutig gesagt, was jene zu hoffen haben, die treu an ihn glauben und sich an seinen Geboten orientieren? Wieso läßt er zu, daß etliche Theologen behaupten, der Mensch selbst könne gar nichts beitragen zu seiner ewigen Glückseligkeit, denn Gott erwähle oder verwerfe ganz nach Lust und Laune? Manchmal gefällt ihm ja die Vorstellung, ein so unerträglich arroganter Gott zu sein, aber als Mensch hätte er in diesem Zusammenhang doch die eine oder andere Frage zu stellen.
Wieso läßt er es überhaupt zu, daß die Theologen an seinem Charakter herumbasteln, grad wie es ihnen gefällt? Weil er die Freiheit des Menschen so sehr achtet, daß er das Elend von zahllosen Gläubigen in Kauf nimmt, nur damit die Freiheit eines Theologen, seine kranke Phantasie auszuleben, nicht eingeschränkt werde?
Wäre er ein Gott, dem nichts unmöglich ist, hätte er wohl sagen können: Glaubt nicht die Hälfte von dem, was so ein Augustinus versucht hat, euch einzureden! Und was die zu geltende Moral angeht, hätte er von Anfang an sagen können: So will ich das, daran habt ihr euch zu halten! Aus, basta! so spricht der Herr.
Er hat es nicht getan. Er hat überhaupt nichts dazu beigetragen, das Zusammenleben der Menschen menschenwürdiger zu machen. In den heiligen Büchern, in denen er doch angeblich sich und seinen Willen offenbart, findet sich kein Wort davon, daß im Krieg Besiegte nicht abgeschlachtet werden dürften, daß er die Todesstrafe ablehne oder daß ihm Sklaverei verhaßt sei. Er würde, wäre er ein Mensch, die Theologen auffordern, ihm eine solche Bibelstelle zu nennen. Natürlich kennt er ihre Antwort. Sie würden versuchen, das eine oder andere Prophetenwort so lange zurechtzubiegen, bis es wie eine passende Antwort aussieht, und sie würden auf ihren Herrn Jesus Christus verweisen, der doch die Welt um so vieles menschlicher gemacht habe. Das würde er, wäre er ein Mensch, aber nicht akzeptieren; man könne nicht, würde er argumentieren, wenn von einem Gott die Rede sei, auf einen anderen ausweichen, um den einen zu erklären.
Einen Gedanken würde er, wäre er ein Mensch, recht reizvoll finden: Gott habe vielleicht den Menschen Gelegenheit geben wollen, die allgemeinen Menschenrechte selbst zu entdecken. Das wäre, so könnte man es deuten, ein großer Vertrauensbeweis Gottes den Menschen gegenüber. Was hätte es dann aber in diesem Gedankenkonstrukt zu bedeuten, daß die, die heute und lange schon in seinem Namen das Heil verwalten, die Durchsetzung der Menschenrechte behinderten, wo sie nur konnten? Zweierlei könnte es bedeuten: Daß sein Zutrauen in den Menschen so groß ist, daß er sie von Anfang an für fähig hielt, sich am Ende sogar gegen die Kirchen durchzusetzen. Oder aber, Möglichkeit zwei, daß er über etwas verfügt, was ihm noch kaum jemand nachgesagt hat, makabren Humor nämlich.
Über solchen zwar fruchtlosen, doch amüsanten Gedankenspielen vergeht ihm die Zeit, die er nun, ewig geworden, hat in Hülle und Fülle.
7
Ein herumirrender Aramäer war unser Vater.
Glaubt man der Bibel, so beginnt (nach den mythologischen Erzählungen über die Anfänge der Menschheit) die hebräische Geschichte mit einem Mann namens Abram, später Abraham genannt. Er lebt – ich unterstelle jetzt einmal, daß er gelebt hat – in der mittleren Bronzezeit. In der ersten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends also. (Man hat sich angewöhnt, die Patriarchenzeit um 1800 herum beginnen zu lassen, aus der Bibel selbst läßt sich freilich auch errechnen, Abram sei schon zwei- oder sogar dreihundert Jahre früher nach Kanaan gekommen.)
Abram stammt, heißt es, aus Ur, einer sehr alten Stadt, am Euphrat gelegen, im südlichen Mesopotamien. Wie der Clan, dem Abram angehört, dort gelebt hat, erzählt die Bibel nicht. Es könnten Nomaden gewesen sein oder Händler oder auch seßhafte Bauern, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht infolge politischer Veränderungen, zu einer nomadischen Lebensweise entschlossen haben. (Solcher Wechsel der Lebensform ist tausend Jahre später den Hebräern noch durchaus vertraut.) Die Bibel erzählt: Abram habe eines Tages mit seinem Vater Terach, seiner Frau Sarai (später Sara genannt), mit seinem Neffen Lot und dessen Frau die Stadt Ur verlassen.
Zuerst zieht die Sippe nach Haran (an der heutigen syrisch-türkischen Grenze). Dort läßt man sich nieder. Als Abram nach Terachs Tod zum Clan-Chef wird, bricht man mit großen Kleinviehherden, Ziegen und Schafen, wieder auf. Diesmal wendet man sich nach Süden und gelangt in ein Land, das bald Kanaan und viel später Palästina heißen wird. »Ein herumirrender Aramäer war mein Vater«, sagen die Hebräer achthundert oder tausend Jahre später über Abraham, den sie als ihren Ahnherrn betrachten.
Man darf sich Eselsnomaden vorstellen, die in Zelten wohnen, von Weideplatz zu Weideplatz und manchmal, bei einer Dürre etwa, bis weit hinunter in den Süden ziehen, bis Ägypten gar. Der Reichtum solcher Clans hängt von der Fruchtbarkeit der Tiere ab, seine Stärke von der Fruchtbarkeit der Menschen. Abrams Herde vermehrt sich so stark, daß er sich bald von seinem Neffen Lot trennen muß, weil das Land Kanaan, wie es heißt, zwei so große Herden nicht ernähren kann.
Abrams Familie aber will nicht recht gedeihen. Sarai wird, so scheint es, kinderlos bleiben. Da zeugt Abram, um nicht ohne einen Erben zu bleiben, mit ihrer Magd Hagar ein Kind, das Ismael genannt – und dann verstoßen wird, als Sara (nun schon nicht mehr Sarai) selbst doch noch ein Kind gebiert: Isaak.
Später, nach Saras Tod, nimmt Abraham (so heißt er jetzt bereits) sich eine gewisse Ketura zur Frau, die ihm noch weitere sechs Söhne schenkt, auch an anderen Frauen beweist er die Kraft seiner Lenden. Aber: »Abraham vermachte Isaak alles, was ihm gehörte. Den Söhnen der Nebenfrauen, die er hatte, gab Abraham Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten weg nach Osten, ins Morgenland, weit weg von seinem Sohn Isaak.« (Gen 25,5)
Für den Universalerben Isaak wird, auf daß er keine Kanaaniterin heiraten muß, eine Frau aus Abrahams alter Heimat geholt: Rebekka. Sie gebiert ihm Zwillinge und sorgt durch eine List dafür, daß nicht der Erstgeborene Esau, sondern ihr Liebling Jakob das Erbe des Vaters Isaak antritt.
Dieser Jakob wiederum, den man bald auch Israel nennen wird, ist fruchtbar wie sein Großvater Abraham. Mit zwei Hauptfrauen und zwei Dienerinnen zeugt er insgesamt zwölf Söhne und eine Tochter.
Jakob und all die Seinen müssen vor einer großen Hungersnot, die Kanaan heimsucht, nach Ägypten flüchten. Wie es den Nachkommen von Jakobs zwölf Söhnen dort ergeht, das erzählt die Bibel uns, wie schon gesagt, nicht mehr. Die Zeit der »Erzväter«, der Patriarchen, ist abgeschlossen. Alle drei waren sie, glaubt man den biblischen Berichten, durchaus schillernde Persönlichkeiten mit allerhand Schwächen und charakterlichen Besonderheiten.
Als Abraham (zu dieser Zeit noch: Abram) einmal wegen einer Dürre hinunter nach Ägypten zieht, da fürchtet er, der Pharao könnte sich für seine schöne Frau Sarai interessieren. Und er fürchtet dabei vor allem um sein eigenes Leben: Der Pharao würde ihn vielleicht töten, um Sarai dann in seinen Harem zu holen. Da gibt er Sarai lieber als seine Schwester aus. (Gelegentlich wurde behauptet, Sarai sei nicht nur Abrams Frau, sondern auch seine Halbschwester gewesen. Ich lese das aus der Bibel nicht heraus, nicht eindeutig jedenfalls. Es würde daran auch nichts ändern:) Abram überläßt Sarai freiwillig der königlichen Begehrlichkeit – und läßt sich dafür vom Pharao auch noch reichlich beschenken. De facto verkauft er seine Frau. Später bekommt er sie, was er zunächst nicht wissen kann, wieder zurück. Der ägyptische Herrscher hat nämlich das Gefühl, mit Sarai sei allerhand Unheil an seinen Hof gekommen.
Daß Abram seine Frau als seine Schwester ausgibt, geschieht dann noch einmal, nun schon wieder im Lande Kanaan – nämlich Abimelech, dem König von Gerar, gegenüber. Ein bißchen seltsam mutet das heute schon an.
Aber sein Sohn Isaak macht es später genauso. Er stellt gleichfalls einem (wohl nicht dem gleichen) Abimelech, der nun der König der Philister genannt wird, seine Frau Rebekka als seine Schwester vor. »Er fürchtete sich nämlich zu sagen: Sie ist meine Frau. Er dachte: Die Männer des Ortes könnten mich sonst wegen Rebekka umbringen. Sie war nämlich schön.« (Gen 26, 7) – Verwunderlich das alles, von heute aus gesehen. Doch spielen diese Geschichten eben in der Bronzezeit; ein Mann wird damals seine Frau weniger als eigenständige Person, eher als Besitz verstanden haben, für den man aber sein Leben nicht riskiert. (So haben es auch jene noch gesehen, die diese Geschichte aufgeschrieben haben – ungefähr tausend Jahre nach der Zeit, in der sie angesiedelt ist.)
Isaak, der mittlere der Patriarchen, ist von den dreien der blasseste und übrigens, wie schon erzählt, auch der am wenigsten fruchtbare. Zwei Söhne, das ist nicht viel für damalige Verhältnisse. Ihm wird übel mitgespielt. Zuerst, als Kind, wäre er beinahe von seinem Vater Abraham als Menschenopfer geschlachtet worden. Im hohen Alter dann und schon erblindet, wird er das Opfer dieses ebenso simplen wie wirksamen Betruges: Er will Esau als seinen Nachfolger einsetzen und segnen, aber statt dessen segnet er Jakob, dem seine Mutter Rebekka Ziegenfelle um Hals und Hände gelegt hat, auf daß der Vater ihn für den dichtbehaarten Esau halten möge.
Auch Jakob wird zunächst betrogen – von seinem Onkel und Schwiegervater Laban. Dessen Tochter Rahel will Jakob heiraten und muß dafür sieben Jahre ohne Lohn für Laban als Hirte arbeiten. Doch als dann die Nacht der Nächte kommt, legt ihm Laban Rahels ältere Schwester Lea ins Zelt, was Jakob freilich erst am anderen Morgen bemerkt. Für Lea muß er dann noch einmal sieben Jahre schuften. Aber dann betrügt er seinerseits Laban – um erhebliche Teile seiner Herde. So kehrt Jakob schließlich reich nach Kanaan zurück, mit allerhand Vieh, mit vier Frauen (Lea, Rahel und zwei Mägden), die ihm eine stattliche Kinderzahl geschenkt haben. Eine einzige Tochter ist übrigens darunter, Dina, von ihr erfahren wir nicht viel mehr, als daß sie einmal von einem Mann aus Sichem vergewaltigt wird, woraufhin die Jakobssöhne alle Sichemiten erschlagen, obwohl ausgleichende Verhandlungen schon zum Erfolg geführt haben. (Nachzulesen in Gen 34.)
Von seinen insgesamt zwölf Söhnen liebt Jakob den Josef am meisten, er zeigt das auch deutlich. An einem prächtigen Mantel, den Jakob seinem Lieblingssohn schenkt, und an Josefs Überheblichkeit entzündet sich die lange aufgestaute Wut der Brüder. Sie wollen ihn am liebsten umbringen, werfen ihn dann aber, um sich nicht mit Blut zu beflecken, in eine ausgetrocknete Zisterne, wo er sterben würde, kämen da nicht gerade auf ihrem Weg nach Ägypten midianitische Händler vorbei, sie kaufen Josef als Sklaven. Dem Vater Jakob bringen die Brüder den schönen Mantel, den sie ins Blut eines geschlachteten Ziegenbocks getaucht hatten. Jakob erschrickt: »Der Rock meines Sohnes! Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Zerrissen, zerrissen ist Josef.« (Gen 37, 33)
Der von seinem Vater tot geglaubte Josef macht in Ägypten Karriere, freilich nicht gleich. Er ist Sklave im Haus des Potifar und sieht sich konfrontiert mit den Wünschen von Potifars Gemahlin, »bei ihr zu schlafen und ihr zu Willen zu sein«. Doch bleibt Josef keusch, weshalb ihn das lüsterne Weib aus Rache verleumdet, so landet Josef schließlich im Gefängnis. Und ausgerechnet dort beginnt sein Aufstieg. Er kann, stellt sich heraus, aufs trefflichste Träume deuten. Davon erfährt endlich auch der Pharao, der gerade von sieben fetten und sieben mageren Kühen geträumt hat. Josef weiß, was das zu bedeuten hat: Auf sieben fette Jahre werden sieben magere folgen, für die, so rät er, vorgesorgt werden müsse. Niemand anderem als ihm erteilt der Pharao diesen Auftrag, so wird er die Nummer zwei in Ägyptens Hierarchie, nur dem Pharao selbst unterstellt.