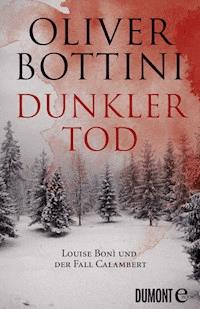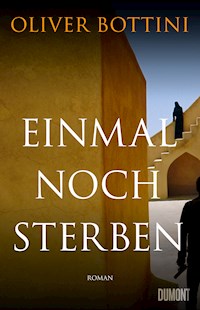
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Februar 2003. Nach den Anschlägen von New York steht der Krieg gegen den Terror vor einem weiteren Höhepunkt: Die USA und ihre Verbündeten bereiten sich darauf vor, in den Irak einzumarschieren. BND-Agent Frank Jaromin ist gerade von einem Einsatz in Bosnien zurückgekehrt und will sich eigentlich um seine zerstrittene Familie kümmern. Da kommt ein hochbrisanter Auftrag aus dem Kanzleramt: Eine irakische Regimegegnerin behauptet, die Vorwürfe, die den Krieg legitimieren sollen, seien erfunden, es gebe im Irak nachweislich keine Massenvernichtungswaffen. »Curveball« – jener Informant, auf dessen Aussage die Vorwürfe basieren – lüge. Der BND schickt Frank Jaromin mit zwei Kollegen in geheimer Mission nach Bagdad, um die Beweise der Dissidentin zu sichern und den Krieg im letzten Moment zu verhindern. Das aber liegt nicht im Interesse einer Gruppe einflussreicher Akteure – ganz im Gegenteil. Und schon bald kämpft Frank Jaromin um sein Leben … Dem sechsfachen Deutschen-Krimipreis-Träger Oliver Bottini gelingt mit seinem neuen Roman ein Meisterwerk des Spionagethrillers, politisch brisant und absolut mitreißend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Ähnliche
Februar 2003. Nach den Anschlägen von New York steht der Krieg gegen den Terror vor einem weiteren Höhepunkt: Die USA und ihre Verbündeten bereiten sich darauf vor, in den Irak einzumarschieren. BND Agent Frank Jaromin ist gerade von einem Einsatz in Bosnien zurückgekehrt und will sich eigentlich um seine zerstrittene Familie kümmern. Da kommt ein hochbrisanter Auftrag aus dem Kanzleramt: Eine irakische Regimegegnerin behauptet, die Vorwürfe, die den Krieg legitimieren sollen, seien erfunden, es gebe im Irak nachweislich keine Massenvernichtungswaffen. »Curveball« – jener Informant, auf dessen Aussage die Vorwürfe basieren – lüge. Der BND schickt Frank Jaromin mit zwei Kollegen in geheimer Mission nach Bagdad, um die Beweise der Dissidentin zu sichern und den Krieg im letzten Moment zu verhindern. Das aber liegt nicht im Interesse einer Gruppe einflussreicher Akteure – ganz im Gegenteil. Und schon bald kämpft Frank Jaromin um sein Leben …
Dem fünffachen Deutschen-Krimipreis-Träger Oliver Bottini gelingt mit seinem neuen Roman ein Meisterwerk des Spionagethrillers, politisch brisant und absolut mitreißend.
© Hans Scherhaufer
Oliver Bottini wurde 1965 geboren. Für seine Romane erhielt er zahlreiche Preise, unter anderem den Krimipreis von Radio Bremen, den Berliner ›Krimifuchs‹, den Stuttgarter Krimipreis und fünfmal den Deutschen Krimipreis, zuletzt 2018 für ›Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens‹. Bei DuMont erschienen außerdem ›Der kalte Traum‹ (2012) und ›Ein paar Tage Licht‹ (2014) – kürzlich von ARTE/ZDF unter dem Titel ›Algiers Confidential‹ verfilmt – sowie die Kriminalromane um die Freiburger Kommissarin Louise Bonì. Oliver Bottini lebt mit seiner Familie in Frankfurt am Main.
OLIVER BOTTINI
EINMAL NOCHSTERBEN
Roman
Von Oliver Bottini sind bei DuMont außerdem erschienen:
Mord im Zeichen des Zen
Im Sommer der Mörder
Im Auftrag der Väter
Jäger in der Nacht
Das verborgene Netz
Der kalte Traum
Ein paar Tage Licht
Im weißen Kreis
Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens
eBook 2022
© 2022 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Jean-Pierre De Mann/DEEPOL by plainpicture und © Snaptitude/Adobe Stock
Karte: Kartografie Angelika Solibieda, Cartomedia-Karlsruhe
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN EBOOK 978-3-8321-8251-9
www.dumont-buchverlag.de
Für Hans-Christof von Sponeck,
4.FEBRUAR 2003
PROLOG
Bosnien und Herzegowina
ENDLICH, denkt Jaromin.
Im Dunkel der Nacht sind zwei winzige gelbe Lichter aufgetaucht. Lautlos gleiten sie in der Ferne über die unbeleuchtete Straße. Verschwinden in Kurven, hinter Bäumen, Hügeln. Tauchen wieder auf. Das Auto fährt schnell, ein ums andere Mal springen die Lichter aus dem Fadenkreuz.
Jaromin fängt sie wieder ein.
»Auto von Osten, fünfzehnhundert Meter«, murmelt dicht neben ihm Koeppen ins Mikro.
»Sind bereit.« Ivos Stimme in seinem Ohr.
Dann herrscht wieder Stille, bis auf die Geräusche des nächtlichen Waldes.
Plötzlich erlöschen die beiden Lichter. Als sie wieder aufglimmen, beginnt Jaromin stumm zu zählen. Nach zehn Sekunden verschwindet das Licht erneut. Kehrt zurück, und Jaromin zählt.
Und ein drittes Mal.
Das verabredete Signal.
»Er ist es«, bestätigt Koeppen.
Wenig später kann Jaromin das Gesicht des Fahrers durch das Zielfernrohr sehen. Die Augen fliegen immer wieder zum Rückspiegel, er hat Angst. Mirko, ein Musikstudent. Tagsüber spielt er Violine in den Straßen von Banja Luka. Nachts verfasst er Flugblätter für eine verbotene serbische NGO.
Jetzt bringt er ihnen einen Mörder.
»Und?«, sagt Ivo in Jaromins Ohr.
»Tausend Meter«, erwidert Koeppen.
Jaromin bewegt das Visier entlang der Straße, die Mirko gekommen ist. Keine Verfolger.
Dann hat er wieder das junge Gesicht im Blick.
Gleich hast du es geschafft, Mirko, denkt er.
Doch das Schwierigste kommt noch. Mirko muss Jergović aus dem Kofferraum hieven.
Allein.
Der Musiker und der Mörder.
Im Elternhaus einer Freundin in einem Dorf am Fuß irgendeines Berges der Republika Srpska ist Mirko vor einer Woche einem Toten begegnet.
Einem Toten mit kraftloser Stimme und resignierten Augen.
Noch in derselben Nacht flüsterte er den Namen des Toten in sein Mobiltelefon. Zoran Jergović, offiziell in den letzten Kriegstagen 1995 gefallen, Ende Januar 2003 in der Republika Srpska wiederauferstanden.
Die Nachricht wanderte auf verschlungenen Pfaden nach Den Haag, wo sie am nächsten Mittag eintraf. Zwei Tage später rief ein Tribunal-Staatsanwalt in Berlin an. Zoran Jergović hatte seit 1996 unter einem falschen Namen in Passau gelebt. Anfang Dezember 2002 hatte er Wohnung und Job gekündigt und war verschwunden.
Aus Belgrad und Banja Luka hieß es: Unmöglich, unser Held Zoran Jergović ist im Krieg geblieben, täglich besuchen die Witwe und die Söhne das Grab.
Um zu verhindern, dass Jergović sich erneut absetzt, bat Den Haag Berlin um Unterstützung. Der BND wurde eingeschaltet, kurz darauf stellte Bengt Koeppen ein Team zusammen: Ivo, Toni, Jaromin. Seit zwei Tagen hausen sie im Wald in der Nähe der unbewachten Grenze zwischen der Republika Srpska und der Föderation, Jaromin und Koeppen auf einem bosnisch-serbischen Hügel, die beiden anderen einen halben Kilometer entfernt in einem bosnisch-herzegowinischen Tal. Zwei Tage in der klammen Winterfeuchtigkeit. Die größte Herausforderung war, den Körper warm und das Gewehr trocken zu halten.
Vor drei Stunden dann kam der Anruf. Mirko und seine NGO-Freunde haben Jergović am Abend in einem Bergdorf überwältigt. Ein paar mit Stöcken bewaffnete Studenten bringen einen Kriegsverbrecher zur Strecke.
Doch Jergović muss Helfer haben. Getreue von damals. Freunde, die Familie natürlich, die beiden Söhne. Informanten in Banja Luka und Belgrad.
Deshalb liegen Jaromin und Koeppen im nassen Gebüsch über dem Fluss. Um die Übergabe des Mörders zu sichern.
Dreihundert Meter bis zur Brücke.
Eine schmale Brücke aus Stein, vierzig Meter lang, nicht einmal drei Meter breit. Am diesseitigen Ufer weht im schwachen Licht einer Straßenlaterne die Flagge der Republik, gegenüber die der Föderation. Die Grenzanlagen sind längst abgebaut, die Straße ist zu dieser nächtlichen Stunde verwaist. Die Brücke ist die letzte Möglichkeit, Jergović zu befreien. Vielleicht die beste.
Jaromin trocknet die von der Wärme seines Körpers beschlagenen Stellen an Okular und Objektiv. Koeppen, kaum zu sehen neben ihm im Gebüsch, hat das Fernglas vor den Augen, wirkt wie versteinert. Wie immer in solchen Lagen scheint er höchstens alle fünf Minuten einmal zu atmen.
Jaromin spürt, dass seine Hände leicht zittern, und der Puls rast. Er tastet unauffällig nach den Tabletten in der Brusttasche, schluckt eine hinunter.
Dann holt er den herankommenden Wagen ins Visier zurück.
»Zweihundert Meter«, sagt Koeppen. »Ivo, Toni?«
»Startklar«, sagt Ivo.
Leichter Nebel liegt über dem Fluss und den Ufern, hängt zwischen den Bäumen des Waldes diesseits und jenseits der Brücke. Kein Licht außer dem der beiden Straßenlaternen. Kein anderes Auto weit und breit.
Koeppen aktualisiert Richtung und Geschwindigkeit des Windes, Jaromin justiert nach und entsichert das G22.
»Er ist jetzt an der Brücke«, murmelt Koeppen.
»Verstanden«, sagt Ivo.
Ohne das Tempo merklich zu verringern, fährt Mirko weiter. Der Wagen holpert über das Kopfsteinpflaster der Brücke, bleibt am anderen Ufer abrupt stehen. Die Tür fliegt auf, Mirko springt heraus, erbricht sich. Er ist mittelgroß und dürr, ungelenke Bewegungen, dunkler Wuschelkopf. Einer, der für klassische Musik gemacht sein mag, sicher nicht für Guerilla-Aktionen wie diese, denkt Jaromin.
»Er ist ausgestiegen«, sagt Koeppen.
Mirko hastet zum Kofferraum, öffnet ihn und weicht zurück. Erst jetzt sieht Jaromin, dass er mit der rechten Hand einen faustgroßen Stein umklammert. Er hält den Atem an. Den Haag braucht Jergović unversehrt. Wenn Mirko zuschlägt, bricht Koeppen die Operation ab.
»Verflucht!«, flüstert Koeppen.
»Was?« Ivo, alarmiert.
Sekunden verstreichen. Schließlich erscheint über dem Kofferraumrand ein fast kahler Kopf. Dann die Arme, an den Handgelenken gefesselt. Drohend hebt Mirko den Stein. Mit der linken Hand zerrt er Jergović über den Rand, lässt ihn auf die Straße fallen. Brüllt auf den Liegenden ein. Im Zielfernrohr sieht Jaromin, dass er der Panik nahe ist.
Jergović rührt sich nicht.
»Alles okay«, sagt Koeppen.
Mirko schleudert den Stein von sich, steigt in den Wagen, wendet und fährt in einer Staubwolke davon. Auf der Brücke bricht das Heck aus, kracht gegen die niedrige Mauer. Erst am anderen Ufer bekommt er den Wagen unter Kontrolle.
Dann hat er es geschafft.
Jergović hat sich auf den Rücken gedreht. Im Vergleich zu dem Fahndungsfoto des Haager Tribunals wirkt er gespenstisch abgemagert. Weißer Rauschebart wie bei Karadžić, verschmutzte Jeans, verschmutzte Tennisschuhe. Ein todkranker Kriegsverbrecher Ende fünfzig, der zum Sterben in sein isoliertes Heimatdorf zurückgekehrt war und sein Leben nun im Fokus der Weltöffentlichkeit beenden wird.
»Können wir?«, fragt Ivo.
»Noch nicht«, sagt Jaromin.
»Was ist?«, fragt Koeppen.
Jaromin hebt den Gewehrlauf leicht an und lässt das Fadenkreuz über die Bäume jenseits der Straße gleiten. Nichts ist. Nur ein seltsames Gefühl, das ihm klamm im Nacken sitzt.
Zwei Tage und Nächte in der Winterfeuchtigkeit, denkt er. Alles ist klamm.
»Sprich mit mir«, sagt Koeppen.
»Eine Minute«, murmelt Jaromin.
Die Minute verstreicht, niemand taucht auf, um Jergović zu befreien.
Der Nacken bleibt klamm.
»Was siehst du?«
»Bäume. Jergović.«
»Gut«, sagt Ivo. »Dann kommen wir jetzt.«
Jaromin antwortet nicht.
Bäume und Jergović.
Der Gefesselte liegt inzwischen auf der Seite, in Jaromins Richtung gewandt. Die Augen sind offen. Er wirkt konzentriert.
Wartet.
»Klar wartet er«, sagt Ivo.
Weitere drei Minuten lang führt Jaromin den Gewehrlauf und mit ihm das Visier sachte hin und her.
Bäume, das Flussufer, Jergović. Sonst nichts.
»Wie sieht’s aus?«, fragt Koeppen drängend.
»Okay«, sagt Jaromin.
Ivo und Toni brauchen keine dreißig Sekunden. Ein dumpfes Grollen kündigt sie an. Der schwere Geländewagen umkurvt Jergović, hält vier Meter von ihm entfernt, die Türen fliegen auf. Jergović hat den Kopf gehoben, lässt ihn jetzt wieder sinken. Seine Miene ist angespannt. Lauernd.
»Aufpassen!«, raunt Jaromin.
Ivo und Toni laufen auf Jergović zu, die Waffe in der Hand. Plötzlich fällt ein Schuss. Ivo stürzt mit einem überraschten Schrei, bleibt liegen. Toni feuert in Richtung Wald.
Das klamme Gefühl im Nacken.
Ein weiterer Gewehrschuss, kein Treffer.
»Im Wald, mindestens zwei«, sagt Koeppen gepresst. Jaromin hat sie im Visier, zwischen den Bäumen bewegen sie sich auf die Straße zu. Einer hält einen Selbstladekarabiner in den Händen, lädt ihn hektisch. Ein junger Mann, vielleicht zwanzig, Tarnkleidung, das Gesicht geschwärzt, jetzt legt er wieder an.
»Neutralisieren!«, sagt Koeppen.
Jaromin betätigt den Abzug, hört über den Knopf im Ohr einen kurzen Schrei, während er den Rückstoß abfängt. Koeppen bestätigt den Treffer. Schnell bringt Jaromin das Gewehr wieder in Anschlag. Der zweite Angreifer hält die Hände in die Höhe, ist auf die Knie gefallen. Jaromin schätzt ihn auf achtzehn. Alles an ihm zittert. Erneut schießt er, eine Warnung, das Projektil rast keine zehn Zentimeter neben dem Knienden in einen Baumstamm, Rinde fliegt ihm um die Ohren.
»Toni!«, sagt Koeppen.
Schon ist Toni bei dem Jungen, stößt ihn zu Boden.
Ivo rappelt sich hoch, rennt zu Jergović, die Schutzweste hat ihm das Leben gerettet. Jergović windet sich unter ihm, schreit hysterisch. Jaromin braucht einen Moment, dann begreift er. Jergović schreit Vornamen. Vladi, Jovan.
Sie warten, Toni hinter Bäumen bei dem Jungen, Ivo bei Jergović, die Mündung an dessen Schläfe, während Jaromin und Koeppen nach weiteren Angreifern suchen.
Ein Geräusch lenkt Jaromin ab. Über Ivos Mikro dringt ein Wimmern an sein Ohr.
Jergović weint.
Kurz darauf fahren Ivo und Toni mit Jergović los. Koeppen beginnt zu packen. Jaromin beobachtet, wie sich der Junge am Waldrand auf die Seite dreht und halb hochkommt. Auf allen vieren krabbelt er zu der Leiche. Legt sich neben sie, die Beine angezogen.
»Alles in Ordnung?«, fragt Koeppen.
»Ja.«
»Dann los.«
Jaromin richtet sich auf, zerlegt das Gewehr und verstaut es in dem Spezialrucksack. Schlafsack, Geschirr, Nachtsichtgerät kommen in den kleineren Rucksack. Er hält inne, blickt zur Brücke hinunter, die er mit bloßem Auge im Schein der Laternen erkennen kann. Den Jungen und die Leiche zwischen den Bäumen sieht er nicht.
Er schultert den Rucksack, als er unten auf der Straße Bewegungen wahrnimmt. Durch das Fernglas beobachtet er, wie der Junge die Brücke betritt, den Toten auf den Armen. Einmal wendet er den Kopf in Jaromins Richtung. Die Ähnlichkeit ist unverkennbar, und Jaromin begreift, weshalb Jergović geweint hat.
Er hat in dieser Nacht einen seiner beiden Söhne verloren.
Eine halbe Stunde später treten Jaromin und Koeppen an einer Straßengabelung der Föderation nahe der Grenze zur Republika Srpska aus dem Wald und steigen in Koeppens Wagen. Die Schubkraft drückt Jaromin ins weiche Polster, die Wärme der Sitzheizung strömt durch seinen Körper. Angespannt registriert er bosnische Landstraßen in völliger Dunkelheit, lichtlose Dörfer, die sekundenlang vom Lärm des starken Motors wachgerüttelt werden. Koeppen fährt verhalten, sie dürfen nicht gestoppt werden.
Knapp dreihundert Kilometer bis zur Küste.
Jaromin spürt, wie die Wirkung der Tabletten nachlässt. Der Puls steigt auf Normalniveau. Er schließt die Augen.
Sieht Mirkos Wagen, die Brücke, Jergović. Schemen im Wald.
Den toten Jungen.
Koeppen wirft ihm einen Blick zu, schaut wieder nach vorn. Wie immer nach einem solchen Einsatz kann Jaromin noch nicht darüber sprechen, nicht in den ersten Stunden. Koeppen respektiert das. Sie werden oft genug über die vergangene Nacht reden, bei einem Bier, auf einer Grillparty, wenn niemand sonst zuhört. Werden die Legenden stricken, die sie brauchen, um weitermachen zu können.
Am Vormittag lehnen sie an der Reling der Fähre Split-Ancona. Die Adria ist rau, die Spritzer der Gischt auf Gesicht und Händen fühlen sich weich und samtig an. Über ihnen tiefe Wolken, Schattierungen von Hellgrau bis Schwarz. Jaromin versucht zu rauchen, aber der Wind reißt die Glut der Zigarette mit sich.
»Fahrt ihr weg?«, fragt Koeppen.
Er schüttelt den Kopf. »Die Kinder haben Schule.«
»Ah ja.«
Koeppen hat, soweit Jaromin weiß, keine Familie. Vielleicht auch keine Ehefrau, jedenfalls spricht er nie von einer und antwortet einsilbig. Gelegentlich erkundigt er sich nach Daniela, den Kindern. Er möchte wissen, wie es seinen Leuten geht. Private Probleme können im Einsatz in Katastrophen münden.
Jaromin würde mit ihm nie über private Probleme reden.
Als die grauen Wolken aufreißen, liegen sie quer über Schalensitzen entlang der Reling und schlafen.
In Ancona verabschieden sie sich voneinander.
»Kommst du klar?«, fragt Koeppen.
Jaromin nickt.
»Dann bis in drei Wochen.«
Ein langer, fester Handschlag. Natürlich sind sie nicht Familie, sind keine Freunde. Auf der anderen Seite sind sie mehr als das, Koeppen, er und Ivo, den er bei der Bundeswehr kennengelernt hat. Gemeinsam haben sie sich 1993 von dort zum BND abstellen lassen. Koeppen holt sie immer wieder in seine Einsatzteams. Den rothaarigen Hünen Ivo fürs Getümmel, den geduldigen Jaromin als Back-up.
Er schultert den Rucksack, steigt die Gangway hinunter und geht zu Fuß weiter. In einem Straßencafé nahe dem Bahnhof isst er Spaghetti Bolognese. Koeppen passiert ihn im Auto, blickt nicht herüber. Er wird den Wagen und das Präzisionsgewehr in Rom abliefern und von dort nach München zurückfliegen. Den nächsten Einsatz vorbereiten. Ivo ist mit Toni und Jergović auf dem Weg nach Den Haag, wird in zwei Tagen wieder in Pullach sein, in einer Woche in Scharm El-Scheich.
»Scharm El-Scheich«, ein Platzhalter. Irgendwann, bei einem Bier, einer Grillparty, wird Jaromin erfahren, wo Ivo wirklich gewesen ist.
Wird die Legenden hören.
Er lehnt sich zurück, zündet sich eine Zigarette an. Die Sonne scheint warm im Februar in Ancona.
I
ABEER
7.FEBRUAR 2003
1
Bagdad (Irak)
CLAUDE BITAT IST KEINE VIERZIG und hat schon drei Kriege erlebt. Vor zwölf Jahren Desert Storm, sieben Wochen verbrachte er mit anderen Europäern im Keller der aufgegebenen DDR-Botschaft in Bagdad, machte sich vor Angst in die gestärkten Khakihosen und starb tausend Tode. Im Bosnienkrieg Mitte der Neunziger wich die Angst einer Art Routine, er wusste nun, wie sich Agenten des französischen Geheimdienstes verhalten sollten – in die Hosen machen gehörte nicht dazu. Sein dritter Krieg dauert seit bald vierzig Jahren an und wird noch lange nicht enden. Ein Krieg, der in Frankreich erst seit Kurzem so genannt werden darf: die »Ereignisse von Algerien«.
Er wartet in einer Seitenstraße westlich des Regierungsviertels im Schatten einer Hauswand auf seine Informantin, raucht eine Zigarette nach der anderen, verteilt die Kippen unruhig mit dem Fuß im Sand. Auf dem Weg von der Botschaft hierher überall Soldaten, Militärfahrzeuge unter Tarnnetzen, Panzer, Flugabwehr, Absperrungen, Offiziere der Republikanischen Garde. An der nahen Kreuzung steht ein Jeep mit Militärpolizisten, sie müssen ihn längst bemerkt haben.
Sein Vater war an den »Ereignissen« beteiligt. Sprengte Anfang der Sechzigerjahre französische Soldaten in die Luft, wurde gefoltert und hingerichtet. Ein paar Jahre danach geriet die Mutter in Algier durch Gerüchte unter Kollaborationsverdacht und floh mit ihren zwei Kleinkindern nach Frankreich. Da sitzt sie in ihrer fast lichtlosen Küche und erzählt noch immer vom Krieg des Vaters.
Vom Helden der Familie.
Claudes Bruder nahm sich mit siebzehn in einer Gefängniszelle in Lyon das Leben. In der Familie des Helden war kein Platz für Kleinkriminelle. Er selbst verkroch sich hinter Büchern, um dem einen wie dem anderen Schicksal zu entgehen. Hockte in der Schule, bis es draußen dunkel war, später in Vorlesungen, bis sein Kopf zerbarst. Am Ende schrieb er seine Abschlussarbeit über den »Krieg in Algerien«, zu einer Zeit, als man noch von »Ereignissen« sprach.
Der Auslandsgeheimdienst las die Arbeit. Fand sie mutig und hellsichtig. Dass Claude fließend Arabisch sprach und Arabisch aussah, tat ein Übriges.
Aber ich bin wirklich kein Held …
Die Zeit der Helden ist vorbei, Monsieur Bitat. Wir brauchen Analysten. Wie Sie.
So kam er zur DGSE.
Nach Bagdad.
Begegnete Abeer.
Ein Wispern, ein Rascheln, ein feiner Lufthauch. Gepflegte, langgliedrige Finger. Der Duft nach Zimt.
Das ist Abeer.
Ihren echten Namen kennt Claude nicht.
Wie soll ich Ihnen vertrauen, wenn ich Ihren Namen nicht …
Denken Sie sich einen aus.
Sie saß auf einer Parkbank, Claude stand mit dem Rücken zu ihr, beide hatten den Kopf nur leicht zur Seite gedreht. Aus dem Augenwinkel sah er im sandigen Licht einen hellbraun verhüllten Körper. Einmal, für einen viel zu kurzen Moment, ihre Augen.
Und er nahm den Geruch von Zimt wahr.
Gut, sagen wir: Abeer.
Sie schien kurz den Atem anzuhalten. Abeer, »Duft«.
Sie nickte.
Was haben Sie für mich, Abeer?
Als sie sich kurz darauf mit einem Rascheln erhob, unterdrückte er das Bedürfnis, ihr nachzusehen. Ein Bedürfnis, das von Begegnung zu Begegnung wuchs.
Abeer, eine romantische Projektion, eine dumme Sehnsucht.
Sein Kontakt zum kommunistischen irakischen Untergrund.
Am Himmel tauchen zwei MiG-25 der irakischen Luftstreitkräfte auf. Tief rasen sie über der Stadt dahin, entfernen sich wieder. Viel Platz bleibt ihnen nicht zwischen den Flugverbotszonen, die seit 1991 in Kraft sind. Ein seltener Anblick. Fast alle irakischen Kampfjets sind verschwunden. Die Nachrichtendienste glauben, sie warten in unterirdischen Bunkern auf die große Schlacht. Oder sind heimlich nach Syrien gebracht worden und werden von dort angreifen. Abeer sagt, sie habe gehört, Saddam wolle seine Kampfjets im Krieg nicht einsetzen, sondern für die Zukunft schonen. Sie seien in der Wüste vergraben. In der Wüste vergraben, Monsieur Bitat?, fragte Paris. Und Sie halten Ihre Quelle für glaubwürdig?
Manchmal weiß er nicht, was er ihr glauben kann und was nicht. Sie hasst Bush fast so sehr, wie sie Saddam hasst.
Die MiGs kehren zurück, fliegen in die andere Richtung.
Mein vierter Krieg, denkt Claude.
Er ist seinem Vater ähnlicher, als es ihm gefällt. Auch der kannte am Ende nichts anderes mehr als den Krieg.
Seine Gedanken kehren zu Abeer zurück. Ein Anruf in der Nacht, ein Treffen außer der Reihe, schon wenige Stunden später, ungewöhnlich für sie.
Vielleicht hat es mit Colin Powell zu tun.
Die Rede im UN-Sicherheitsrat vorgestern. Saddam produziert biologische Kampfstoffe, sagte Powell. Verfügt über mobile Labors, um die UN-Kontrolleure zu täuschen. Saddam ist mit Al Qaida verbunden. Führt die Welt an der Nase herum. Die Welt muss ihn aufhalten! Powell präsentierte Beweise, Unterlagen eines übergelaufenen irakischen Chemie-Ingenieurs.
Eine Rede, die alles verändert hat. Jetzt ist die Invasion legitimiert. Der Countdown läuft. Ein paar Wochen noch, dann wird der Krieg beginnen.
Aus einer Seitenstraße nähert sich eine Gruppe Frauen, alle in schwarzen Abayas, Tücher verhüllen die Gesichter. Sie lachen und gestikulieren. Auf Claudes Höhe stolpert eine von ihnen mit einem Schmerzensschrei. Die anderen scharen sich um die »Verletzte«. Auch Claude tritt einen Schritt nach vorn, steht jetzt nah bei den Frauen.
Ein Hauch von Zimt liegt in der Luft.
Die Militärpolizisten beobachten sie gelangweilt.
Ja, es hat mit Powell zu tun.
»Die Quelle der Amerikaner lügt!«, wispert Abeer dicht neben ihm.
»Der Ingenieur?«, flüstert Claude.
»Wir haben mit seinem ehemaligen Boss gesprochen, mit anderen, die ihn kennen … Er ist ein Lügner! Es gibt keine mobilen Labors, keine Massenvernichtungswaffen! Ja, der Ingenieur, er heißt Rafid Ahmed Alwan, die CIA nennt ihn Curveball.«
Claude erinnert sich an den Codenamen. Ein Informant des Bundesnachrichtendienstes. Die Deutschen haben vor ein, zwei Jahren Vernehmungsprotokolle an die französischen Kollegen geschickt, auch die Amerikaner und die Briten haben sie bekommen. Den Inhalt kennt er nicht.
»Wir haben Beweise«, flüstert Abeer. »Aufnahmen, Skizzen, Fotos, Zeugenaussagen.« Ihre Finger berühren seinen Arm, eine schmale rechte Hand legt sich darauf, der Zimtgeruch verstärkt sich. Claude kann nicht anders und senkt den Kopf. Sieht eine Narbe quer über zwei Finger und einen schlichten Ehering. »Verstehst du, damit können wir den Krieg verhindern!«
»Und ihr rettet Saddam.«
»Wir retten das irakische Volk!«
Die Gruppe gerät in Bewegung, die Frauen schicken sich an weiterzugehen.
»Kannst du ein Treffen mit jemandem aus der deutschen Botschaft arrangieren? Der die Beweise nach Berlin bringt?«
Berlin?
Claude begreift – Schröders Nein zum Krieg. Chirac hat sich nicht so eindeutig geäußert. Der Élysée tritt für eine friedliche Lösung ein und hält sich doch alle Optionen offen. War 91Teil der Kriegskoalition gegen den Irak. »Gib sie mir, ich leite sie weiter.«
Aus dem Augenwinkel sieht er, dass sie den Kopf schüttelt. »Nicht die DGSE. Keine Franzosen.«
»Ich bin eigentlich Algerier«, erwidert er ein wenig gekränkt.
»Kümmerst du dich darum?«
Zögernd nickt er. Dann spürt er ihre Hand von seinem Arm gleiten. »Hoffentlich nichts Ernstes«, sagt er laut in Richtung der anderen Frauen.
»Nein, bestimmt nicht, danke«, entgegnet eine fremde Stimme.
Die Frauen laufen weiter, auf die Mansour Street und die Militärpolizisten zu. Claude folgt ihnen langsam. Der Wind lässt die Abayas flattern, und es sieht aus, als führten die Frauen einen exaltierten Tanz auf. Eine von ihnen duftet nach Zimt, trägt an den Fingern derselben Hand einen Ehering und eine Narbe und will die amerikanische Regierung der Lügen überführen, um einen Krieg zu verhindern, der längst beschlossen ist.
10.FEBRUAR 2003
2
Schäftlarn bei München
SECHS UHR MORGENS, eine eiskalte Nacht mündet in einen eiskalten Tag. Jaromin läuft durch erstarrte, dunkle Wälder, ist der einzige Mensch auf schneebedeckten Landstraßen, auf Pfaden entlang gefrorener Äcker. Sein Atem hängt in der Luft, auf seinen bloßen Wangen gefriert der Schweiß. Seit seiner Rückkehr aus Bosnien schreckt er trotz der Schlaftabletten jede Nacht hoch. Mirkos Wagen in seinen Träumen, die Brücke, der weinende Jergović. Ein Junge, der eine Leiche trägt. Andere Menschen und Gesichter und Tote von anderen Einsätzen.
Eine Stunde später kriecht von Osten die Morgendämmerung heran. In der Ferne taucht Kloster Schäftlarn auf, die roten Dächer grauweiß. Verkehr setzt ein. Jaromin ist am Waldrand, als ein Schuss fällt, und obwohl er weiß, dass Jäger unterwegs sind, duckt er sich unwillkürlich.
Zu Hause haben die Kinder die beiden Bäder besetzt. Er wartet im Gästezimmer im zweiten Stock. Hört sie im Flur streiten. Danielas unbeherrschte Stimme. Schließlich verlagern sich die Geräusche nach unten in die Küche. Er duscht, rasiert sich. Die Haustür fällt zu, kurz darauf rollt der Laguna mit stotterndem Motor aus der Garage.
Als er sich in seinem Zimmer anzieht, klopft es. Alina.
»Wollen wir am Samstag Ski fahren?«
»Klar«, sagt Jaromin. »Kommt Alex mit?«
»Hab ihn nicht gefragt.«
»Frag ihn, bitte.«
Sie zuckt die Achseln.
Die Tochter ist ihm nahe geblieben, der Sohn abhandengekommen. Jaromin hat sich vorgenommen, in diesen drei Wochen Urlaub zu versuchen, den Kontakt wiederherzustellen. Das Gleiche mit Daniela. Viel ist ihm bislang nicht eingefallen.
Vielleicht, weil er keine Hoffnung hat. Und nicht weiß, wie man Abhandengekommene zurückgewinnt.
Das Mobiltelefon vibriert, Koeppens Nummer wird angezeigt. Irritiert lässt Jaromin die Klappe aufspringen. »Ja?«
»Neun Uhr, üblicher Ort«, sagt Koeppen.
Jaromin bestätigt knapp, legt auf. Bosnien, denkt er. Der tote Junge. Irgendjemand macht Probleme.
»Musst du schon wieder weg?«, fragt Alina.
Er küsst sie auf die Stirn. »Nur für eine Stunde.«
Koeppens BMW steht in Hohenschäftlarn an der Abzweigung zur katholischen Kirche. Straße und Gehweg hinauf sind vereist, Jaromin geht vorsichtig. Hunderte Male ist er als Kind hier hochgelaufen, dem rastlosen Vater hinterher, der immer zu schnell war für ihn, als wollte er die Last seines Leides so rasch wie möglich nach St.Georg tragen, um nicht darunter zusammenzubrechen. Eine Stunde lang saßen sie dann auf »ihrer« Bank weit vorn, der Vater mit geschlossenen Augen, Tränen auf den Wangen, der Sohn gekrümmt von der Schuld. Wenn er die Stille nicht mehr ertrug, begann er, in Gedanken mit dem Heiligen Georg zu sprechen, der neben dem Altarauszug auf einer Wandkonsole steht, in goldener Rüstung, die Lanze in der Rechten, den Drachen zu Füßen.
Man muss seine Schuld tragen, antwortete der Heilige Georg.
Man muss das Schlechte in sich bekämpfen.
Sich für das Gute opfern.
Auch auf dem Weg hinunter ging der Vater zu schnell, als wollte er vor dem Sohn verbergen, dass er keinen Trost gefunden hatte.
Mit sechzehn, im Internat, ließ Jaromin sich das rote Georgskreuz auf die rechte Brustseite tätowieren. Jahre später erfuhr er, dass Georg der Schutzheilige des Bundesnachrichtendienstes ist.
Zufall.
Berufung.
Bengt Koeppen wandert an den zugeschneiten Gräbern entlang, die Hände in den Taschen des Parkas, bleibt stehen, als er Jaromin sieht.
Sie reichen sich die Hand, wandern zusammen weiter.
»Probleme wegen Bosnien?«
Koeppen verneint. »Ein neuer Einsatz, ziemlich heikel.«
»Ich hab Urlaub, Bengt.«
»Verschoben.«
Jaromin lässt die Luft langsam ausströmen. »Ich muss hier ein paar Dinge klären.«
»Klär sie heute. Morgen früh um fünf wirst du abgeholt.« Koeppens konzentrierter Blick liegt auf ihm.
Jaromin spreizt die Hände, schweigt. Längst spürt er das Adrenalin.
»Ohne dich geht es nicht«, sagt Koeppen.
Vier, fünf Tage, nicht länger. Und Ivo ist dabei.
Schließlich nickt Jaromin. »Wohin?«
»Amman, Jordanien. Dort triffst du Ivo und Bert. Ihr fahrt zusammen nach Bagdad.«
Jaromin bleibt überrascht stehen.
Koeppen dreht sich zu ihm. »Zwei Tage Amman, ein paar Tage Bagdad, dann bist du zurück.«
Jaromin schließt zu ihm auf. Bagdad also.
»Ihr fahrt von Amman aus mit dem Auto«, sagt Koeppen. »Neunhundert Kilometer, auf irakischer Seite eine komfortable dreispurige Autobahn. Die übliche Strecke für Diplomaten, der Geschäftsträger fährt zweimal im Monat hin und zurück, also nicht weiter problematisch. Wir haben in Amman einen Nissan Sunny, einen Kombi, nicht gepanzert. In Bagdad sicherst du die Übergabe von Dokumenten. Auf unserer Seite Ivo, Bert und ein französischer Kollege, auf der anderen eine Irakerin.«
»Regierung?«
»Opposition. Heißt es zumindest.«
Jaromin weiß, was das bedeutet: Informationen, die sich nicht verifizieren lassen.
»Was für ein Gewehr?«
»Bin noch dran«, sagt Koeppen. »Wahrscheinlich ein OSW-96. Wäre das okay?«
»Sicher.«
Eine lange, schwere Waffe, Selbstlader, knapp dreizehn Kilo, für Ziele bis fast zwei Kilometer ausgelegt. Vor drei Jahren hat Jaromin das OSW-96 getestet, er spürt noch in den Fingern, wie es sich anfühlt, erinnert sich an den bitteren Geruch des Kunststoffkolbens. Erfahrung hat er damit nicht.
Koeppen reicht ihm einen leicht abgewetzten Diplomatenausweis, vor vier Jahren in Augsburg ausgestellt, vor einem Tag in Berlin-Kreuzberg im Eilverfahren von der Bundesdruckerei produziert. Ein etwas älteres Foto, ein neuer Name: Frank Lahn, Sicherheitsberater; ein paar harmlose Ein- und Ausreisestempel, dazu Algerien und Russland.
Koeppen ist Bengt Kirchner, Militärattaché.
»Noch was.« Koeppen hebt die Brauen. »Falls irgendjemand später fragt: Ivo und Bert sind mit uns zurückgefahren.«
Jaromin hakt nicht nach, hat genug Erfahrung und Fantasie. Ivo und Bert gehören zu den Kollegen mit Kriegseinsätzen. Ivo war 1994 in Bosnien, 1999 in Belgrad, während die NATO-Bomben fielen, verbrachte 2002 mehrere Monate in Afghanistan. Bert erlebte die beiden Tschetschenienkriege vor Ort, 1997 den Aufstand gegen Mobutu im Kongo.
Sie bleiben in Bagdad, das Kanzleramt schickt sie in ihren nächsten Krieg.
Sie passieren das Grab von Jaromins Mutter. Die Inschrift ist stark verwittert, vierunddreißig Jahre Schnee, Regen, Sonne und die Fingerkuppen des Vaters. Koeppens Blick bleibt nach vorn gerichtet. Nicht zum ersten Mal fragt Jaromin sich, ob er von dem Grab und allem anderen weiß und den Friedhof deshalb für kurzfristige Treffen ausgewählt hat.
Um ihn an die Schuld zu erinnern.
Aber er kann nicht davon wissen.
»Macht die Familie Stress? Daniela?«
»Nicht mehr als sonst«, sagt Jaromin.
»Weil du sagst, du musst was klären.«
Jaromin lügt weiter. Alex unglücklich verliebt, ein Mädchen aus der Schule, er kommt nicht mehr aus dem Bett. Koeppen scheint sich damit zufriedenzugeben.
Am Ausgang bleiben sie stehen.
»Offiziell fliegst du nach Sarajevo«, sagt Koeppen.
Jaromin nickt.
Er sieht Koeppen nach, der auf dem glatten Untergrund kaum Mühe hat. Schnell und sicher geht er die Straße hinunter.
Draußen, an der Friedhofsmauer, steht inzwischen ein Kleinbus aus dem nahen Pflegeheim, daneben ein Rollstuhl mit einem alten Mann. Die Augen erstarrt, der Kopf umrahmt von Kunststoffpelz, im Mundwinkel steckt eine glimmende Zigarette. Die Hände liegen reglos im Schoß, die Schultern und das noch volle Haar sind schon weiß vom Schnee. Ein schmächtiger Zivildienstleistender schließt Heck- und Schiebetür, bugsiert den Rollstuhl dann mühsam über Eis und Streuschotter auf Jaromin zu. Er macht Platz.
Es dauert einen Moment, bis der Junge den Rollstuhl durch das Tor manövriert hat.
»Kann ich helfen?«, fragt Jaromin.
Die Augen des Alten bewegen sich nicht.
Der Pfleger nickt, überlässt ihm die Griffe. »Der zweite Weg rechts.«
»Ich weiß.«
Am Grab sieht Jaromin ein paar Minuten lang zu, wie die Finger seines Vaters kraftlos über den verwitterten Namen der Mutter gleiten.
3
Berlin-Tiergarten
HANNE LAY IST BESONDERE AUFTRÄGE gewöhnt, doch was sie von diesem halten soll, weiß sie noch immer nicht.
Ein Auftrag aus dem Kanzleramt.
Sie wollte ablehnen, doch das BKA nahm an. Wenige Stunden später kamen aus der Willy-Brandt-Straße zwei Kartons mit Unterlagen und ein ernster Mann Anfang sechzig mit schlohweißem Haar: Andreas von Goerden, Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung. Zur Vorbereitung blieben der Sonntag und die Nacht auf Montag. Im Morgengrauen ging von Goerden und nahm seine Kartons wieder mit. Lay klappte einen Notizblock auf und schrieb per Hand ein Gedächtnisprotokoll. Möglichst kein Computer, hatte von Goerden gesagt. Kein Internet. Keine Handys.
Muss ich flüstern?
Kein Moment für Späße.
Nicht einmal zwei Stunden später sitzt Lay todmüde in der Kanzlergalerie auf kühlem Leder und wartet. Hinter ihr türmt sich eine Fensterfront zur grauen Spree auf, vor ihr eine leicht gewölbte grüne Wand, ein Kunstwerk, Grün nicht die Hoffnung oder die Natur, sondern die antike Tugend der Klugheit. Gegenüber dieser Wand hängen im Vergleich fast winzige Porträtgemälde, sechs Männer, die bisherigen Kanzler der Republik. Wenigstens im Nachhinein, denkt Lay, müssen sie sich an der Klugheit messen lassen.
Ist es klug, den Bundesnachrichtendienst zu brüskieren?
Sie hat Bedingungen gestellt, von Goerden hat alles abgesegnet: jegliche Unterstützung, die sie braucht. Einsicht in alle relevanten Unterlagen. Keine Tabus. Salih mit im Team. Von Goerdens private Handynummer für den Notfall.
Und: Ich fliege nicht in den Irak.
Pullach genügt.
Auch von Goerden hatte eine Bedingung: absolute Geheimhaltung. Keine Information verlässt ihr Büro schriftlich.
Hanne Lay starrt die grüne Wand an. Hält sich mit dem Blick daran fest, um nicht einzuschlafen.
Später tippt ihr jemand an die Schulter. Die namenlose Frau, die sie an der Schleuse in Empfang genommen hat, steht vor ihr. Sie duftet nach Mandarinen. »Kommen Sie bitte«, sagt sie sanft.
Selbst das Nicken fällt Lay schwer.
Sie fahren mit dem Aufzug in den vierten Stock. Ein herkömmliches Büro genügt nicht für dieses Treffen. Es muss der abhörsichere Raum des Kanzleramts sein.
»Die Namen haben Sie parat?«
Lay bejaht. Von Goerden, dazu Eberhard Träger, Präsident des BND, und Heiner Seibold, Führungsoffizier jenes Mannes, um den es geht: Curveball.
»Ist Kaffee da?«
»Genug«, erwidert die Frau.
Drei Männer mit verkniffenen Gesichtern, die Mimik spricht Bände: Von Goerden redet Tacheles, Träger und Seibold sind in der Defensive. Lay hört, wie sich die Tür hinter ihr schließt. Der Raum ist groß, ein Tisch für dreißig Personen, an den Wänden Landkarten, der Nahe Osten, Irak, Afghanistan. Die Blicke der drei Männer liegen auf ihr, während sie auf den Tisch zugeht. Von Goerden stellt sie vor, nur ihr Name, keine Organisation, keine Funktion.
Wir schüchtern sie ein bisschen ein.
So leicht lassen sichBND-Leute einschüchtern?
Curveball kann sie den Job kosten.
Sie setzt sich neben ihn und fasst die beiden sichtlich irritierten Geheimdienstler gegenüber ins Auge. Träger kennt sie seit 9/11 und dem Afghanistankrieg aus dem Fernsehen, ein SPD-Bürokrat Mitte fünfzig, Brille, rote Fliege, Schuppen auf den Schultern. Schwitzt bei TV-Interviews, verhaspelt sich, macht komplexe Zusammenhänge gänzlich unverständlich. Es heißt, bei Krisenlagen tendiere er zur Hysterie. Ein Vertrauter des Kanzlers, dazu kam irgendein regierungsinterner Proporz.
Einen Kopf größer und zehn Jahre jünger. Heiner Seibold, Jeanshemd und Sakko, nachlässig gebundene Krawatte, wachsame, empathische Augen, ein Mann der Straße, des Zwielichts, wie so viele Quellenführer.
Von Goerden greift nach einer Thermoskanne und versorgt Lay mit Kaffee, lässt sich dabei Zeit. Zucker? Milch? Er wartet, bis sie den ersten Schluck getrunken hat.
Dann nimmt er einen Faden wieder auf, sagt mit wachsender Schärfe zu Träger: »Curveball ist eine BND-Quelle. Allein das muss man sich mal vorstellen: Ein Informant des deutschen Nachrichtendienstes liefert den Amerikanern die Rechtfertigung für einen Krieg, den der Kanzler und der Außenminister öffentlich abgelehnt haben. Wenn der Mann jetzt auch noch lügt … Wenn Saddam nicht über biologische Massenvernichtungswaffen und diese mobilen Labors verfügt … Nicht auszudenken!«
Träger räuspert sich. »Nach allem, was wir wissen … aufgrund von vielen anderen Indizien und Erkenntnissen … besitzt der Irak nach wie vor, mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls, B- und C-Waffen, außerdem mobile Labors für die Herstellung von B-Waffen … auch wenn sich das zurzeit nicht beweisen lässt.« Mit zufriedenem Lächeln verschränkt er die Arme vor der Brust. »So habe ich es dem Direktor der CIA mitgeteilt, und so werde ich es übermorgen auch dem Auswärtigen Ausschuss mitteilen.«
»Powell sagt, es lasse sich beweisen.«
»Ich würde Herrn Powell nicht widersprechen wollen, allerdings würde ich es vermutlich nicht so formulieren. Möglicherweise hat Herr Powell weiterführende Informationen …«
»Blix’ Leute waren vor vier Tagen im Irak und haben nichts gefunden. Also: Lügt Curveball, oder lügt er nicht?«
»Er lügt nicht«, sagt nun Seibold ruhig.
»Die Irakerin behauptet etwas anderes«, erwidert von Goerden.
»Die Irakerin kenne ich nicht. Unsere Quelle schon.« Seibold bleibt gelassen, macht auf Lay den Eindruck, als fühlte er sich seinem Präsidenten und selbst dem Mann aus dem Kanzleramt überlegen. Am Ende landet alles, was sie und ihresgleichen verfügen, in seiner Welt, in seinen Händen. »Wer ist die Frau?«
»Eine Informantin der Franzosen, DGSE.«
»Mehr haben Sie nicht?«
»Wir nicht, und die Franzosen auch nicht«, sagt von Goerden. »Zurück zu Curveball.«
Träger lehnt sich vor. »Herr Seibold hat seit Anfang 2000 Dutzende Gespräche …«
»Über hundert.«
»… über hundert Gespräche mit diesem Mann geführt. Er ist ein erfahrener Führungsoffizier … Wenn Herr Seibold also seiner Quelle vertraut und der Ansicht ist, dass sie nicht lügt, dann sollte man ihm, empfehle ich, glauben.«
Wie Seibold ist der BND-Präsident auf von Goerden fokussiert, hat Lay ganz offensichtlich abgehakt und vergessen. Sie hebt die Tasse, trinkt. Niemand scheint es zu bemerken.
Sekretärinnen sind unsichtbar.
»Sollte man das?« Aus dem Gedächtnis zitiert von Goerden aus jüngeren BND-Berichten, die Lay wenige Stunden zuvor gelesen hat. Curveball trinkt zu viel. Curveball ist wochenlang verschwunden. Stellt Forderungen, jammert, nimmt Psychopharmaka. Verlangt mehr Geld. Verlangt die versprochene Einbürgerung. Widerspricht sich. »Klingt nicht gerade nach Verlässlichkeit, finde ich.«
»Man muss das verstehen«, sagt Seibold sanft.
»Was?«
»Den Druck. Die Entbehrungen. Die Angst, enttarnt zu werden. So kann keiner jahrelang leben. Könnten Sie so leben? Er bricht unter dem Druck zusammen. Kann sich nicht mehr konzentrieren. Vergisst, was er weiß, was er erzählt hat. Dazu die Sehnsucht nach der Heimat. Die Scham, weil er die Heimat verrät. Ich habe das bei vielen Quellen erlebt. Irgendwann brechen die meisten zusammen. Aber das heißt nicht, dass sie gelogen haben.«
»Rührend«, sagt von Goerden. »Der Kanzler will Beweise.«
»Beweise …« Seibold lauscht dem Klang des Wortes mit desillusionierter Miene nach.
»Die Amerikaner …«, beginnt Träger.
Von Goerden schüttelt den Kopf. »… sind irrelevant.«
»Es gibt keine Beweise«, sagt Seibold. »Nur Plausibilität, Vertrauen und Erfahrung.«
»Ich bitte Sie!«
»Beweise zu verlangen heißt, Quellen in den Tod zu schicken. Erklären Sie das dem Kanzler.«
»Klar«, sagt von Goerden, streicht mit einer Hand weiße Strähnen zurück. »Meine Herren, so kommen wir nicht weiter.«
Das Ticken einer Wanduhr überlaut, während sich die drei Männer mustern. Auf Trägers Stirn steht Schweiß. Es ist nicht erst seit Colin Powells Rede vor dem Sicherheitsrat zu spät für ihn, Curveball die Rückendeckung zu entziehen. Der BND hat seit der Ankunft des Asylsuchenden im Aufnahmelager Zirndorf 1999 viele Tausend Arbeitsstunden, D-Mark und Euro in ihn investiert. Auch das Zeugenschutzprogramm ist nicht gerade billig. Dann die politischen Implikationen, die von Goerden als Schreckgespenst an die Wand gemalt hat. Also fährt Träger seit Längerem eine Doppelstrategie. Curveballs Informationen seien überaus plausibel, hat er top secret an Kanzleramt, CIA und DIA geschrieben – könnten allerdings nicht verifiziert werden. Auch diese Memos und Briefe hat Lay in der vergangenen Nacht gelesen: die Stimme eines Bürokraten, der um seinen Job bangt. Curveball ist für den BND nicht mehr der Jackpot, der er anfangs war, sondern ein Albtraum. Nur darf das niemand erfahren. Also lässt der Dienst nach wie vor keine ausländischen Agenten zu ihm. Weder die CIA noch die Briten, Franzosen oder Israelis haben je mit ihm gesprochen. Lediglich eine Handvoll Eingeweihte wissen, wo er lebt, wie er mit richtigem Namen heißt und welchen Decknamen er verwendet. Und hätte nicht Colin Powell Curveballs Informationen vor der gesamten Welt öffentlich gemacht, hätte die Welt vielleicht nie erfahren, dass er existiert.
»Und wenn wir uns erst einmal ansehen«, sagt Träger, »was diese mysteriöse Irakerin an Beweisen zu haben behauptet? Sollte da etwas drinstehen, was … sagen wir … missverständlich ist … Von den Medien falsch interpretiert werden könnte … Dann sollten wir gewährleisten, dass die Medien es eben nicht bekommen. Es fällt ja unter die nationale Sicherheit.« Er wartet.
»Fahren Sie fort«, sagt von Goerden ruhig.
Träger beugt sich wieder vor, die rote Fliege schwebt dicht über dem Tisch. »Wer soll je erfahren, was da drinsteht, wenn wir es nicht wollen? Falls uns das, was drinsteht, nicht gefällt?«
Von Goerden nickt interessiert.
Träger nickt ebenfalls, scheint nicht zu merken, dass er in eine Falle läuft. »Wir sehen uns an, was drinsteht, und dann …« Er bricht ab, ein verschworenes Lächeln auf den Lippen.
Lay schenkt sich geräuschvoll Kaffee nach. Milch. Zucker. Bleibt unbeachtet.
»Und dann?«, hakt von Goerden nach.
Träger schweigt vielsagend.
Dann landet das Zeug im Giftschrank.
Von Goerden atmet tief durch, tippt mit einem Finger auf den Tisch. »Die Unterlagen kommen auf direktem Weg nach Berlin, und zwar hierher, ins Kanzleramt. Versiegelt und ungeöffnet. Falls nicht, leitet Ende des Jahres jemand anders den Bundesnachrichtendienst.«
Träger hüstelt indigniert. Nach einem Moment der Kontemplation schiebt er seine Kaffeetasse in Lays Richtung über den Tisch.
Sie lächelt nur.
»So viel zu Bagdad«, sagt von Goerden. »Was Curveball betrifft: Der Kanzler verlangt eine externe Untersuchung.«
Seibold scheint als Erster zu begreifen. Er wendet sich Lay zu.
»Richtig«, sagt von Goerden. »Frau Lay ist Sonderermittlerin des Bundeskriminalamtes und wird diese Untersuchung durchführen. Wann fliegen Sie nach München?«
»Übermorgen.« Sie legt zwei Visitenkarten auf den Tisch, schiebt sie in Richtung der BND-Männer. »Ich lande um sieben Uhr am Morgen und komme dann nach Pullach. Sorgen Sie bitte dafür, dass Curveball dort ist.«
Ein Sturm des Protests hebt an.
Als er schließlich abebbt, kündigt Träger an, seinen Freund, den Kanzler, anzurufen. Von Goerden erhebt sich, deutet auf die Tür. »Das können Sie sich sparen, er wartet auf uns.«
Die Frau mit dem Mandarinenduft bringt Lay zur Schleuse hinunter.
»Hat der Kaffee geschmeckt?«
Lay nickt lächelnd.
Eine Frau mit Sinn fürs Wesentliche.
4
Schäftlarn
DER VERDACHT IST NICHT NEU. Jetzt ist er wieder da.
Sie hat einen Geliebten.
Jaromin weiß nicht, woher der Verdacht kommt. Etwas in ihrem Blick, ihrer Stimme. Eine neue Selbstgewissheit. Als wüsste sie jetzt, dass sie nicht ins Bodenlose stürzt, wenn sie stürzt.
Wenn er sie stürzt.
Sie stehen mitten im Wohnzimmer, schaffen es nicht einmal mehr, im Sitzen miteinander zu sprechen. Zu viel Anspannung, um zu sitzen. Nur das Deckenlicht brennt noch, Terrasse und Garten liegen im Dunkel. Die Kinder sind im Bett, ein weiterer verlorener Abend geht zu Ende.
»Es ist nur für ein paar Tage«, sagt Jaromin.
»Und dann?«
»Reden wir.«
Daniela lacht dumpf. »Ach ja? Haben wir in den letzten … fünf, sechs Jahren geredet? Ich meine: richtig geredet? Ein einziges Mal? Ich erinnere mich nicht.«
Er weiß, dass sie recht hat. Er kann das nicht mehr, reden. Weiß nicht mehr, was er sagen soll. Dass er sie braucht, sie und die Kinder? Eine funktionierende Familie, eine normale, harmlose Welt als Rückzugsort? Um immer dann, wenn Koeppen ruft, mit Ivo und den anderen an Orten, von denen er nicht sprechen kann, Einsätze durchzuführen, von denen nur eine Handvoll Menschen wissen darf?
Ivo hat es drei Frauen erzählt. Ist dreimal geschieden.
Daniela geht zum Sofa, setzt sich auf die Lehne. Unter ihren Augen liegen Schatten. Wie er schläft auch sie schlecht, aus anderen Gründen. »Reden wir jetzt«, sagt sie.
Er nickt. »Hast du jemanden? Einen anderen Mann?«
»Das ist das Einzige, was dich interessiert?«
»Antworte.«
»Nein, hab ich nicht.«
Sie spricht zu schnell, zu defensiv, denkt Jaromin. Sie lügt.
»Früher haben wir viel geredet«, sagt sie. »Na ja, nicht viel, aber … intensiv. Du hast von der Ausbildung erzählt, von Auslandseinsätzen. Von Norwegen, den Offizierstreffen auf Sardinien …«
»Sizilien.«
»Ja, Sizilien.«
Jaromin nickt. Er war nie in Norwegen oder in Sizilien.
»Ivo ist manchmal gekommen. Der andere, der aus dem Verteidigungsministerium …«
»Bengt.«
»Seit ein paar Jahren kommt niemand mehr.«
»Keine Freundschaft hält ewig.«
Sie faltet die Hände im Schoß, die Daumen bohren sich ins Fleisch. »Du ziehst dich immer weiter vor mir zurück. Ich erfahre nichts mehr … Ich weiß nicht mal, in welcher Dienststelle du inzwischen bist.«
Er zuckt die Achseln. »In derselben wie vor zehn Jahren.«
»Ach ja? Vom Ausbilden von Bundeswehrrekruten bekommt man Albträume?«
Der Spott in ihrer Stimme ist neu.
»Weiß du, was ich glaube? Dass du zu irgendeiner Sondereinheit gewechselt bist, die …« Sie hebt die Schultern. »Geheimaufträge erledigt. In Krisengebieten operiert. Wie diese neue Spezialeinheit.«
Er ist überrascht, wie nah sie der Wahrheit ist. »Das KSK? Das ist in Calw stationiert. Dreihundert Kilometer von hier. Fahre ich jeden Tag dreihundert Kilometer hin und zurück?«
»Bist du bei denen?«
»Nein.«
Sie lächelt bitter. »Was für Medikamente nimmst du?«
»Wie bitte?«
»Glaubst du, ich bekomme das nicht mit?«
Er zögert. »Schlaftabletten.«
Daniela steht auf und tritt an die Terrassentür. Jaromin sieht ihr gespiegeltes Gesicht in der Scheibe, erkennt sie nicht wieder darin. Sie steht straff, wirkt stark und unerreichbar. »Wir machen uns Sorgen um dich. Du hast dich verändert. Früher hattest du keine Albträume. Keine Schlafstörungen.« Auch ihre Stimme erkennt er kaum wieder, so distanziert klingt sie jetzt. Er wirke abwesend, wirft ihm die fremde Stimme vor. Verschlossen. Aggressiv. »Und du fasst mich nicht mehr an.«
»Deshalb suchst du dir …« Er reibt sich mit zwei Fingern die Nasenwurzel, denkt: reden, reden, das bringt doch nichts. Hilft ihr nicht, hilft ihm nicht. Er kann nicht einmal sich selbst erklären, warum er jedes Mal wieder los will, kaum dass er nach Hause zurückgekehrt ist.
Das draußen ist seine Welt. Dorthin wollte er immer.
Die Welt des Heiligen Georg. Gegen die Drachen kämpfen.
Daniela hat sich umgedreht, die Arme vor der Brust verschränkt. Am Kragen ihrer Bluse hängen ein paar Wollflusen von ihrem schwarzen Schal. Es gibt Tage, da geht sie ohne Schlüssel aus dem Haus. Ohne Portemonnaie. Vergisst den Regenschirm, die Jacke, vergisst den Arzttermin. Er mochte ihre Art, damit umzugehen, sich die eigenen Versäumnisse zu verzeihen. In meinem Kopf ist soooo viel drin, da darf ich schon mal was vergessen.
»Dein Job macht dich krank«, sagt sie.
Krank, denkt er. Sie hat ihn zum Psycho abgestempelt.
Fällt ihm in den Rücken.
Langsam geht er zur Tür. »Wir sehen uns in einer Woche. Dann können wir reden. Versuchen, es wieder hinzukriegen. Wenn du das überhaupt willst.«
Sie mustert ihn schweigend.
»Willst du es, Danny? Oder bist du schon auf dem Absprung?«
Sie tritt einen Schritt vor, und er sieht, dass sie allen Mut sammelt. »Ich sag dir, was ich will: dass du deinen Abschied nimmst.«
Er spürt, wie sein Puls zu rasen beginnt. »Das ist keine Option.«
»Es ist meine Bedingung, Frank. Wenn du zurück bist, möchte ich eine Antwort.«
»Die Antwort ist Nein.«
Er geht nach oben in den zweiten Stock, ins Gästezimmer, die fremde Stimme im Ohr, sieht die veränderten Augen vor sich, die ihn früher voller Stolz angeschaut haben: mein Mann, der Soldat, der Offizier. Wie würden sie ihn jetzt ansehen, wenn sie es wüsste?
Mein Mann, der Scharfschütze.
Der Killer.
Selbst wenn er wollte, könnte er ihr nicht sagen, was er tut, seit er sich zum BND hat abstellen lassen. Sie wollte einen Offizier heiraten, den man herumzeigen kann, keinen Mann, der mit einem Gewehr im nassen Gebüsch liegt und Menschen tötet.
Er packt den Seesack, legt sich angezogen aufs Gästebett. Erst Stunden später hört er, endlich im Einschlafen begriffen, Danielas Schritte auf der Treppe, kurz darauf lange das Rauschen der Dusche.
Du fasst mich nicht mehr an.
Sie sind viel zu weit voneinander entfernt, als dass er sie anfassen könnte.
Um vier holt ihn der Wecker aus wirren Träumen. Um fünf hält er Alina an der Haustür in den Armen, während der Wagen, der ihn zum Flughafen bringen wird, am Straßenrand wartet. Alina, im Schlafanzug und barfuß, zittert vor Kälte. Er legt die Säume seiner Jacke um sie, hält sie dicht an sich gedrückt. Spürt den schmalen Körper, die langen dünnen Beine. »Es sind nur ein paar Tage, Schatz.«
»Aber hier geht doch alles kaputt!«, flüstert sie.
»Wir reparieren es, wenn ich zurück bin, okay?«
Er spürt sie nicken.
»Pass auf Mama und Alex auf, während ich weg bin.«
»Und wer passt auf mich auf?«
»Wir telefonieren jeden Tag. Versprochen.«
Er küsst sie auf den Kopf, schiebt sie sanft von sich. Dann läuft er in den Schnee hinaus und steigt in den Wagen. Der Kollege am Steuer nickt ihm zu.
Sie fahren los. Das Land ist weiß, der Himmel ist weiß.
Durch das Seitenfenster glaubt Jaromin im ersten Stock ein bleiches Gesicht hinter einer Scheibe zu sehen. Noch lange verfolgt es ihn, immer wieder steht es unvermittelt vor seinen Augen, auf dem Weg zum Flughafen, hoch in der Luft, Alex, das andere seiner beiden Kinder, das verlorene.
11.FEBRUAR 2003
5
Berlin-Dahlem
DREI AUFREIBENDE TAGE, die Nächte unruhig und kurz, doch jetzt steht der Plan und muss nur noch umgesetzt werden, von anderen, weit weg im Nahen Osten. Gleich das Treffen mit den Amerikanern, dann, denkt Hans Breuninger, während er das Gewächshaus betritt und den Mantel gegen die Gartenschürze tauscht, kehrt wieder Ruhe ein in seinem Leben, das mittlerweile, Gott sei’s gedankt, aus nicht viel mehr besteht als Ruhe … Einer altersschwachen Hundedame, einem Gewächshaus voller duftender Kräuter, zwei Frauen: der jungen Vivian, die ihm die wenigen verbliebenen Geschäfte regelt, der wenig älteren Henriette, die ihm die wenigen verbliebenen Gelüste erfüllt. Den alljährlichen Geburtstagsanrufen des Bundespräsidenten, die ihm zeigen, wie lang die Jahre sind, seit er sie allein verbringt.
Aus vielen Erinnerungen.
Und Ruhe.
Er passiert die Gemüsehochbeete, an denen er bequem im Stehen arbeiten kann, hält vor den Kräutertöpfen inne. Die alte Mary mit dem fernen Blick neben sich, rückt er mit ruhigen Händen dem Majoran zu Leibe.
Fünf Minuten später streicht ein kalter Luftzug über seinen Nacken. »Alle da?«, fragt er, ohne sich umzudrehen.
»Ja«, sagt Vivian.
»Wie ist die Stimmung?«
»Vielleicht ein wenig angespannt.«
Er setzt den Deckel auf die Schale mit den Kräutern, umrundet die eingeschlafene Bernhardinerhündin. An der Tür reicht er Vivian die Schale, ihr Schritt ist stabiler als seiner. Er schlüpft in den Mantel, sagt dabei: »Wesley?«
»Ist zugeschaltet.«
Nebeneinander folgen sie dem gepflasterten Weg durch den farblosen Garten zum hinteren Eingang des Hauses. Nichts ist deprimierender als ein Garten im Winter, denkt Breuninger. All die Stümpfe und Strünke, das Leben abgestorben. Ein unfreundlicher Ausblick auf den Tod. Und die Lücken im Bewuchs! Jahr für Jahr tauchen ab November jenseits des Zauns plötzlich Nachbarn, Häuser, andere Welten auf, die ihn neugierig anstarren. So kahl ist er geworden, der Herr Staatssekretär a.D.? So kraftlos schleppt er sich über die Wege, der Herr BND-Präsident a.D.? Und wo sind all die anderen geblieben, die einst die Villa und den Garten bevölkerten, den Park, es ist ja mehr ein Park?
Alle fort. Nur Mary ist noch da.
Hinter Vivian steigt er die Stufen zur Terrasse hoch, die Hand am eiskalten Geländer. Sie öffnet die Küchentür, unvermittelt liegt der Duft von frisch gemahlenem Kaffeepulver in der Luft.
»Brauchen Sie mich unten?«
»Ich denke nicht.«
In der Küche reicht er ihr den Mantel. Sie deutet auf ein Glas Wasser, gehorsam trinkt er. In der Bibliothek zieht er Jackett und Krawatte an. »Möchten Sie mit Ihrem Mann zum Abendessen wiederkommen?«, fragt er laut durch die geöffneten Türen. »Es gibt Lamm.«
Er hört sie durch die Diele zur Garderobe gehen. »Das geht leider nicht. Er hat ein Spiel und will angefeuert werden.«
»Ich drücke die Daumen. Vergessen Sie bitte nicht, Mary ins Haus zu holen.«
Allein geht Breuninger die Kellertreppe hinunter. Kein Laut dringt aus dem schallisolierten Besprechungsraum. Erst als er die schwere Tür öffnet, branden Stimmen auf, Deutsch, Amerikanisch, gedämpft natürlich, Geheimnisträger haben immer die Sorge, zu laut zu reden. Die Anspannung, von der Vivian gesprochen hat, ist deutlich zu spüren.
Jetzt verstummen die Stimmen, aller Blicke richten sich auf ihn.
Er hebt zur Begrüßung beide Arme halb, einem Conférencier gleich, und betritt den Raum. Schritte zurück in die Vergangenheit, denkt er mit einem wohligen Kribbeln, in den Wahnsinn der Politik, der Nachrichtendienste.
Der Kriege.
Höflich macht er die Runde, reicht den drei Amerikanern die Hand. Sie sitzen auf einer Seite des runden Tischs, die beiden Deutschen gegenüber, auf dem Wandmonitor das vertraute Gesicht des immer grimmig dreinblickenden Wesley, aus Ramstein zugeschaltet und der einzige Uniformierte. Am Ende der Begrüßungsrunde wendet Breuninger sich ihm zu, hebt erneut die Arme. »Wesley!«
Der General salutiert. »Hans, my friend.«
»Berlin, next week?«
Ein militärisch-knappes Nicken.
Breuninger setzt sich, stellt »Steffen vom BND und Petra aus dem Innenministerium« vor, denen die Amerikaner zum ersten Mal begegnen. Steffen gehört zu den jüngeren Mitgliedern der Gruppe Schmidt. Breuninger möchte den Amerikanern zeigen, dass man sich um den Nachwuchs kümmert. Dass junge Leute da sind, wenn er dereinst abtreten wird.
Er will gerade fortfahren, als Ben, der Repräsentant des »Project for the New American Century« in Europa, mit kaum verhohlener Wut und ungebremstem texanischen Einschlag ruft: »Wer zum Teufel ist diese Irakerin?«
Breuninger verschränkt die Hände auf dem Tisch. Er hat keine Mühe, höflich zu bleiben, auch wenn er Ben in höchstem Maße unsympathisch findet. Zu impulsiv und unhöflich für einen Mann um die fünfzig, zu ungepflegt – gelbe Zähne, schlechte Rasur, Haarbüschel in den Ohrmuscheln. Die gemeinsamen Ziele helfen darüber hinweg. »Irgendeine unbedeutende Kommunistin, die Franzosen haben sie ›Abeer‹ genannt.« Er lauscht seinen Worten nach, distinguiertes New-England-Amerikanisch, das sich ungeheuer wohltuend von Bens texanischem Slang absetzt.
»Das ist alles? Mehr wissen Sie nicht?«
Steffen antwortet an seiner Stelle. Nicht einmal Abeers französischer Kontaktmann wisse mehr. Wie sie wirklich heiße, wo sie wohne, ob sie die »Beweise« schon in Händen halte oder noch besorgen müsse. Was man unter »Beweisen« überhaupt zu verstehen habe. Nur eines sei klar: Die einzige Möglichkeit für die Gruppe Schmidt und damit für PNAC und die amerikanische Regierung, Abeers »Beweise« abzufangen, sei der Moment der Übergabe in Bagdad.
Breuninger spürt mehr, als dass er es sieht, wie sich Petra von links leicht zu ihm neigt. Spürt ihre plötzliche Unruhe.
»In Bagdad, Hans? Wie willst du das bewerkstelligen?«, murmelt sie.
Er mustert sie nachsichtig. Petra Weissmann, Staatssekretärin im Innenministerium, früher Vizepräsidentin des hessischen Verfassungsschutzes, Witwe seines Freundes Michael, mit dem er die Gruppe Schmidt 1998 gegründet hat. Seit drei Jahren ist sie im Führungsgremium, um das Werk Michaels fortzusetzen.
Der letzte Wunsch eines Sterbenden im Morphiumrausch.
Anfangs dachte Breuninger, dass sie mit ihrer Erfahrung, ihren Verbindungen, ihrer kühlen Entschlossenheit ein Glücksfall für die Gruppe sein könnte. Aber die Trauer zersetzt sie.
»Mach dir keine Gedanken«, entgegnet er ebenso leise.
»Und wenn das nicht klappt?«, bellt Ben.
»Es wird klappen«, erwidert Steffen.
Ben reibt sich die Schläfen, seine Finger hinterlassen purpurrote Abdrücke. Es heißt, er habe politische Ambitionen, wolle aus dem Think Tank PNAC zu Rumsfeld ins Pentagon wechseln. Europa ist seine Chance, sich zu bewähren. Doch »Europa« bedeutet zu Bens Leidwesen im Moment Bagdad und Abeer. Es bedeutet, die Hände in den Schoß zu legen und Breuninger und der Gruppe Schmidt zu vertrauen.
Jim, CIA, nickt sinnierend. Nancy, State Department, mustert Breuninger konzentriert. Ben knurrt: »Schön, dass Sie da so sicher sind.«
»Wie soll die Übergabe stattfinden?«, fragt Wesley.
Ein Sondereinsatzteam des BND sei bereits zusammengestellt, erwidert Breuninger. Durchgeführt werde die Operation »Abeer« unter der Leitung eines altgedienten Agenten, den er selbst noch geführt habe. In Kürze würden der französische Agent und Abeer einen Übergabeort vereinbaren. Dort übernehme »unser Mann« die Unterlagen.
Alles im Griff also.
»Das heißt, Sie haben einen Mann im BND-Team?«, hakt Ben nach.
Breuninger lächelt nur.
»Ach kommen Sie, Hans! Ich brauche mehr!«
»Keine Namen«, sagt Wesley vom Monitor herab. Der Einzige unter den Amerikanern, der ihm blind vertraut. Der Einzige, der ihn aus der alten Zeit kennt, jenen Jahren, als die Villa und der Park noch bevölkert waren.
Breuninger greift nach der Kaffeetasse, trinkt.
Wesley war der Erste, der ihn im leeren Haus aufsuchte, Anfang 1983. Sie sollten es verkaufen, sagte er. Das kann ich nicht, erwiderte Breuninger. Der erste Golfkrieg, seit zwei Jahren schlachteten sich Iraker und Iraner ab. Sie tranken an Marions Teetischchen Whiskey und besprachen die Optionen des Westens. Marys Mutter lief bellend durchs Haus und suchte vergeblich nach dem Frauchen und den Kindern.
Auch nach 9/11 war Wesley der Erste, der kam. Das Teetischchen befand sich da längst in Washington, wie alles andere, was Marion mitgenommen hatte. Zum ersten und einzigen Mal überhaupt reichten sie sich die Hand. Wir finden Ihren Sohn, sagte Wesley. Lebend. Das verspreche ich Ihnen.
Ein sehr amerikanisches Versprechen, dachte Breuninger ohne Vorwurf: uneinlösbar.
So war es dann auch gekommen.
Sachte stellt er die Tasse zurück, fixiert Ben, der eingeschnappt schweigt.
Jim, hochgewachsen, graumeliert, räuspert sich. »Ihr Mann wird auf sich allein gestellt sein. Weder wir noch die DIA haben Agenten in Bagdad.«
Die Botschaft ist freundlich verklausuliert, aber klar: Man hält nicht viel vom BND. Noch immer eines der Grundprobleme des deutschen Dienstes. Diesmal allerdings brauchen die Amerikaner die Deutschen. Und umgekehrt natürlich.
»Wir bekommen Unterstützung aus Ramstein«, sagt Steffen.
Breuninger nickt lächelnd.
Doch die Übergabe bereitet Jim, Ben und Nancy weiterhin Sorgen. Wie stellt ihr euch das vor? Wie wollt ihr garantieren, dass euer Mann die »Beweise« bekommt, nicht einer der anderen BND-Leute? Oder der französische Agent? Dass es keine Kopien gibt, die dann in den westlichen Medien auftauchen? Die Übergabe ist zu wichtig, als dass man Risiken eingehen dürfte! Saddam muss endlich abgesetzt werden! Die Operation Iraqi Freedom muss stattfinden!
Bereitwillig stellt Breuninger sich den Sorgen. Beantwortet die Fragen und wirbt um Vertrauen. Der BND mag es nicht mit der CIA aufnehmen können, gibt er zu, aber unser Mann ist erprobt. Spricht Arabisch, kennt Bagdad. Kann improvisieren, falls nötig.
»Sie meinen hoffentlich: liquidieren«, schnarrt Ben.
Eine Bedingung, keine Frage. Breuninger reagiert nicht. Noch immer spürt er die Unruhe links von sich. Die größte Skeptikerin sitzt womöglich im eigenen Lager. Vor ein, zwei Jahren hätte ihn diese Erkenntnis überrascht. Dabei weiß er doch, dass der Tod eines Nahestehenden die Menschen verändert.
»Was passiert mit den angeblichen Beweisen?«, fragt Jim.
»Sie werden noch in Bagdad vernichtet.«
Seine einzige Lüge an diesem Nachmittag.
Später spricht Nancy das Thema Curveball an. Droht uns hier Gefahr? Breuninger schüttelt den Kopf. Der Mann wird hermetisch abgeschirmt. Niemand – und er wiederholt und betont: niemand – wird zu ihm durchdringen. Abgesehen davon sind nur eine Handvoll Menschen in die Wahrheit um Curveball eingeweiht. Alle gehören der Gruppe Schmidt oder dem PNAC an. Weder »mein ehrwürdiger Nachfolger, Mr.Träger« noch Curveballs Führungsoffizier sind darunter.
Dann nähert sich das Treffen dem Ende.
»Falls Sie Hilfe brauchen, Hans …«, sagt Nancy.
Das Angebot, auf das Breuninger gewartet hat. »Wir könnten Unterstützung vom jordanischen Geheimdienst brauchen.«
Ein Grummeln vom Monitor, dann erwidert Wesley: »Shouldn’t be a problem. We’re best friends with theGID.«
6
Amman (Jordanien)
EIN TAXI BRINGT JAROMIN vom Flughafen in die Stadt, über die er so gut wie nichts weiß, außer dass Bengt Koeppen in den Neunzigern hier zwei Jahre als Resident verbracht hat. Die jordanische Königin fällt ihm ein, Rania – Daniela liebt arabische Königinnen, verfolgt noch immer fasziniert Hochzeiten und Charity-Auftritte im Fernsehen. Ebenfalls nicht unwichtig: der Zeitunterschied. In Amman ist es eine Stunde später als in Sarajevo.
Andererseits kennt er wenige Städte besser als diese. Er hat den halben Stadtplan auswendig gelernt.
Im Zentrum verlassen sie den Highway und kommen nur noch im Schritttempo voran. Auch die Gehsteige sind bevölkert, auffallend viele junge Männer, die Frauen zum Teil verschleiert, Gruppen von Polizisten. Kleine Geschäfte dicht an dicht, Konditoreien, farbenprächtige Damenmode, Uhren, Schmuck, Schuhe. Vor Metzgereien und in Seitengassen Schächtungen, heute beginnt das islamische Opferfest. Eine Demonstration, Plakate gegen Bush und die USA, ein Sternenbanner brennt, Polizei und Militär stehen bereit. Und immer wieder der Blick auf die antiken Ruinen des Zitadellenhügels.
Vor dem Hotel, das Koeppen genannt hat, steigt Jaromin aus. Die Luft ist mild und sandig, riecht nach Abgasen und Stein. Er betritt die Lobby, passiert West-Journalisten, die auf Sofas und Sesseln auf den Krieg warten. An der Rezeption fragt er nach »Mr.Kerry« und erhält einen Umschlag mit dem Wohnungsschlüssel.
Draußen wendet er sich nach Norden, folgt den Straßen und Markierungspunkten vor seinem inneren Auge. Auf den Schildern stehen die Straßennamen in arabischer und lateinischer Schrift, so kann er sich zusätzlich orientieren. Nach einem Kilometer biegt er ab, geht hügelaufwärts nach Osten. Oben ein Wohnhauskoloss, Satellitenschüsseln vor den Fenstern, zahllose Funkmasten auf dem flachen Dach. Kurz danach führt rechts ein breiter Durchgang zur Parallelstraße hinunter. Auf halber Strecke steht ein schmales weiteres Hochhaus, der Eingang zwischen zwei schlanken, turmartigen Vorsprüngen. Zu Fuß steigt er nach oben, Kameras auf allen Treppenabsätzen, unscheinbare kleine Äuglein hoch oben in Winkeln und Ecken, vom Schmutz kaum zu unterscheiden. Vor der ersten Wohnungstür im vierten Stock öffnet er den Umschlag und nimmt den Schlüssel heraus.
Eine schlichte Zweizimmerwohnung, die nur einem Zweck dient: dass BND-Mitarbeiter in Amman übernachten können, ohne sich in Hotels anmelden zu müssen. Kleine Räume ohne Vorhänge, nach Norden ausgerichtet, schon im Halbdunkel liegend. Im Wohnzimmer ein paar wenige Möbel, im Schlafzimmer zwei schmale Betten und ein Schrank. Schon lange scheint niemand mehr die Wohnung benutzt zu haben. Die Hälfte der an Kabeln herabhängenden Fassungen enthält keine Glühbirnen. In Ecken und Winkeln vertrocknen tote Spinnen. Das Bier im Kühlschrank hat das Mindesthaltbarkeitsdatum um ein halbes Jahr überschritten. In Pullach wartet ein Formular zum Zustand der Wohnung auf Jaromin. Viele kleine Quadrate zum Ankreuzen, der BND ist ein penibler Nachrichtendienst.
Er öffnet zwei Fenster und die Balkontür der Küche, um den Geruch nach Schimmel zu vertreiben. Im Bad kniet er sich neben das WC und tastet auf dem verschlierten Boden nach einer losen Fliese. Darunter liegen, von einer Staubschicht bedeckt, eine Walther PPK, eine Sig Sauer, Munitionsschachteln, jeweils ein Bündel Jordanische Dinare und US-Dollar, ein Satellitentelefon, zwei Prepaid-Handys, der Autoschlüssel.
Ohne etwas herauszunehmen, schließt Jaromin das Fach.
Auf dem Küchenbalkon raucht er eine Zigarette, lässt dabei den Blick über die Stadt gleiten. Wieder die Ruinen auf dem Hügel, der inmitten anderer Hügel liegt, alle überzogen von fast ausschließlich sandfarbenen Gebäuden, als käme hier, am Rand der arabischen Wüsten, nur diese eine Farbe infrage.
Alinas Stimme, die nicht in diese Wüsten gehört, auch ihn herauszureißen droht. Aber er weiß, wie wichtig die Telefonate für sie sind.
Erzähl mir von Sarajevo …