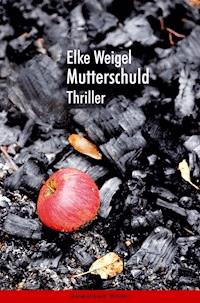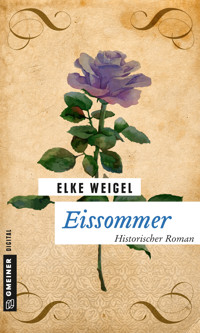
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
1815. Die junge Rose ist den Weinbauern unheimlich: Allein auf ihrem Hof, mit sechs Zehen an jedem Fuß und ihr Vater soll ein Waldgeist gewesen sein. Rose selbst beginnt daran zu glauben, als sie merkwürdige Veränderungen an sich feststellt. Dann geschieht etwas Schreckliches, das das Leben aller Dorfbewohner für immer verändern wird. 1846. Ein geerbtes Hemd löst bei Cumera Visionen aus. Hat ihre Großmutter wirklich ein ganzes Dorf vergiftet? Um die Wahrheit herauszufinden, macht sie sich mitten im Winter allein auf den Weg zu den Ruinen des Weindorfes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elke Weigel
Eissommer
Historischer Roman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-digital.de
Gmeiner Digital
Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Katja Ernst
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlagbild: Collage unter Verwendung von: © Mika_48 – istockphoto.com, © love1990 – Fotolia, © elvil - Fotolia.com
Umschlaggestaltung: Simone Hölsch
ISBN 978-3-7349-9364-0
Widmung
für Eva
1. Kapitel
Juni 1815
Rose konnte sich an Georgette nicht sattsehen. Seit die Sonne die ersten Strahlen ins Zimmer geschickt hatte, lag sie neben ihr im Bett, den Kopf in die Hand gestützt, und bewunderte die weiße Haut. Die Freundin schlief. Auf dem Kissen lag ihr schwarzes Haar in langen Strähnen und wirkte sturmzerzaust, was die Zartheit ihrer Gesichtszüge hervorhob.
Ein Weilchen lasse ich sie noch schlafen, dachte Rose. Ihr Blick wanderte über Georgettes Hals zu ihrer Brust, die sich mit dem Atem hob und senkte. Vorsichtig zog Rose die Bettdecke ein Stückchen nach unten. Schon streifte sie Georgettes Brustspitzen. Beim nächsten Einatmen, rechnete sie aus, müsste die Decke fast von selbst hinunterrutschen, sie brauchte nur ein klein wenig nachhelfen, die Freundin würde es nicht bemerken.
Ihr Herz schlug schneller, während sie wartete. Jetzt, jetzt gleich musste Georgette wieder einatmen und die Brust sich heben. Nichts geschah. Jetzt? Nein.
Georgette lachte leise und die Decke glitt herab.
»Was machst du da?«, fragte sie mit klarer Stimme.
»Oh, bist du wach?«
»Nein, ich träume von einem Mädchen, das vor lauter Neugier kein Auge zumacht.« Georgette umarmte Rose und zog sie auf sich. »Ich habe dich beobachtet.«
Rose küsste endlich Georgettes Mund und genoss den Zitrusgeschmack, der immer von ihm ausging. Sie barg ihr Gesicht an ihrer Halsbeuge und schnupperte.
»Du meine Schlehe, du.«
Georgette streichelte über Roses Rücken und presste ihre Hüften gegen Roses in einem Rhythmus, den sie beide gut kannten. Feuchtigkeit perlte zwischen ihren Leibern.
Rose warf ihre hellen Haare nach hinten.
»Küss mich«, forderte sie. Sie beugte sich hinunter zu Georgettes Mund. Ihr Haar fiel wieder nach vorn und bedeckte sie beide mit einem Schleier. Georgette griff danach, wickelte es um ihre Hand und zog daran.
»Es schimmert hellgrün«, murmelte sie.
Rose gab einen wohligen Ton von sich und steigerte das Tempo ihrer Beckenbewegung.
Es war gut, so gut. Rose sah in Georgettes braune Augen, die immer dunkler wurden, und wartete auf den Moment, da sie sie schloss, das Kinn hob und einen leisen Schrei von sich gab.
Jetzt. Der Blumenduft im Raum verbreitete sich so überwältigend, dass Rose glaubte, sie seien Büsche voller Blüten, die das betörendste Parfüm verströmten, das sie je gerochen hatte.
»Kannst du es auch riechen?«, fragte Rose, als sich ihr Atem wieder beruhigt hatte.
Georgette nickte. »Du duftest wie eine Heckenrose.«
»Und du wie eine Schlehe.«
Sie hielten sich umschlungen, Haut an Haut, und Rose nickte ein.
»Ich muss gehen«, sagte Georgette plötzlich, »es ist schon viel zu spät.«
Im Aufsetzen fuhr sie über Roses nacktes Bein, das unter der Decke hervor sah. Schnell versteckte Rose ihren Fuß.
Sie hatte sechs Zehen, und wenn auch Georgette niemals igitt schrie oder sich abwendete, verbarg sie lieber ihre Missgestalt.
Mit einem Ruck fuhr Rose im Bett hoch und sah zur Tür. Stand sie einen Spalt offen? Verklangen Schritte auf dem Hof? Sie lauschte angespannt, aber es war ganz still. Georgette war verschwunden. War sie doch ein Traumgespinst? Dabei gab es viele Anzeichen, dass sie existierte: Rose roch immer noch ihren Zitrusduft, spürte ihre Berührungen auf der Haut, das Bett war zerwühlt, als hätten zwei darin geschlafen und die Lippen fühlten sich wund an von den Küssen.
Rose griff nach ihrem Kleid und hatte es plötzlich eilig hinauszukommen. Seit ein paar Tagen bemerkte sie schon, dass sie es im Haus kaum mehr aushielt. Obwohl es drinnen eine Waschschüssel gab, wusch sie sich lieber am Brunnen.
Sie trat an die Viehtränke. Tag und Nacht plätscherte das Wasser in einen ausgehöhlten Baumstamm. Rose liebte das Geräusch. Sie hielt die flachen Hände unter den Strahl und sah zu, wie Millionen Tröpfchen nach allen Seiten sprühten. Dann trank sie direkt mit dem Mund am Eisenrohr.
Rose war klein und muskulös. Ohne zu ermüden konnte sie den ganzen Tag arbeiten. Sie schleppte schwere Wasserkannen zum Feld oder hackte trockene Erde auf. Ihre Hände waren rau, die Nägel abgebrochen. Doch ihre Haut an Gesicht und Körper schimmerte hell und so durchscheinend wie die eines Säuglings. Ihre feinen, hellblonden Haare rutschten immer wieder aus dem Zopf und klebten unangenehm am Hals oder auf der Stirn, sodass Rose sie mehrmals am Tag neu zusammenflechten musste. Dies war ihr so sehr zur Gewohnheit geworden, dass sie es gar nicht mehr bemerkte, wenn sie dazu ihre Finger wie einen Kamm benutzte.
An diesem Morgen stutzte sie. Ein hellgrüner Schimmer lag auf ihrem Haar, wie Georgette es gesagt hatte! Ihr Herz stockte einen Moment. Aber dann sagte sie sich, dass es dieses Jahr nur früher von der Sonne ausgebleicht worden war als die Jahre zuvor und dass das Grün der Tannen darin reflektiert wurde.
Entschlossen warf Rose den Zopf nach hinten und verbat sich das Grübeln über Georgette; sie konnte das Rätsel ja doch nicht lösen.
An den Hüften strich sie das Kleid glatt. Am liebsten trug sie das Braune ohne Gürtel, weil der Stoff vom Waschen so dünn geworden war, dass sie ihn kaum auf der Haut spürte. Wenn niemand zugegen war und ihre Zehen anstarrte, ging sie barfuß.
Rose stellte die Blechkanne unter den Strahl und sah zu, wie das Wasser hineinströmte.
Der Wandelhof lag weit oberhalb des Dorfes, nahe an den schwarzen Tannen. Nur in dieser Höhe wuchs der Waid, den die Frauen in Schrattingen brauchten, um ihre geklöppelten Borten blau einzufärben.
Ein Jahr war es her, seit Roses Mutter verschwunden war, seit einem Jahr fanden die Schrattinger, dass es für ein Mädchen zu einsam sei, hier oben zu leben.
Aber keiner hatte Interesse, den Hof zu bewirtschaften, also überließen sie ihn Rose und keiner merkte, dass Georgette zu ihr kam.
Sie kam, um Rose zu trösten.
»Alle sagen, sie sei beim Waldgeist. Soll das heißen, sie ist tot? Das glaube ich nicht, ich würde es doch spüren.« Georgette hörte zu, strich ihr die Haare aus der Stirn und küsste ihren Mund.
Ein paar Wochen später, nachdem ein Gewitter Roses Garten verwüstet hatte, kam Georgette wieder und streichelte allen Kummer weg.
Danach fand sich häufig ein Grund, warum Georgette kommen musste: Um Rose zu trösten. Sie zu küssen. Und immer länger legten sie die Lippen aufeinander und ein seltsamer Hunger breitete sich aus. Er wuchs, nahm schließlich den ganzen Körper in Besitz und war nur schwer zu stillen. Die Hände mussten dazugenommen werden und bald warteten sie nicht mehr, bis Rose traurig wurde, um mit den Zärtlichkeiten zu beginnen.
Wir lieben uns, wusste Rose, und sie wusste auch, dass sie es heimlich tun mussten.
Während Rose den Waid wässerte, dachte sie darüber nach, dass andere Frauen ebenfalls freundlich zueinander waren und sich halfen, wenn ein Unglück geschehen war. Aber niemals hatte sie gesehen, dass zwei sich auf diese Art berührten und so zärtlich miteinander umgingen.
Und weil im Dorf über alles getratscht wurde, das irgendwie auffiel, beschloss sie, Georgette geheim zu halten.
Eine Furcht war damit verbunden, die schwer zu fassen und noch weniger zu erklären war.
»Anni ist weg!« Eine Männerstimme riss Rose aus ihren Gedanken. Sie fuhr herum und rannte zum Haus. Gerade schlüpfte sie in die Holzschuhe mit den schiefgetretenen Absätzen, da bog Ludwig um die Hausecke. Rot im Gesicht stützte er die Hände auf die Knie und keuchte. Seine Mütze rutschte vom Kopf und fiel auf den Boden.
Rose sah auf seine Haare, die in schwarzen Büscheln nach allen Seiten abstanden.
»Was rennst du so?«, fragte sie. »Sie wird nicht weit sein.«
Anni war zwölf und nicht richtig im Kopf, sie lief weg, wenn man nicht auf sie aufpasste. Dann schwärmten die jungen Männer des Dorfes aus und suchten sie.
Ludwig kam wieder zu Atem. Er richtete sich auf und sah Rose an. Das Hemd spannte über seinen Schultern, sein Kinn war kantig wie ein abgeschlagener Stein. Der Sohn des Schmieds hatte neben Rose in der Schulbank gesessen. Seit einiger Zeit arbeitete er bei seinem Vater und sie traf ihn nur noch selten, aber jedes Mal schien er ihr dreister geworden zu sein.
Er packte Roses Unterarm. »Du und ich könnten auch was anderes machen, als Anni zu suchen.«
Sie sah auf die grobe Hand und dann in seine Augen.
»Jetzt hab dich nicht so«, sagte er, ließ sie jedoch los und drängte: »Du findest sie doch immer.«
»Habt ihr wieder gewettet?« Rose rührte sich nicht von der Stelle. Die tumbe Anni war ihm egal, sie sah es an seinem Lachen.
»Nun komm schon.«
Vom Weg her waren Stimmen zu hören. Die anderen Kerle des Dorfes kamen johlend und stöckeschwingend näher.
Schaudernd wandte sich Rose um. Schnell ging sie am Waidfeld entlang auf den Wald zu. Ludwig folgte ihr.
»Hei, du wirst immer draller. Komm doch mal zum Tanz.« Sein Schritt krachte wie der eines Ebers durchs Unterholz.
Rose schüttelte den Kopf. Er zog an ihrem Rock und grapschte nach ihrem Hinterteil.
»Mit dir macht’s sicher viel Spaß.«
Mit einer einzigen Bewegung fuhr sie herum und schlug peitschend nach seiner Hand.
»Autsch.« Ludwig lachte immer noch, aber Rose bemerkte zufrieden, dass sie eine rote Strieme auf seiner Haut hinterlassen hatte. Verstohlen rieb er seinen Arm, sah auf ihre Hand, dann suchend über den Boden.
»Wo ist der Stock?«
»Den hättest du verdient.«
Sie hatte keinen benutzt.
Verwirrt schüttelte er den Kopf.
Zwischen den Baumstämmen bewegte sich etwas.
»Leise«, raunte Ludwig. »Die anderen.«
Rose zuckte mit den Schultern und ging weiter. Sie wusste, die anderen würden Anni zuerst bei den Brombeeren suchen, dahin kroch sie meistens. Rose kannte einen kürzeren Weg durch das Gestrüpp an den Felsen. Er war gefährlich, denn dort veränderte sich die Vegetation jedes Jahr und überwucherte Felsspalten, in die man stürzen konnte.
Wenn sie sich beeilte, würde sie Anni vielleicht vor den Tritten und dem Gelächter beschützen können, mit dem die Kerle das arme Mädchen nach Schrattingen zurückjagen wollten. Üblicherweise feierten sie ihren Fang mit viel Bier im Wirtshaus »Wilder Mann«.
Rose zwängte sich zwischen den Zweigen hindurch, schob die Äste beiseite und lauschte. Endlich verhielt sich Ludwig still, sie hörte nur seinen Atem hinter sich.
Wenig Sonnenlicht drang durch das Dickicht, die Tannen bildeten ein grünes Dach. Im Unterholz raschelte eine Amsel. Rose balancierte an einer Felsspalte entlang und fand den kaum sichtbaren Pfad. An einem abgebrochenen Ast wehte ein blauer Faden – der stammte von Annis Kleid. Vor ihnen erhob sich ein grauer Felsen. Rose presste sich daran vorbei, Ludwig folgte ihr schnaufend. Das Gestrüpp wurde dichter. Brombeerranken umschlangen einen Busch, von dem nur noch ein holziges Gerüst übrig geblieben war. Die Dornenwedel hatten ihn erstickt. Dunkelgrüne Blätter und winzige, harte Beeren verdeckten das Meer aus Stacheln. Rose hörte, wie Ludwig scharf den Atem einzog. Sie drehte sich um. Sein Hemd hatte sich in den Dornen verfangen, er zerrte daran und blutete bereits am Handgelenk. Rose wartete, bis er sich befreit hatte, dann ging sie vorsichtig weiter.
Sie entdeckten Anni zur gleichen Zeit wie die andere Gruppe. Die Kerle waren den breiten Weg entlanggerannt, standen nun an der Brombeerhecke und droschen mit Stöcken auf das Gestrüpp ein. Tief drinnen konnte Rose Annis hellbraunes Haar sehen. Mit kläglichem Gesichtsausdruck saß sie geduckt in der Höhle.
»Raus mit dir«, johlten die Kerle.
Anni kreischte auf, bevor sie sich die Ohren zuhielt.
»Wir haben sie zuerst gesehen«, rief Ludwig.
»Nein, wir waren eher da«, entgegnete Kurt.
»Ja, wir«, stimmten Bastian und Wolfgang zu.
»Nur wer sie rausholt, hat gewonnen.« Ludwig baute sich vor Kurt auf.
Kurt war der Sohn des Wagners. Rotgesichtig und mit genauso groben Händen wie Ludwig hatte er schon viele Kämpfe mit ihm ausgetragen, um herauszufinden, wer von ihnen der Stärkste im Dorf war.
Nun schrien alle gleichzeitig auf Anni ein und stocherten mit ihren Stöcken ins Gebüsch. Das Mädchen zuckte zusammen, rührte sich aber nicht. Keiner hatte eine Jacke dabei, um sich vor den Dornen zu schützen, deswegen wagten sie nicht, hineinzukriechen.
»So geht das nicht«, sagte Ludwig mit lauter Stimme. Die anderen verstummten und warteten auf seine Idee, denn alle wussten, dass er der Klügste war.
»Wir müssen die Ranken auseinanderbiegen, dann kann einer hineinkriechen und sie holen.«
Sie versuchten es, doch die Stöcke rutschen ab, das Gewirr der Brombeerwedel war unberechenbar. Beherzt fasste Kurt hinein, zog aber sofort die Hand zurück. Alte Brombeerdornen sind kleine Säbel. Ludwig lachte hämisch.
»Dir geb’ ich’s gleich.« Kurt ballte die Faust.
Ludwig trat näher an ihn heran und drückte die Brust raus. »Was, was?«
Kurt stieß ihn weg.
Ludwig schlug zu. Sie begannen zu raufen. Bastian und Wolfgang feuerten sie an; sie würden sich auf die Seite des Stärkeren schlagen, damit sie später auf jeden Fall den Sieg begießen konnten.
Rose wartete einen Moment, dann bog sie die Brombeerranken auseinander und schlüpfte zu Anni in die Dornenhöhle. Das Mädchen hielt die Knie umschlungen, Blut lief über ihre Wangen. Ihr Gesicht war verschmiert vom Dreck, weil sie mit der Hand darüber gefahren war. Sie schob die Unterlippe vor und schmatzte. Anni war immer ein wenig schmutzig und erinnerte Rose an ein sturmzerzaustes Gräserbüschel. Das Mädchen roch nach frischem Heu.
»Komm, wir gehen nach Hause, Bärli wartet«, flüsterte Rose in Annis Ohr. Sie wusste, dass der Teddy ihr bester Freund war. Anni nickte und nahm Roses Hand.
»Und die Buben?« Anni legte den Kopf schief und sah nach den raufenden jungen Männern.
»Ich pass auf.«
Gebückt drückten sie sich zwischen den Ranken hindurch. Anni weinte, ihre Haare verfingen sich in den Dornen, das Kleid wurde zerrissen. Sie rieb sich über die blutigen Striemen auf den Armen.
»Mama«, rief sie und ließ Roses Hand los.
Verblüfft hielten die jungen Männer mit ihrer Rauferei inne. Annis Mutter riss das Mädchen an sich. Die Schultern und Mundwinkel der Frau hingen gleichermaßen und ihre Glieder waren dünn wie die Wedel einer Trauerweide.
»Saubande«, schimpfte sie, warf Rose einen finsteren Blick zu und zog Anni den Weg entlang.
Die jungen Männer richteten betreten ihre Kleider, wandten sich ab und trotteten davon.
»Jetzt brauch ich ein Bier«, brummte Bastian.
»Oh, ja.« Wolfgang nickte.
Ludwig reagierte nicht auf die Rufe seiner Kumpane, er starrte Rose an. Sein Blick wanderte an ihr hinauf und hinunter. Er strich sich durchs Haar und wirkte verwirrt. Dann rannte er hinter den anderen her.
»Sie hat keinen einzigen Kratzer!«, schrie er. »Wie kann das sein?«
»Fasel nicht.« Sie gingen einfach weiter.
Ludwig drehte sich noch ein paar Mal um, bis er zwischen den Bäumen verschwunden war.
Rose strich über ihren Arm. Er war tatsächlich glatt und heil. Es schien ihr sogar, als wäre ihre Haut heller geworden, ledriger. Sie zupfte und rieb. Warum hatte sie sich nicht verletzt? Anni hatte sogar im Gesicht geblutet. Rose sah an sich hinunter. In ihrem Kleid klafften Risse, lose Fäden hingen heraus. Seltsam. Rose streckte die Hand nach einer Brombeerranke aus, zögerte kurz, dann griff sie um die braunen Widerhaken, spürte keinen Schmerz. Aus ihrer Handfläche quoll ein klarer Tropfen hervor – das war kein Blut. Mit dem Fingernagel drückte Rose gegen den kleinen Schnitt im Handballen. Mehr klare Flüssigkeit sammelte sich um die Wunde. Sie leckte mit der Zunge darüber. Es schmeckte bitter. Irgendetwas stimmte nicht mit ihr!
Nachdenken war noch nie Roses Stärke gewesen, aber jetzt fiel es ihr besonders schwer. Ihr Herz klopfte wie wild und übertönte alle anderen Geräusche. Es wurde heiß auf der Anhöhe. Rose setzte sich auf den Boden und starrte vor sich hin.
Als sie nach einer Weile den Kopf hob und blinzelnd nachsah, wo die Sonne stand, erkannte sie, dass es fast Mittag sein musste.
Habe ich geträumt? Wo ist nur die Zeit hin? Rose sprang auf und warf noch einen Blick auf die Dornenhecke. Es war gut, dass Anni jetzt bei Bärli war. Rose hatte eben Glück gehabt, dass sie sich nicht verletzt hatte.
Schluss mit dem Rumtrödeln, schimpfte sie sich. Sie zog die Holzschuhe aus, nahm sie in die Hand und rannte so schnell sie konnte den breiten Weg hinunter bis zum Wandelhof.
Auf dem Rand des Trogs stand noch die Gießkanne, das Wasser sprudelte über. Rose schleuderte die Schuhe Richtung Haustür und trug die Kanne zum Feld.
Die Waidpflanzen sahen matt aus.
»Es tut mir so leid«, flüsterte Rose. »Es tut mir so leid.«
Vorsichtig goss sie ein wenig Wasser an jede Pflanze. Sie achtete darauf, die Blätter nicht zu benetzen, denn durch die Tropfen würden die Sonnenstrahlen braune Flecken hineinbrennen. Es war eine mühevolle Arbeit und sie wusste, dass sie fast vergebens war, da die Blattrosetten dicht über der Erde wuchsen. Erst wenn die Sonne untergegangen war, bestand keine Gefahr mehr und sie konnte gießen, wie es sein musste.
Rose sorgte sich so sehr um den Waid, dass sie kaum in der Lage war, zwischen ihren eigenen Bedürfnissen und denen der Pflanzen zu unterscheiden. Ging es ihnen schlecht, litt sie ebenfalls.
Mühevoll schleppte sie Kanne um Kanne aufs Feld. Immer wieder hielt sie den Mund ans Eisenrohr und trank.
Endlich war es geschafft, mehr konnte sie jetzt nicht tun.
Rose wandte sich zum Haus. Vor der Tür lag Ludwigs Mütze. Sie hob sie auf, klopfte den Staub ab und hängte sie an einen Nagel im Türrahmen. Danach setzte sie sich auf die Bank in den Hausschatten und streckte seufzend die Beine aus. Ihr Blick wanderte über das Feld. Die gelben Blüten des Waids wippten sachte in einem Lüftchen, Bienen schwirrten um die Dolden. Eine Libelle surrte an Roses Kopf vorbei, sie schwenkte ihren schillernden Leib hin und her. Fasziniert beobachtete Rose, wie sich das Insekt langsam auf ihren Fuß senkte. Mit einem Schrei zog sie den Fuß weg und fiel von der Bank. Die Libelle flog davon.
Vor ihr hatte sie keine Angst gehabt.
Mit zitternden Fingern berührte sie ihren sechsten Zeh. Er war lindgrün und sah aus wie ein frischer Zweig. Kein Nagel. Sie bog vorsichtig daran. Da brach er ab.
Rose wurde ohnmächtig.
Als sie erwachte, war es dunkel. Der Mond warf sein Licht über den Hof. Benommen rappelte sie sich hoch. Warum lag sie auf der Erde?
Da erinnerte sie sich an ihren Zeh. Sie keuchte und hielt sich den Magen, sie atmete langsam und kämpfte die Übelkeit nieder. Sollte sie noch einmal hinfassen? Womöglich war es nur eine Fantasie, weil sie so erschöpft gewesen war? Rose traute sich nicht. Sie suchte nach ihren Holzschuhen und fand sie neben der Haustür. Die Hand an den Türrahmen gestützt schlüpfte sie hinein. Nur nicht hinsehen. Mit zitternden Knien ging sie Richtung Feld.
Was war das nur für ein grässlicher Tag? Sie hatte es nicht geschafft, sich richtig um den Waid zu kümmern.
An die Pflanzen zu denken half ihr, die Angst zu verdrängen.
Die Blütezeit ist die wichtigste Phase, hatte ihre Mutter immer betont.
»Von ihr hängt ab, wie es im nächsten Jahr weitergeht.« Rose wiederholte, was sie gelernt hatte. Nach Johannis erntete man die Samenkapseln. Das konnte sie allein, das Feld mit den Zweijährigen war klein, aber die Blätter der Jährlinge, die mussten gleichfalls geerntet werden. Dabei würde ihr Ludwig helfen, wie seither auch.
Rose goss die Pflanzen. Mit jedem Gang spürte sie das Gewicht der vollen Kanne stärker, ihre Schultern begannen zu schmerzen. Der Mond wanderte weiter und verschwand hinter dem Wald. Es wurde zu dunkel, um noch irgendetwas zu sehen. Rose stellte die Kanne neben dem Feld ab und wandte sich Richtung Haus. Durch die offenstehende Eingangstüre wirkte das Innere des kleinen Gebäudes wie ein schwarzes Loch. Ohne Georgette erschien es ihr eng und muffig und sie wollte nicht hineingehen.
Ein süßer Duft stieg in ihre Nase. Sie schnupperte, drehte den Kopf und entdeckte den Hagebuttenstrauch, der an der Hausecke wuchs. Rose musste nur die Hand ausstrecken, schon konnte sie die feinen Blätter berühren. Mit geschlossenen Augen unterschied sie sie von den seidigen Blütenblättern mit den harten Staubgefäßen in der Mitte.
Rose war unendlich müde. Neben dem Hagebuttenstrauch legte sie sich auf die Erde und schlief sofort ein.
Rose erwachte mit einem Ruck. Sie setzte sich auf und sah sich suchend nach dem um, was sie geweckt hatte. Die Sonne war noch nicht zu sehen, nur ein Streifen am Horizont leuchtete graublau. Vögel zwitscherten, doch sie waren es nicht gewesen. Rose starrte zum Himmel über dem Berg.
Da, ein gelber Schimmer stieg auf und Rose lächelte.
Alles ist gut, dachte sie. Sie wusste nicht, woher das Gefühl kam, verspürte auch kein Verlangen, darüber nachzudenken.
Sie ging zum Brunnen und trank. Dann begann sie sofort wieder, die Kanne zu füllen und den Waid zu gießen. Sie spürte, dass es ein sehr heißer Tag werden würde.
Je weiter der Tag fortschritt, umso kräftiger fühlte sie sich. Das Wasser schien heute kein Gewicht zu haben. Zügig schritt sie die Reihen ab und hatte ihre Arbeit schnell beendet.
Die Sonne stand hoch am wolkenlosen Himmel.
Rose hockte sich neben den Hagebuttenstrauch und freute sich über das zarte Rosa der Blütenblätter. Sachte berührte sie die Stängel, deren haarig feine Dornen wie ein gesträubtes Fell wirkten. Sie dachte an die roten Früchte, die im Herbst leuchten würden, das süße Mus und die Kerne, die ein schreckliches Jucken auf der Haut verursachen konnten.
»Wehrhaft und stark bist du«, sagte Rose anerkennend.
Sie bohrte die Absätze der Holzschuhe in die harte Erde neben dem Strauch, bis die Oberfläche sich lockerte. Die braunen, feuchten Krümel dufteten wunderbar.
Ohne nachzudenken schleuderte Rose die Schuhe davon und grub die Füße ins Erdreich. Ein tiefer Atemzug entwich ihr. Sie schloss die Lider und streckte das Gesicht dem Licht zu. Ein Pulsieren durchströmte sie. Langsam, wohlig und kraftvoll.
Ein kühler Hauch streifte ihre Wange und sie öffnete die Augen.
Die Sonne war hinter den Bäumen verschwunden, es dämmerte bereits. Erschrocken sah sie sich um. Was tat sie für seltsame Dinge? Gestern war sie in Ohnmacht gefallen und heute hatte sie tagsüber geschlafen. Sie blickte auf ihre Füße, die immer noch bis zu den Knöcheln in der Erde steckten. Sie strich über ihre Waden. Sollte sie es wagen, die Zehen anzusehen? Sie bewegte die Fersen hin und her und zog dann mit einem Ruck die Füße heraus. Sie waren bedeckt mit Erde und Rose konnte zunächst nichts erkennen. Mit den Händen fuhr sie darüber, wischte den Dreck weg.
Grün und weich wuchs eine kleine Knospe da, wo vorher der sechste Zeh gewesen war. Rose biss auf die Unterlippe. Tränen liefen über ihre Wangen. Erleichterung und Entsetzen wechselten in ihr.
Irgendetwas sagte: Alles ist gut. Gleichzeitig fürchtete sie sich.
Das war doch nicht normal. Gab es eine Krankheit, die so aussah? Rose tastete nach dem anderen Fuß. Auch dort schimmerte der sechste Zeh grün wie ein Mistelzweig.
Vielleicht werde ich verrückt und sehe Sachen, die nicht da sind? Rose wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und schaute umher.
Im Süden auf dem kleinen Feld wippten die gelben Blüten des Waids auf den dürren Stängeln. Auf dem großen Feld daneben wuchsen die blaugrünen Rosetten der einjährigen Pflanzen. Jenseits der Felder begann der Wald. Im Osten stand das Haus, in dem sie ihr Leben lang gewohnt hatte. Es war winzig und schief, der Putz blätterte an vielen Stellen ab und gab das Mauerwerk frei. Fensterläden und Haustüre waren blau gestrichen, das Dach mit Ziegeln gedeckt.
Rose erhob sich. Hinter dem Haus fiel der Hang steil ab. Weiter unten sah sie die Rebstöcke und im Tal lag das Dorf – Schrattingen.
Alles sieht aus wie immer, stellte Rose erleichtert fest. Ich bin nicht verrückt.
Ohne sich umzusehen, wusste sie, dass die Sonne die Baumwipfel im Westen fast erreicht hatte. Sie musste sich um die Pflanzen kümmern, bevor es ganz dunkel wurde.
Nach Lausbefall Ausschau haltend, ging sie die Reihen ab. Der Waid wuchs gesund und kräftig.
Wie sie es erwartet hatte, war der Tag heiß gewesen, die Erde ausgedörrt. Während sie geduldig wartete, bis die Kanne mit Wasser vollgelaufen war, wunderte sie sich, dass sie den Tag verschlafen hatte. Allerdings fühlte sie sich nicht, als hätte sie geschlafen, sondern so, als läge ein arbeitsreicher Tag hinter ihr.
Je dunkler es wurde, desto mehr ermattete sie. Kaum hatte sie alles gegossen, spürte sie eine riesige Müdigkeit aufsteigen. Sie legte sich neben den Hagebuttenstrauch, lächelte im Mondlicht die duftenden Blüten an und dann kam Georgette.
Rose spürte, wie die Freundin sie streichelte. Sie fuhr über ihren Oberschenkel, das Schienbein entlang und wanderte mit der Hand zu ihrem Fuß.
»Nicht«, flüsterte Rose und versuchte, ihre Füße zu verbergen. Sie fürchtete sich davor, wie Georgette auf ihre veränderten Zehen reagieren würde.
Georgette legte sich auf sie und umfasste mit beiden Händen Roses Wangen. Ihre Augen glühten dunkellila wie reife Schlehenbeeren. Sie küsste Roses Mund, ihren Hals und wanderte mit den Lippen über ihren Bauch.
Rose flocht ihre Finger in Georgettes schwarzes Haar und schloss die Augen. Kühl prickelte die feuchte Spur von Georgettes Zunge auf ihrer Haut und sie öffnete weit ihre Schenkel, um sie auch dort zu empfangen.
Später, als sie trunken von ihrem gemeinsamen Blütenduft nebeneinanderlagen, sagte Georgette: »Lass die Wurzeln an deinen Füßen wachsen, sie werden dir Halt geben.«
Woher weißt du das?, dachte Rose, aber sie war zu müde, um es laut auszusprechen.
2. Kapitel
Cumeras Tagebuch
11. Januar 1846
Meine Großmutter war eine Mörderin. Sie hat fast alle Einwohner ihres Dorfes getötet. Es war nur ein kleiner Flecken, ein unbedeutender Ort, der keine große Zukunft hatte und aus dem sowieso bald sämtliche Bewohner abgewandert wären, aber Mord ist natürlich Mord. Ich weiß davon, seit ich denken kann, und hatte nie einen Anfall deswegen bekommen. Aber nun war es passiert und mein Verlobter löste unsere Verbindung, stotterte dabei fürchterlich herum und wagte nicht mehr, mir in die Augen zu sehen. »Da Sie mich über Ihre Schwäche getäuscht haben … und wie kann ich mir sicher sein, dass Sie nicht auch …« Für Mama ist klar, dass das Stift schuld an meinem Anfall ist. Ein gebildetes Frauenzimmer würde eben keiner heiraten wollen, lautete ihr Kommentar mit einem vorwurfsvollen Seitenblick auf Papa, der mir erlaubt hatte, die Mädchenschule zu besuchen. Papa regte sich auf, weil es egal ist, wie weit man wegzieht, die Vergangenheit holt einen immer ein. Ich glaube, es hatte begonnen, als ich mich auf dem Speicher mit den Sachen meiner Großmutter beschäftigte, denn dort bekam ich den ersten Anfall.
Meine Ärztin riet mir dieses Tagebuch zu führen, um meine Gedanken zu ordnen, meine Träume sollte ich darin festhalten und, was mir sonst noch wichtig erschiene.
Sie interessiere sich für alles, betonte sie.
»Ein weiteres gebildetes Frauenzimmer«, schnaubte Mama, als Fräulein Dornbach ihr die Hand reichte.
Mama glaubt einfach nicht, dass eine Frau etwas anderes zustande bringen kann als Kinder oder einen Hefezopf. Arme Mama, ich schreibe gehässige Sachen über sie, dabei ist sie wirklich in Sorge um mich und will nur mein Bestes. Letztlich hat sie geschwiegen, sich nur eine Träne weggewischt, während Fräulein Dornbach erklärte, wie sie sich meine Behandlung vorstellte.
Ich solle bei ihnen im Haus wohnen, in diesem hübschen Zimmer, und täglich zweimal mit ihr sprechen. Sie würde mich mesmerisieren und bald wären meine innere Unruhe und meine Anfälle verschwunden.
»So Gott will«, seufzte Mama. Papa tätschelte ihre Hand und ich war erstaunt, dass er so viel Zärtlichkeit in der Gegenwart anderer Leute zur Schau stellte. Ein Zeichen, dass auch er sehr besorgt war.
Er küsste mich zum Abschied auf die Stirn und nun sitze ich also hier in meinem Zimmerchen.
Das Haus von Dr. Dornbach liegt oberhalb der Altstadt, unweit der Gassen voller verlauster Kinder, die ständig husten, den Arbeitsstätten der Handwerker, die so eng sind, dass die meisten Tätigkeiten in den Straßen verrichtet werden müssen, dem Gezeter der Marktfrauen und dem Schimpfen der Fuhrleute, die sich mit ihren Wagen durch das Gewühle kämpfen. Ich bin in diesem Gewirr aufgewachsen und konnte es dennoch nie lieb gewinnen oder als Teil des Alltags ignorieren. Schon immer habe ich mit Gereiztheit darauf reagiert.
Aber zurück zu Doktor Dornbachs Haus, das auf halber Höhe der Heusteigstraße liegt.
Hochmütig ragt es mit seinen schmalen Fenstern auf und die Vorderfront sieht auf Stuttgart hinab.
Ich blicke jedoch von meinem Zimmer in den Garten, der aus einer breiten Terrasse besteht, die wie eine Stufe den Hang hinauf angelegt ist. Ein winziger Flecken Grün, der mir den Aufenthalt verschönert, denn einen Garten haben wir in der Altstadt natürlich nicht. Die Spitzenvorhänge habe ich beiseitegeschoben, um das Winterlicht hereinzulassen. In der Mitte der hohen Zimmerdecke prangt ein Stuckmedaillon. Die Möbel sind mit ovalen Schnitzereien verziert und in der Ecke verströmt ein grün gekachelter Ofen wohlige Wärme. Ich schreibe an einem runden Tischchen mit Fransendecke und hoffe, meine Worte bringen mich meiner Heilung näher.
Wenn ich ehrlich bin, und das soll ich in diesem Tagebuch sein, weiß ich nicht, ob ich geheilt werden will, noch weniger, ob ich mich für krank halte, aber auch darüber kann ich mir vielleicht Klarheit durch dieses Tagebuch verschaffen. Absolute Ehrlichkeit sei notwendig, erklärte mir Fräulein Dornbach.
»Schreiben Sie alles auf und beginnen Sie am Anfang.«
Als ob das so leicht wäre. Wann hat alles begonnen? Als ich geboren wurde? Als Wilhelm die Verlobung löste? Oder begann es, als ich auf dem Speicher im Haus meines Vaters die Hinterlassenschaften meiner Großmutter fand und das blaue Hemd herausnahm? Da hatte ich jedenfalls meinen ersten Anfall. Mir gefällt das Wort Vision viel besser, denn daran erinnert mich, was mit mir geschah.
Aber beginne ich mit meinem Anfang.
Ich wurde 1818 geboren, das war zwei Jahre nach den Morden. »Ich dachte, ich verliere das Kind, als ich erfuhr, was geschehen war«, pflegt Mama zu wiederholen. Das Kind, damit bin ich gemeint. Ich bin ihr einziges Kind und ich glaube, das nimmt sie mir übel. Großmutter saß also im Gefängnis und Mama konnte vor Entsetzen darüber nicht schlafen. Drei Jahre vor der Tat war sie zu ihrem Mann nach Stuttgart gezogen. »Hätte es mich sonst auch getroffen?«, fragt sie noch heute. Papa schüttelt dann nur den Kopf und zupft an seinem Backenbart. Wahrscheinlich hat er diese Frage so oft gehört, dass er keine wortreichen Überlegungen mehr anstellen mag. Trotzdem sprechen sie über das, was passiert ist, mindestens einmal im Jahr, an meinem Geburtstag, der auf den Hinrichtungstag meiner Großmutter fällt. Man enthauptete sie mit dem Fallbeil, das extra mit der Eisenbahn herangeschafft worden war, während meine Mutter in den Wehen gelegen hatte.
Gestern war es wieder so weit, Mama gratulierte mir zu meinem Achtundzwanzigsten, zündete anschließend eine Kerze an und betete für Großmutters Seelenheil. Sie tut das, obwohl sie nicht katholisch ist und folglich nicht an die Hölle glauben sollte, aber seitdem das Verbrechen verübt worden war, ist sie sich wohl nicht mehr so sicher, wie so etwas von Gott gehandhabt wird.
Mama suchte nach Großmutters Verhaftung regelmäßig eine Kapelle auf und kniete vor dem Bild der heiligen Kümmernis nieder. Auf dem zerkratzten Bildchen, das sie in ihrem Gesangbuch herumträgt, steht der Name der Heiligen: Ontcomera – schwierig auszusprechen und noch schwieriger zu merken.
Und als ich meinen ersten Schrei tat, flüsterte Mama der Hebamme etwas zu, was diese als meinen Namen verstand. Und seitdem heiße ich Cumera. Eigentlich Anna Elisabeth Cumera Seibold.
Ich habe meine Großmutter also nie kennengelernt, und sie war eine Mörderin. Als kleines Mädchen begriff ich nicht, was geschehen war, ich bemerkte nur die Beachtung, die ihr geschenkt wurde: Wenn man von ihr sprach, nickten die Nachbarn ernsthaft, Mama seufzte laut und Papa presste die Hände zusammen. Die Atmosphäre schien mit einem Mal angespannt, wie vor einem Gewitter, und das gefiel mir. Die Bezeichnung Großmutter suggerierte mir auch, dass sie eine bewundernswerte Frau gewesen sein musste, schließlich strebte ich danach, endlich groß zu werden. Da ich nie ein Bild von ihr gesehen hatte, dachte ich sie mir hochgewachsen und stattlich. Als sich herausstellte, dass ich mich zu einer großen Frau entwickeln würde, hieß es tatsächlich: »Du siehst deiner Großmutter immer ähnlicher«. Vielleicht war das der Grund, warum Papa Wert darauf legte, dass ich ins Königin-Katharina-Stift ging. »Wer weiß, wofür es mal gut ist«, führte er ins Feld, wenn Mama über die Kosten jammerte und betonte, dass sie Bildung bei Frauen hässlich fand.
Nun, ich bin wirklich nicht hübsch geworden, dafür klug genug, um zu wissen, dass nicht die Bücher für meine großen Füße und meine lange Nase verantwortlich sind. Ich verstehe nicht, wie Mama so unsinnige Verbindungen herstellen kann. Ich glaube, dass ich mein Aussehen meiner Großmutter zu verdanken habe.
Überhaupt stelle ich gerne Verbindungen her, nur nicht solche wie meine Mutter, völlig aus der Luft gegriffene, sondern ich beziehe mich dabei auf die Logik oder eine geschichtliche Verknüpfung.
Das war auch der Grund, warum ich auf dem Speicher herumsuchte.
Ich hatte Tage gebraucht, bis ich Wilhelm dazu gebracht hatte, die Leiter für mich hinaufzutragen. Denn zum obersten Boden unter dem Dach führte keine Treppe. Er verstand mein Bedürfnis nach Vergangenheitserforschung nicht. »Lass die Geschichte ruhen, wir sind die Zukunft«, sagte er.
Das wiederum konnte ich mir nicht vorstellen, ich sah mich weder in seinem Haus wirtschaften, noch seine Kinder hüten. Ich hatte mich mit ihm verlobt, weil er der Einzige war, der mich je gefragt hatte, bzw. meinen Vater, und ich war schon sechsundzwanzig gewesen, zwei wichtige Gründe, ja zu sagen. Aber kein triftiger Grund, ihn zu heiraten. Ich schob die Hochzeit hinaus, solange ich konnte, und dass letztlich die Kisten auf dem Speicher dazu beitragen würden, dass unsere Verlobung gelöst wurde, ahnte ich nicht, als wir die Leiter hinaufstiegen.
Ich blättere gerne in Zeitungen und Journalen und war in einem Artikel über heimische Sagen und Märchen zufällig auf das Wort »Schrat« gestoßen.
»