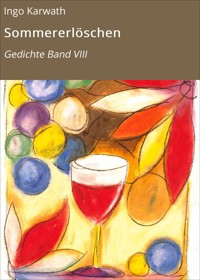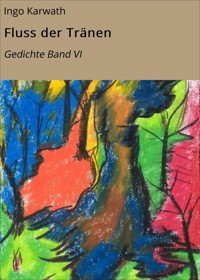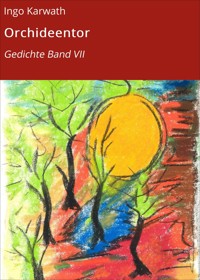9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Lust auf Erotik im spannungsgeladenen Bogen aus Verbotenem, Abenteuer und Verführung. Kurzgeschichten um das schönste Thema der Welt. Aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, findet hier vielleicht auch der eine oder die andere seine oder ihre Leselust wieder. Und nicht nur die...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Ähnliche
EROS SPIELE
Erotische Kurzgeschichten
WILD HONEY
Rums! Das Echo hallte mit leichter Verzögerung doppelt und dreifach von den Hügeln zurück. Rums! Auch der zweite Schuss löste den Widerhall aus. Die Wucht des Rückschlages warf den Schützen nach hinten, doch er hielt stand. Durch den Pulverdampf konnte ich schemenhaft erkennen, dass er getroffen hatte. Die große Katze lag tödlich verwundet im Staub und zucke nur noch mit einer Vorderpfote. Im Augenblick der einsetzenden Stille stürzte ein babylonisches Stimmengewirr, begleitet vom Trampeln schwerer Wanderstiefel, von allen Seiten auf das Geschehen ein. Warum Großwildjäger so schwere Schuhe tragen, habe ich nie verstanden. Wie wollten die damit vor einem wütenden Nashorn fliehen? Da drin musste sich jeder Fuß zu Tode quetschen oder im eigenen Schweiß ersaufen. Gut, dass meine Sohlen aus Haut den Boden fühlen und lesen konnten. Das Gegröle erreichte seinen Höhepunkt, als die anderen den glücklichen Jäger erreichten und ihm anerkennend auf die Schultern klopften. Doch der Held stand nicht da als der strahlender Sieger, den sie feierten, dafür stand ihm der Schock, der ihn erfasste, als der Löwe unverhofft aus dem Dickicht brach und angriff, noch zu sehr ins blasse Gesicht geschrieben. Mit zittriger Hand nahm er den breitkrempigen Hut ab und wischte sich am Hemdärmel den Schweiß von der Stirn. Seine schnelle Reaktion hatte ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Das Tier, ein kapitaler Bursche mit riesiger Mähne, trug eine Verwundung vom Vortag und war deshalb bis zum Äußersten gereizt gewesen. Jetzt bestaunten alle den toten Killer, wie sie ihn ehrfurchtsvoll nannten, und neideten dem Schützen Triumph und Trophäe, lange bevor beides ins ferne Amerika ging. Langsam neigte sich der Tag und der Führer der Jagdgruppe drängte darauf, ein sicheres Nachtlager zu bereiten. Den ganzen Tag hatten sie versucht, den angeschossenen Löwen zur Strecke zu bringen und fast schon aufgegeben. Wäre der in Deckung geblieben, hätte ihn die hereinbrechende Dunkelheit vielleicht gerettet. Selbst die Hunde schlugen dieses Mal nicht an. Aber dann wäre er womöglich elendig verblutet oder verhungert, da er verletzt nicht mehr jagen konnte.
Manchmal begleite ich die Großwildjäger als Fährtenleser, die bei den Einheimischen angeworben werden. Wir leben in der Natur, verstehen sie und können ihre Zeichen lesen, Wetter vorhersagen, Wasser, Wurzeln und Medizin finden, kurzum im Busch überleben. Ohne erfahrene Buschleute waren die Fremden hier draußen aufgeschmissen, auch wenn sie oft auf uns herabsahen. Wir fanden sie auch nicht so toll. Dass eine junge, leicht bekleidete Afrikanerin sie begleitete, trug mir manchen ungläubigen, aber auch lechzenden Seitenblick ein. Nur war ich keine Folklore, sondern Realität. Ich machte mich nützlich, trug Holz für ein Lagerfeuer zusammen, um nachts wilde Tiere und Moskitos abzuhalten. Ein paar abgestorbene Äste des kargen Buschwerks reichten für den Zweck. Am Horizont verschwand die glutrote Scheibe gerade und tauchte den Himmel in feine Pastellfarben, die von Azur über Gelb und Rot zu allen Schattierungen von Pink und Violett verschmolzen. Afrika kann sanft und harmonisch sein und ist nicht nur wild und grausam wie in der Welt der Jäger. Der Schnee auf dem Kilimandscharo schmilzt und die Krieger der Massai haben ihre Speere an die Wand gehängt. Ich liebe die Sanftmut der blassgrünen Hügel der Savanne, die sich offenbar nicht entscheiden mochte, ob sie lieber das verbrannte Braun der Trockenzeit oder das saftige Grün der Regenperiode zeigen sollte.
Auch wenn die Fremden uns für exotische Wilde hielten, wir gingen in Schulen und Universitäten, hatten kluge Lehrer, die von der großen weiten Welt erzählten. Ansehen würde ich mir sie irgendwann, da bleiben jedoch nicht.
Ich mochte die Jäger nicht, auch wenn mancher netter Kerl darunter war. Sie gebärdeten sich übertrieben laut, respektlos gegenüber Land und Leuten, gestikulierten ständig wild schreiend herum und tranken Unmengen Alkohol. Außerdem rochen sie wie ein totes Flusspferd. Kein Wunder bei dieser Ausrüstung, die bei unseren Leuten nur Kopfschütteln auslöste. Gingen unserer Männer auf Jagd, nahmen sie wenig wie möglich mit, um sich schnell und lautlos bewegen zu können. Jeder Ballast war nur hinderlich. Die Fremden wuschen sich nur, wenn ein Fluss in der Nähe war. So oft es ging, führten wir sie deshalb an Furten. Wenn sie fragten, sagten wir, die Frischwasservorräte müssten unbedingt aufgefüllt werden. Da vertrauten sie uns, wäre aber anderswo genauso gut möglich gewesen. Doch das brauchten sie nicht zu wissen. Sie benahmen sich wie kleine Kinder, warfen sich johlend ins Wasser, spritzen sich gegenseitig nass und tauchten andere unter, während wir die Umgebung wegen der Krokodile im Auge behielten. Wie leichtsinnig sie doch mitunter waren, obschon sie bei jeder Schlange kreischend davon rannten. Ihre helle Haut war unter den martialischen Lederklamotten noch blasser als ohnehin schon, und wenn sich einer rasierte, sah er zu unserer stummen Belustigung hinterher aus, als hätte er Mehl im Gesicht. Es kamen überwiegend Männer in den besten Jahren, denn die Tour galt als anstrengend. Kranke oder Verletzte blieben im Camp; das galt als unumstößliches Gesetz. Überforderte mitschleppen, wollte sich keiner im Busch antun. Für alternde Großwild-Cowboys war das nichts, für die gab es spezielle Safaris mit allem Nervenkitzel auf Distanz. Unsere Tour gab ein bewusst gewähltes Kontrastprogramm zum verwöhnten Leben in der westlichen Zivilisation. Überlebenstraining nannten sie das. Immerhin wollten sie was zu erzählen haben, wenn sie wieder nach Hause kamen. Und wir redeten es ihnen auch nicht aus, auch wenn keiner von ihnen drei Tage hier draußen überleben würde.
Unser Dorf liegt an der Grenze zur Savanne; die Hand voll kleiner, kegelförmiger Lehmhütten im Schutz der nahen Berge umgibt eine verschließbare Dornenhecke, um die Rinder vor Räubern auf vier Pfoten zu schützen. Von diesen Dörfern existieren viele, und die Kinder liefen zu Fuß kilometerweit zur nächsten Schule. Später müssen sie wie ich in die große Stadt, wenn sie an der Universität studieren wollen. Ich bin als Ingenieurin zurückgekehrt, um mit meinem erworbenen Wissen das Leben im Busch zu erleichtern. Doch ohne finanzielle Mittel bleibt es Utopie, etwa Brunnen zu bohren und so die Wasserversorgung zu verbessern. Tourismus und Großwildjagd sind die einzigen Einnahmequellen, was ich teils nur mit blutendem Herzen ertrage. Dennoch ging ich lieber mit den Jägern, als im Dorf gaffenden Fremden irgendwelche archaischen Tänze zu zeigen oder bemalte Baströcke zu verkaufen. Hier lernte ich über die Wildnis, was ich wissen wollte, um sie später vielleicht vor dem Schicksal, nur als Abenteuerspielplatz wertvoll zu sein, bewahren zu können.
„Was ist, schwarze Schönheit, kommst du mit ins Wasser?“ riefen mir die Männer zu und grinsten dümmlich. Dabei machte sie eindeutigen Gesten und Verrenkungen unter dem Gejohle ihrer Kumpels. Einige zogen in meiner Nähe absichtlich blank und zwinkerten grinsend den anderen zu.
„Wenn du mir wilden Honig holst…“, lautete meine stets gleiche Antwortet auf die plumpe Anmache. Ich ging diesem Treiben aus dem Weg, auch wenn bisher keiner versucht hatte, den Worten Taten folgen zu lassen. Angst hatte ich ohnehin keine, denn ich wusste mich zu wehren.
Am Lagerfeuer ging es nach der großen Löwenjagd hoch her. Knackend und knisternd begleiteten die Flammen die wild gestikulierenden Männer und warfen zuckende Schatten auf ihre erhitzten Gesichter, was die Theatralik ihrer Auftritte noch erhöhte. Die Jagd mutierte zur Heldentat und wurde nach reichlich Whiskey immer weiter ausgeschmückt. Jetzt war jeder Teil des Erfolges. Wieder und wieder musste der Schütze die Story erzählen, Löwe und Gefahr wuchsen ins Unermessliche. Neue Detail tauchten auf, schossen ins Kraut, und am Ende war Anglerlatein die pure Wahrheit gegen das, was die Jungs da fabulierten.
Ich hockte etwas abseits und sah dem Szenario zu. Einer der Jäger, der am Feuer fehlte, tauchte unvermittelt neben mir auf. Er war deutlich jünger als die meisten, drahtig und groß.
„Hi…“ Er roch nach Leder und Tabak.
„Kein Whiskey mit den Jungs?“ Meine Frage sollte ihn abwimmeln.
„Ich will morgen nicht mit dickem Kopf…“
Ich stand auf zum Zeichen, dass ich keine Lust auf ein Gespräch mit ihm hatte.
„Ich…“, versuchte er, mich zum Bleiben zu bewegen.
„Bring mir wilden Honig!“ Der Spruch klappte immer und ließ ratlose Männer zurück.
Ich stand früh vor Sonnenaufgang auf, wusch mich am Fluss, legte den traditionellen Schmuck meines Volkes an, bemalte meine perlmuttfarben schimmernde Haut mit Ocker und half nach dem Frühstück den Trägern beim Packen. Heute wollte die Jagdgemeinschaft auf Elefantenjagd gehen. Es gab entsprechend Unruhe im Lager, alle waren nervöser als sonst. Wir marschierten mehrere Stunden. Der Typ von gestern Abend hielt sich am rechten Rand der aufgefächerten Gruppe, die eine Herde Elefanten entdeckt hatte und verfolgte. Die Tiere bemerkten die Verfolger und gaben unmissverständliche Warnzeichen. Doch die Jäger ignorierten das. Schließlich reichte es dem wütenden Leittier, es machte kehrt und stellte sich der hetzenden Meute mit hoch ausgestellten Ohren und aufgerichteten Rüssel entgegen. Schnaubend warf der Bulle Staubfontänen in die Luft und trompetete, bevor er auf den erstbesten Angreifer in seiner Nähe losstürmte. Der zu Tode Erschrockene bewegte sich keinen Millimeter und stand wie angewurzelt. Erst kurz vor ihm, als alle glaubten, dass es um den Burschen geschehen wäre, stoppte der tobende Elefant abrupt. Sofort rissen alle ihre Büchsen hoch, doch der Bedrohte drehte sich um und schrie mit ausgebreiteten Armen, so laut er konnte: „Stopp!“
Es war der junge Kerl vom Vorabend. Alle Gewehre gingen nach unten. Atemlose Spannung lag in der staubigen Luft, die wabernd in der Mittagssonne kochte. Es war nichts zu hören außer dem stoßweisen Schnaufen des Tieres und einem leichten Wind, der über die Savanne hauchte. Fast eine Ewigkeit später wandte sich der Bulle ab, schnaubte warnend und trabte im Triumph zu seiner Herde zurück. Der Guide hielt es für besser, die Jagd für heute abzublasen.
Von jetzt an behielt ich den Elefantenflüsterer, der scheinbar nicht auf alles schoss, was sich bewegte, im Auge. Er wollte mit dem Töten möglichst furchteinflößender wilder Tiere tausende Meilen entfernt wohl keinen Ruhm ernten. Oft sah ich ihn stehenbleiben, Pflanzen begutachten, an Blüten riechen oder einfach nur riesigen Herden in der Ferne mit dem Feldstecher beobachten. Ich hielt mich, eher zufällig, immer mehr in seiner Umgebung auf, so dass es ihm irgendwann auffallen musste. Er fragte mich dann auch prompt das eine oder andere. Nachdem ich ihm mehrfach geholfen hatte, suchte er nun immer öfter meinen Rat. Wir freundeten uns ein wenig an, dennoch blieb ich vorsichtig. Wenn er offensichtlich auch kein rücksichtsloser Großwildjäger war, so doch ein Mann. Als Biologe, erzählte er mir, seien die Jäger der einfachste Weg für ihn, möglichst nahe an die Flora und Fauna der Wildnis zu kommen, ohne auf eigene Faust losziehen zu müssen. Die Safari bot alles Erforderliche: Verpflegung, Schutz, gute Führer. Einmal bezahlen und der Rest wurde organisiert. Perfekt. Die Einheimischen schienen ihm auch nicht egal zu sein, jedenfalls wollte er alles über unser Leben wissen. Gut, dachte ich, er ist offenbar anders, weshalb ich ihm zunehmend vertraute. Auf mehr wollte ich allerdings nicht eingehen. Irgendwann fragte er mich, was ich eigentlich mit dem wilden Honig meinte.
„Wilde Bienen.“
„Ja, und?“ Er sah mich lächelnd an.
„Als Biologe solltest du wissen, dass sich die afrikanische Biene zu verteidigen weiß, aggressiver als andere ist und schneller zusticht. Das kann gefährlich werden.“
„Ah, verstehe.“
Noch am selben Abend stand er vor meinem Zelt und rief leise meinen Namen. Ich verzögerte extra meine Reaktion, weil ich mich dem Lockruf nicht sofort ergeben wollte. Doch als ich endlich raus ging, war er verschwunden. Vor dem Eingang lag ein in Blätter gewickeltes Paket aus Baumrinde. Ich roch sofort den Honig und musste mir meine Überraschung und Verblüffung eingestehen. Wilder Honig ist für Ungeübte schwer zu finden, aber noch schwerer zu ernten. Nicht umsonst gebrauchte ich den Spruch gegen ungewollte Freier. Selbst die Männer unseres Volkes mit weitaus mehr Erfahrung, Wissen und Geschicklichkeit als jeder Weiße bezahlen die Beute oft teuer. Nicht nur deshalb galt der Honig wilder Bienen bei der Brautwerbung als Bekenntnis großer Liebe. Wer sich derart in Gefahr begab, musste wahrlich lieben, denn die Stiche der Bienen konnten tödlich enden.
Gegen Mitternacht später stand ich im Mondschatten vor seinem Zelt. Schmuck und Bemalung hatte ich abgelegt. Der leichte Wind jagte ein paar Wolkenfetzen über die goldene Scheibe am Firmament. Rhythmisches Zirpen der Zikaden ließ die abgekühlte Luft vibrieren. Aus der Ferne waren, kaum hörbar, Trommeln zu vernehmen. Ich imitierte mehrfach einen Vogelruf, den ich ihm beigebracht hatte. Etwas in seinem Zelt bewegte sich, ich hörte Getuschel, bevor der Strahl einer Taschenlampe am Eingang auftauchte. Ich wich zurück ins Dunkel, denn auch der Geruch irritierte mich. Weder Leder noch Tabak, eher Parfüm. Schemenhaft tauchten nacheinander zwei Männergestalten auf. Flüsternd erklärte eine mir bekannte Stimme, welchem Vogel der Ruf gehörte. Dann vernahm ich etwas wie einen Kuss und den gut gemeinten Rat, sich vorsichtig ins eigene Zelt zurück zu schleichen, damit keiner ihr Stelldichein bemerkte.
„Darum also…“, murmelte ich enttäuscht, strich mit einem Finger langsam über meinen nackten Körper und steckte ihn anschließend in den Mund. Vollständig mit wildem Honig bestrichen, konnte ich jetzt zusehen, wie ich ihn am Fluss wieder abwusch, ohne von Krokodilen gefressen zu werden. Eine Zunge würde ihn jedenfalls nicht abschlecken.
ENDE
SKYLINE AVENUE
Oft sitze ich vor der Fensterfront, die sich niemals öffnen lässt, und schaue hinaus. Die hermetisch dichte Doppelverglasung sperrt sämtliche Geräusche aus, auch den Regen, der in Bahnen an der riesigen Scheibe abperlt. Doch anstatt davor geschützt, wäre ich lieber da draußen inmitten der lautlosen Regentropfen und ihrer spürbaren Erinnerung an das wirkliche Leben.
Der Blick von hier oben, hunderte Meter über der Stadt, ist atemberaubend. In den Schluchten der Wolkenkratzer wuseln Myriaden von bunten Ameisenheeren, die sich im Fernglas in einzelne Autos, Bahnen und Menschen auflösen. Schaut man länger zu, sortiert sich das System zu einem gleichförmig pulsierenden Rhythmus, als atme ein lebender Organismus ruhig ein und aus. Ampeln wechseln die Farben, Schatten wandern, Sonnenstrahlen huschen hastig an Glaswänden hoch und wieder runter. Verkehrsströme begegnen sich, laufen nebeneinher, stoppen, verschwinden, tauchen wieder auf. Alles wiederholt sich, ununterbrochen, und folgt einer vorgegebenen Choreographie, in der jeder Wassertropfen, jede Wolke und jedes Blatt seinen angestammten Platz einnimmt. Ein unsichtbarer Dirigent ordnet das Chaos mit einem überirdischen Taktstock. Nichts erscheint sinnlos, jede Bewegung folgt einem Zweck. Dabei spielt es offenbar keine Rolle, ob die beteiligten Elemente unverrückbar fest stehen oder mobil in steter Bewegung sind. Biomasse, Stahl oder Beton. Egal, alles wird im Kontext ausbalancierter Kreisläufe zum gleichberechtigten Bestandteil der Atmung eines unverwundbaren Molochs. Kein höher oder nieder, kein weniger oder mehr. Keine Wertung für nichts. Hektik, Lärm, Abgase und einzelne Geschehnisse verschwimmen von hier oben zu einem entrückt pumpenden Pulsschlag, so wie dem Träumer nicht zwingend anzusehen ist, welchen Albtraum er gerade durchlebt. Das Metronom pendelt zwischen den Extremen und verliert doch weder an Ruhe noch Tempi.