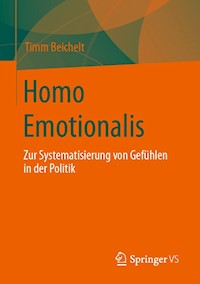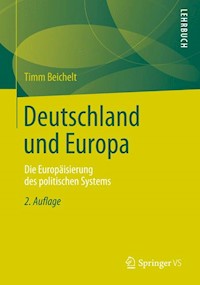17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Vergaben der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 nach Russland und Katar haben erneut gezeigt, dass ein Fußballplatz nie nur ein grünes Rechteck ist, auf dem 22 Spieler einem Ball hinterherjagen. (Profi-)Fußball ist stets zugleich ein Ersatzspielfeld der Politik: Machthaber unterschiedlicher Couleur inszenieren sich, Normen wie Wettbewerbsdenken werden eingeübt, Nationalteams sind ein Indikator dafür, welche Gruppen als zur Nation gehörig betrachtet werden und welche nicht. Anhand von Beispielen aus Deutschland, Frankreich und Russland untersucht Timm Beichelt das Verhältnis von Fußball und Macht. In seinem Essay geht er dabei zugleich der Frage nach, ob das Spiel auch heute noch eine Plattform für Gleichberechtigung, Toleranz und ein authentisches Leben sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Ähnliche
3Timm Beichelt
Ersatzspielfelder
Zum Verhältnis von Fußball und Macht
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Vorwort
1. Einleitung: Fußball als symbolischer Möglichkeitsraum
2. Subjekte im Feld des Fußballs: Präferenzbildung im vorpolitischen Raum
Dauerhafte Wachsamkeit
Unbedingter Wettbewerb
Verinnerlichter Erfolgswillen
3. Politik jenseits politischer Institutionen: Fußball als organisationelles Feld
Fußballpolitik: Das institutionelle Gefüge
Ökonomisches Denken und Öffentlichkeit im Profifußball
Fußball und Staat
Gesellschaftliche Integration
Subventionierung durch Stadionbau
Sicherheit im Stadion
4. Fußballpolitik und Kommerz: Gemeinwohlorientierung des Fußballs auf dem Prüfstand
Vereine und
DFL
: Professionalisierung der Finanzierungsstrukturen
Profitorientierung versus Gemeinnützigkeit beim
DFB
5. Gemeinschaftsbildung durch Fußball: Ein inhärenter Widerspruch?
Gruppen in der Wir-Perspektive: Sportlicher Erfolg, Integration und das Management von Diversität
Wankelmütige Gemeinschaftsbildung: Das Extrembeispiel der französischen Nationalmannschaft
Gruppen als »Andere«: Fußballfans und Gewalt
6. Internationale Fußballpolitik: In fataler Nähe zu autokratischen Regimes und Praktiken
Das Regime der Fifa
Autokratische Akteure und ihre Praktiken im internationalen Fußball
7. Autokratiegestützte Fußballpolitik: Die Verbindung von Fußball, Wirtschaft und Politik in Russland
8. Fazit: Fußball als selektive Heimat
9. Literaturverzeichnis
Wissenschaftliche Publikationen, Dokumente und Monografien
Quellen aus publizistischen Online- und Printmedien
Deutsche und englische Wikipedia-Einträge
Russische Wikipedia-Einträge
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
7Vorwort
»Warum«, fragt Michael Eder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 13. Februar 2018 und damit während der Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang, »ist Olympia in der Krise? Doping, ja. Die alten Korruptionsgeschichten, klar. Die Nähe zu den Autokraten. Die große Koalition mit den Sponsoren, die Geldmacherei, die fehlende Nachhaltigkeit […], die ausufernde Gier, die Überheblichkeit. Es ist eine lange Liste.« In der Tat. Wer aber, gerade im Vorfeld einer Weltmeisterschaft in Russland, auf den Fußball blickt, muss eine andere Frage stellen: Warum ist der Fußball nicht in der Krise? Gewiss nicht wegen der Abwesenheit von Korruption, Autokraten, Sponsoren oder Geldgier. Auch Doping und fehlende Nachhaltigkeit sind dem Fußball vielfach nachgesagt und nachgewiesen worden.
Was unterscheidet also den nach wie vor prosperierenden Fußball von den Olympischen Spielen, die sich offenbar in der Krise befinden? Die Antwort auf diese Frage findet sich nach meinem Ermessen nicht in der viel beschworenen Faszination des Fußballs als Spiel. Sportliche Ästhetik — die »Lobpreisung athletischer Schönheit« (Gumbrecht 2006) — findet sich ebenso in anderen Sportarten, und es ließe sich lange diskutieren, ob nicht der Eiskunstlauf anmutiger ist, die olympischen Snowboard-Wettbewerbe athletischer sind und das Eishockey einem authentischeren Männlichkeitsideal folgt als der Fußball.
Ich vertrete in diesem Buch dagegen eine soziologische These: In Deutschland besteht der Unterschied zwischen 8dem (professionellen Männer-)Fußball und (fast) allen anderen Sportarten darin, dass die Akteure, die sich im Feld des Fußballs bewegen, über hinreichende Macht verfügen, um die eigene Position im gesellschaftlichen Gefüge abzusichern. Diese Macht ist nicht politisch in einem engen, institutionellen Sinn. Vielmehr speist sie sich aus sozialen Quellen, ist symbolischer, diskursiver und natürlich nicht zuletzt materieller Natur. Damit ergeben sich Konsequenzen für all jene Subjekte, die nicht dem unmittelbaren Feld des Fußballs angehören. Diskurse und Symbole aus der Welt des Fußballs gewinnen auch in der weiteren Gesellschaft an Relevanz, dort umgesetzte Geschäfte berühren die Gesamtwirtschaft, und zwar in erheblichem Maße.
Selbst wenn die Machtquellen des Männerfußballs keinen politischen Charakter aufweisen, so kommen politische Akteure nicht umhin, sich mit den gesellschaftlichen Konsequenzen des Fußballs auseinanderzusetzen: Je größer seine gesellschaftliche Relevanz, desto größer ist der Bedarf an fußballbezogener Politik. Politisch legitimierte Machthaber treten dann in Beziehung zu Machthabern im Fußball, die ihre Machtansprüche mit symbolischen und materiellen Ressourcen begründen. Von diesem Herrschaftsgeflecht, das unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche betrifft und zu einem guten Teil transnational organisiert ist, handelt das vorliegende Buch. Dabei gilt mein Hauptinteresse dem deutschen Fußball, es finden sich aber auch Kapitel zum Machtgeflecht des Fußballs auf internationaler Ebene, zur politischen Funktion der französischen Nationalmannschaft und zur Verankerung des russischen Fußballs in der Politik des Landes.
Die in diesem Buch vorgenommene Fokussierung auf den Männerfußball soll nicht als Abwertung des profes9sionellen Frauenfußballs verstanden werden. Vielmehr trage ich damit der Tatsache Rechnung, dass sich die im Laufe des Buches angesprochenen Herrschaftsverflechtungen, ein wesentlicher Teil der einschlägigen Literatur sowie die öffentliche Wahrnehmung des Sports vor allem auf den Männerfußball konzentrieren. Inwieweit sich analoge Praktiken auch im Frauenfußball wiederfinden und welche Interaktionen zwischen beiden Sphären bestehen, wäre Gegenstand einer eigenen Arbeit.
Was politische und ökonomische Herrschaft angeht, so sind sich (in Demokratien) die meisten Beobachter einig, dass sie kontrolliert werden müssen. Die Einhegung politischer Machthaber geschieht durch Gegengewalten, z. B. durch politische Opposition, Gerichte oder Medien. Ebenso gehört ökonomische Macht begrenzt, jedenfalls wenn man den meisten satisfaktionsfähigen Denkschulen folgt. Kartellbehörden, der Steuer- und auch der Wohlfahrtsstaat sind Instrumente, die einer Konzentration wirtschaftlicher Macht entgegenwirken oder wenigstens entgegenwirken sollen. Es herrscht zwar wenig Übereinstimmung hinsichtlich der Frage, wie gut dies gelingt. Aber dass ungebremste wirtschaftliche Macht negative Effekte auf das Gemeinwohl hat, ist spätestens seit der letzten globalen Finanzkrise kaum noch strittig.
Doch wie verhält es sich mit diskursiver und symbolischer Macht? Gilt auch für sie, dass ihre Träger kontrolliert und zurückgedrängt gehören? Eindeutige Haltungen gibt es hier nur punktuell. In Demokratien, so die Position der liberalen Demokratietheorie, habe generell das Primat der freien Rede zu gelten. Die kritische Diskurstheorie wendet dagegen ein, ein Übermaß an »Äquivalenzen«, d. h. gleichgerichteten Interessen und Forde10rungen, könne zu hegemonialen Zuständen führen, in dem sich einzelne »Essenzialitäten« (Standpunkte) durchsetzen und zu einer Hegemonialkonstellation führen, die sodann die politische und soziale Gleichheit gefährden (Laclau/Mouffe 1985).
Auch wenn es vielleicht zu weit greift, dem Diskurs des Fußballs eine hegemoniale Rolle zuzuschreiben, so sind seine antiegalitären Tendenzen deutlich zu erkennen. In kaum einem anderen gesellschaftlichen Bereich geht es so häufig wie hier darum, die gegnerische Mannschaft zu besiegen — gewinnen kann eben nur einer. Kritiker einzelner Praktiken des Fußballs werden ausgegrenzt und als systemische Störenfriede hingestellt. Doping, das die Gleichheit der sportlichen Voraussetzungen kategorisch infrage stellt, wird systematisch totgeschwiegen. Und Weltmeisterschaften werden an Orte mit dem größten wirtschaftlichen Potenzial und nicht an Orte mit der größtmöglichen politischen Gleichheit vergeben. Das Potenzial für eine umfassende Kritik des Fußballs existiert zweifellos.
In dieses Bild passt eine weitere Eigenschaft des Fußballs, die sich auch auf das vorliegende Buch ausgewirkt hat. Die (sozialen, diskursiven, materiellen) Machthaber im Feld des Fußballs schotten sich in einem Maße von außenstehenden Beobachtern ab, das ich zu Beginn meiner Arbeit nicht für möglich gehalten hätte. Auf fast alle meine Rechercheanfragen an Vereine oder Verbände erhielt ich die Antwort, wissenschaftliche Anliegen könne man aus Kapazitätsgründen leider nicht berücksichtigen — auf die restlichen erhielt ich gar keine Reaktion. Deshalb stütze ich mich im Verlauf des Buches häufig auf Quellen, die normalerweise vor der innerwissenschaftlichen Qualitätskontrolle nicht bestehen. Renommierte deutsche Me11dien wie DerSpiegel, Frankfurter Allgemeine oder Süddeutsche Zeitung waren noch das geringere Problem, da hier redaktionsinterne Mechanismen zur Qualitätssicherung unterstellt werden können; Gleiches gilt für die herangezogenen Internetauftritte von ARD (tagesschau.de) und ZDF (zdf.de/sport). Weniger eindeutig ist dies bei privat betriebenen Internetseiten, noch problematischer bei internationalen Foren, die kein Impressum besitzen. Wikipedia — das wegen der Vielzahl der Einträge für mich unverzichtbar war — habe ich immer in mehreren Sprachversionen genutzt und die konkreten Stellen im Text sowie in einer eigenen Bibliografie markiert. Obwohl ich mich um größtmögliche Sorgfalt bemüht habe, kann ich an vielen Stellen letztlich nur hoffen, dass ich nicht auf unzutreffende oder veraltete Informationen zurückgegriffen habe.
Bei den Recherchen, und nicht nur hier, waren eine Reihe von Personen behilflich, denen ich an dieser Stelle herzlich danken möchte. Manuel Normann hat mit großer Umsicht eine Vielzahl an editorischen Aufgaben übernommen. Piotr Franz hat Recherchen insbesondere zum russischen Fußball unternommen und ist in manchem Geschäftsbericht auf empirische Daten gestoßen, die einen Verzicht auf unsicherere Quellen möglich machten. Martin Schewe war mir bei der Bewertung der wirtschaftlichen Aktivitäten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) behilflich. Matthias Rebentisch hat mich über die Kompetenzgrenzen von Polizei und Staatsanwaltschaft in (privat betriebenen) Fußballstadien aufgeklärt. Obgleich mir alle Genannten meine Fragen erschöpfend beantwortet haben, werden sich inhaltliche Fehler und Ungenauigkeiten eingeschlichen haben. Für diese bin allein ich verantwort12lich. Danken möchte ich auch Heinrich Geiselberger und besonders Christian Heilbronn, die mich beim Suhrkamp Verlag exzellent betreut haben.
Frankfurt (Oder), im Februar 2018
131. Einleitung: Fußball als symbolischer Möglichkeitsraum
Das Wort »хозяин« (»Chozjain«) findet sich auf den Seiten der Onlineenzyklopädie Wikipedia, die in immerhin 295 Sprachen existiert, nur auf Russisch.[1] Es entstammt der russischen Wirtschaftskultur und bezeichnet einen Eigentümer oder Verwalter von Produktionsmitteln, der sich durch eine Reihe von Eigenschaften auszeichnet: eine ausgeprägte Urteilskraft, Pragmatismus, Sorge um Untergebene und eine ethische Lebensführung. Der Begriff entstand im agrarisch geprägten Russland zu Zeiten der Leibeigenschaft, erfuhr aber in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts durch Vordenker des Eurasianismus wie Nikolaj S. Trubeckoj und Pjotr N. Savickij eine Umdeutung. Diese entwickelten das Idealbild der Ideokratie, in der »Mitglieder einer führenden Schicht durch eine gemeinsame Weltanschauung, eine gemeinsame Gesinnung miteinander verbunden« sind (Trubeckoj 2005, S. 280). Savickij prägte den Begriff der Chozjainsherrschaft (хозяйнодержавие), in der eine fürsorgliche Machtausübung durch den Chozjain auch eine politische Dimension erhielt (Savickij 1925). Savickij sah in ihr eine Herrschaftsordnung, der eine spirituelle Berufung eigen und die deshalb jenseits kapitalistischer und sozialistischer Muster 14angesiedelt war. Die nach einem organischen Prinzip strukturierten Gemeinschaften scharten sich um die Person eines Machthabers, der die Produktivität einer Gemeinschaft auch jenseits des reinen Gewinnstrebens zu sichern hatte.
Während die Idee der Chozjainsherrschaft zu sowjetischen Zeiten unter Durchsetzungsschwierigkeiten litt, lebte sie ab der Perestrojka in einer neuen Variante auf. Nach dem Terror der Stalin-Jahre, der Stagnation unter Breschnew und der Zeit der Wirren unter Gorbatschow und Jelzin bestand in Russland und seiner Nachbarschaft ein erheblicher Bedarf an Stabilität. Gefunden wurde sie in den postsowjetischen Staaten, abgesehen von denen des Baltikums, in autokratischen Regimes mit vermeintlich starken Führerpersönlichkeiten. Auf der Suchmaschine Google ergibt die kombinierte Suche nach »Chozjain« und »Putin«, »Lukašenko« oder »Kadyrov« jeweils über 400 000 Treffer, wenn man die Begriffe in kyrillischer Schrift eingibt.
Konkret repräsentieren die Präsidenten Russlands, Weißrusslands sowie Tschetscheniens nur bedingt die Dimension der Fürsorge; eher stehen sie wohl für rücksichtslose Machtausübung. Aber noch heute wird in Russland und seiner nahen Umgebung das Idealbild eines durchsetzungsfähigen Mannes gepflegt, der mit repressiven Methoden das Primat der Gemeinschaft gegen die freie Gesellschaft durchsetzt, dabei politische und wirtschaftliche Ressourcen bündelt und so die Machtansprüche verschiedener Elitengruppen gegeneinander austariert. Das im Westen verbreitete Bild der korrupten und repressiven Machtapparate in Osteuropa ist zwar nicht falsch. Es ist jedoch zu ergänzen um eine Vorstellung von Herrschaft, die auf Tugenden wie individueller Tatkraft und Gemein15schaftsorientierung beruht. Diese wiederum korrespondieren mit einer idealisierten Welt, wie sie der russisch-eurasische Konservatismus entworfen hat und bis heute entwirft.
Daher überrascht es nicht, dass sich Putin, Lukašenko und Kadyrov zu Zwecken der Imagepflege häufig als Herrscher inszenieren, die sich für Sport interessieren und ihn aktiv betreiben. Putin tritt als Judoka und Eishockeyspieler an, Lukašenko spielt ebenfalls Eishockey, Kadyrov läuft im Fußballtrikot auf. Ein guter Teil der westlichen Berichterstattung macht sich darüber lustig, dass russische Medien ernsthaft über die sportlichen Hobbys ihrer politischen Führer berichten. Vor dem Hintergrund des Spannungsfelds, das im russischen Kulturraum zwischen dem idealisierten und dem realen Chozjain existiert, erscheint die Angelegenheit indes in einem differenzierteren Licht. Im Feld des Sports lässt sich an die ehrenhaften Bestandteile der Chozjainsherrschaft appellieren, die auch im Bewusstsein osteuropäischer Journalisten in einem Kontrast zur Rücksichtslosigkeit und Bereicherung stehen, die die Politik im postsowjetischen Raum so häufig prägt.
Warum aber ist es der Sport und oft genug der Fußball, in dessen Nähe sich autoritäre Herrschergestalten begeben? Geht es beim Schlüpfen ins Sporttrikot darum, sich beim Publikum durch vermeintliche (oder echte) Sportlichkeit anzubiedern? Ist die Beteiligung an »Freundschaftsspielen« mit Prominenten ein Ritual, bei dem Gleichgesinnten und Günstlingen auf subtile Weise eine Gelegenheit zur Subordination gegeben wird? Soll mit sportlichen Großveranstaltungen die innere und äußere Macht gesichert werden?
16Diese Motive von sportnahen Politikern werden auf den kommenden Seiten diskutiert, wobei keineswegs nur der postsowjetische Herrschaftsraum zu berücksichtigen ist. Nicht nur in Russland und Umgebung, sondern weit darüber hinaus hat in den letzten beiden Jahrzehnten ein Politikertypus an Bedeutung gewonnen, bei dem sich eine latent autoritäre Weltsicht, ethnisch-nativistische Anwandlungen und ein prinzipienloser Pragmatismus miteinander verbinden. Jenseits der Betrachtung autoritärer Herrschaftsräume stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Fußball und Macht gerade dort, wo Fußballpolitik und die Partikularinteressen fußballpolitischer Akteure mit demokratischen Normen in Konflikt stehen.
Dabei ist kaum zu übersehen, dass der organisierte Sport und wiederum insbesondere der Fußball ein geeignetes Feld für politische Praktiken bieten, die sich jenseits politisch-institutioneller Bahnen entfalten. Zwischen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung des Fußballs und den indirekten und schwachen Zugriffsrechten des Staates besteht sogar eine auffällige Diskrepanz.
Unpolitisch ist der Fußball dennoch beileibe nicht. Manchmal wird ihm ein emanzipatorisches Potenzial zugeschrieben. Im Sinne einer Graswurzelbewegung seien mit dem Fußball verbundene Praktiken geeignet, gesellschaftliche Diskriminierung und die Ökonomisierung der Lebenswelt zurückzudrängen (vgl. Kuhn 2011). Einige Gegebenheiten aus der Geschichte des Fußballs dienen gar als Belege für gesellschaftliche Auflehnung gegen autoritäre Machthaber. Ein wiederkehrendes Beispiel ist der leise Widerstand einiger — aber bei Weitem nicht aller — Protagonisten des argentinischen Fußballs gegen das 17Militärregime in den späten siebziger Jahren (Alabarces 2010). Dem Sport wird eine wichtige Rolle bei der symbolischen Gleichstellung der Geschlechter zugeschrieben (Markovits/Rensmann 2010, Kap. 4), und er kann in geteilten Gesellschaften konfliktmindernd wirken (Sugden/Haasner 2010).
Trotz dieser wichtigen Beispiele sehen viele Beobachter den Fußball indes eher nicht als einen Bereich, der auf politischer Ebene Werten wie Gleichberechtigung, Toleranz oder generell einem authentischen Leben zum Durchbruch verhilft. Dafür ist der professionelle Fußball zu sehr von Kommerz geprägt, gibt es zu viele Beispiele für politische Kumpanei mit autoritären Machthabern. Trotz aufwändiger Kampagnen gelten Stadien bis heute als Orte von Homophobie und vielfach auch von Gewalt. Mit der Ausrichtung auf Profit und aufgrund vieler informeller und häufig intransparenter Machtstrukturen, die nur schwer kontrollierbar sind, hat der organisierte Profisport ein Geschäftsmodell geschaffen, das mit den Mustern autokratischer Herrschaft kompatibel ist.
Wenn sich die Kreise des professionellen Sports und der politischen Machtausübung begegnen, ergibt sich also ein wenig klares Bild. Auf der einen Seite finden wir den Sport als zunächst politikferne kulturelle Praxis, auf der anderen die Instrumentalisierung durch politische Akteure; hier produktive gemeinschaftliche Kräfte mit identitätsbildender Funktion, dort Ausgrenzung und Exklusion. Einerseits wird die Integrationskraft des Sports für das Gemeinwesen beschworen, andererseits der Sport für sein Potenzial verdammt, gesellschaftliche und politische Konflikte zum Ausbruch kommen zu lassen. Wie ist dem Wirrwarr an empirischen Beobachtungen und 18normativen Aussagen beizukommen? Das ist die diesem Essay zugrunde liegende Frage. Sein Ziel besteht darin, die widersprüchlichen Phänomene der zeitgenössischen Fußballpolitik in einen Zusammenhang zu setzen.
Fußball wird dabei in mehrfacher Weise als Ersatzspielfeld — wie es im Titel heißt — angesehen. Diese Metapher findet sich unter anderem in der 2013 erschienenen Geschichte der Fußballbundesliga von Nils Havemann. Ähnlich wie im vorliegenden Text wird dort das Ersatzspielfeld zu einem Ort, »auf dem in einer für die Massen leicht zugänglichen Form zentrale politische, wirtschaftliche und soziale Konflikte ausgefochten werden können« (Havemann 2013, S. 15). Ich verwende den Begriff allerdings im Gegensatz zu Havemann mit explizitem Bezug auf das Konzept des »Felds« von Pierre Bourdieu. Das Fußballfeld umfasst und verweist auf verschiedene Arenen, in denen Sportpolitiker, Vereins- und Verbandsrepräsentanten, Journalisten und auch Fans miteinander agieren (siehe unten). Fußball ist demzufolge als abgegrenztes »Feld« zu verstehen, in dem spezifische Regeln und Normen mit einer gesamtgesellschaftlichen Dimension existieren. Fußball stellt (auch) für Nichtfußballer einen Möglichkeitsraum für soziales Handeln dar. Darüber hinaus fungiert er als Projektionsfläche für gesellschaftliche Deutungen, die nicht primär etwas mit dem Sport zu tun haben müssen.
Eine der Kernthesen der sozialtheoretischen Fußballforschung lautet, dass der Sport der Gesellschaft eine Möglichkeit bietet, etablierte Regeln zu durchbrechen und Konventionen spielerisch infrage zu stellen. Fußball führt den Zufall in ein überreguliertes Leben ein und hält auf 19diese Weise Praktiken bereit, um herrschende Kultur alternativ zu gestalten (Gebauer 2016). Mit dieser Perspektive wird dem Sport eine entlastende Funktion zugeschrieben. Ganz gleich, ob wir Fußball mit oder ohne Verbindung zu Fragen der politischen Macht denken, können wir davon ausgehen, dass durch Sport und Spiel das Austragen gesellschaftlicher Konflikte sublimiert wird.
Das Aufeinandertreffen der Mannschaften der Bundesrepublik und der DDR während der Weltmeisterschaft 1974 wurde ebenso als Gradmesser des Systemkonflikts angesehen wie die durchaus nicht seltenen Partien in verschiedenen Europapokal-Wettbewerben. Während die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine nicht abebben, koexistieren russische und ukrainische Mannschaften unter dem Dach des Weltfußballverbandes Fifa und des europäischen Fußballverbandes Uefa weiterhin nebeneinander. Wo in spätmodernen Dienstleistungsgesellschaften viele Milieus faktisch voneinander segregiert sind, begegnet sich eine klassenlose Fangemeinschaft im Stadion oder beim Public Viewing.
Diese Überlegungen knüpfen an die Thesen von Johan Huizinga an, der in seinem 1938 erschienenen Buch Homo Ludens auf den Charakter des Spiels als »Kulturfaktor« hinwies. Der große niederländische Kulturhistoriker hatte auf die enge Verbindung des Kulturlebens mit Mythos, Kult und damit spielerischem Handeln hingewiesen: »Kultur in ihren ursprünglichen Phasen wird gespielt. Sie entspringt nicht aus Spiel, wie eine lebende Frucht sich von ihrem Mutterleibe löst, sie entfaltet sich in Spiel und als Spiel« (Huizinga 2004 [1938], S. 189, Hervorhebungen im Original). Auf dieser Grundlage entwickelt Huizinga 20ein Tableau, mit dem sich verschiedene Spielelemente in der modernen Kultur identifizieren lassen: im Geschäftsleben, in der modernen Kunst, in der Wissenschaft, in der Politik und im Krieg. In allen diesen Sphären sind Spielelemente »unentbehrlich«, um die im menschlichen Leben angelegte Dualität zwischen Ernst und Spaß, zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Abgeschlossenheit und Ordnung zu überbrücken. Das Spiel ermöglicht soziales Lernen, indem es eine Sphäre jenseits des »gewöhnlichen Lebens« öffnet. Das Spiel »steht außerhalb des Prozesses der unmittelbaren Befriedigung von Notwendigkeiten und Begierden, ja es unterbricht diesen Prozess« (ebd., S. 17). Durch diese Eigenschaften können im Spiel gesellschaftliche Konflikte stellvertretend ausgetragen und unterdrückte Emotionen ersatzweise auf einem begrenzten Spielfeld ausgelebt werden.
Nun ist allerdings strittig, ob der moderne Sport und erst recht der hochprofessionalisierte Fußball überhaupt noch der Sphäre des Spiels zugeordnet werden dürfen. Huizinga diagnostizierte schon in den dreißiger Jahren, dass im Sport das Spiel immer ernster aufgefasst werde und daher jenen spielerischen Charakter einbüße, der ihn in früheren Epochen ausgezeichnet hatte (ebd., S. 213). Damit führte er schon früh eine Klage ein, die heute jedes Fanforum durchzieht und im Grunde einen Konsens in der fanorientierten Öffentlichkeit darstellt. In Deutschland kann die Redaktion des Magazins 11Freunde als wichtige Vertreterin dieser Position gelten. Chefredakteur Philipp Köster schreibt z. B. in seiner monatlichen Kolumne »Rot wegen Meckerns« gegen Kommerzialisierung und Fußballfunktionäre sowie ganz allgemein gegen den Ausverkauf des Fußballs an. Dieser gehe mit der 21Entfremdung von der Basis einher: dem Amateurfußball und einer Fankultur, die Fußball mit Spiel und Leichtigkeit verbindet (einschlägig auch Rasch 2014; Plitt 2017).
Der Klage, der moderne Sport beinhalte zu viel Ernst und zu wenig Spiel, ist wenig entgegenzusetzen. Wer wollte schon leugnen, dass im zeitgenössischen Fußball alles auf unbedingten Erfolg ausgerichtet ist? Huizinga zieht aus der zutreffenden Diagnose indes nicht den Schluss, dass man die spielerische Wurzel des Sports vollkommen vernachlässigen könne. Vielmehr spricht er von einer »verwirrenden Unauflösbarkeit des Problems Spiel oder Ernst«. Die Kultur, die »in edlem Spiel gegründet ist«, kenne auch Spielregeln, die in der Politik oder selbst im Krieg »dem primitiven Spiel um Prestige Form und Inhalt« gebe. In der Politik seien daher Praktiken wie »das Herausfordern und Aufreizen, das Bedrohen und Beschimpfen des Gegners« dem »Banne des Spiels« zuzurechnen. Die Verbindung von Kultur, Politik und Spiel setze mithin »eine gewisse Selbstbeschränkung und Selbstbeherrschung voraus, eine gewisse Fähigkeit, in ihren eigenen Tendenzen nicht das Äußerste und Höchste zu sehen«. Kultur wolle »noch immer in einem gewissen Sinn in gegenseitigem Einverständnis nach Regeln gespielt werden« (Zitate ebd., S. 227-229). Eine strikte Trennung von Ernst und Spiel, mithin eine Art Rückverschiebung des Fußballs in die Sphäre des reinen Spiels, so könnte man Huizingas Gedanken auf den modernen Fußball anwenden, würde diesem seine gesellschaftliche Bedeutung nehmen. Der Fußball würde die Fähigkeit einbüßen, über sich selbst hinaus auf die Geltung (und Nichtgeltung) gesellschaftlicher Regeln zu verweisen.
22Und so ist der moderne Fußball für uns gerade deshalb interessant, weil er dort über die Grenzen der sittlichen Normen etwas aussagen kann, wo er die Sphäre des Überflüssigen verlässt und in der Gesellschaft Spuren hinterlässt. Dazu nur ein Beispiel: Das Magazin 11Freunde veröffentlicht eine monatliche Rubrik mit Bildern und Text, in der sich Amateurfußballmannschaften aus der »Kreisliga B« präsentieren. Dargestellt werden genau solche Praktiken, die sich von der Kommerzialisierung und Erfolgsorientierung des Profifußballs dezidiert abheben. Ihre Relevanz gewinnen die Praktiken allerdings durch ebendiesen Kontrast — ohne ihn verlöre die Rubrik für die allermeisten Leser ihren Reiz.
Doch wie sind der Sport und die Gesellschaft miteinander verbunden, und wie spielen Politik und Macht in dieses Wechselverhältnis hinein? Ein konventionell politikwissenschaftlicher Politikbegriff scheint nicht besonders geeignet zu sein, um die im Fußball relevanten Aspekte von Machtausübung zu erfassen. Staatliche Akteure, etwa in Regierungen oder Parlamenten, spielen nur eine begrenzte Rolle bei der Lenkung des Fußballs. Das liegt zum einen an der Autonomie des Sports, die in demokratischen Gesellschaften aus der Vereinigungsfreiheit abgeleitet wird und ein Verfolgen privater Ziele zulässt und unter Schutz stellt — auch solche, die nicht mit den Zielen des Staates übereinstimmen.
Zum anderen agieren zentrale Machtinstanzen des Fußballs, z. B. die Fifa oder die Uefa, in einem transnationalen Kontext. Welchen politischen Setzungen und welchen Rechtsordnungen sich der organisierte Fußball zu unterwerfen hat, ist keineswegs ausgemacht. Die Verbände sind laut ihren Satzungen nur sehr eingeschränkt dem All23gemeinwohl verpflichtet[2] und bewegen sich — wohl bewusst — in der Grauzone zwischen eingetragenem Verein und unternehmerischen Zielen. Damit ist ihr Handeln seitens politisch gewählter Akteure nur unter Mühen beeinflussbar. Politische Steuerung kann im Kontext des transnationalen Fußballs nur in einem recht eingeschränkten Maße stattfinden.
Dennoch wäre es vollkommen verfehlt, den Fußball und seine gesellschaftlichen Auswirkungen als politik- oder machtfernen Raum zu verstehen. Wenn man Politik als »autoritative Verteilung von materiellen und immateriellen Werten in der Gesellschaft« versteht (Easton 1965, S. 50), dann ist ganz offensichtlich, dass zu den immateriellen Werten gemeinschaftsbezogene Sentimente hinzugezählt werden müssen. Und in der Tat existiert eine einschlägige Forschung, die einen — wenn auch eher kurzfristigen — Zusammenhang zwischen Erfolgen im Fußball und kollektivem Glücksempfinden herstellt. Es strahlt positiv auf das Selbstwertgefühl aus, als Gastgeberland eines Sportgroßereignisses aufzutreten (Kavetsos 2012). Dieses statistisch signifikante Ergebnis geht einher mit der anekdotischen Beobachtung, dass fußballerische Erfolge 24wie das »Wunder von Bern« (1954), das »Sommermärchen« (2006) oder der französische WM-Titel 1998 zu Wellen der gesellschaftlichen Euphorie geführt haben. Auf einer analogen empirischen Basis hat bereits vor einigen Jahren Norbert Seitz auf auffällige Parallelen zwischen sportlichen Erfolgen und politischen Entwicklungen hingewiesen (Seitz 1997).
Fußball ist also für das gesellschaftliche Selbstverständnis in einem politischen Sinne relevant. Zugleich eignen sich etablierte Ansätze aus der Government- oder Governance-Forschung nicht gut, um einen Bereich zu beleuchten, der sich relativ fern der etablierten politischen Institutionen selbst reguliert. Daher ziehe ich zur weiteren Analyse der politischen Belange des Fußballs den Feldansatz von Pierre Bourdieu heran. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass politische Subjekte nicht primär über eine gegebene Institutionenordnung erfasst, sondern im Hinblick auf Konflikte in einer beliebig strukturierten Gesellschaftsordnung betrachtet werden. »Felder« werden dann als »Arenen der Produktion, Zirkulation, der Aneignung von Gütern, Dienstleistungen, Wissen und Status« angesehen, in denen Akteure verschiedene Arten von Kapital akkumulieren oder monopolisieren (Swartz 2013, S. 35).
Im Feld des Fußballs, von dem ich also fortan in Anlehnung an Bourdieu sprechen werde, lassen sich die wichtigsten Arten von Kapital in geradezu mustergültiger Art nebeneinander finden.[3] Über ökonomisches Kapital 25verfügen etwa Vereine, Sponsoren und Verbände. Man muss hier nicht einmal an staatseigene Fonds denken, die bei europäischen Top-Klubs einsteigen. Noch der Marktwert des »ärmsten« Bundesliga-Teams bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich. Auch kulturelles Kapital, das bei Bourdieu an Bildung und Ausbildung gekoppelt ist (Bourdieu 1982, S. 143-167), hat in den letzten Jahrzehnten über Jugendausbildung und eine allgemeine Professionalisierung Einzug in den Fußball erhalten. So gilt es in Deutschland als große Ausnahme, wenn ein Nationalspieler nicht vorher das Ausbildungssystem eines Bundesliga-Vereins oder des DFB durchlaufen hat — der letzte Fall war wohl Miroslav Klose.
Spieler und Trainer als Stars, wichtige Stadien und Fußballstädte verfügen über geballtes soziales Kapital, das auf viele Fans oder Zuschauer faszinierende Wirkung ausübt. Man denke an die Selbstverständlichkeit, mit der die deutsche Nationalmannschaft im November 2016 — anlässlich eines Testspiels gegen Italien in Rom — von Papst Franziskus zur Audienz empfangen wurde (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. 11. 2016, S. 32). Sieben der zehn beliebtesten Twitter-Profile in Deutschland haben einen unmittelbaren Bezug zu Fußball.[4] Fußballer oder 26Fußballvereine gehören zu den Spitzenreitern bei Facebook-Profilen: Cristiano Ronaldo (ca. 120 Millionen Fans), Real Madrid und der FC Barcelona (jeweils ca. 100 Millionen Fans) nehmen obere Plätze ein (Statista 2017d). Die neun beliebtesten Facebook-Profile in Deutschland haben allesamt Fußballbezug (Daten siehe Statista 2017b). Nicht zu vergessen: Selbst in ungeraden Jahren, also in Jahren ohne WM- oder EM-Endrunde (der Männer), ist es seit 2008 immer ein Fußballspiel gewesen, das die höchste Einschaltquote im deutschen Fernsehen aufwies. Und im Jahr 2011 stellte das Viertelfinale der Frauen-Weltmeisterschaft (Deutschland gegen Japan, 0:1) mit 17,01 Millionen Zuschauern den Jahresrekord auf (Wikipedia DE 2018i).[5]
Natürlich lässt sich aus diesen Zahlen kein politischer Einfluss in direktem Sinne ableiten. Dennoch wird deutlich, dass Fußball für den immateriellen Wertehaushalt des öffentlichen Lebens eine große Rolle spielen kann. Dies gilt, wenn wir bei Bourdieu bleiben, insbesondere wegen der vielleicht einzigartigen Fähigkeit des Fußballs, ökonomisches und soziales Kapital zu akkumulieren und in symbolisches Kapital umzuwandeln — also die einzelnen Kapitalarten zu gesellschaftlicher Anerkennung und sozialer Macht zu verdichten und so allgemeine gesellschaftliche Reputation zu gewinnen (Bourdieu/Passeron 1973; Bourdieu 1998).
Dieses gesellschaftliche Prestige lässt sich nun politisch 27nutzen. Erneut erscheint der Ansatz von Bourdieu vielversprechend. In seinen Schriften zur Analyse politischer Machtausübung orientiert er sich nicht an einem festen institutionellen Gefüge, sondern untersucht diskursive Praktiken in spezifischen Feldern. Politik findet dann statt, wenn Akteure eine bestehende soziale Ordnung herausfordern oder handelnd hinterfragen (Bourdieu 2013a [1981], S. 11-12). Der zunächst unspezifische Charakter dieser Aussage über den Kreis politischer Akteure wird zu einem Vorteil, wenn wir uns in einem diffusen und im Prinzip »politikfernen« Feld bewegen. Dies ist in der Fußballpolitik der Fall. Viele Akteure, die allgemeine Regeln hinsichtlich der Verteilung materieller und immaterieller Werte setzen, befinden sich keineswegs aufgrund politischer Selektionskriterien in ihren Positionen. Dazu gehören beispielsweise Fußballmanager oder Journalisten, die mit ökonomischem und symbolischem, nicht jedoch mit politischem Kapital ausgestattet sind.
Gleichzeitig ist das Feld des Fußballs einerseits einigermaßen fest umrissen, andererseits in seinen immateriellen Bezügen sehr variabel. Zur Fußballpolitik gehört ein vergleichsweise enger Kreis juristischer Regeln, z. B. im Wettbewerbsrecht, bei der Sportförderung oder bei der Dopingprävention. Durch seine große gesellschaftliche Bedeutung sind aber auch Bereiche wie Fußballberichterstattung in den Medien (z. B. wegen des gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks), die Bekämpfung gesellschaftlicher Gewalt (z. B. beim Umgang mit robusten Fangruppen) oder gesellschaftliche Integration (z. B. wegen der Mitgliedschaft von Nichtdeutschen in Fußballvereinen) politikrelevant. Akteure, die sich mit politischen Intentionen im Feld des Fußballs be28wegen, sind also vielfältig und mit dem Erringen nicht nur politischer Macht, sondern auch mit der Akkumulation von ökonomischem, sozialem oder symbolischem Kapital beschäftigt.
Aber kommen wir zurück zur Figur des Chozjain. Sie findet sich nicht nur in den Regimes der postsowjetischen Politik, sondern ebenfalls im Feld des Fußballs. Jedem, der sich auch nur halbherzig mit Fußball auseinandergesetzt hat, fallen sofort einschlägige Charaktere ein. Unter Silvio Berlusconi hat sich der AC Milan in den neunziger Jahren zu einer der ersten Adressen des europäischen Fußballs entwickelt, was seine in Italien bis heute währende Popularität mit erklärt. Der sowjetisch-ukrainische Trainer Valerij Lobanovskij hat in den achtziger und neunziger Jahren mit Dynamo Kiew nicht nur einen bewunderten und schnell kopierten fußballerischen Stil erfunden, sondern darüber hinaus in alle Geschicke des Vereins eingegriffen. Ähnliches gilt für den Schotten Alex Ferguson bei Manchester United und den Franzosen Arsène Wenger bei Arsenal London, die prägende Figuren der Renaissance des englischen Fußballs seit den späten neunziger Jahren waren. Der Manager und spätere Präsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, dominierte seinen Verein selbst aus dem Gefängnis, wo er zwischen 2014 und 2016 wegen Steuerhinterziehung einsaß. Die Bezeichnung »Chozjain« passt auch auf einige Fußballfunktionäre, z. B. den Brasilianer João Havelange oder den Schweizer Joseph (»Sepp«) Blatter, beides langjährige Präsidenten des Weltfußballverbandes.
Wie schon anhand Chozjains im politischen Raum gezeigt, offenbart auch diese Liste gewisse Abweichungen von der Idealfigur. Nicht nur Uli Hoeneß geriet in Konflikt mit dem Gesetz und musste die Unterordnung unter 29das Rechtssystem zähneknirschend hinnehmen. Havelange und Blatter wurden der Korruption im großen Stil bezichtigt und fielen am Ende ihrer Karrieren deswegen in Ungnade. Silvio Berlusconi entkam der Strafverfolgung durch Flucht nach vorne, indem er sich immer, sobald es eng wurde, zum Abgeordneten oder Ministerpräsidenten wählen ließ und fortan Immunität genoss. Auch seine vermeintlichen Vergehen hatten mit Fußball zu tun, denn die Steuerhinterziehung wurde ihm im Zusammenhang mit Medien angelastet, deren wirtschaftlicher Erfolg sich auf die Ausstrahlungsrechte an Fußballspielen stützte. Andere starke Männer im Fußball, wie etwa der ukrainische Mäzen von Schachtar Donezk, Rinat Achmetov, müssen sich sogar mit Vorwürfen auseinandersetzen, Teil der organisierten Kriminalität zu sein.
Wir können also im Feld der Fußballpolitik eine ganze Ansammlung mächtiger Leitfiguren beobachten, deren gesellschaftliche (und damit symbolische und politische) Macht sich unter anderem daraus ableitet, dass sie mit fußballbezogenen Äußerungen oder Handlungen eine große Resonanz jenseits des Fußballs erzeugen können. Und doch repräsentieren die patrons natürlich nur einen Ausschnitt des Fußballs. Als Vereins- und Mannschaftssport ist dem Fußball eine gewisse Egalität eingeimpft. Das Publikum und insbesondere organisierte Fans hegen oft sogar eine ritualisierte Distanz gegenüber den vermeintlich Allmächtigen des Fußballs. Überhaupt kommen Fans aus ganz unterschiedlichen Milieus, treten in verschiedenen Organisationsgraden und mit unterschiedlichen Motiven auf, womit sie im Prinzip ein Spiegelbild der gesamten Gesellschaft darstellen. Während der professionelle Fußball »von oben« patriarchalisch organisiert 30ist,[6] repräsentiert er »von unten« egalitäre Diversität und Vielgestaltigkeit.
Dieser Gegensatz, der verschiedene Akteure voneinander abgrenzt und sie zugleich aufeinander bezieht, kann als konstitutiv für das Feld des Fußballs angesehen werden. Ohne strikte Hierarchie, ökonomisches Potenzial und sportliches Know-how wird sich kein sportlicher Erfolg einstellen. Würde der professionelle Fußball nicht über (mindestens) diese Kombination von Ressourcen verfügen, verlöre er große Teile seiner Attraktivität. Ohne ein entsprechend interessiertes — mannigfaltiges, großes — Publikum haben Akteure mit ökonomischem Kapital indes kaum über Anreize, Geld und Zeit in größerem Umfang zu investieren.
Aber was sichert den Fortbestand des Kreislaufs? Warum ist gerade der Fußball in Europa und nicht nur in Europa ein so großes Faszinosum? Hierzu verfechte ich im Folgenden die bereits angedeutete These, dass der Fußball die Funktion erfüllt, gegenläufige soziale Lebensformen und Positionen miteinander vereinbar zu machen (Beichelt 2016). Diese bestehen in Lebensweisen, die Individuen bzw. Subjekte in Reaktion auf Anforderungen der Spätmoderne entwickeln bzw. entwickelt haben. Bei (unter anderem) Émile Durkheim, Georg Simmel und Ferdinand Tönnies findet sich die Überlegung der ambivalenten Wirkung der Moderne auf das Subjekt. Industrialisierung, Verstädterung, Verwissenschaftlichung und andere Formen der Rationalisierung der Welt zwingen 31den Einzelnen einerseits, immer neue Herausforderungen annehmen zu müssen, um ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft zu werden oder zu bleiben. Schule und Bildung dienen nicht mehr nur als Grundlage für ein erfülltes Leben, sondern der Vorbereitung auf einen Beruf, dessen erfolgreiche Ausübung gewissermaßen selbstverständlich wird. Im Kontext der Arbeitsteilung erfüllen Individuen mithin ökonomische Funktionen für die Gesamtgesellschaft. Es gehört zu den klassischen Thesen der Soziologie, dass dadurch zusätzliche Erwartungen an das Individuum gerichtet werden, so nehmen z. B. die Anforderungen an Arbeitsbereitschaft und Mobilität zu. Die Individualität des Einzelnen, die in vormodernen Gesellschaften kein zentraler Aspekt war, bildet sich dabei erst heraus; sie wird zur Grundlage des Menschen in der arbeitsteilig organisierten Gesellschaft (Simmel 1890). Sie zu pflegen verlangt Aufmerksamkeit und Selbstbewusstsein.
Die Konsequenzen von Arbeitsteilung und sozialer Differenzierung führen dabei nicht automatisch zu Vereinzelung und Atomisierung. Ganz im Gegenteil können auch Formen der Reziprozität entstehen. Durkheim nennt solche positiven Verpflichtungen auf die Regeln und das Recht der Moderne »organische Solidarität« (Durkheim 1996 [1930]). Durch sie wird gewissermaßen auf indirektem Wege sichergestellt, dass die Gesellschaft als Ganze von den Segnungen einer immer stärker auf Wertschöpfung ausgerichteten Wirtschaft profitieren kann. Die Rationalisierung des menschlichen Lebens führt mithin dazu, dass kollektive Gesellschaftsformen entstehen. Nur so können die neuen Produktionsmittel, die eng mit Handel und kollektivem Vertrauen verbunden sind, effektiv 32genutzt werden. Auf diese Weise stellen Industrialisierung und ökonomische Arbeitsteilung eine zentrale Voraussetzung für die Bildung von Nationalstaaten oder anderen gesellschaftlichen Organisationen dar, die auf Reziprozität und Solidarität beruhen (Deutsch 1953; Greenfeld 1992; Tönnies 2010 [1887]).
Während diese Prozesse einander auf der Makroebene bedingen, bedeuten sie für das Individuum auf der Mikroebene jedoch erhebliche Herausforderungen. Je stärker der Zwang zu ständiger ökonomischer Verfügbarkeit — zu Mobilität, zu Weiterqualifikation und beruflicher Selbstverwirklichung —, desto schwerer wird es, solche Bedingungen zu erfüllen, die mit der Pflege kollektiver bzw. solidarischer Praktiken einhergehen. Gemeinschaftliche Identität, wie sie z. B. in traditionellen Lebensformen wie Familie, Kirchengemeinden, Freundeskreisen oder jeder Form von regelmäßiger Zusammenkunft gefordert ist, lässt sich nun einmal schlecht mit Hypermobilität und Zwang zu ständiger Weiterbildung vereinbaren. Je stärker die Unvereinbarkeit, desto höher die Gefahr von Erschöpfungs- oder Ermüdungszuständen (Ehrenberg 2008). Aber auch ohne pathologische Auswüchse steht außer Frage, dass die gleichzeitige Pflege eines ambitionierten Selbst sowie einer intensiven Gemeinschaftlichkeit nicht nur aufwändig ist, sondern darüber hinaus unterschiedlicher Mittel bedarf, die in Spannung zueinander geraten können.
Meine These lautet nun, dass der Fußball — bzw. die sich im Feld des Fußballs abspielenden Praktiken — dabei hilft, diese auf das Individuum einwirkenden Anforderungen abzufedern. Vor allem bietet er eine Bühne, auf der sich widerstreitende Impulse verarbeitet werden können. Der 33moderne Fußball verfügt einerseits über hohe Qualitäten als Projektionsfläche für Lebenspfade der Selbstverwirklichung. Einzelne Fußballstars — siehe Twitter, Facebook etc. — werden dann in hohem Maße idealisiert, wenn sie Aktivitäten jenseits des Fußballplatzes nachgehen. Cristiano Ronaldo unterhält eigene Mode- und Parfümlinien, die ein bestimmtes Männlichkeitsideal unterstreichen.[7] Lionel Messi, der als Jugendlicher wegen Kleinwüchsigkeit in Behandlung war, unterstützt mit einer eigenen Stiftung schutzbedürftige Kinder und Jugendliche.[8] Der deutsche Nationalspieler Jérôme Boateng entwirft und verkauft edle Brillen, die latent den Kontrast zu seinem Bruder Kevin-Prince Boateng — einem wesentlich rustikaleren Spielertyp — inszenieren.[9] Mesut Özil hatte über die Jahre mehrere Freundinnen, die in der Boulevardpresse keine Unbekannten waren.[10] All dies entfaltet insofern eine Wirkung, als hier Vorbildmodelle für die individuelle Lebensentwicklung insbesondere junger Männer vorgelebt werden. Diese helfen, die fast unvermeidbare Lücke zu füllen, die zwischen der gesellschaftlichen Erwartung an die individuelle Unverkennbarkeit und dem begrenzten Potenzial für tatsächliche Selbstbestimmung besteht.
34Andererseits lassen sich im Fußball natürlich viele Anknüpfungspunkte für die Pflege gemeinschaftlicher Lebenspraktiken finden. Die Organisationsform in Mannschaften, die sich stellvertretend für Städte, Regionen oder Länder miteinander messen und dabei mit spezifischen Identitäten aufeinandertreffen, hält eine reichhaltige Gemeinschaftssymbolik bereit. Zahlreich sind zudem die Praktiken des Fußballs, die an Gemeinschafts- und Solidaritätsgefühle anknüpfen. »Die Mannschaft« ist eine geschützte Marke des Deutschen Fußball-Bundes, der sie mit einer ausgefeilten Werbe- und Kommunikationsstrategie in Szene setzt. Auf der durchaus informativen Homepage[11] wird viel über das alltägliche Leben rund um die Nationalmannschaft mitgeteilt, vom »Team hinter dem Team« über Grafiken zur Spielphilosophie bis hin zu einem Besuch der Sendung mit der Maus in der Umkleidekabine. Der Titel des Magazins 11Freunde ist eine Referenz an den Spruch »Elf Freunde müsst ihr sein«, ein — wohl fälschlicherweise — Sepp Herberger zugeschriebenes Zitat, das dank eines im Jahr 1955 erschienenen Jugendbuches mit demselben Titel Bekanntheit erlangte (Drechsel 2008). Und auch die Fifa setzt mit ihrem seit 2007 verwendeten Slogan »For the Game. For the World« einen Akzent auf soziale Verantwortung und Gemeinschaftlichkeit (vgl. Fifa 2007).
Liebe, Freundschaft und Gemeinschaft stellen mögliche authentische Ziele innerhalb des Fußballfeldes dar. Analog zu den individualistischen Motiven werden sie allerdings vor allem als Projektionen wichtig. Traditionelle 35gemeinschaftliche Instanzen wie etwa Kirche, Familie oder auch kleinere Betriebe stehen bekanntlich seit Jahrzehnten unter Druck. Damit gehen jene Arenen verloren, in die sich Individuen zurückziehen können, wenn sie dem individuellen Verwirklichungszwang entgehen wollen. Hier kann, wie viele Dokumente für die Zuneigung von Fußballfans zu ihren Vereinen belegen, eine Ersatzidentifikation mit vermeintlichen Subjekten des Fußballs entstehen.
Mitunter tritt dieser Zusammenhang ganz offen zutage. So heißt es auf der Homepage von Borussia Dortmund: »Borussia Dortmund empfängt von seinen Fans echte Liebe. Denn der BVB ist, wie sie, tief in der Kultur seiner Heimatstadt Dortmund und der westfälischen Region verwurzelt: geradlinig, ungeschminkt, kämpferisch.«[12] In diesem Sinne ist Fußball als »Hidden Game« (Blutner/Wilkesmann 2008) zu verstehen, das — ganz im Sinne Huizingas — einen Rahmen für den lebensweltlichen Abgleich der Prinzipien des Individualismus und der Gemeinschaftlichkeit bereitstellt. Wenn wir dieser Aussage folgen, verfügt der Fußball mithin über die Funktion, zwei fundamentale Motive menschlichen Verhaltens miteinander vereinbar zu machen: individuelle Selbstverwirklichung sowie das Wohlergehen einer jeweils »nahen« Kollektivität.
Allerdings sollte sogleich betont werden, dass die hier formulierte These weiterer empirischer Unterfütterung bedarf. Welchen Prinzipien genau folgen Fußballakteure — Spieler, Trainer, Sportjournalisten, Fans —, wenn sie individualistische Praktiken in den Mittelpunkt ihres Handelns 36stellen? Wie wird mit den Gegensätzen zwischen individueller Selbstverwirklichung und kollektiver Bindungskraft konkret umgegangen? Und: Rufen überaffirmative Formulierungen wie die eben zitierten nicht sofort einen Abwehrimpuls hervor, und wie wirkt sich dieser auf die Rezeption des Fußballs aus?
In den kommenden Abschnitten werde ich versuchen, auf mehreren Ebenen zu argumentieren, um diese Fragen zu beantworten. Zur Sprache kommen Überlegungen bezüglich politischer Subjekte — also Individuen, die angesichts einer engen Einbettung in die kontextuelle Welt (bzw. in »Kulturen«) nur über begrenzte Freiheitsgrade verfügen, um eigenen Wünschen und Interessen nachzugehen (Reckwitz 2008a). Dies geschieht in Kapitel 2, das sich somit dem kulturellen Kontext widmet, in dem sich Akteure des Fußballs bewegen. Weiterhin soll herausgearbeitet werden, welche Akteure im Feld des Fußballs in einem engeren Sinn zur Regelsetzung fähig und befugt sind — das ist Gegenstand von Kapitel 3. Dort wird näher ausgeführt, dass Politiker kaum über direkte Instrumente verfügen, um die Aktivitäten rund um den Fußball zu beeinflussen. Sie können allerdings Mittel zur »weichen Steuerung« einsetzen, beispielsweise diskursive Praktiken, Argumente und Symbole (vgl. Göhler et al. 2009).
Im anschließenden Kapitel 4 soll herausgearbeitet werden, wie Ökonomisierung und Selbstdisziplinierung den Möglichkeitsraum definieren, in dem sich die Subjekte im Fußball bewegen. Hier zeigt sich, dass die wirtschaftlichen Notwendigkeiten den professionellen Fußball weit von jener gesellschaftlichen Verankerung entfernt haben, die den deutschen Vereinsfußball in früheren Jahrzehnten geprägt haben. Politische Akteure stehen deshalb vor dem Problem, 37dass frühere gemeinwohlorientierte Funktionen des Fußballs von dessen Protagonisten nur noch selektiv erfüllt werden. Im Zuge dieser Entwicklung ist die politische Sphäre zu einem gewissen Grad von ebendem Teil des Fußballs abhängig geworden, der sich eher um Erfolge und Gewinne als um gesellschaftliche Integration kümmern muss.
Kapitel 5 thematisiert die Ebene der Gemeinschaft, die im Fußball in Fan- und Gegenfangemeinden strukturiert ist. Neben der Frage, welche Logiken der Abgrenzung zwischen den verschiedenen Gruppen existieren (und wie die Politik mit ihnen umgeht), wird auch die innere Dynamik von Gemeinschaften untersucht. Dabei demonstriere ich am Beispiel der französischen Nationalmannschaft, wie variabel Urteile über Zugehörigkeit (oder Nichtzugehörigkeit) zu einer Gemeinschaft ausfallen können. Im Anschluss daran wird in Kapitel 6 die Analyse auf die transnationale Ebene erweitert. Im Mittelpunkt stehen dort die politischen und geschäftlichen Praktiken der Fifa. Kapitel 7 thematisiert den russischen Fußball, seine Verflechtung mit der Politik sowie staatseigenen oder staatsnahen Unternehmen.
Der Ausblick (Kap. 8) führt die diversen Fäden der vorherigen Kapitel zusammen. Der Chozjain spielt dabei insofern eine Rolle, als sein Rollenmodell eine attraktive Option bietet, um soziale Kommunikation über Regimeformen sowie über ökonomische und politische Grenzen hinweg zu ermöglichen. Der internationale Fußball, zu dem auch der deutsche gehört, ist in diesem Zusammenhang nicht per se als autokratische Angelegenheit zu charakterisieren. Aufgrund der Einbettung des deutschen Fußballs in einen autokratieaffinen Kontext ist allerdings wenig verwunderlich, dass politische Praktiken hier wie 38dort von Intransparenz und Partizipationsferne gekennzeichnet sind. In gewisser Weise hat die Fußballpolitik daher ein Paralleluniversum errichtet, in dem einige Ideale der Demokratie keine Gültigkeit mehr besitzen.
392. Subjekte im Feld des Fußballs: Präferenzbildung im vorpolitischen Raum
Im Dezember 2013 überraschte der Manager der deutschen Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff, die Öffentlichkeit mit einem ungewöhnlichen Plan. Die Suche nach einer geeigneten Unterkunft während der Weltmeisterschaft in Brasilien im Sommer 2014 habe zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt. Lange Wege innerhalb Brasiliens, die notorische Unsicherheit vieler Städte und die Ruhebedürftigkeit der Spieler zwischen den Partien galten als Faktoren, die für die Wahl des Quartiers relevant waren. Vor diesem Hintergrund entschied sich die Leitung der Nationalmannschaft dafür, am Strand in der Nähe der Kleinstadt Porto Seguro — gut 1200 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro — ein Luxusresort zu beziehen, das sich zu jener Zeit noch im Bau befand. Die Anlage mit 65 Wohneinheiten in 14 zweigeschossigen Häusern sowie Pool und diversen Wellness-Einrichtungen biete »alle Möglichkeiten, die wir uns während des hoffentlich langen Zeitraums bei der WM wünschen« (RP-Online 2013). Offenbar hatte sich trotz intensiver Suche in Brasilien, dem fünftgrößten Land der Erde, kein einziges bereits existierendes Hotel von zufriedenstellender Qualität finden lassen.
Diskutiert wurde die Angelegenheit in Deutschland in unterschiedlichen Phasen. Zunächst wurde die Frage hin und her gewendet, ob ausgerechnet der reiche Deutsche Fußball-Bund die sozialen Belange in der unterentwickelten Region genügend berücksichtige. Schließlich griff man nicht auf eine bestehende Infrastruktur zurück, sondern 40brachte vieles von zu Hause mit. Oliver Bierhoff wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass durch die Bedürfnisse des (ebenfalls zu erbauenden) Medienzentrums als Infrastrukturmaßnahme neue Mobilfunkmasten gebaut würden — wobei er dem Publikum zugleich versicherte, während der WM würden die Kommunikationswünsche ausländischer Handy-Nutzer bevorzugt berücksichtigt, »wenn das Netz überlastet ist« (Zitate in diesem und dem folgenden Absatz siehe Bild-Zeitung 2014).
Ebenfalls diskutiert wurden mögliche ökologische Schäden. Das Areal liegt an der dem Regenwald vorgelagerten Küste und ist von Porto Seguro aus nur über eine Fährverbindung zu erreichen. Bei genauerer Betrachtung reiht sich das Hotel allerdings nur in eine Reihe weiterer touristischer Anwesen rund um das Fort Santo André ein. Zerstörungen fanden nicht statt. Angelegt wurde ein eigener Fußballplatz, für den die vorher dort wachsenden Orchideen per Hand umgepflanzt wurden und um den sich, so Bierhoff, »der bekannte Rasenexperte Rainer Ernst, […] ein absoluter Fachmann«, kümmerte.
Während der Weltmeisterschaft wurde das Dorf dem deutschen Fernsehzuschauer über die begleitende Berichterstattung von ARD und ZDF bekannt. Die ZDF-Sportjournalistin Katrin Müller-Hohenstein, die während der gesamten Weltmeisterschaft in Santo André stationiert war, spezialisierte sich auf Interviews, in denen sie mit den Spielern und dem Trainerstab die Wohn- und Lebenssituation des Teams thematisierte. Dafür bekamen sie und der verantwortliche Sender viel Häme — was wohl nicht zuletzt mit der restriktiven Medienstrategie der Mannschaftsleitung zu tun hatte, die eine echte sportjournalistische Berichterstattung stark erschwerte (Spiegel Online412014b). Die Perzeption von Campo Bahia war jedenfalls in hohem Maße durch das Fernsehen geprägt, dessen Bilder eine sportlich erfolgreiche Weltmeisterschaft mit einem luxuriösen Lebensstil verknüpften. Etwaige Interaktionen mit der brasilianischen Umgebung fanden kein verstärktes Interesse der Redaktionen und/oder der Zuschauer.
Damit war auch der spätere Rückblick auf das WM-Quartier vorgezeichnet. Die Spieler äußerten sich angetan von der Atmosphäre und Funktionalität ihres vorübergehenden Wohnorts: »Der Plan ging auf«, so der deutsche Spieler Thomas Müller.[13] Viele Beobachter aus dem In- und Ausland stuften die Entscheidung nun als Zeichen »sorgfältiger Planung« ein, da die Anlage in derselben Klimazone wie die Stadien der Vorrundenspiele gelegen habe. Dadurch habe man sich auf die Strapazen des langen Turniers besser eingestellt als andere Verbände, was sich z. B. im Endspiel gegen Argentinien zeigte, als die Mannschaft trotz blutender Wunden noch zulegen konnte und kurz vor dem Ende der Verlängerung das Siegtor erzielte. Heute ist das Campo Bahia ein luxuriöses, aber wohl nicht ausgelastetes Hotel. Für brasilianische Touristen dürften die Erinnerungen an das 1:7 im Halbfinale gegen Deutschland noch allzu lebendig sein, als dass man »im ehemaligen Zimmer von Bundestrainer Löw« echte Entspannung finden könnte.[14] Und betuchte deutsche Fußballnostalgi42ker dürften fernab der brasilianischen Tourismuszentren allenfalls eine Randgruppe darstellen.
Mit dem Bau des Kleindorfes, aber auch mit dessen diskursiver Einbettung, verbindet sich eine markante Entwicklung nicht nur der deutschen Nationalmannschaft, sondern des Profifußballs insgesamt. Immer mehr Entwicklungen werden systematisch antizipiert, was wiederum als unabdingbare Voraussetzung für sportlichen Erfolg gesehen wird. Der Deutungsrahmen ist so umfassend, dass sich ihm Spieler, Journalisten und andere Beteiligte kaum noch entziehen können. Dabei ist sein Wahrheitsgehalt wenigstens in historischer Perspektive keineswegs ausgemacht. So haben etwa die deutschen Erfolgsmannschaften von 1972 und 1974 durchaus mit Improvisationsgeist aufgewartet. Unvergessen ist die dänische Nationalmannschaft, deren Spieler sich bei der Europameisterschaft von 1992 mit unkonventionellen Aktionen bei Laune hielten und gerade daraus viel Kraft bezogen (11Freunde 2017).
Was ist also im Profifußball mit Werten wie Kreativität und Unbefangenheit geschehen? Wurden sie verdrängt, leben sie an verborgenen Stellen weiter? Die These dieses Kapitels hierzu lautet, dass Arenen der Spontaneität und Authentizität im modernen Fußball systematisch reduziert worden sind, um sie dem Primat des sportlichen Erfolgs unterzuordnen. Innerhalb des sportlichen Gefüges hat sich damit eine gewisse Verschiebung ergeben: weg von den Spielern als Leitwölfen auf dem Platz und hin zu Managern und langfristig planenden Trainern, die besonders in England verbreitet sind und dort passenderweise manager heißen. Durch deren Prägung ist im Fußball das Idealbild eines perfekten Profis entstanden.
Abweichende Verhaltensmuster wie abendliche Club43besuche oder handfeste Auseinandersetzungen im privaten Rahmen werden hart sanktioniert. Zwar existiert eine allgemeine Nostalgie nach »echten Typen«, die z. B. in Interviews authentische Antworten zu geben in der Lage sind. Jenseits der rhetorischen Ebene sind Attribute vergangener Zeiten wie Zigaretten, Alkohol und ungesunde Ernährung aber tabu. Und die Einhegung des Fußballs findet nicht nur auf der zwischenmenschlichen Ebene statt. Die Profis bewegen sich in einem Umfeld, in dem jedes Fernsehbild genauestens auf mögliche Abweichungen überprüft wird. Man denke hier nur an den Medienaufschrei im April 2017, als der Dortmunder Spieler Pierre-Emerick Aubameyang nach einem Tor eine Maske der Firma Nike aufsetzte, obwohl Borussia Dortmund vom Konkurrenten Puma — der zugleich fünf Prozent der BVB-Aktien hält — ausgestattet wird (Frankfurter Allgemeine Zeitung 2017e).
Wenn wir ergründen wollen, welche subjektbezogenen Normen im Feld des Fußballs gültig sind, erleichtert das Wechselspiel aus Erlaubtem und Unerlaubtem die Betrachtung. Wenn Politik als Feld angesehen wird, in dem materielle und diskursive Handlungen relevant sind, dann wird Macht auch über sprachliche Setzungen ausgeübt. Die wichtigen hegemonialen Rahmen für Politik lassen sich durch die Rekonstruktion zentraler Sprechakte gewinnen. Genauso relevant sind indes Äußerungen, an deren Umstrittenheit sich nachträglich zeigt, wo und wie offenbar geltende Regeln verletzt werden. Für den fußballpolitischen Diskurs sind somit affirmative und herausfordernde Aussagen gleichermaßen wichtig. Beide verweisen auf kollektiv geteilte Bedeutungen, die herauszuarbeiten das Ziel dieses Kapitels ist.
44Um diesem doppelten Kriterium für die Relevanz von Debattenbeiträgen zu genügen, werde ich mich in diesem Abschnitt lose an einen sprachtheoretischen Ansatz anlehnen, der im Zuge der Diskussion um die Emotionalität von Sprache an Bedeutung gewonnen hat. Vertreten wird er von dem Linguisten George Lakoff und dem Philosophen Mark Johnson, die seit Jahren zur Körperlichkeit und Inkorporierung von Metaphern forschen. Mit ihrem bekanntesten Buch Leben in Metaphern (2014 [1980]) gehören sie zu den Mitbegründern der Idee »konzeptioneller Metaphern«: sprachlicher und sonstiger symbolischer Bilder, über deren Bedeutung eine gewisse kollektive Einigkeit herrscht, die sprachlich und lebensweltlich eine besondere Bedeutung haben und daher mitunter als »verkörperlichte Kognitionen« bezeichnet werden (Lakoff/Johnson 2014 [1980]; Wehling 2016).
Im Folgenden werde ich mich also besonders auf wirkungsmächtige Symbole konzentrieren, die in der öffentlichen Debatte um den Fußball evoziert werden. An ihnen kann man zeigen, welche kollektiven Bedeutungen dem Fußball innewohnen. Dabei stehen jene Topoi im Zentrum des Interesses, die als offensichtliche Reibungspunkte der geistigen Situation der Zeit gelten können: das Verhältnis von Hyperglobalisierung und regionaler Gemeinschaft, von nationaler und kosmopolitischer Identität, vom Streben nach Gewinn und solidarischem Verhalten, von Individualität und Kameradschaft, von partikulären Interessen und Gemeinwohl. Politisch aufgefasst wird der Fußball an dieser Stelle noch nicht in einem traditionell-institutionellem Sinn — dieser Schritt erfolgt anschließend in Kapitel 3. Hier wird er zunächst als gesellschaftlich-diskursive Instanz aufgefasst, in der viele 45Randbedingungen verhandelt werden, an denen sich fußballpolitische Akteure orientieren müssen.
***