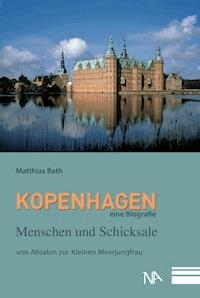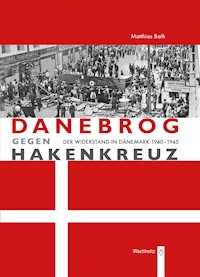Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Erträge
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Die Schriftenreihe ERTRÄGE dokumentiert Vorträge, die in der Bibliothek des Konservatismus gehalten wurden, sowie wissenschaftliche Arbeiten, die in Anbindung an die Bibliothek entstanden sind. Darüber hinaus werden solche Texte veröffentlicht, die für eine akademische Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Konservatismus im weitesten Sinne von Interesse sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Satz: Oktavo, Hohen Wangelin
Gesetzt aus 10/14 Punkt Stempel Garamond
Gedruckt in Deutschland
Inhalt
Vorwort
Matthias Bath
Die »Neue Rechte« in West-Berlin 1965 bis 1985
Hartmuth Becker
Konservative Staatspraxis: Ernst Forsthoffs Daseinsvorsorgekonzept
Hartmuth Becker
Carl Schmitts
Begriff des Politischen.
Eine Zwischenbemerkung
David Engels
The European Union and the Decline of the West, or: Determinism and Determination
Klaus Hornung
Freiheit oder Despotismus – Wohin treiben Deutschland und Europa?
Till Kinzel
Nicolás Gómez Dávila – Aphorismen als Einspruch gegen die Moderne
Timo Kölling
Philosophie im Gegenlauf: Leopold Zieglers Kritik der Neuzeit
Heinz-Joachim Müllenbrock
Erbe und Auftrag – Konservatives Denken bei Burke und Disraeli
Rainer Waßner
Helmut Schelsky – Soziologe und Anti-Soziologe
Zu den Autoren
Vorwort
Nach mehreren monographisch angelegten Ausgaben versammelt der vorliegende fünfte Band der Schriftenreihe ERTRÄGE wieder Vorträge, die in der Bibliothek des Konservatismus (BdK) gehalten wurden. So wird das in lebendiger Rede flüchtig Gesagte dauerhaft festgehalten, verifizier- und zitierbar.
Auf zwei Besonderheiten gilt es gleichwohl hinzuweisen: David Engels hat die Vorstellung seines Buches Auf dem Weg ins Imperium – Die Krise der Europäischen Union und der Untergang der römischen Republik zum Anlaß genommen, zentrale Aspekte seines Werkes herauszuarbeiten und auf aktuelle Fragestellungen zu beziehen. Wir freuen uns, daß auf diesem Wege auch eine Buchvorstellung Eingang in unsere Schriftenreihe gefunden hat. Klaus Hornung mußte seinen bereits terminierten Vortrag in der BdK aus gesundheitlichen Gründen absagen. Um so mehr freuen wir uns, den Vortragstext nun in schriftlicher Form vorlegen zu können.
Allen Beiträgern sei an dieser Stelle gedankt, daß sie die teilweise erheblichen Mehrarbeiten, die der Weg vom gehaltenen Vortrag zum gedruckten Aufsatz mit sich bringt, klaglos auf sich genommen haben. Meinem Kollegen Jonathan Danubio danke ich wiederum für seine wertvolle Unterstützung bei der Erstellung des vorliegenden Bandes.
Dr. Wolfgang Fenske
Bibliotheksleiter
Berlin, im Mai 2017
Matthias Bath
Die »Neue Rechte« in West-Berlin 1965 bis 19851
Angesichts der Erfolglosigkeit traditionell rechter, konservativer Politikkonzepte entstand – parallel zum Aufkommen der »Neuen Linken« – Anfang der 60er Jahre in verschiedenen Ländern Europas die Bewegung der »Neuen Rechten«.
Ausgangspunkt war Frankreich mit der »Nouvelle Droite« um Alain de Benoist.2 Die Ausprägungen der Neuen Rechten in den verschiedenen Ländern Europas waren sehr unterschiedlich, trafen sich jedoch in der Bejahung eines revolutionären Befreiungsnationalismus und einer gesellschaftspolitischen Kritik des liberalkapitalistischen Systems aus dem Blickpunkt eines nichtmarxistischen europäischen Sozialismus.
Befreiungsnationalismus
Der Begriff des Befreiungsnationalismus ist sicherlich vor dem seinerzeitigen Hintergrund der Entkolonialisierung durch nationale Befreiungsbewegungen verschiedener Völker Afrikas und Asiens zu sehen. Beispielhaft wären hier die algerische Front de la Libération National oder die Freien Offiziere unter Gamal Nasser in Ägypten zu nennen. Wichtig ist dabei, daß der Träger nationalistischer Bestrebungen das Volk als solches und nicht seine staatliche Organisation ist.3
Die unterdrückten Völker der Welt wenden sich so gegen ihre imperialistischen Unterdrücker und befreien sich durch ihre revolutionäre Erhebung von fremder Herrschaft.
Bis zu einem gewissen Grade deckte sich diese Perspektive auch mit der der Neuen Linken. Auch diese sah einen Kampf der kolonialistisch unterdrückten Völker gegen die imperialistischen Staaten des Westens.
Die Neue Rechte sah im Westen aber nicht nur Staaten, sondern auch Völker, auf die sie die im Zusammenhang mit der Entkolonialisierung gewonnene Position nationaler Befreiungskämpfe übertrug. Dies galt für so unterschiedliche Phänomene wie die nationalen Minderheiten in verschiedenen westeuropäischen Staaten, etwa die deutschen Südtiroler in Italien oder vor allem die republikanischen Iren in Nordirland oder den Freiheitskampf der national unterdrückten Völker in der Sowjetunion.4
Revolutionär ist dieser Nationalismus erst einmal in ganz allgemeiner Form wegen des ihm potentiell innewohnenden revolutionären Moments. Konkreter gefaßt aber auch, weil er sich eruptiv, gewaltsam und damit revolutionär äußern kann. In letzter Zuspitzung aber auch deshalb, weil mit der nationalen Befreiung auch eine Umwälzung der sozialen Verhältnisse einhergehen sollte.
Damit sind wir aber auch schon bei der Frage des nichtmarxistischen europäischen Sozialismus:
Nichtmarxistischer Sozialismus
Ausgangspunkt dieses Sozialismus ist der Trieb des Menschen zu einem Leben in sozialen Gemeinschaften. Diese können nur bei solidarischem, sozialbezogenem Verhalten ihrer Mitglieder funktionieren. Größte dieser sozialen Einheiten sind die Völker. Die »Bereitschaft, nationale Solidarität zu üben«,5 ist so gesehen der sozialistische Maßstab für den Wert des einzelnen Menschen.
Sozialismus ergebe sich aus dem Gefühl der Mitverantwortung für die soziale Gemeinschaft, der der einzelne angehöre. Seine Verwirklichung erfordere, den Begriff des Ganzen, das heißt der Verantwortung für das eigene Volk, auch in den sozialökonomischen Verhältnissen durchzusetzen.
Diese Auffassung schließt alle Formen des Sozialismus aus, die sich mit einer bestimmten Klasse oder Sozialschicht verbinden. Für die Neue Rechte war nicht das Proletariat oder die Intelligenz, sondern das ungeteilte Volk der Träger des Sozialismus. Dies allerdings nur dann, wenn es sich als Nation fühlt oder realisiert, wenn es nationalistisch denkt und handelt.
Die Neue Rechte stellte also dem marxistischen Klassensozialismus einen nationalistischen Volkssozialismus entgegen.6
Deutschland
In Deutschland waren die Ausgangspunkte für die Entstehung der Neuen Rechten die deutsche Teilung und die andauernde Besetzung der deutschen Teilstaaten durch die Siegermächte von 1945. Im weiteren Sinne die Ablehnung der durch das System von Jalta begründeten Teilung Europas und die Solidarität mit den nationalen Befreiungsbewegungen in Osteuropa. Zugleich aber auch die Ablehnung des materialistischen Denkens als gemeinsame Grundlage des westlichen Liberalkapitalismus wie auch des östlichen marxistischen Staatskapitalismus. Die Beseitigung des Status quo der deutschen Teilung setzte aus Sicht der Neuen Rechten auch die Änderung der gesellschaftspolitischen Verhältnisse in West wie Ost voraus. In dieser gesellschaftspolitischen Orientierung unterschied sich die Neue Rechte kaum von der Neuen Linken.
Allerdings blieben Neue Linke und Neue Rechte gleichwohl auch in der geistigen Aufbruchsstimmung der 60er Jahre als zwei Pole jenseits der politischen Mitte gegenwärtig.
Nachfolgend sollte die Neue Linke größere Bedeutung erlangen und allgemein bekannt werden. Bei der Neuen Rechten war das anders. Sie verblieb für die Allgemeinheit beinahe unsichtbar im Schatten der Neuen Linken.7
Die Entstehung der Neuen Rechten
Die Neue Rechte entstand aus kleinen Diskussionszirkeln rechter, nationaler Intellektueller, die über Alternativen zu bisherigen Formen rechter Politik nachdachten. Vorläufer in Deutschland waren die 1951 entstandene Zeitschrift Nation Europa und der seit 1958 aktive Jungeuropäische Arbeitskreis aus Mitarbeitern und Lesern dieser Zeitschrift. Der Arbeitskreis versammelte sich von 1958 bis 1964 einmal jährlich zu themengebundenen Jahrestreffen. Ein weiterer Vorläufer war der am 17. Juni 1956 in Heidelberg gegründete Bund Nationaler Studenten, der aber bereits 1960 verboten wurde.8
Erste nationalrevolutionäre Diskussionszirkel waren der Anfang 1964 in Hamburg entstandene Arbeitskreis »Junges Forum« und der unabhängig von diesem, aber ebenfalls in Hamburg im Frühjahr 1965 gegründete Arbeitskreis »Fragmente«.9
In West-Berlin entwickelten sich die ersten Ansätze der Neuen Rechten aus dem unter dem Dach des staatlich geförderten Kuratoriums Unteilbares Deutschland tätigen
Hochschularbeitskreis Unteilbares Deutschland (HUD). Mitglieder des HUD gründeten im Oktober 1964 die Gruppe »Initiative der Jugend« (IDJ). Zu nennen sind hier vor allem Sven Thomas Frank, Bodo Blum, Fred Mohlau, Karl-Wolfgang Holzapfel und der spätere CDU-Politiker Wolfgang Hackel. Die IDJ setzte sich vor allem für eine offensivere Ostpolitik der Bundesregierung ein. Durch stärkere Bundespräsenz in West-Berlin sollte der Wille zur nationalen Einheit wachgehalten werden.10
Frank und Hackel entwarfen auch die Grundsatzerklärungen des HUD. Darin hieß es, der Weg zur Wiedervereinigung liege jenseits von Koexistenz und Sicherheit. Frank hielt Mitte 1966 ein Referat auf einer Jugendtagung des Kuratoriums Unteilbares Deutschland, wo er ausführte, die Wiedervereinigung setze die Überwindung beider Staatsprovisorien in Deutschland voraus. Weder das eine noch das andere sei der Jugend Vaterland. Aber in beiden Staaten gebe es Errungenschaften, die im vereinigten Deutschland beibehalten werden müßten. Frank befürwortete eine Synthese der beiden Wirtschaftsformen. In der DDR sah er eine Art »preußischen Sozialismus«, durch den auf dem Gebiet der Bildung weitgehende Chancengleichheit erreicht worden sei.
Zugleich distanzierte sich Frank vom undifferenzierten Antikommunismus. In zwei Aufsätzen, »Die innere Verfassung West-Berlins« (1966) und »Was wird aus Berlin« (1968), stellte er die Gefahr einer Austrocknung und Vorzeichen einer Agonie für West-Berlin fest. Die Bundesregierung müsse dem entgegentreten, indem sie Berlin wieder zur Hauptstadt Deutschlands mache.11
Im Februar 1968 wandte sich eine Gruppe von Abiturienten der Britzer Albert-Einstein-Schule mit dem Flugblatt »Das verschweigt der SDS« gegen den seinerzeitigen Vietnam-Kongreß des SDS und die damit verbundene Straßendemonstration. Die Initiatoren des Flugblattes waren die Schüler Bernd Müller, Michael Marquard und Detlev Schultze.12
Sie erfuhren Unterstützung durch ihren Schulleiter Otto Wenzel, der gleichzeitig Vorsitzender des 1967 entstandenen Demokratischen Klubs, des Gegenstücks zum Republikanischen Klub der APO, war.
Am 24. Juni 1968 gründeten sie gemeinsam mit anderen Schülern die Außerparlamentarische Mitarbeit (APM), die schnell zur Jugendgruppe des Demokratischen Klubs wurde.13 Zum Schlüsselerlebnis für die Gründer der APM wurde die Niederschlagung des Prager Frühlings durch den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen am 21. August 1968. Die APM-Aktivisten waren von der weitgehenden Identität von Regierenden und Regierten in der ČSSR, wie sie sich um den 21. August 1968 manifestierte, nachhaltig beeindruckt. Die grundsätzliche Bejahung des »Dritten Weges«, den die ČSSR zu gehen gedachte, brachte die APM bereits wenige Monate nach ihrer Gründung in eine zunächst nur theoretische Konfrontation zur bürgerlichen Politik, die den Prager Frühling nur als Abkehr vom Sozialismus sah.14
Anfang 1969 traten sechs Mitglieder der IDJ der APM bei. Sven Thomas Frank wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der APM gewählt.15 Anläßlich der Bundesversammlung in Berlin im Frühjahr 1969 begannen APM und IDJ eine Kampagne unter dem Titel »Berlin-Aktion«, in der: 1. Stimmrecht der Berliner bei den Bundestagswahlen, 2. Stimmrecht der Berliner Abgeordneten im Bundestag, 3. Hauptstadtaufgaben für Berlin und 4. ein Volksentscheid über die uneingeschränkte Zugehörigkeit Berlins zur Bundesrepublik gefordert wurden.16
In der Folge verbanden sich die deutschlandpolitischen Vorstellungen der IDJ mit den dynamischen Aktionsvorstellungen der jüngeren APM-Mitglieder. Gemeinsam organisierte man eine Demonstration mit 2000 Teilnehmern zum 13. August 1969. Das war für lange Jahre die letzte größere Demonstration in Berlin, die nicht aus dem linken Bereich kam.17
Nach dieser Demonstration kam es jedoch zu internen Auseinandersetzungen innerhalb der APM, in deren Ergebnis sowohl die Anhänger der sozialliberalen Koalition als auch die der CDU die APM verließen. Hierdurch wurde auch das Verhältnis zum Demokratischen Klub zunehmend belastet.18
Im April 1970 kam es zum Bruch, als die APM in dem Flugblatt »Berlin verlassen oder rebellieren«, die Ostpolitik der Bundesregierung mit dem Appeasement Chamberlains vor dem Zweiten Weltkrieg verglich. Allerdings wurde die inhaltliche Aussage dieses Flugblattes durch die Verwendung von Verbalradikalismen (»politische Verbrecher«, »SPD-Vaterlandsverräter« etc.) überlagert, die gerade in SPD-Kreisen als beleidigend empfunden werden mußten.19
Die APM als eigenständige nationalrevolutionäre Gruppe in Berlin
Es gelang der APM jedoch, einen Laden in der Neuköllner Pannierstraße (nahe dem Hermannplatz) zu mieten und dort am 1. Juli 1970 das »Nationale Zentrum 1871« zu eröffnen.20
Es begann eine Phase gesteigerter deutschlandpolitischer Aktivität. Dabei arbeitete man zunächst auch mit altrechten (NPD) oder neonazistischen Gruppen zusammen, wobei hierzu die Abstempelung der APM als »rechtsradikal« durch Medien und Behörden wesentlich beitrug. Im weiteren Verlauf der theoretischen Diskussionen innerhalb der APM bildeten sich dort aber antiimperialistische, nationalrevolutionäre Positionen heraus, die die APM von der Alten Rechten wegführten.
Die deutsche Teilung wurde nun als ein Aspekt der Aufteilung der Welt zwischen zwei imperialistischen Supermächten gesehen. Dem wollte man den Befreiungsnationalismus der betroffenen Völker, nicht den Staatsnationalismus der betroffenen Staaten entgegensetzen. Zugleich grenzte sich die APM mit dem Bekenntnis zum 20. Juli 1944 von der Alten Rechten ab.21
Die APM nahm nun auch Kontakt zu Gleichgesinnten im westdeutschen Bundesgebiet auf und entwickelte sich mit ihrem Laden schnell zu einem Führungszentrum der nationalrevolutionären Szene in Deutschland.22
Seit 1971 gab die APM die Flugschrift Rebell (Abb. 1) heraus, die vor allem vor Schulen verteilt wurde. Sehr bald verfügte Rebell über sechs regionale Kontaktadressen in Westdeutschland. Die Anfangsauflage von Rebell betrug 3000 Exemplare. Anfang 1974 lag sie bei 17000.23
Ende 1971 wurde das »Nationale Zentrum 1871« in »barricade« umbenannt.24 Seit Anfang 1972 wurde ebenfalls im Format einer Flugschrift das Theorieorgan Ideologie und Strategie als vierteljährlich erscheinendes internes »Kaderorgan« nationalrevolutionärer Basisgruppen herausgegeben.25
Die »Neue Rechte« Mitte der siebziger Jahre
Ebenfalls Anfang 1972 kam es in München unter dem bisherigen bayrischen NPD-Landesvorsitzenden Pöhlmann zum Austritt eines Teils des linken Flügels der NPD, der sich anschließend als Aktion Neue Rechte (ANR) konstituierte. Das Gründungsmanifest der ANR wurde von Henning Eichberg, einem Vordenker der deutschen Nationalrevolutionäre, verfaßt.26 Gleichwohl erwies sich die ANR als nicht durchweg nationalrevolutionär, sondern die Nationalrevolutionäre bildeten neben Nationalkonservativen und Neonationalsozialisten nur eine von drei Richtungen innerhalb der ANR.27 Der ANR-Vorsitzende Pöhlmann entsprach keineswegs nationalrevolutionären Vorstellungen und trat noch im Januar 1972 dem Freiheitlichen Rat des Herausgebers der Deutschen National-Zeitung, Gerhard Frey, bei, der in den Augen der Nationalrevolutionäre die Inkarnation eines Vertreters der »Alten Rechten« war. Pöhlmann band zudem die ANR an Frey und dessen Verlag durch einen Vertrag über die Herausgabe einer Zeitung der ANR. Sie sollte zunächst »Neue Ordnung« heißen, erschien dann aber unter dem Titel Recht und Ordnung.28
Als publizistisches Gegengewicht gaben die Vertreter der nationalrevolutionären Richtung in der ANR ab April 1972 die Monatszeitschrift Neue Zeit heraus, die über die ANR hinaus, bei allen nachfolgenden organisatorischen Umformierungen der Nationalrevolutionäre, diese stets als Publikationsorgan begleiten sollte.29
Nach heftigen internen Auseinandersetzungen spaltete sich im März 1974 die nationalrevolutionäre Richtung auf einem von 120 Personen besuchten Kongreß in Würzburg als Nationalrevolutionäre Aufbauorganisation (NRAO) von der ANR ab.30
Die APM, die sich 1973 auch den Namen »Nationalrevolutionäre Basisgruppe Berlin« zugelegt hatte, unterstützte in diesen Auseinandersetzungen die nationalrevolutionäre Richtung innerhalb der ANR und war wohl auch der ANR als deren Berliner Ortsgruppe beigetreten. Im Herbst 1973 produzierte sie unter dem Herausgebernamen »Nationalrevolutionäre Basisgruppen in Deutschland« drei Flugblätter unter dem Titel »NR Basis Info« und fünf Aufkleber, die bundesweit verbreitet wurden.31 Mit der Gründung der NRAO wurde die APM deren Berliner Basisgruppe.
Anfang 1974 wurden die Räume in der Pannierstraße zugunsten einer Ladenwohnung in der nahegelegenen Reuterstraße aufgegeben. Die Anmietung der neuen Räume wurde jedoch nur dadurch ermöglicht, daß der Geschäftsführer der Berliner Gruppe zugleich privat auch in die Wohnung mit einzog.
Die Organisation »Sache des Volkes«
Die NRAO war von vornherein nur als Provisorium angelegt, um auf ihrer Grundlage eine neue, dauerhafte politische Organisation der Nationalrevolutionäre zu schaffen. Dies geschah am 31. August 1974 in Frankenberg/ Eder mit der Gründung der Organisation »Sache des Volkes« (SdV). An diesem Gründungskongreß nahmen etwa 120 Personen aus allen Teilen der Bundesrepublik (mit Ausnahme Hamburgs, wo sich eine eigene solidaristische Richtung der Nationalrevolutionäre entwickelte) teil, von denen jedoch etwa ein Drittel vorzeitig abreiste. Zum Abschluß des Kongresses wurden ein neunköpfiger Zentralrat und ein dreiköpfiges Zentralbüro als Leitung der Organisation gewählt. Dem Zentralbüro gehörte mit Sven Thomas Frank auch ein Berliner Vertreter an. Der Sitz der Organisation befand sich allerdings in München, wo auch die Redaktion der Neuen Zeit, des Presseorgans der SdV, ihren Sitz hatte. Die APM setzte ihre Arbeit nunmehr als »Basisgruppe Berlin« der SdV fort.32
Die Hamburger »Solidaristen«
Die aus dem Arbeitskreis »Junges Forum« hervorgegangene NRAO-Landesgruppe Hamburg unter Leitung von Lothar Penz lehnte den nationalrevolutionären Begriff des »Sozialismus« ab und wollte ihn durch den Begriff des »Solidarismus« ersetzen. Auch der Begriff »nationalrevolutionär« sollte eher als eine Methode zur Erreichung eines solidaristischen Ziels und nicht selber als Zielsetzung verstanden werden.33
Solidarismus sei eine Synthese von Nationalismus und Sozialismus und damit etwas völlig anderes als ein nationalistischer und sozialistischer Standpunkt.34
Schließlich lehnte die Hamburger Gruppe auch die Kennzeichnung der Bundesrepublik als Separatstaat ab, den es auf dem Weg zu einer revolutionären Neuvereinigung Deutschlands gegebenenfalls auch zu zerstören gelte. Die Solidaristen sahen demgegenüber die Bundesrepublik als Ausgangspunkt, wenn nicht sogar als erste Etappe der Neuvereinigung an.
Vor dem Hintergrund des Wiedervereinigungsgebotes des Grundgesetzes sei es falsch, die Bundesrepublik als Staat zu bekämpfen. Der Kampf müsse vielmehr gegen die liberalistischen und marxistischen Kräfte geführt werden, die das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes verfassungsfeindlich mißachteten und verfälschten.35 Dabei sei der Solidarismus die verfassungskonforme Alternative zum tödlichen System des Materialismus, sei es als Kapitalismus oder Kommunismus.36
Im Ergebnis beriefen die Solidaristen für den 24. August 1974 – eine Woche vor dem Gründungskongreß der »Sache des Volkes« – eine Konferenz nach Aschaffenburg ein, auf der sie die Solidaristische Volksbewegung (SVB) gründeten. Diese verkörperte fünf Gruppen mit etwa 100 Anhängern. Das Zentrum der SVB lag in Hamburg. Hier wurde auch ihre Zeitung SOL (Abb. 2) herausgegeben.37 Der SVB blieb aber auch in den Folgejahren ein größerer organisatorischer Erfolg versagt. Anfang 1980 benannte sie sich in Bund Deutscher Solidaristen (BDS) um.
Aber auch der Organisation »Sache des Volkes« war kein großer organisatorischer Erfolg beschieden, und sie kam niemals über den Stand des Gründungsstadiums hinaus. Auch die Berliner Basisgruppe zählte nur etwa 20 Mitglieder.
Immerhin trug ihr Einfluß mit dazu bei, den Verfasser zu radikalisieren, so daß dieser im Herbst 1975 in Auseinandersetzungen mit seinen bisherigen Mentoren in der CDU geriet, aus der Schülerunion austrat und eine eigenen, nationalrevolutionär beeinflußte Gruppe, die Gemeinschaft Unabhängiger Schüler (GUS), gründete.38 Auch sein Entschluß, sich im Frühjahr 1976 an Fluchthilfeaktionen zu beteiligen, hing sicher mit der nationalrevolutionären Beeinflussung des damals Zwanzigjährigen zusammen.39 Er wollte als kleiner Teil eines größeren Ganzen etwas Sinnvolles gegen den damaligen Status quo der deutschen Teilung tun. Das hatte weniger mit Abenteuerlust als mit revolutionärer Romantik (von der der Verfasser 1976 nicht frei war) zu tun. Nach der Festnahme des Verfassers in der DDR im April 1976 löste sich die GUS auf. Die Nationalrevolutionäre vergaßen den Verfasser in den folgenden Jahren bis 1979 nicht, wiesen – wie andere Gruppen freilich auch – auf sein Schicksal hin und forderten seine Freilassung.40Der Verfasser hatte in diesen Jahren viel Zeit nachzudenken. Unter den DDR-Haftbedingungen wandelte er sich wieder zum Antikommunisten, dem die Gefahr der Ausbreitung des sowjetischen Willkürsystems angesichts einer Schwächung der westlichen Supermacht viel zu groß war, als daß man dies durch irgendwelche nationalrevolutionären Experimente riskieren dürfte. Als er 1979 zurückkehrte, hatte er sich weitgehend vom nationalrevolutionären Denken abgewandt und engagierte sich vorerst von neuem in der CDU, wo er auch zunächst mit offenen Armen wieder aufgenommen wurde.
Nationalrevolutionärer Epilog
1979 mußten die Berliner Nationalrevolutionäre die eigenen Räume in der Reuterstraße aus Kostengründen aufgeben. Statt dessen traf man sich bis in die achtziger Jahre hinein als Stammtisch oder Frühschoppen im Café Stresemann im Deutschlandhaus in der Kreuzberger Stresemannstraße.41
Ebenfalls 1979 war auch eine neue Generation von Nationalrevolutionären herangewachsen, die sich von den an maoistischen Gruppen orientierten Organisationsformen der bisherigen nationalrevolutionären Kadergruppen nicht mehr angesprochen fühlten. So erschien Ende 1979 in Mainz auch die erste Ausgabe von wir selbst42 (Abb. 3) als Sprachrohr dieser jüngeren Nationalrevolutionäre.
Um 1980 herum versuchten Anhänger der Neuen Rechten vergeblich in der Gründungsphase der Grünen Einfluß auf diese zu gewinnen. Nach ihrem Scheitern beteiligten sie sich teilweise an Herbert Gruhls ÖDP oder in grünen Splittergruppen wie der GAZ.
Anfang der achtziger Jahre erkannte die Neue Rechte auch zunehmend die ethnischen Probleme der massenhaften Zuwanderung aus fremden Kulturkreisen nach Deutschland und Europa. So trafen sich Vertreter der Organisation »Sache des Volkes« und des Bundes Deutscher Solidaristen im Sommer 1981 in Aschaffenburg zur Erörterung der mit dieser Thematik verbundenen Fragen. Sie verabschiedeten eine gemeinsame »Erklärung zur Frage des kapitalistischen Menschenhandels und zur Gastarbeiterfrage«,43 in der es noch ganz in der Diktion der Nationalrevolutionäre heißt:
»Die Machthaber und Nutznießer des herrschenden Systems, die Manager der Großunternehmen und die Politiker materialistischer Weltanschauungen schieben rücksichtslos Millionen Menschen durch Länder Europas. Sie sind gewillt diese Politik fortzusetzen – weil ihr materialistisches Weltbild keine Alternative zum zerstörerischen Wirtschaftswachstum zuläßt, – weil sie sich von der einfacher manipulierbaren Masse, den nomadisierenden Hilfsarbeiterheeren und den identitätslosen Restvölkern eine Stabilisierung ihrer Herrschaft erhoffen.
Seit einiger Zeit werden auch mehr und mehr außereuropäische Menschen zu Werkzeugen dieser Politik gemacht. Im Interesse multinationaler Konzerne und imperialistischer Ideologien soll der Zustrom immer neuer Völkerschaften alle nationalen Strukturen restlos auflösen und deren Neubildung auch für die Zukunft unmöglich machen.«44
Vorausschauend wurde festgestellt: »Der Anteil der Ausländer an den Einwohnern westdeutscher Städte hat teilweise schon 25% überschritten. Er wird, wenn der bisherigen Entwicklung nicht bald Einheit geboten wird, bis 1990 in Einzelfällen 50% betragen. Gleiches gilt für andere westeuropäische Länder. Besonders bedrohlich für den Fortbestand des deutschen Volkes ist der steigende hohe Anteil ausländischer Jugendlicher. Jetzt noch knapp 7% wird er bei fortschreitender Entwicklung bis 1995 auf mindestens 20% der Gesamtbevölkerung dieser Altersgruppe steigen.«45
Angesichts dessen wurde von den Unterzeichnern der Erklärung u. a. gefordert: »[…]
Aufrechterhaltung und konsequente Durchführung des Anwerbestops.
Stop der Familienzusammenführung im Gastland.
Rückkehr der arbeitslosen Gastarbeiter in ihr Heimatland.
Stetiger Abbau des Ausländeranteils durch Förderung der Rückkehrwilligkeit auch durch wirtschaftliche Maßnahmen.
Kapitalisierung von Arbeitslosengeld und Rentenansprüchen, berufliche Qualifizierungsmaßnahmen,
Förderung von zielgerichteten wirtschaftlichen Investitionen in den jeweiligen Heimatländern, z.B. durch Arbeitnehmergesellschaften.«
46
Und schließlich ein »Asylrecht, das die Anerkennungsverfahren drastisch verkürzt und ethnische und finanzielle Belastbarkeit der Bundesrepublik berücksichtigt.«47
In der Folge begannen sich Anhänger der Neuen Rechten daraufhin auch unter bewußter Aufgabe nationalrevolutionärer Positionen in ein- und zuwanderungskritischen, eher bürgerlichen Gruppen wie der 1982 in Wilmersdorf entstandenen Bürgerinitiative »Demokratie und Identität« oder der am 13. August 1984 von aus der SPD ausgetretenen Mitgliedern gegründeten Sozialen Volkspartei Deutschlands (SVD) zu engagieren. Die SVD blieb zwar bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus 1985 mit einem Ergebnis von 0,4 Prozent erfolglos, deutete aber doch die unterschwellig vorhandene Unzufriedenheit immer größerer konservativer, national eingestellter Bevölkerungskreise mit der etablierten Politik, gerade auch der seit 1981 in West-Berlin regierenden CDU, an.
Diese Unzufriedenheit sollte die Grundlage für den späteren Erfolg der seit 1987 in Berlin aktiven Republikaner bilden. Die Aktivisten der Neuen Rechten waren jedenfalls seit Mitte der achtziger Jahre in den Vorläuferorganisationen der Republikaner auch in West-Berlin aktiv.
Auf der anderen Seite lösten sich Mitte der achtziger Jahre sowohl die Organisation »Sache des Volkes« als auch der Bund Deutscher Solidaristen mangels Resonanz weitgehend im verborgenen auf.
Das Presseorgan der »Sache des Volkes«, die Zeitschrift Neue Zeit (Abb. 4), erschien bis zum Sommer 1987 als organisationsunabhängige Publikation im Eigenverlag, von nur noch wenigen Aktivisten erstellt. Diese beschlossen schließlich die Einstellung des Blattes, da der Aufwand bei der Herstellung in keinem Verhältnis zur erzielten Wirkung stand. Der Verfasser dankt Claus-M. Wolfschlag für den Hinweis,48 daß sie dabei die verbliebenen Abonnenten aufforderten, nunmehr die ein Jahr zuvor entstandene Junge Freiheit zu abonnieren, womit sich der Kreis zum Hier und Heute schließt.
© Bibliothek des Konservatismus
Abb. 1: Rebell - Flugschrift für Schüler und andere Jugendliche, hg. v. Arbeitskreis Rebell, 1971–1980
© Bibliothek des Konservatismus
Abb. 2: SOL – Organ der solidaristischen Volksbewegung, 1974–1980
© Bibliothek des Konservatismus
Abb. 3: wir selbst - Zeitschrift für nationale Identität und internationale Solidarität, 1979–2002
© Bibliothek des Konservatismus
Abb. 4: Neue Zeit, hg. v. d. Aktion Neue Rechte (ANR), 1972–1987
1 Vortrag, gehalten in der Bibliothek des Konservatismus am 16. April 2015.
2 Vgl. Alain de Benoist, Mein Leben, Berlin, 2014, S. 69 ff., 135ff.; Günter Bartsch, Revolution von rechts?, Freiburg, 1975, S. 20 f., S. 74.
3 Für letzteres: Gert Waldmann, Sechs Thesen zum modernen Nationalismus, in: Junge Kritik 1, Coburg, 1970, S. 77 ff.
4 Vgl. Bartsch, S. 53; vgl. auch Michael Meinrad, Das Prinzip Nationalismus, in: Junge Kritik 3, Hamburg, 1973, S. 7 ff. (12).
5 Bartsch, S. 54.
6 Vgl. ebd.
7 Vgl. Bartsch, S. 13.
8 Vgl. Bartsch, S. 95 ff.
9 Vgl. Bartsch, S. 104 ff.
10 Vgl. Bartsch, S. 114.
11 Vgl. Bartsch, S. 116.
12 Vgl. Bartsch, a.a.O.; Selbstdarstellung der Außerparlamentarischen Mitarbeit vom März 1974, S. 1 (Archiv des Verfassers).
13 Vgl. Bartsch, a.a.O.; Selbstdarstellung, a.a.O.
14 Vgl. Selbstdarstellung, S. 1 f.
15 Vgl. Bartsch, S. 116.
16 Vgl. Selbstdarstellung, S. 2.
17 Vgl. ebd.
18 Vgl. Selbstdarstellung, S. 2 f.
19 Vgl. Selbstdarstellung, S. 3; Bartsch, S. 120; Flugblatt »Berlin verlassen oder rebellieren« (Archiv des Verfassers).
20 Vgl. Bartsch, S. 121.
21 Vgl. Selbstdarstellung, S. 3.
22 Vgl. Bartsch, a.a.O.; Selbstdarstellung, S. 4.
23 Vgl. Bartsch, a.a.O.; Selbstdarstellung, S. 3 f.; Rebell 1/1974 (Archiv des Verfassers).
24 Vgl. Bartsch, a.a.O.
25 Vgl. Selbstdarstellung, S. 4.
26 Vgl. Bartsch, S. 145 f.; Grundsatzerklärung der ANR (Archiv des Verfassers).
27 Vgl. Bartsch, S. 147 ff.
28 Vgl. Bartsch, S. 146.
29 Vgl. Bartsch, S. 147.
30 Vgl. Bartsch, S. 152, 154 ff.
31 Archiv des Verfassers.
32 Vgl. Bartsch, S. 165 f.
33 Vgl. Bartsch, S. 171 ff.
34 Vgl. Bartsch, S. 173.
35 Vgl. Bartsch, S. 174.
36 Vgl. Manifest der Solidaristen vom 24. August 1974, S. 5/6, zitiert bei Bartsch, S. 176.
37 Vgl. Bartsch, S. 175.
38 Vgl. Junges Forum 6/75, S. 15.
39 Vgl. etwa Junges Forum 5/75, »Eine dritte Nation?« von Wolfgang Strauß, hier insbesondere S. 12 (»Die eingesperrte Teilnation«) mit der Erwähnung der Fluchthilfe als Form des Widerstandes.
40 Vgl. Junges Forum 1/77, S. 23; SOL – Organ der Solidaristischen Volksbewegung, Nr. 1–2/77, S. 11 ff.; Neue Zeit, Ausgabe 1/79, S. 22 ff.
41 Vgl. Einladungsschreiben zum 6. Januar 1980 (Archiv des Verfassers).
42wir selbst – Zeitschrift für Nationale Identität, Dezember 1979.
43Junges Forum 3+4/80–81, S. 41 f.
44 A.a.O., S. 41.
45 Ebd.
46 Ebd.
47 A.a.O., S. 42.
48 Anläßlich dessen Vortrages über »Hitlers rechte Gegner«, gehalten in der Bibliothek des Konservatismus am 18. Juli 2014.
Hartmuth Becker
Konservative Staatspraxis: Ernst Forsthoffs Daseinsvorsorgekonzept49
Vorbemerkungen zu Person und Schrifttum
August Wilhelm Heinrich Ernst Forsthoff wurde am 13. September 1902 in Laar – heute zur Stadt Duisburg gehörig – als Sohn eines evangelischen Pfarrers geboren. 1921 nahm er nach dem Abitur das Studium der Rechtswissenschaften auf: zunächst in Freiburg, dann in Marburg und schließlich in Bonn. Im Sommersemester 1923 besuchte der Student bei Prof. Carl Schmitt, seinem späteren Doktorvater, eine Übung im Öffentlichen Recht. 1924 legte Forsthoff das erste Staatsexamen ab. Im folgenden Jahr wurde er mit der Dissertation Der Ausnahmezustand der Länder an der Universität Bonn promoviert. 1928 wurde das zweite Staatsexamen abgelegt. Im Jahr 1930 habilitierte sich Ernst Forsthoff in Freiburg mit einer Schrift zum Thema Die öffentliche Körperschaft im Bundesstaat. 1933 wurde er auf einen Lehrstuhl in Frankfurt am Main berufen. Später lehrte er in Hamburg (1935), Königsberg (1936), Wien (1941) und schließlich Heidelberg (1943). Zunächst aus dem Lehramt vertrieben, durfte er ab 1952 erneut in Heidelberg bis zu seiner Emeritierung im Wintersemester 1967/68 Öffentliches Recht lehren. Im Jahr 1966 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Universität Wien zuerkannt. Die zunächst politisch verhinderte Verleihung holte die Juristische Fakultät schließlich 1969 in Heidelberg nach. Weit überregional bekannt wurden die von ihm organisierten Ebracher Ferienseminare. In den Jahren 1960 bis 1963 amtierte Forsthoff als Präsident des zypriotischen Verfassungsgerichtes. Forsthoff war von 1935 mit Ursula Seefeldt, mit der er einige Kinder hatte, bis zu ihrem Tode im Jahre 1960 verheiratet. Am 13. August 1974 verstarb der bedeutende Staatsrechtslehrer nach längerer Krankheit, der zeitlebens mit seinem Lehrer Carl Schmitt verbunden blieb.50 Aufschluß über die Verbundenheit der beiden Personen gibt der Briefwechsel Ernst Forsthoff – Carl Schmitt 1926–1974 aus dem Jahre 2007.51 Schmitt widmete ihm seine 1963 erschienene Schrift Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen.
Ernst Forsthoff verfaßte zahlreiche Bücher und Artikel. Die wichtigsten Artikel finden sich in dem Werk Rechtsstaat im Wandel. Verfassungsrechtliche Abhandlungen 1950 bis 1964, Stuttgart 1964, wieder. In der zweiten Auflage hieß die Schrift Rechtsstaat im Wandel. Verfassungsrechtliche Abhandlungen 1954 bis 1973, München 1976.
Zu erwähnen sind folgende Monographien: die schon angesprochene Habilitationsschrift Die öffentliche Körperschaft im Bundesstaat. Eine Untersuchung über die Bedeutung der institutionellen Garantie in den Artikeln 127 und 137 der Weimarer Verfassung, Tübingen 1931; Der totale Staat, Hamburg 1933;52Die Verwaltung als Leistungsträger, Königsberger Rechtswissenschaftliche Forschungen, Bd. 2, Stuttgart und Berlin 1938; Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit, Berlin 1940; Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Erster Band: Allgemeiner Teil, München und Berlin 1950 (101973); Rechtsfragen der leistenden Verwaltung, Stuttgart 1959. Hervorzuheben ist sein Alterswerk: Der Staat der Industrie-Gesellschaft. Dargestellt am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, München 1971. Die Romanisten, Geschichtswissenschaftler und Juristen kennen ggf. die von ihm neuübersetzte und herausgegebene Schrift von Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, 2 Bde., Tübingen 1951.
Zu nennen ist der von ihm herausgegebene Sammelband Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit. Aufsätze und Essays, Darmstadt 1968, der die Forsthoff-Abendroth-Sozialstaatsdebatte dokumentiert;53 ferner die von ihm als Mitherausgeber edierte Festschrift für Carl Schmitt zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern, Berlin 1959, sowie die Festschrift für Ernst Rudolf Huber zum 70. Geburtstag am 8. Juni 1973, Göttingen 1973.
Ihm selbst wurden drei Festschriften gewidmet: Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag, Stuttgart et al. 1967; Doehring, Karl (Hrsg.): Festgabe für Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag, München 1967; Schnur, Roman (Hrsg.): Festschrift für Ernst Forsthoff zum 70. Geburtstag, München 1972.54
Begriffsgeschichte
Im 18. Jahrhundert kümmerten sich die europäischen Staaten – im Reichsverbund waren es die deutschen Territorialstaaten – um das Gemeinwohl, jedoch gab es damals strenggenommen noch keine Wirtschaftspolitik. Es war nämlich die Polizei, die neben der Wahrnehmung der Sicherheitsbelange (Staatszweck Sicherheit) in der Stadtund Landwirtschaft vorsorglich i. S. der Schaffung einer »guten Ordnung« tätig wurde. Um nur einige instruktive Beispiele zu geben: Die Polizei schrieb u. a. vor, wie Felder zu bebauen waren, verpflichtete die bäuerlichen Besitzer von Grund und Boden, den Ernteertrag anzugeben und das Getreide auf den Markt zu bringen, kaufte bei Mißernten Getreide von auswärts an, um Teuerungen zu verhindern, richtete öffentliche Badeanstalten ein, um der mangelnden Hygiene Herr zu werden, ordnete das Zunftwesen, sorgte für eine hinreichende Münz- und Geldkontrolle, richtete Armenhäuser ein, um dem Betteln zu begegnen. Mit polizeilichen Mitteln sollte der Staatszweck Wohlfahrt angestrebt und verwirklicht werden. Die sogenannte polizeiliche Vorsorge war typisch für das entstehende moderne Staatswesen. Der Begriff läßt sich in der Literatur des 18. Jahrhunderts wiederholt nachweisen. Wohlfahrts- und Polizeistaat wurden als Synonyme begriffen. In Wolzendorffs Werk Der Polizeigedanke des modernen Staates ist darüber nachzulesen:
»Das Prinzip der ›allgemeinen Wohlfahrt‹ oder, wie es in der rührseligen Dekadenz des ancien régime genannt wurde, der ›allgemeinen Glückseligkeit‹, ›le bonheur de tous‹ – in der Geschichte der Staatslehre als ›Eudämonismus‹ bezeichnet – gibt nichts anderes als die Firma des Polizeigedankens, wie er für den Polizeistaat charakteristisch ist; eine Firma allerdings, an deren sittlichen Gehalt ihre Inhaber vielfach ebenso glaubten, wie diejenigen, die wissenschaftlich über sie schrieben.«55
Die negativen Konnotationen, die man gegenwärtig mit dem Begriff des Polizeistaates verbindet, der für ein »Durchgreifen« im Bereich der inneren Sicherheit steht, hat es seinerzeit nicht gegeben, wie ein Blick in die polizeiwissenschaftliche Literatur der damaligen Zeit belegt. Im Gegenteil wurde die Polizei des modernen Staates als bedeutende Errungenschaft gesehen, weil sie dem Bürgertum Schutz gewährte, wie Wolzendorff schrieb, »gegen seine beiden Widersacher: die asozialen Mächte des Verbrechertums und der feudalen Willkür.«56 Auch finden sich bei G. W. F. Hegel und Lorenz von Stein im 19. Jahrhundert entsprechende wohlfahrtspolizeiliche Anleihen, über die sich einmal Ernst Rudolf Huber in einem Artikel, Vorsorge für das Dasein. Ein Grundbegriff der Staatslehre Hegels und Lorenz v. Steins grundlegend ausgelassen hat.57 Es besteht darüber hinaus kein Zweifel – und läßt sich in Forsthoffs Buch Der Staat der Industrie-Gesellschaft nachlesen58 –, daß in dieser jedoch abgerissenen staatsund polizeiwissenschaftlichen Traditionslinie der Begriff der Daseinsvorsorge steht, mit dem Forsthoff das Wirken der staatlichen Leistungsverwaltung umschrieb. Allerdings zeichnete sich das Handeln der absolutistischen Wohlfahrtspolizei dadurch aus, daß es einen Gemeinwohlbezug aufwies. Diesen sucht man im Daseinsvorsorgekonzept vergeblich. Erstmals wurde der Begriff der Daseinsvorsorge in der Schrift Die Verwaltung als Leistungsträger aus dem Jahre 1938 erwähnt.59 Wirkungsgeschichtlich setzte er sich im deutschen Sprachraum, über die Amts- und Rechtssprache weit hinausgehend, eindrucksvoll durch.
Über die Begriffsbildung, also die Entstehung des Begriffs der Daseinsvorsorge selbst, ist viel geschrieben worden. Zeitlich nah liegt ein Bezug zur Existenzphilosophie der damaligen Zeit. In Heideggers Buch Sein und Zeit aus dem Jahre 1927 lautet die Überschrift des sechsten Kapitels »Die Sorge als Sein des Daseins«.60 Dort heißt es:
»Die Sorge liegt als ursprüngliche Strukturganzheit existenzial-apriorisch ›vor‹ jeder, das heißt immer schon in jeder faktischen ›Verhaltung‹ und ›Lage‹ des Daseins. Das Phänomen drückt daher keineswegs einen Vorrang des ›praktischen‹ Verhaltens vor dem theoretischen aus. Das nur anschauende Bestimmen eines Vorhandenen hat nicht weniger den Charakter der Sorge als eine ›politische Aktion‹ oder das ausruhende Sichvergnügen. ›Theorie‹ und ›Praxis‹ sind Seinsmöglichkeiten eines Seienden, dessen Sein als Sorge bestimmt werden muß.«61