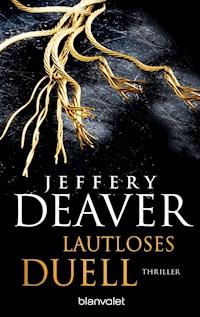7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John-Pellam-Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein skrupelloser Brandstifter versetzt das New Yorker Viertel Hell's Kitchen in Angst und Schrecken. Bei Dreharbeiten in einem heruntergekommenen Mietshaus sieht sich der Dokumentarfilmer John Pellam plötzlich von einer Flammenwand eingeschlossen. Ihm gelingt es zu entkommen, doch ein kleiner Junge stirbt. Verdächtig schnell steht für die Polizei die Täterin fest: Ettie Washington ist schwarz, arm und kann sich keinen Anwalt leisten. Noch ahnt niemand, dass der wahnsinnige Feuerteufel eine ganz persönliche Rechnung mit John Pellam offen hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Ähnliche
Jeffery Deaver
Feuerzeit
Thriller
Deutsch von Helmut Splinter
Buch
Ein skrupelloser Brandstifter versetzt das New Yorker Viertel Hell’s Kitchen in Angst und Schrecken. Bei Dreharbeiten in einem heruntergekommenen Mietshaus sieht sich der Dokumentarfilmer John Pellam plötzlich von einer Flammenwand eingeschlossen. Ihm gelingt es zu entkommen, doch ein kleiner Junge stirbt. Verdächtig schnell steht für die Polizei die Täterin fest: Ettie Washington ist schwarz, arm und kann sich keinen Anwalt leisten. Noch ahnt niemand, dass der wahnsinnige Feuerteufel eine ganz persönliche Rechnung mit John Pellam offen hat …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffrey Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Hell’s Kitchen« bei Pocket Books, Simon & Schuster, Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
E-Book-Ausgabe 2016Copyright der Originalausgabe © 2001 by Jeffery DeaverCopyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2003 by Wilhelm GoldmannVerlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHCopyright dieser Ausgabe © 2016 by Blanvalet in der VerlagsgruppeRandom House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: © www.buerosued.deUmschlagmotiv: © plainpicture/Anja Weber-Decker
ISBN 978-3-641-19625-7V001
www.blanvalet.de
Ich bin Profi. Ich habe in einem ziemlich harten Gewerbe überlebt.
Humphrey Bogart
Inhaltsverzeichnis
… Eins
Mit seinen schweren Stiefeln stapfte er die Treppe hinauf. Auf dem burgunderfarbenen Teppich mit Blumenmuster klangen seine Schritte dumpf, an den fadenscheinigen Stellen, wo das verkratzte Eichenholz durchschimmerte, etwas heller.
Das Treppenhaus war dunkel. In einem Viertel wie diesem wurden die Birnen aus den Deckenlampen und Notausgangsbeleuchtungen geklaut, sobald sie eingesetzt worden waren.
John Pellam hob den Kopf und versuchte, den seltsamen Geruch einzuordnen. Er konnte es nicht, wusste nur, dass er ihn beunruhigte und leicht nervös machte.
Erster Stock und weiter in den nächsten.
Er war vielleicht zum zehnten Mal in diesem alten Mietshaus, doch immer noch entdeckte er Dinge, die ihm bei den anderen Besuchen entgangen waren. Heute Abend wurde sein Blick auf einen Bleiglas-Einsatz mit einem über einer gelben Blume schwebenden Kolibri gelenkt.
Was machte dieses wunderschöne Bleiglas-Bild in einem hundert Jahre alten Mietshaus in einem der übelsten Viertel von New York? Und warum ein Kolibri?
Er hörte ein Schlurfen über sich und blickte nach oben. Er hatte gedacht, er wäre allein. Ein leiser Schlag, als etwas auf den Boden fiel. Ein Seufzen.
Wie der undefinierbare Geruch weckte auch dieses Geräusch ein unbehagliches Gefühl in ihm.
Im zweiten Stock hielt Pellam kurz an und betrachtete den Glaseinsatz über der Tür von Apartment 3B. Dieses Bild, ein Rotkehl-Hüttensänger oder Eichelhäher auf einem Zweig, war genauso sorgfältig gearbeitet wie der Kolibri im ersten Stock. Bei seinem ersten Besuch hier vor einigen Monaten hatte er die schäbige Fassade gesehen und erwartet, dass das Haus innen genauso verfallen wäre. Doch er hatte Unrecht gehabt. Es war ein Meisterstück der Handwerkskunst – Eichenholzdielen, die so dicht aneinander lagen wie Stahlplatten, Gips, der so makellos war wie Marmor, gedrechselte Geländer und Pfosten, bogenförmige Nischen, in denen früher bestimmt einmal katholische Heiligenbilder gestanden hatten. Er …
Wieder dieser Geruch. Diesmal stärker. Seine Nasenflügel flatterten. Noch ein Schlag über ihm. Jemand keuchte. Er spürte, dass es irgendwie dringend war, und stieg mit nach oben gerichtetem Blick weiter die enge Treppe hinauf, während er sich gegen das Gewicht seiner Tasche – Videokamera, Akkus und Zubehör – stemmte. Er war schweißgebadet. Es war zehn Uhr abends, doch im August war New York einfach nur die Hölle.
Was war das für ein Geruch?
Er weckte Erinnerungen in ihm, dann war er wieder verschwunden, überdeckt von dem Duft nach gebratenen Zwiebeln, Knoblauch und zu oft verwendetem Öl. Er erinnerte sich, dass an Etties Herd immer eine leere Dose Folgers-Kaffee mit altem Fett stand. »Ich kann Ihnen sagen, damit spare ich eine ganze Menge Geld.«
Auf halbem Wege zwischen dem zweiten und dritten Stock blieb Pellam noch einmal stehen und rieb sich die brennenden Augen. In dem Moment fiel es ihm ein:
Ein Studebaker.
Er stellte sich vor, wie der purpurrote, Ende der Fünfzigerjahre gebaute Wagen seiner Eltern, der wie ein Raumschiff ausgesehen hatte, langsam bis auf die Reifen abgebrannt war. Sein Vater hatte aus Versehen eine Zigarette auf den Sitz fallen lassen, und das Polster des Buck-Rogers-Wagens hatte Feuer gefangen. Pellam, seine Eltern und alle Nachbarn hatten sich das Schauspiel schockiert, erschrocken oder in heimlicher Freude betrachtet.
Und jetzt hatte er den gleichen Geruch in der Nase: schwelendes Feuer, Rauch. Plötzlich war er von heißen Rauchschwaden umhüllt. Er beugte sich über das Geländer und blickte ins Treppenhaus. Zuerst war alles nur dunkel und rauchig. Doch plötzlich wurde in einer heftigen Explosion die Tür im Erdgeschoss nach innen gerissen, und Flammen wie aus einer startenden Rakete schossen ins Treppenhaus und in den kleinen Flur im Erdgeschoss hinaus.
»Feuer!«, rief Pellam, als die schwarze Wolke den Flammen voraus zu ihm hinaufjagte. Er hämmerte an die nächstgelegene Tür. Keine Antwort. Er rannte die Treppen hinunter, doch die Flammen hielten ihn zurück, die wogende Welle aus Rauch und Funken war zu dicht. Der Würgereiz ließ ihn am ganzen Körper erzittern.
Verdammt, das Feuer kam rasend schnell näher! Flammen, Papierfetzen und Funken wurden wie in einem Wirbelsturm durchs Treppenhaus nach oben bis in den fünften, den obersten Stock getrieben.
Über sich hörte er einen Schrei und blickte hinauf.
»Ettie!«
Die alte Dame, eine Schwarze, hatte sich im vierten Stock übers Geländer gebeugt und blickte entsetzt in die Flammen. Sie muss es gewesen sein, die er vorher gehört hatte, als sie vor ihm die Stufen hinaufgeschlurft war. Die Plastiktüte mit Lebensmitteln rutschte ihr aus der Hand. Drei Orangen rollten an ihm vorbei und wurden zischend und blaue Funken sprühend von den Flammen verschluckt.
»John!«, rief sie. »Was ist …?« Sie hustete. »… das Haus.« Mehr konnte er nicht verstehen.
Er wollte zu ihr rennen, doch der Teppich und ein Müllhaufen im dritten Stock standen in Flammen. Sie schlugen ihm ins Gesicht, die orangefarbenen Tentakeln griffen nach ihm, sodass er rückwärts nach unten taumelte. Ein Stück brennender Tapete schwebte nach oben und um seinen Kopf herum. Bevor es Schaden anrichten konnte, war es zu Asche verbrannt. Pellam stolperte nach unten in den zweiten Stock, wo er an eine andere Tür pochte.
»Ettie«, rief er ins Treppenhaus hinauf. »Gehen Sie zu einer Feuerleiter! Gehen Sie raus!«
Am Ende des Flurs wurde vorsichtig eine Tür geöffnet, und ein spanisch aussehender Junge mit weit aufgerissenen Augen und einem gelben Power Ranger in der Hand blickte ihm entgegen.
»Ruf die neun-eins-eins!«, rief Pellam. »Los, beeil dich!«
Die Tür wurde wieder zugeschlagen. Pellam pochte heftig dagegen. Er dachte, er würde Schreie hören, doch er war sich nicht sicher, weil der Lärm des Feuers, der sich wie ein beschleunigender Lastwagen anhörte, alles andere übertönte. Die Flammen fraßen sich durch den Teppich nach oben, verzehrten das Geländer wie Pappe.
»Ettie«, rief er hustend nach oben und ließ sich auf die Knie fallen.
»John! Hauen Sie ab. Los, bringen Sie sich in Sicherheit!«
Die Flammen zwischen ihnen wurden immer dichter, wanderten über Wände, Fußboden und Teppich. Das Glasbild explodierte, Scherben von Bleiglas-Vögeln regneten auf ihn herab.
Wie konnte sich das Feuer so schnell ausbreiten, fragte sich Pellam, der immer schwächer wurde. Funken sprühten um ihn herum, knackten und knallten wie Querschläger. Die Luft war aufgebraucht, er konnte nicht mehr atmen.
»John, helfen Sie mir!«, schrie Ettie. »Es brennt auch auf der anderen Seite! Ich kann nicht …« Die Feuerwand hatte sich um sie geschlossen und ihr den Weg zum Fenster abgeschnitten, an dem sich die Feuerleiter befand.
Vom dritten Stock abwärts und ersten Stock aufwärts rasten die Flammen auf ihn zu. Oben sah er Ettie im vierten Stock, wie sie vor der näher rückenden Feuerwand zurückwich. Der Teil der Treppe, der sie voneinander trennte, brach zusammen. Zwei Stockwerke über ihm saß Ettie in der Falle.
Er würgte, schlug die glühenden Fetzen fort, die Löcher in sein Hemd und seine Jeans brannten. Die Wand zerbarst unter dem Druck des Feuers und fiel nach außen. Flammen züngelten in seine Richtung und verfingen sich im Ärmel seines grauen Hemds.
Der Gedanke an den Tod wurde verdrängt von den heftigen Schmerzen durch das Feuer, das ihn blind machen, seine Haut zu schwarzem Gewebe verbrennen und seine Lungen zum Platzen bringen wollte.
Er ließ sich auf seinen Arm fallen, um die Flammen zu ersticken, und richtete sich mühsam wieder auf. »Ettie!«
Er sah, wie sie sich umdrehte und ein Fenster aufriss.
»Ettie«, rief er wieder. »Versuchen Sie, aufs Dach zu klettern. Die Feuerwehr wird mit einem Wagen kommen …« Er trat ebenfalls an ein Fenster und schleuderte nach kurzem Zögern die Segeltuchtasche mit der vierzigtausend Dollar teuren Kameraausrüstung durch die Scheibe, wo sie auf der anderen Seite auf der Metalltreppe liegen blieb. Ein halbes Dutzend andere Bewohner rannte achtlos an der Tasche vorbei hinunter auf die Gasse.
Pellam kletterte auf die Feuerleiter und blickte zurück.
»Aufs Dach!«, rief er noch einmal zu Ettie hinauf.
Doch vielleicht war auch dieser Weg versperrt; die Flammen waren mittlerweile überall.
Oder vielleicht konnte sie in ihrer Panik nicht denken.
Durch das tosende Feuer hindurch warf sie ihm ein schwaches Lächeln zu. Ohne dass er sie schreien oder rufen hörte, zerschmetterte Etta Wilkes Washington ein seit langem übermaltes Fenster und hielt einen Moment inne, während sie nach unten taumelte. Dann sprang sie hinaus, fünfzehn Meter über der Gasse mit den Pflastersteinen, auf die Isaac B. Cleveland fünfundfünfzig Jahre zuvor seine Liebeserklärung an die junge Ettie Wilkes geschrieben hatte. Die unscharfen Umrisse der alten Frau verschwanden im Rauch.
Holz und Stahl keuchten, dann ein Schlag wie mit dem Holzhammer auf Metall, als irgendwo ein tragendes Teil nachgab. Pellam sprang bis an den Rand der Feuerleiter, wo er fast über das Geländer stolperte. Während er nach unten hechtete, regneten orangefarbene Flammen auf ihn herab.
Er hatte es genauso eilig wie die Bewohner – doch er floh nicht vor dem verheerenden Feuer, sondern er wollte, in Gedanken an Etties Tochter, die Leiche der Frau fortbringen, bevor das Gebäude zusammenbrechen und sie in einem glühend heißen, nicht zu erkennenden Grab verschluckt haben würde.
… Zwei
Als er die Augen öffnete, blickte ein Wachmann auf ihn herab.
»Sir, sind Sie Patient hier?«
Er schnellte hoch und merkte, dass er sich bei der Flucht vor dem Feuer verletzt und Brandwunden zugezogen hatte. Aber erst die fünf Stunden, die er in der Notaufnahme auf dem orangefarbenen Fiberglasstuhl geschlafen hatte, hatten ihn so richtig fertig gemacht. Sein Nacken tat höllisch weh, als er sich bewegte.
»Ich bin eingeschlafen.«
»Sie können hier nicht schlafen.«
»Ich war Patient hier. Ich wurde gestern Abend hier behandelt, und dann bin ich eingeschlafen.«
»Ja, Sir. Sie wurden hier zwar behandelt, aber Sie können trotzdem nicht bleiben.«
Seine Jeans waren voller Brandlöcher, und er hatte den leisen Verdacht, dass er völlig verdreckt war. Die Wache muss ihn für einen Landstreicher gehalten haben.
»Gut«, sagte er, »noch eine Minute.«
Pellam drehte seinen Kopf langsam im Kreis. Tief in seinem Nacken knackte es, dann ein stechender Schmerz, als würde sich ein Eisgetränk in seinem Kopf ausbreiten. Er zuckte zusammen und blickte sich schließlich um. Er verstand, warum ihn die Wache rausschmeißen wollte. Das Zimmer war voller Patienten, die auf ihre Behandlung warteten. Aufgeregte Gespräche brandeten durch den Raum – englisch, spanisch, arabisch. Alle Anwesenden hatten Angst oder waren resigniert oder gereizt. Die Resignierten fand Pellam am schlimmsten. Neben ihm saß ein Mann, nach vorne gebeugt, die Unterarme auf die Knie gestützt. In seiner rechten Hand baumelte ein Kinderschuh.
Der Wachmann hatte seine Botschaft überbracht, aber keine Lust, für die Durchsetzung zu sorgen. Statt dessen ging er zu zwei Jugendlichen, die in einer Ecke einen Joint rauchten.
Pellam stand auf und reckte sich. Er kramte in der Tasche und fand den Zettel, den er am Abend zuvor erhalten hatte. Blinzelnd las er, was darauf stand. Dann schnappte er sich seine Videokamera und ging den langen Flur entlang, wo er den Schildern zum Flügel B folgte.
Die dünne grüne Linie bewegte sich kaum einen Millimeter.
Der stattliche indische Arzt neben dem Bett hob den Kopf, als würde er überlegen, ob der Hewlett-Packard-Bildschirm kaputt war. Er blickte hinunter auf seine Patientin, die regungslos unter der Bettdecke lag, und hängte das Klemmbrett an den Haken.
John Pellam stand in der Tür. Sein Blick glitt von der dämmrigen Landschaft vor den Fenstern des Manhattan Hospital zurück zu Ettie Washington.
»Liegt sie im Koma?«, fragte er.
»Nein«, antwortete der Arzt. »Sie schläft. Sediert.«
»Kommt sie wieder in Ordnung?«
»Sie hat sich einen Arm gebrochen und einen Knöchel verstaucht. Wir haben keine inneren Verletzungen gefunden. Wir werden noch ein paar Untersuchungen durchführen. Am Gehirn. Sie ist auf den Kopf geknallt, als sie aus dem Fenster gesprungen ist. Sie wissen aber, dass nur Familienmitglieder in die Intensivstation dürfen?«
»Oh«, seufzte Pellam erschöpft. »Ich bin ihr Sohn.«
Der Arzt starrte ihn einen Augenblick an, dann blinzelte er in Ettie Washingtons Richtung, deren Haut so dunkel wie ein Mahagonigeländer war.
»Sie … ihr Sohn?« Die leeren Augen blickten wieder zu ihm auf.
Von einem Arzt, der auf der wilden West Side von Manhattan arbeitet, würde man mehr Sinn für Humor erwarten. »Ich sag Ihnen was«, meinte Pellam. »Lassen Sie mich fünf Minuten hier sitzen. Ich werde schon keine Bettpfannen klauen. Sie können sie ja nachzählen, bevor ich gehe.«
Immer noch kein Lächeln. »Fünf Minuten«, sagte er schließlich.
Pellam ließ sich auf den Stuhl fallen und stützte sein Kinn in die Hände. Sein Nacken brannte vor Schmerzen. Er setzte sich aufrecht hin und neigte den Kopf zur Seite.
Zwei Stunden später stürmte eine Krankenschwester ins Zimmer und weckte ihn. Sie interessierte sich mehr für Pellams Verband und seine zerrissenen Jeans als für seine Anwesenheit an sich.
»Was ist los, dass hier so viele Patienten sind?«, fragte sie in ihrem kehligen, langgezogenen Dallas-Tonfall. »Und wer ist hier zu Besuch?«
Pellam massierte seinen Nacken und nickte in Richtung des Bettes. »Wir wechseln uns ab. Wie geht’s ihr?«
»Oh, sie ist eine zähe, alte Dame.«
»Wieso wacht sie nicht auf?«
»Vollgedröhnt.«
»Der Arzt hat von weiteren Untersuchungen geredet.«
»Das tun sie immer. Bringen ihren Arsch in Sicherheit. Ich denke, sie kommt wieder in Ordnung. Ich habe vorher mit ihr geredet.«
»Tatsächlich? Was hat sie gesagt?«
»So was Ähnliches wie: ›Jemand hat meine Wohnung abgefackelt. Es ist doch unsäglich, so was tun, oder?‹ Na ja, sie hat ein anderes Wort als ›unsäglich‹ verwendet.«
»Ja, unsere Ettie.«
»Das gleiche Feuer?«, fragte die Schwester mit Blick auf seine verbrannte Kleidung.
Pellam nickte und erzählte ihr von Etties Sprung aus dem Fenster. Sie war nämlich nicht auf dem Kopfsteinpflaster gelandet, sondern die Müllsäcke der letzten zwei Tage hatten den Aufprall gedämpft. Pellam hatte sie zur Rettungsmannschaft gebracht und war zurück ins Haus gegangen, um den anderen Bewohnern zu helfen. Schließlich hatte auch ihm der Rauch so sehr zugesetzt, dass er in Ohnmacht gefallen war. Erst hier im Krankenhaus war er wieder aufgewacht.
»Sie wissen schon, dass Sie voller Ruß sind?«, fragte die Krankenschwester. »Sie sehen aus wie jemand aus den Kommandotruppen in den Schwarzenegger-Filmen.«
Pellam wischte über sein Gesicht und betrachtete seine fünf schwarzen Fingerspitzen.
»Moment.« Die Schwester verschwand im Flur und kam mit einem nassen Lappen zurück. Kurz überlegte sie, ob sie ihm das Gesicht abwischen sollte, gab dann aber Pellam den Lappen. Pellam putzte sich das Gesicht ab, bis der Lappen schwarz war.
»Äh, möchten Sie einen Kaffee?«, fragte sie.
In Pellams Magen rumorte es. Er vermutete, dass er mindestens ein Pfund Asche geschluckt hatte. »Nein, danke. Wie sieht mein Gesicht aus?«
»Jetzt nur noch dreckig. jedenfalls besser als vorher. Ich muss die Pfannen wechseln. Tschüss, erst mal.« Und weg war sie.
Pellam streckte seine langen Beine aus und untersuchte die Löcher in seiner Levi’s. Völlig hinüber. Für die Überprüfung seiner Betacam brauchte er länger; irgendeine nette Seele hatte sie den Sanitätern gegeben und dafür gesorgt, dass sie mit zur Notaufnahme genommen wurde. Er führte den Standardtest durch – schütteln. Nichts klapperte. Der Ampex-Rekorder hatte ein paar Dellen, doch die Mechanik lief einwandfrei, und das Band, das darin lag – mit dem letzten Interview, das je in der Sechsunddreißigsten Straße West Nummer 458 aufgenommen wurde –, war unversehrt.
Also, John, worüber wollen wir heute reden? Möchten Sie mehr über Billy Doyle hören, meinen ersten Mann? Der alte Hurensohn. Wissen Sie, dieser Kerl und Hell’s Kitchen waren eins. Hier war er groß, aber überall sonst ganz klein. Woanders war er ein Nichts. Hell’s Kitchen war wie dieses Haus, wie eine eigene Welt. Hmm, ich muss Ihnen eine gute Geschichte über ihn erzählen. Ich denke, sie wird Ihnen gefallen …
An viel mehr von dem, was ihm Ettie beim letzten Interview vor einigen Tagen erzählt hatte, konnte er sich nicht mehr erinnern. Er hatte die Kamera in ihrer kleinen Wohnung aufgebaut, die angefüllt war mit den Momentaufnahmen eines sieben Jahrzehnte währenden Lebens – mit etwa hundert Bildern, mit Körben, Schnickschnack, billigen Möbeln von Goodwill und Essen, das zum Schutz vor Kakerlaken in Tupperdosen verwahrt wurde, die sie sich eigentlich gar nicht leisten konnte. Er hatte die Kamera aufgestellt und eingeschaltet und Ettie dann einfach reden lassen.
Also, Leute, die in Hell’s Kitchen wohnen, kommen auf solche Gedanken. Sie schmieden Pläne, wissen Sie. Billy wollte Land. Er hatte ein Auge auf ein paar Grundstücke geworfen, die in der Nähe vom heutigen Javits Center lagen. Ich sag Ihnen, wenn er das gemacht hätte, wäre er ein reicher Stinker geworden. Ich darf ›Stinker‹ sagen, weil er das über sich selbst auch gesagt hat.
Eine Bewegung auf dem Bett riss ihn aus seinen Gedanken.
Die alte Frau tippte mit geschlossenen Augen auf den Rand der Bettdecke, als würde sie mit zwei Fingern unsichtbare Perlen suchen.
Pellam machte sich Sorgen. Er erinnerte sich an die letzten Lebenszeichen von Otis Balm, einem hundertzweijährigen Mann, der vor einem Monat gestorben war. Er hatte zu dem Fliederbusch vor dem Fenster im West-Side-Pflegeheim geschaut und angefangen, auf die Bettdecke zu tippen. Jahrelang hatte er im selben Haus wie Ettie gewohnt und sich, obwohl er im Heim untergebracht war, gefreut, über seine Zeit in Hell’s Kitchen reden zu können. Plötzlich hatte der Alte nichts mehr gesagt und auf die Bettdecke getippt – genau wie Ettie jetzt. Dann hatten sich auch seine Finger nicht mehr bewegt. Pellam hatte Hilfe gerufen. Der Arzt hatte den Tod bestätigt. Das täten sie immer, hatte er erklärt – am Ende würden sie immer auf die Bettdecke tippen.
Pellam beugte sich zu Ettie Washington hinüber. Sie stöhnte plötzlich, und aus dem Stöhnen wurden Worte. »Wer ist da?« Ihre Hände blieben ruhig, und sie öffnete die Augen, konnte aber offenbar nicht gut sehen. »Wer ist da? Wo bin ich?«
»Ettie«, sagte Pellam, ohne zu drängen. »Ich bin’s, John Pellam.«
Ettie blinzelte ihn an. »Ich kann kaum was sehen. Wo bin ich?«
»Im Krankenhaus.«
Sie hustete und bat um ein Glas Wasser. »Ich bin froh, dass Sie hier sind. Sind Sie heil da rausgekommen?«
»Ja, das bin ich«, bestätigte Pellam und schenkte ihr ein Glas Wasser ein, das sie in einem Zug leerte.
»Irgendwie erinnere ich mich, dass ich gesprungen bin. O je, hatte ich eine Angst. Der Arzt meinte, ich sei überraschend gut in Form. Genau das hat er gesagt. ›Überraschend gut.‹ Zuerst habe ich nicht kapiert, was er meinte.« Sie murrte. »Er ist Inder. Na ja, Sie wissen schon, einer von Übersee. Curry und Elefanten. Hab noch keinen einzigen amerikanischen Arzt hier gesehen.«
»Tut es sehr weh?«
»Würde ich schon sagen, ja.« Sie untersuchte ihren Arm. »Ich sehe doch übel aus, oder?« Ettie schnalzte mit der Zunge, während sie die beeindruckenden Bandagen beäugte.
»Nein, wie ein Covergirl, alles in allem.«
»Sie sehen aber auch ziemlich mitgenommen aus, John. Ich bin so froh, dass Sie da rausgekommen sind. Mein letzter Gedanke beim Fallen war: ›Nein, John wird auch sterben!‹ Ein komischer Gedanke.«
»Ich habe den einfacheren Weg genommen – die Feuerleiter.«
»Was ist denn eigentlich passiert?«
»Ich weiß nicht. Von einer Minute auf die andere war das ganze Haus weg. Wie eine Streichholzschachtel.«
»Ich war beim Einkaufen, und auf dem Weg nach oben in meine Wohnung …«
»Ich habe Sie gehört. Sie müssen nach Hause gekommen sein, kurz bevor ich das Haus betreten habe. Auf der Straße habe ich Sie nicht gesehen.«
»Ich habe noch nie gesehen, dass sich ein Feuer so schnell ausgebreitet hat«, fuhr sie fort. »Wie beim Aurora. Der Club, von dem ich Ihnen erzählt habe. Auf der Neunundvierzigsten Straße. Wo ich ein oder zwei Mal gesungen habe. Ist vierundsiebzig abgebrannt. Am dreizehnten März. Eine Menge Leute starben. Erinnern Sie sich, dass ich Ihnen die Geschichte erzählt habe?«
Pellam erinnerte sich nicht. Er nahm an, dass er den Bericht irgendwo in den stundenlangen Aufnahmen von Ettie Washington finden würde, die in seiner Wohnung lagen.
Sie schnäuzte sich und musste wieder husten. »Dieser Rauch. Das war das Schlimmste. Haben es alle nach draußen geschafft?«
»Es wurde niemand getötet«, antwortete Pellam. »Bei Juan Torres ist es kritisch. Er liegt oben auf der Intensivstation für Kinder.«
Etties Gesicht erstarrte. Pellam hatte diesen Ausdruck nur einmal an ihr gesehen – als sie von ihrem jüngsten Sohn erzählt hatte, der vor einigen Jahren auf dem Times Square umgebracht worden war. »Juan?«, fragte sie und machte eine längere Pause. »Ich dachte, er sei ein paar Tage bei seiner Großmutter in der Bronx. Er war zu Hause?«
Sie war zutiefst betrübt, doch Pellam wusste nicht, wie er sie trösten sollte. Etties Blick wanderte zur Bettdecke zurück, auf die sie getrommelt hatte. Ihr Gesicht wurde aschfahl.
»Wie wär’s, wenn ich meine Unterschrift auf diesen Gips setze?«, fragte er.
»Klar, warum nicht.«
Pellam zog seinen Markierstift heraus. »Egal, wo? Wie wär’s hier?« Schwungvoll kritzelte Pellam seinen Namen auf den Gips.
Draußen auf dem Flur ertönte viermal eine selbstgefällige elektronische Klingel.
»Soll ich vielleicht Ihre Tochter anrufen?«, fragte Pellam.
»Nein«, antwortete Ettie. »Ich habe schon mit ihr geredet. Hab sie heute Morgen angerufen, als ich aufgewacht bin. Sie hatte sich tierische Sorgen gemacht, aber ich habe ihr gesagt, ich sei noch nicht für den großen Abschied bereit. Sie sollte erst die Testergebnisse abwarten, bevor sie kommt. Wenn sie mich aufschneiden müssen, wär’s mir lieber, sie würde kommen. Vielleicht kann ich sie mit einem von den hübschen Ärzten verkuppeln. Einen von der Notaufnahme. Lisbeth hat eine Schwäche für reiche Ärzte. Hab ich Ihnen doch erzählt.«
An der halb geöffneten Tür wurde geklopft. Vier Männer in Anzügen betraten das Zimmer. Sie waren groß, und durch die düstere Stimmung, die sie verbreiteten, wirkte das geräumige Krankenzimmer trotz der drei leeren Betten plötzlich sehr klein.
Pellam wusste, dass es Polizisten waren. Also ging man von Brandstiftung aus. Das würde erklären, warum sich das Feuer so schnell ausgebreitet hatte.
Ettie nickte ihnen unsicher zu.
»Mrs. Washington?«, fragte der älteste Mann. Er war Mitte vierzig, hatte schmale Schultern und einen Bauch, der eine Schrumpfkur vertragen könnte. An seiner Hüfte hing ein großer Revolver.
»Ich bin Fire Marshal Lomax. Das hier ist mein Stellvertreter.« Er nickte zu einem jungen Hünen mit Bodybuilder-Figur. »Und die beiden hier sind Detectives vom New York City Police Department.«
Einer der Polizisten bat Pellam, zu gehen.
»Nein, nein«, wehrte sich Ettie. »Er ist ein Freund von mir. Er kann ruhig bleiben.«
»Ist schon in Ordnung«, meinte Pellam zu Ettie. »Bestimmt wollen sie mit mir auch reden. Ich komme wieder, wenn wir fertig sind.«
»Sie sind ein Freund von ihr?«, fragte Lomax. »Ja, wir würden uns gerne noch mit Ihnen unterhalten. Aber Sie kommen nicht mehr hier rein. Geben Sie dem Kollegen da Ihren Namen und Ihre Adresse und verschwinden Sie.«
»Bitte?« Pellam lächelte verwirrt.
»Name und Adresse an ihn«, wiederholte Lomax und nickte in Richtung des Detectives. »Und dann machen Sie, dass Sie wegkommen.«
»Das werde ich wohl nicht tun.«
Der Marshal stemmte seine breiten Hände in seine breiten Hüften.
Ganz wie ihr wollt. Ihr habt die Wahl, dachte Pellam, kreuzte die Arme vor der Brust und stellte sich leicht breitbeinig hin. »Ich werde sie nicht allein lassen.«
»John, nein, es ist in Ordnung«, sagte Ettie.
»Besucher haben zu diesem Zimmer keinen Zutritt«, erklärte Lomax. »Hm, und fragen Sie nicht, warum. Das ist unsere Sache und geht Sie nichts an.«
»Ich glaube nicht, dass meine Sache Sie etwas angeht«, erwiderte Pellam. Der Satz stammte aus einem nicht produzierten Kinofilm, für den er vor Jahren das Drehbuch geschrieben hatte. Sehnsüchtig hatte er auf die Gelegenheit gewartet, den Satz einmal anbringen zu können.
»Himmel Arsch«, schimpfte einer der Detectives. »Für so einen Quatsch haben wir keine Zeit. Raus mit ihm.«
Der Stellvertreter wickelte seine Hände wie einen Schraubstock um Pellams Arm und zerrte ihn zur Tür. Ein stechender Schmerz jagte durch seinen steifen Nacken. Pellam machte sich mit einem Ruck frei, was den Polizisten glauben ließ, dass er vielleicht ein paar Minuten gegen die Wand gedrückt werden wollte. Dort hing er beinahe in der Luft, bis sein Arm taub war.
»Pfeifen Sie diesen Kerl zurück«, schnauzte Pellam Lomax an. »Was geht hier eigentlich vor?«
Doch der Fire Marshal war beschäftigt.
Er konzentrierte sich auf die kleine weiße Karte in seiner Hand, als er Ettie über ihre Rechte informierte und wegen fahrlässiger Gefährdung, Überfall und Brandstiftung verhaftete.
»He, vergiss nicht den versuchten Mord«, erinnerte ihn einer der Detectives.
»Oh, stimmt«, brummte Lomax. »Also, Sie haben ihn ja gehört«, meinte er schulterzuckend zu Ettie.
… Drei
Das Haus, in dem Ettie gewohnt hatte, hatte in Hell’s Kitchen gestanden, der Gegend westlich der Achten Avenue zwischen der Vierunddreißigsten und Neunundfünfzigsten Straße. Wie die meisten Mietshäuser in New York, die im neunzehnten Jahrhundert gebaut worden waren, hatte auch dieses eine Grundfläche von etwa zehn auf dreiundzwanzig Meter gehabt und aus Kalkstein bestanden. Es war rötlich mit einem leichten Terrakotta-Ton gewesen.
Vor 1901 hatte es keine Vorschriften für den Bau dieser sechsstöckigen Wohnhäuser gegeben, und viele Baufirmen hatten alten Gips und Mörtel, vermischt mit Sägemehl, verwendet. Doch diese von der Bausubstanz her schlechteren Häuser waren schon vor langer Zeit zusammengebrochen. Aber Gebäude wie dieses, wie Ettie Washington in John Pellams unerbittliche Videokamera erklärt hatte, war von Männern gebaut worden, denen ihr Handwerk noch wichtig gewesen war. Nischen für die Jungfrau Maria und Kolibris aus Glas über den Türen. Es gab keinen Grund, warum diese Häuser nicht zweihundert Jahre halten sollten.
Keinen Grund außer Benzin und ein Streichholz …
An diesem Morgen ging Pellam zu dem, was von diesem Gebäude noch übrig war.
Viel war es nicht. Nur eine schwarze Steinhülle, gefüllt mit einem Wirrwarr aus verschmorten Matratzen, Möbeln, Papier und Haushaltsgeräten. Der untere Teil des Gebäudes war nur eine schlammige graue Masse aus Asche und Wasser. Pellam erstarrte, als er eine Hand entdeckte, die aus einem Haufen Müll herausragte. Er war schon losgerannt, als er die Naht in der Vinyloberfläche am Handgelenk entdeckte. Es war eine Schaufensterpuppe.
Ein grober Scherz ganz im Stil von Hell’s Kitchen.
Auf einem Schutthaufen thronte völlig waagerecht eine Keramikbadewanne auf ihren geschwungenen Beinen. Sie war mit brackigem Wasser gefüllt.
Pellam ging um das Haus herum, schob sich bis zum gelben Absperrband zwischen die Gaffer hindurch, die hier standen, als würden sie darauf warten, dass sich die Ladentore für den Sommerschlussverkauf öffneten. Die meisten wirkten so gierig wie Lumpensammler, doch die Reste waren dürftig. Es gab Dutzende fleckiger, verbrannter Matratzen. Skelette billiger Möbel und Haushaltsgeräte, Bücher mit Wasserflecken. Eine hasenohrförmige Antenne – das Haus war nicht verkabelt gewesen – saß auf einem Klumpen Plastik. Nur das Samsung-Schild und eine Platine deuteten darauf hin, dass es sich einmal um einen Fernseher gehandelt hatte.
Der Gestank war grässlich.
Schließlich entdeckte Pellam den Mann, nach dem er gesucht hatte. Es hatte einen Kostümwechsel gegeben – jetzt trug er Jeans, eine Windjacke und Feuerwehrstiefel.
Pellam duckte sich und ging unter der Absperrung durch. Er versuchte, genügend Autorität auszustrahlen, um nicht von der Spurensicherung und den Feuerwehrleuten aufgehalten zu werden, die hier herumirrten.
»Da, die bröckelige Stelle«, sagte Lomax gerade zu seinem hünenhaften Stellvertreter. »Hier wird’s heiß. Der Ursprungsherd ist hinter dieser Wand. Lass das von einem Fotografen aufnehmen.«
Der Marshal ging in die Hocke und untersuchte etwas auf dem Boden. Pellam blieb in der Nähe stehen. Lomax blickte auf. Pellam hatte sich geduscht und umgezogen. Die Tarnfarbe auf seinem Gesicht war fort, sodass der Marshal einen Moment brauchte, bis er ihn erkannte.
»Sie«, meinte Lomax.
Pellam hielt es für besser, es auf die freundliche Tour zu probieren. »Na, wie kommen Sie voran?«
»Verschwinden Sie!«, schnauzte der Marshal.
»Ich wollte nur kurz mit Ihnen reden.«
Lomax wandte sich wieder dem Boden zu.
Im Krankenhaus hatten sie seinen Namen notiert und von der Polizei überprüfen lassen. Lomax, seine Detectives und vor allem sein großer Stellvertreter schienen zu bedauern, dass es keinen Grund gab, Pellam festzuhalten oder ihn aufs Peinlichste zu vernehmen, sodass sie sich mit einer kurzen Erklärung begnügten und ihn auf den Flur hinausschoben, mit der Warnung, dass man ihn wegen Behinderung der Polizei einsperren würde, sollte er nicht in fünf Minuten aus dem Krankenhaus verschwunden sein.
»Nur ein paar Fragen«, bat er.
Lomax, ein zerknitterter Mensch, erinnerte Pellam an einen Trainer aus seiner Highschool-Zeit, der ein mieser Sportler gewesen war. Lomax erhob sich und sah Pellam von oben bis unten an. Ein schneller, prüfender Blick. Weder vorsichtig noch streitlustig, nur der Versuch, sich ein Bild von seinem Gegenüber zu machen.
»Ich würde gerne wissen, warum Sie sie festgenommen haben«, fragte Pellam. »Das ergibt doch keinen Sinn. Ich war da. Ich weiß, dass sie das Feuer nicht gelegt hat.«
»Das hier ist ein Tatort.« Lomax wandte sich wieder der bröckeligen Stelle zu. Seine Worte hörten sich eigentlich nicht wie eine Warnung an, doch Pellam vermutete, dass sie es dennoch waren.
»Ich wollte Sie nur fragen …«
»Gehen Sie wieder hinter die Linie.«
»Die Linie?«
»Die Absperrung.«
»Gleich. Lassen Sie mich nur …«
»Nimm ihn fest«, bellte Lomax seinen Stellvertreter an, der sich gleich an die Arbeit machen wollte.
»Kein Problem. Ich gehe schon.« Pellam hob die Hände und marschierte hinter die Absperrung.
Dort ging er in die Hocke und nahm die Betacam zur Hand, die er auf Lomax’ Hinterkopf richtete. Durch den Sucher sah er, wie ein Uniformierter mit Lomax flüsterte, der zu Pellam schielte, sich aber gleich wieder umdrehte. Hinter ihnen schwelte der Trümmerberg des abgebrannten Hauses. Pellam kam der Gedanke, dass es erstklassiges Filmmaterial war, obwohl er nur wegen Lomax drehte.
Der Fire Marshal ignorierte Pellam, bis er es nicht mehr aushielt, zu ihm ging und das Objektiv zur Seite schob. »Also gut. Hören Sie mit dem Scheiß auf.«
Pellam schaltete die Kamera ab.
»Sie hat das Feuer nicht gelegt«, sagte Pellam.
»Was sind Sie? Reporter?«
»So was Ähnliches.«
»Sie hat das Feuer also nicht gelegt, hä? Wer dann? Sie etwa?«
»Ich habe vor Ihrem Stellvertreter meine Aussage gemacht. Hat er übrigens einen Namen?«
Lomax überhörte die Frage. »Antworten Sie. Wenn Sie so sicher sind, dass sie das Feuer nicht gelegt hat, dann waren Sie es vielleicht.«
»Nein, ich habe das Feuer auch nicht gelegt.« Pellam seufzte frustriert.
»Wie sind Sie da rausgekommen? Aus dem Gebäude, meine ich.«
»Über die Feuerleiter.«
»Aber sie hat ausgesagt, sie sei nicht in ihrer Wohnung gewesen, als es losging. Wer hat Ihnen die Tür aufgemacht?«
»Rhonda Sanchez aus 2D.«
»Sie kennen sie?«
»Hab sie mal getroffen. Sie wusste, dass ich einen Film über Ettie drehe. Deswegen hat sie mich reingelassen.«
Lomax ließ keine Pause bis zur nächsten Frage. »Wenn Ettie nicht da war, warum sind Sie dann überhaupt reingegangen?«
»Wir waren um zehn Uhr verabredet. Ich dachte, sie würde gleich kommen. Ich wollte oben warten. Es hat sich rausgestellt, dass sie einkaufen war.«
»Kommt Ihnen das nicht irgendwie komisch vor – eine alte Frau, die abends um zehn noch in den Straßen von Hell’s Kitchen rumlungert?«
»Ettie hat ihre eigenen Zeiten.«
Lomax war in Gesprächslaune. »Sie waren also zufällig in der Nähe der Feuerleiter, als das Feuer ausbrach. Ein Glückspilz, was?«
»Manchmal bin ich das«, meinte Pellam.
»Sagen Sie mir genau, was Sie gesehen haben.«
»Ich habe meine Aussage schon gemacht.«
»Und die sagt einen Scheißdreck aus«, schnauzte Lomax zurück. »Geben Sie ein paar Einzelheiten. Seien Sie kooperativ.«
Pellam dachte einen Moment nach und entschied sich, dass seine Kooperationsbereitschaft Ettie nur nützen könnte. Er erzählte von der Tür, die nach außen flog, vom Feuer und vom Rauch. Und den Funken. Eine Menge Funken. Lomax und sein Profikämpfer-Stellvertreter blieben gelassen. »Ich bin wohl keine große Hilfe, nehme ich an«, meinte Pellam schließlich.
»Wenn Sie die Wahrheit sagen, sind Sie mehr als eine Hilfe.«
»Warum sollte ich lügen?«
»Dann sagen Sie mir doch mal, Sie Glückspilz, ob es mehr Feuer oder mehr Rauch gab.«
»Mehr Rauch, denke ich.«
Der Fire Marshal nickte. »Welche Farbe hatten die Flammen?«
»Ich weiß nicht. Feuerfarben. Orange.«
»Und blau?«
»Nein.«
Lomax notierte sich die Angaben.
»Was haben Sie gegen sie in der Hand? Beweise? Zeugen?«
Mit seinem Grinsen wollte Lomax zeigen, dass er von seinem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch machte.
»Jetzt hören Sie mal«, schnauzte Pellam. »Sie ist eine siebzigjährige Dame …«
»He, Glückspilz, ich sag Ihnen mal was. Letztes Jahr haben fünf Marshals zehntausend verdächtige Feuer in der Stadt untersucht. Mehr als die Hälfte waren Brandstiftung, und ein Drittel dieser Feuer wurde von Frauen gelegt.«
»Das kommt mir aber nicht wie ein zulässiger Beweis vor. Was ist denn Ihr hinreichender Verdachtsgrund?«
Lomax drehte sich zu seinem Stellvertreter. »Hinreichender Verdachtsgrund. Er kennt den Ausdruck ›hinreichender Verdachtsgrund‹. Haben Sie das aus einer Krimi-Serie? Ach nee, Sie sehen eher aus, als würden Sie O. J. Simpson gucken. Ich scheiß auf Sie und ihren hinreichenden Verdachtsgrund. Jetzt verschwinden Sie gefälligst.«
Wieder hinter der Absperrung, machte Pellam weitere Filmaufnahmen und wurde weiterhin von Lomax ignoriert.
Er filmte die rußige Gasse hinter dem Haus und verewigte den Berg aus Müllsäcken, der Etties Haut gerettet hatte. Plötzlich hörte er ein leises Heulen, ein Geräusch, das Rauch machen würde, wenn Rauch ein Geräusch machen könnte.
Er ging auf die andere Straßenseite zu einer Baustelle, wo ein sechzigstöckiges Hochhaus kurz vor der Vollendung war. Als er näher kam, wurde der Rauch zu Worten. »Eine von ihnen. Ich bin eine von ihnen.« Die Frau saß im Schatten eines Müllcontainers neben zwei abgewetzten steinernen Bulldoggen, die einhundertdreißig Jahre lang an der Treppe zu Etties Haus Wache gehalten hatten. Die Frau war eine Schwarze mit einem hübschen, pockennarbigen Gesicht. Ihre weiße Bluse war verschmiert und abgetragen.
»Sibbie, ist alles in Ordnung?«, fragte Pellam und kniete sich neben sie.
Sie wandte ihren Blick nicht von dem abgebrannten Haus ab.
»Sibbie, erinnern Sie sich an mich? Ich bin John. Ich habe ein paar Bilder von Ihnen gemacht. Für meinen Film. Sie haben mir erzählt, Sie wollten nach Harlem ziehen. Sie erinnern sich doch an mich.«
Dem schien aber nicht so zu sein. Pellam hatte sie eines Tages an der Eingangstür kennen gelernt, als er auf dem Weg zu Ettie war, um sie zu interviewen. Offenbar hatte Sibbie von ihm gehört, weil sie, ohne ihn zu grüßen, gesagt hatte, sie würde ihm für zwanzig Dollar aus ihrem Leben erzählen. So manch andere Dokumentarfilmer hätte sich aus ethischen Gründen geweigert, Geld für so etwas zu bezahlen, doch Pellam schob ihr den Schein zu und filmte drauflos, bevor sie wusste, in welche Tasche sie das Geld stecken sollte. Aber Zeit und Geld waren vergeudet gewesen – das meiste, was sie erzählt hatte, war erfunden gewesen.
»Sie haben es unverletzt nach draußen geschafft.«
Abwesend erklärte Sibbie, sie sei beim Ausbruch des Feuers zu Hause gewesen und hätte sich mit ihren Kindern gerade an das Abendessen aus Reis mit Bohnen und Ketchup gemacht. Sie hätten ohne Probleme fliehen können, doch sie und ihre Kinder seien trotz der Gefahr zurückgekehrt, um zu retten, was sie retten konnten. »Aber den Fernseher nicht. Wir haben’s versucht, aber er war zu schwer. Scheiße.«
Eine Mutter setzte ihre Kinder einem solchen Risiko aus? Pellam erschauderte bei dem Gedanken.
Hinter ihr stand ein etwa vierjähriges Mädchen, das ein Spielzeug umklammerte, und ein neun- oder zehnjähriger Junge, dessen Mund zwar nicht lächelte, doch dessen Augen eine unbezähmbare Freude ausdrückten. »Jemand hat uns das Haus über dem Kopf angezündet«, sagte er voller Stolz. »He, Mann, können Sie das glauben?«
»Kann ich ein paar Fragen stellen?«, fing Pellam an.
Sibbie gab keine Antwort.
Er schaltete seine Betacam ein, in der Hoffnung, dass Sibbies Kurzzeitgedächtnis besser war als die Erinnerung an ihre Jugend.
»He, sind Sie von CNN?«, fragte der Junge und blickte in das rote Auge der Sony.
»Nein, ich arbeite an einem Film. Ich habe letzten Monat ein paar Aufnahmen von deiner Mutter gemacht.«
»Was? Das glaube ich nicht!« Er bedeckte überrascht seine Augen mit der Hand. »Ein Film. Wesley Snipes, Denzel, ja! O Mann!«
»Hast du eine Ahnung, wie das Feuer angefangen hat?«
»Es waren die crews«, stieß der Junge hervor.
»Halt den Mund«, schimpfte seine Mutter, die plötzlich aus ihrem verträumten Jammertal zurückgekehrt war.
Mit crews meinte er die Gangs. »Welche?«
Die Mutter sagte nichts mehr und starrte auf einen Schlüssel, der vom vorbeiziehenden Verkehr tief in den Asphalt gepresst worden war. Daneben lag eine Patronenhülse aus Messing. Dann blickte sie zum Gebäude. »Sehen Sie sich das an.«
»Es war ein schönes Haus«, meinte Pellam.
»Der helle Wahnsinn!« Sibbie schnalzte laut mit den Fingern. »Oh, jetzt bin ich eine von ihnen.«
»Eine von wem?«, fragte Pellam.
»Von denen, die auf der Straße leben. Wir werden auf der Straße leben. Ich werde krank werden. Ich werde AIDS kriegen, den Village-Fluch, und dann sterben.«
»Nein, es wird alles gut werden. Die Stadt wird sich um Sie kümmern.«
»Die Stadt. So’n Scheiß.«
»Habt ihr irgendjemanden im Erdgeschoss gesehen, als das Feuer ausbrach?«
»Ja, klar«, antwortete der Junge. »Wie ich schon gesagt habe. Die von den crews. Ich habe sie gesehen. Ein Nigger hält seine Augen offen. Ich …«
Sibbie gab ihrem Sohn eine saftige Ohrfeige. »Er hat gar nichts gesehen. Jedenfalls nichts, was jetzt noch wichtig ist.«
Pellam war bei dem Schlag zusammengezuckt. Der Junge hatte es bemerkt, doch die stillschweigende Sympathie war weit weniger tröstlich, als der Schlag schmerzhaft gewesen zu sein schien.
»Sibbie, die Gegend hier ist nicht sicher«, sagte Pellam. »Gehen Sie in die Notunterkunft am Ende der Straße.«
»Notunterkunft. Scheiße. Ich hab ein paar Sachen gerettet.« Sibbie zeigte auf ihre Einkaufstasche. »Als ich nach Mamas Spitze gesucht habe. Hab sie nicht gefunden. Scheiße. Die ist futsch.« Sie blickte zu einer Gruppe von Schaulustigen. »He, ihr, habt ihr hier irgendwo Spitze gesehen?«
Niemand achtete auf sie. »Sibbie, haben Sie noch ein bisschen Geld?«, fragte Pellam.
»Fünf Dollar, die mir ein Mann gegeben hat.«
Pellam schob ihr einen Zwanziger zu, bevor er auf die Straße trat und ein Taxi heranwinkte. »Bringen Sie sie zur Notunterkunft auf der Fünfzigsten.« Er hielt einen Zwanzig-Dollar-Schein hoch.
Der Taxifahrer schielte auf seinen möglichen Fahrpreis. »He, Mann, mein Dienst ist gleich zu Ende.«
Pellam brachte ihn mit einem weiteren Schein zum Schweigen.
Sibbie stieg mit ihren Kindern ein. Vom Rücksitz aus blickte ihn Ismail vorsichtig an, dann war das Taxi fort. Pellam hob die Betacam hoch, die mittlerweile eine halbe Tonne wog, und hängte sie sich ein weiteres Mal über die Schulter.
Was ist denn das? Ein Cowboy?
Stiefel, Jeans, schwarzes Hemd.
Fehlt nur noch die dünne Krawatte und ein Pferd.
Yee-haw. Ihm ging das Lied aus dem Asphalt-Cowboy durch den Kopf – Everybody’s tawking at me …
Er hatte beobachtet, wie der Cowboy die schrumplige Nigger-Lady mit ihren kleinen Nigger-Kindern ins Taxi verfrachtet hatte und zu den verkohlten Resten des Hauses zurückgekehrt war.
Schon seit mehreren Stunden betrachtete sich Sonny das zerstörte Gebäude voller Freude und mit einem Hauch unanständiger Lust. Im Moment dachte er an das Geräusch von Feuer. Er wusste, dass die Böden krachend eingestürzt waren, was aber niemand hören konnte. Feuer ist viel lauter, als man immer denkt. Feuer dröhnt wie das Geräusch von Blut in den Ohren, wenn die Flammen, sagen wir, deine Knie erreichen.
Und er dachte an den Geruch. Er sog den einzigartigen Duft aus verbranntem Holz, verkohltem Plastik und oxidiertem Metall ein. Widerwillig tauchte er aus seinen Träumereien auf und sah sich den Cowboy genau an. Dieser filmte den Fire Marshal, der einen erschöpften Feuerwehrmann anwies, sich mit seiner Halligan durch einen Schutthaufen zu wühlen. Das Ding war eine Mischung aus Axt und Stemmeisen. Erfunden von Huey Halligan, dem besten Feuerwehrmann aller Zeiten und dem Stolz des New York Fire Department. Sonny hatte Respekt vor seinen Feinden.
Er wusste auch viel über sie. Zum Beispiel, dass es in New York mehr als zweihundertfünfzig Fire Marshals gab. Einige waren gut, andere wiederum schlecht, aber dieser hier, Lomax, war hervorragend. Sonny beobachtete ihn, wie er die schuppige Oberfläche von einem Stück Holz fotografierte. Dieses Stück hatte der Marshal sofort entdeckt. Gott schütze ihn. Die großen schwarzen Rechtecke auf der Oberfläche glänzten, was hieß, dass sich das Feuer schnell ausgebreitet hatte und heiß gewesen war. Ganz nützlich für die Untersuchung. Und für die Gerichtsverhandlung – als ob sie ihn jemals schnappen würden.
Der Marshal griff zu einem ein Meter achtzig langen Haken, schlug ein Fenster im Erdgeschoss ein und leuchtete mit seiner Lampe hinein.
Vor ein paar Jahren war bei der New Yorker Feuerwehr eigens eine Red-Hat-Patrouille eingerichtet worden. Die Fire Marshals hatten rote Baseball-Mützen bekommen und waren durch die Viertel geschickt worden, in denen die Gefahr von Brandstiftung am höchsten war. Damals war Sonny gerade dabei gewesen, sein Handwerk zu lernen, und es hatte sich als sehr hilfreich erwiesen, dass die Marshals so leicht zu erkennen waren. Jetzt trugen sie wie gewöhnliche Einfaltspinsel Zivil, doch dank seiner Erfahrung war Sonny nicht darauf angewiesen, seine Feinde an einer roten Mütze zu erkennen. Mittlerweile erkannte er mit einem Blick in die Augen eines Mannes, ob Feuer zu seinem täglichen Brot gehörte.
Entweder als derjenige, der es entfachte, oder derjenige, der es löschte.
Sonny fühlte sich nicht mehr ganz so glücklich, sondern war zittrig auf den Beinen und schwitzte. Er blickte auf die große Kamera in der Hand des Cowboys. Ein Kabel mündete in der Leinentasche mit den Akkus. Es war keine dieser billigen Videokameras. Das war ein echt gutes Teil.
Wer bist du eigentlich? Joe Buck aus Asphalt-Cowboy? Was suchst du hier?
Sonny schwitzte noch mehr, was ihn nicht weiter bekümmerte, obwohl er in letzter Zeit furchtbar viel schwitzte, und seine Hände zitterten – was ihn allerdings arg bekümmerte, weil es nicht zu jemandem passte, der für seinen Lebensunterhalt Brandbomben zusammenbastelte.
Er beobachtete den großen, dünnen Joe Buck, der das ausgebrannte Wohnhaus filmte. Sonny überlegte sich, dass er den Cowboy mehr wegen seiner Größe als wegen der Tatsache hasste, dass er ein Gebäude filmte, das er selbst eben erst niedergebrannt hatte.
Doch irgendwie hoffte er, dass die Aufnahmen gut werden würden; schließlich war er stolz auf sein kleines Feuer.
Nachdem er das Inferno entfacht und wieder aus dem Haus gehuscht war, hatte er sich auf einer Baustelle auf der anderen Straßenseite versteckt und den Polizeifunk abgehört. Der Einsatzleiter hatte die Alarmstufe durchgegeben, 10-45, Code 2. Sonny hatte sich über den Alarm gefreut – er bedeutete, dass es ein ernst zu nehmender Brand war –, war aber enttäuscht über den Code, der bedeutete, dass es nur Verletzte und keine Toten gegeben hatte. Code 1 bedeutete Tote.
Nach ein paar Minuten schaltete der Cowboy die Kamera aus und schob sie in seine Tasche zurück.
Sonny blickte wieder zum Fire Marshal und seinen Kumpels hinüber – du meine Güte, was hatte er doch für einen riesigen, schwuchteligen Stellvertreter. Lomax trug dem großen Kerl auf, einen Löffelbagger zu besorgen und mit dem Ausheben zu beginnen. Schweigend teilte Sonny den beiden mit, dass dies die korrekte Vorgehensweise für die Untersuchung eines derartigen Feuers war.
Doch Sonny machte sich immer mehr Sorgen. Sie schwollen an wie Rauch in einem Flur – in dem einen Moment ist noch alles klar, im nächsten erkennt man die Hand vor den Augen nicht mehr.
Der Grund waren aber nicht Lomax oder sein riesiger Stellvertreter. Der Grund war der Cowboy.
Ich hasse diesen Mann. Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse, hasse, hasse ihn!
Schwungvoll warf Sonny seinen langen blonden Pferdeschwanz nach hinten, wischte sich mit zitternder Hand den Schweiß von der Stirn und schob sich vorsichtig durch die Menschenmenge näher an Joe Buck heran. Er konnte nur mühsam atmen, und sein Herz pochte. Bis tief in seine Lungen sog er die vom Rauch schwere Luft, genoss den Geschmack und den Geruch und stieß sie sehr langsam wieder aus. Unter seinen Händen zitterte das gelbe Band. Hört auf damit, hört auf, hört auf!
Er hob seinen Blick zu Pellam.
Vielleicht dreißig Zentimeter größer. Ach was, höchstens fünfundzwanzig, wenn sich Sonny gerade hinstellte. Oder knapp über zwanzig.
Plötzlich schob sich jemand zwischen sie, und Sonny wurde zur Seite gedrängt. Der Eindringling war eine junge Frau in einem kostbaren dunkelgrünen, zweireihigen Kostüm. Eine Geschäftsfrau. »Schrecklich. Einfach grausam«, sagte sie.
»Haben Sie gesehen, wie es passiert ist?«, fragte der Cowboy.
Sie nickte. »Ich kam gerade von der Arbeit. Ich war zu einer Revision unterwegs. Sind Sie Reporter?«
»Ich drehe einen Film über einige Bewohner in diesem Haus.«
»Einen Film? Super. Einen Dokumentarfilm? Ich bin Alice.«
»Pellam.«
Pellam, dachte Sonny. Pell-am. Er stellte sich den Namen vor und sagte ihn in Gedanken immer wieder auf, bis er wie die Spitze einer Rauchsäule zwar noch da, aber nicht mehr sichtbar war.
»Zuerst sah es so aus, als wäre noch alles in Ordnung«, fuhr sie fort und blickte in das magere Gesicht des Cowboys, in Pellams Gesicht. »Aber plötzlich waren da überall Flammen. Ich meine, wirklich überall.« Sie trug einen schweren Aktenkoffer mit der Goldprägung von Ernst & Young, und mit dem Zeigefinger ihrer freien rechten Hand zwirbelte sie in ihren kurzen roten Haaren. Sonny schielte auf ihre laminierte Visitenkarte, die am Griff herabhing.
»Wo genau hat es angefangen?«, fragte Pellam.
Sie nickte. »Ich habe gesehen, wie die Flammen durch dieses Fenster dort kamen.« Sie zeigte auf das Erdgeschoss.
Auf Sonny wirkte sie überhaupt nicht wie Alice, eher wie diese lahme Hauptdarstellerin aus »Akte X«, die er für sich scherzhaft immer nur Agentin Scullery – die »Spülküche« – nannte.
Wie Pellam war auch Scullery größer als Sonny. Größere Männer mochte er nicht, aber Frauen, die größer waren als er, hasste er wie die Pest, und wenn sie auf ihn herabschauten wie auf ein Eichhörnchen, wandelte sich sein Hass in etwas sehr Ruhiges und gleichzeitig sehr Heißes.
»Ich war diejenige, die die Feuerwehr gerufen hat. Von dem Feuermelder aus dort an der Ecke. Sie wissen schon, die Dinger, die man ständig sieht, aber über die man nie nachdenkt.«
Er hasste auch kurzes Haar, weil es schnell abgebrannt war. Er wischte seine Hände an seinen weißen Hosen ab und lauschte dem Geplapper von Agentin Scullery über fünf Einsatzwagen und Krankenwagen und Brandopfer und Rauchopfer und Sprungopfer.
Und Matsch.
»Überall war Matsch. Bei einem Brand denkt man eigentlich nicht an Matsch.«
Einige allerdings tun das, dachte Sonny. Weiter.
Agentin Scullery erzählte Cowboy-Schwuchtel Joe Buck von glühend roten Schrauben und schmelzendem Glas und einem Mann, der Stückchen eines verbrannten Hühnchens aus der Asche gezogen und gegessen hatte, während um ihn herum die Menschen nach Hilfe schrien. »Es war …« – sie zögerte und dachte über ein passendes Wort nach – »schauderhaft.« Sonny hatte für eine Reihe von Geschäftsleuten gearbeitet, und er wusste, wie wichtig ihnen Zusammenfassungen waren.
»Haben Sie jemanden in der Nähe des Hauses gesehen, als das Feuer ausbrach?«
»Ja, hinter dem Haus. Da waren einige Menschen. In der Gasse.«
»Wer?«
»Ich habe nicht besonders aufgepasst.«
»Haben Sie eine Ahnung?«, bohrte der Cowboy nach.
Sonny lauschte aufmerksam, doch Agentin Scullery erinnerte sich nicht an sehr viel. »Ein Mann. Mehrere Männer. Das ist alles, was ich weiß. Tut mir Leid.«
»Junge Männer? Jugendliche?«
»Nicht so jung. Ich weiß nicht. Tut mir Leid.«
Pellam dankte ihr. Sie blieb stehen, vielleicht weil sie wartete, ob er mit ihr ausgehen würde. Doch er lächelte nur unverbindlich, ging an die Straße und winkte einem Taxi. Sonny eilte hinterher, doch der Cowboy saß schon drin, und der gelbe Chevy jagte davon, noch bevor Sonny den Rinnstein erreicht hatte. Das Ziel hatte er nicht hören können.
Einen kurzen Moment war er sauer auf sich, weil ihm dieser Asphalt-Cowboy so leicht entwischt war. Aber dann dachte er, dass es in Ordnung war – es ging ja nicht darum, Zeugen auszuschalten oder Eindringlinge zu bestrafen. Es ging um etwas viel, viel Größeres.
Als er seine Hände hochhielt, merkte er, dass sie nicht mehr zitterten. Ein kleines bisschen Rauch, ein Geist, der vor Sonnys Gesicht schwebte und sich auflöste – er konnte nur die Augen schließen und das süße Parfüm einsaugen.
Während er eine Weile so stehen blieb, regungslos und blind, kam er langsam wieder auf die Erde zurück und kramte in seiner Umhängetasche. Er merkte, dass er nur noch etwa einen halben Liter Saft hatte.
Aber das reichte, dachte er. Mehr als genug. Manchmal brauchte man nur einen Löffel voll, je nachdem, wie viel Zeit man hatte. Und wie gescheit man war. Im Moment hatte Sonny alle Zeit der Welt. Und wie immer wusste er, dass er schlau wie ein Fuchs war.
… Vier
Ziemlich windig an diesem Morgen.
Ein Auguststurm rückte näher, und das Erste, was Pellam bemerkte, als er aufwachte und den Wind hörte, war, dass er nicht schwankte.
Vor drei Monaten hatte er seinen Wohnwagen auf einem Standplatz in White Plains geparkt, um vorübergehend auf seinen nomadischen Lebensstil zu verzichten. Drei Monate – und immer noch hatte er manchmal Schwierigkeiten, in einem Bett zu schlafen, das nicht auf altersschwachen Stahlfedern ruhte. Bei diesem Wind heute wäre er wie auf einer Galeere geschwankt.
Auch an die fünfzehnhundert Dollar pro Monat für das Einzimmerapartment mit einer Badewanne in der Küche als Hauptattraktion hatte er sich noch nicht gewöhnt. (»Man nennt es bitchen«, hatte ihm die Frau vom Immobilienbüro erzählt, als sie den Scheck für die Maklergebühr und die erste Monatsmiete an sich gerissen hatte, als hätte er ihr schon seit Monaten das Geld geschuldet. »Heutzutage sind die Leute ganz scharf auf so was.«) Dritter Stock ohne Fahrstuhl, schmutziger beigefarbener Linoleumboden und Wände so grün wie die in Ettie Washingtons Krankenhauszimmer. Und was war das bloß für ein komischer Geruch?
Während der Jahre, in denen Pellam als Location Scout gearbeitet hatte, um Drehorte ausfindig zu machen, war er nur selten in Manhattan gewesen. Die meisten Filmgesellschaften vor Ort hatten dicht gemacht, und wegen der hohen Set-Kosten war das Manhattan, das man in den meisten Filmen sah, in Wirklichkeit Toronto, Cleveland oder ein Studio. Die tatsächlich in Manhattan gedrehten Filme übten nur geringen Reiz auf ihn aus – verrückte Jim-Jarmusch-Verschnitte in Studenten-Qualität und langweilige Mainstream-Filme. AUSSEN PLAZA HOTEL – TAG, AUSSEN WALLSTREET – NACHT. Die Aufträge für die Drehortsuche hatten weniger damit zu tun, das dritte Auge für den Regisseur zu spielen, als vielmehr, bei den für Drehgenehmigungen zuständigen Behörden das vorgeschriebene Formular auszufüllen und dafür zu sorgen, dass das Geld den richtigen Weg nahm, ob über oder unter dem Tisch.
Doch im Moment hatte er die Drehortsuche ad acta gelegt. Noch einen Monat bis zum Rohschnitt für seinen ersten Film seit Jahren und den ersten Dokumentarfilm, den er je gemacht hatte. Titel: Westlich der Achten Avenue.
Er duschte und bürstete sich sein widerspenstiges schwarzes Haar in Form. In Gedanken war er bei seinem Projekt. Der Zeitplan gestattete ihm nur noch eine Woche Aufnahmen, dann würden drei Wochen Redaktion und Post Production folgen. Der 27. September war Stichtag für Mischen und Übergabe an die WGBH in Boston, wo er sich mit dem Produzenten für die Schnitt-Endfassung zusammensetzen würde. Die Ausstrahlung im öffentlichen Fernsehen war für den Beginn des nächsten Frühjahrs geplant. Gleichzeitig würde er das Band als Film überarbeiten und in begrenzter Auflage an amerikanische Programmkinos und für eine Sendung auf Channel 4 in England verschicken lassen. Und er würde ihn zu den Filmfestspielen in Cannes, Venedig, Toronto und Berlin und für die Oskarverleihung einreichen.
Tja, das war jedenfalls sein Plan gewesen. Und jetzt?
Das Motiv von Westlich der Achten Avenue war das Wohnhaus in der Sechsunddreißigsten Straße West 458 und dessen Bewohner mit Ettie Washington als zentraler Figur gewesen. Mit ihrer Verhaftung fragte er sich, ob er nun der stolze Besitzer von zweihundert Stunden faszinierender Interviews war, die nie den Weg ins Fernsehen oder auf die Leinwand finden würden.
Er ging eine Zeitung kaufen und winkte nach einem Taxi.