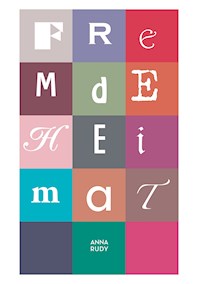Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Elemente
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Lodernde Macht Feuer spendet Licht und Wärme, ist pure Energie, steht für Begeisterung, für Aktivität, für Reinigung und jede Art von Wandel. Das Spiel der Flammen fasziniert und zieht uns an. Diese allesverschlingende Kraft kann uns schnell zum Verhängnis werden. Es glüht, es züngelt, es lodert, hoch und heiß, bis es erlischt - Glut und Rache, Leidenschaft und Zorn. Sieben Kölner AutorInnen erzählen von Feuerteufeln und Brandwunden, die niemand sieht, von Flammentanz und bewusstseinswandelnden Ritualen, vom lebenslangen Brennen der Liebe, von Verlangen und Verlust, vom Weg zur Hölle und zurück. Dreizehn Geschichten über die Gewaltigkeit des Feuers. Band 2 der Anthologie-Reihe "Elemente"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Alles begann mit einem verregneten Sommer. Damals wurde das Projekt „Jahrhundertflut“ geboren, eine Anthologie rund um das Element Wasser. Es erschien uns, einer Kölner Autorengruppe mit fluktuierender Besetzung, nur konsequent, sich auch den anderen Elementen zu widmen. Wasser, Feuer, Luft und Erde – ohne sie gibt es kein Leben. Der Mensch machte sich die Elemente zunutze und so entstand Fortschritt. Mit dem Feuer kam Wärme, Licht, Sicherheit und besser verträgliche Nahrung. Man sammelte sich um Feuerstellen, es entstand Nähe und Gemeinschaft. Und in der Gemeinschaft köcheln die Konflikte. Für sich genommen kann das Feuer eine Waffe sein, doch in uns brennt es vielfach noch heißer. Dreizehn Geschichten vom Feuer der Liebe, Leidenschaft, Lust, Begeisterung, Verzweiflung, Wut und Wandlung.
Inhalt
Anna Rudy
Ich sehe dein Lächeln
Angela Hoptich
Das unerwartete Fehlen von Vanillekipferln
Ingmar Ackermann
Almas und das Gehirn
Katja Winter
Das Feuer wärmt und es verbrennt
Nina Weber
Der zerbrochene Spiegel
Norbert Görg
Gregor
Anna Rudy
Mohammed
Anna Rudy
Der allerbeste Tag im Leben
Ingmar Ackermann
Schwitzhütte
Oliver Kreuz
Die Feuerphilosophen
Nina Weber
Die Brennnessel
Nina Weber
Die seidene Frau
Norbert Görg
Joseph F., die Grazien und der Wolf
Die Autor*innen
Anna Rudy
ICH SEHE DEIN LÄCHELN
Plopp.
Plopp.
Stille.
Dann wieder schnell: Plopp, plopp, plopp.
Der Wasserhahn tropft. Die kleinen Wasserkügelchen bilden sich, lassen sich von der Schwerkraft schwängern und stürzen mit hartem Schlag in das Waschbecken.
Plopp.
Plopp.
Plopp, plopp, plopp.
Draußen regnet es. Die Regentropfen trommeln am Fenstersims und bitten meinen einsamen Wasserhahn um eine musikalische Untermalung, halten den Beat.
Der Himmel ist grau. Die Vorhänge im Zimmer sind grau. Auf meinen grauen Haaren liegt ein schwarzes Tuch.
Du lächelst mich an, aus dem schwarz umrandeten Fotorahmen, mit deinem ewig jungen Lächeln.
„Hast du Feuer?“, fragst du mich.
Ich bin vor einigen Monaten aus der elterlichen Obhut geflohen, bin Studentin und feiere meine Unabhängigkeit. Ich rauche nicht. Noch nicht.
„Hast du Feuer?“, frage ich dich barsch zurück.
„Ich rauche nicht“, sagst du völlig unlogisch und lächelst.
„Ich auch nicht.“ Ich lache zurück – zurück in dein Lächeln, das mir sofort sympathisch ist.
Wir quatschen eine Weile und gehen dann schließlich zu dir. Wir schlafen in dieser Nacht getrennt: ich auf deiner Couch, du auf dem Boden, komisch gekrümmt, wie ein überdimensionaler Fötus. Erst als ich dich morgens so entdecke, gehe ich zu dir. Wir lieben uns auf dem harten Boden, dann auf der Couch, dem Fenstersims, unter der Dusche.
„Hast du noch Feuer?“, frage ich keuchend.
Du, mit schwarz umrandeten Augen, schweratmend: „Ich habe Feuer!“
Den Rest des Tages verbringen wir verflochten wie siamesische Zwillinge.
So leben wir das erste Jahr durch, zusammengeschmolzen von der Flamme, die in uns brennt.
Mein Studium gerät ins Stocken, dein Diplom will nicht werden, wir können uns einfach nicht trennen. Du hast Angst, dass ich verschwinde, wie eine Rauchwolke, und lässt meine Hand nie aus deiner gleiten. Und wenn das zufällig passiert, greifst du schnell nach ihr wie ein Blinder nach dem Gehstock.
Ich versuche erst gar nicht, meine Hand wegzuziehen. Weggerannt von den Eltern, träumend von der Unabhängigkeit, binde ich mich an dich mit den dicken Ketten meiner Liebe. Ich empfinde sie aber als leicht wie Federflügel.
Nach dem ersten Jahr geht das zweite vorbei, nach dem zweiten das dritte. Du lässt meine Hand öfter fallen. Ich wünsche mir, du hättest wieder solche Angst, mich zu verlieren. Aber du bist jetzt satt, jetzt brennt es nicht mehr, es glüht nur. Du schläfst wieder allein auf deiner Couch, ich auf meiner. In einem anderen Stadtteil. Wir sehen uns selten. Du hast einen Job und willst Karriere machen. Ich schreibe mein Diplom und will dich haben. Meine federleichten Liebesketten werden jeden Monat schwerer. Ich versuche es zu verheimlichen, ich will stark und unabhängig sein. Auch ich will Karriere machen. Ich will niemals wie meine Mutter enden – zuhause, reduziert auf die Rolle der Ehefrau und Mutter. Ein Opfer des Patriarchats. Du schmunzelst, wenn ich darüber rede, als ob du hinter meinen Wörtern die verborgenen Liebesketten siehst.
Du ziehst in eine andere Stadt wegen eines neuen Jobs, ich ziehe in ein anderes Land für ein neues Studium. Du hast eine Andere, ich habe einen Anderen. Du heiratest und bekommst Kinder. Ich schreibe meine Doktorarbeit und bekomme ein Magengeschwür.
Nach zehn Jahren sehen wir uns auf einem Symposium in einem völlig fremden Land und drehen durch.
„Hast du Feuer?“
„Hast du immer noch Feuer?“
Drei Tage lang verlassen wir dein Hotelzimmer nicht. Du hältst meine Hand in deiner und hast wieder Angst, sie zu verlieren.
„Warum hast du mich nicht geheiratet?“, frage ich.
„Du wolltest es nicht“, sagst du.
„Du hast mich nie gefragt.“
„Du hättest ,nein' gesagt. Du wolltest nie wie deine Mutter enden.“
„Was weißt du schon über meine Mutter ...“
Unsere von der Ewigkeit geraubte Zeit ist vorbei. Du fährst zu deiner Familie, ich zu meinen Studenten. Eine Woche später stehst du vor meiner Tür. Mit deinem Koffer und unserem neuen Leben in der Hand.
Wir schlafen die nächsten 20 Jahre zusammengeflochten, bis du mich nachts verlässt, ohne aufzustehen. Deine tote Umarmung ist stark und kalt, du klammerst dich fest an meine Hand, die genauso eisig wird wie du selbst. Du hast mich wieder verlassen.
„Was erlaubst du dir? Wer gibt dir das Recht, mich so zu behandeln? Ich kann es einfach nicht fassen!“
Ich schlage deine Brust, ich ohrfeige dein totes Gesicht.
„Was soll ich jetzt machen, ohne dich? Alleine! Wer soll mich jetzt halten?“
Ich umarme deinen steifen Körper. Du liegst auf der Seite, wie ein überdimensionaler Fötus. Ich lege mich zu dir, in unsere gewohnte Schlafposition, und hülle uns in die Bettdecke, damit du nicht frierst. Ich will nicht mehr aufstehen.
Am fünften Tag kommt der Krankenwagen und holt uns ab. Dich ins Kühlhaus, mich in die Nervenklinik. Nach zwei Monaten kehre ich in die leere Wohnung mit dem tropfenden Wasserhahn zurück.
Auf dem Wohnzimmertisch steht dein Porträt aus unseren Studienzeiten. Ich setze mich davor auf den Stuhl. Neben dem Porträt steht eine Kerze, liegt eine Streichholzpackung.
Deine Kinder haben dieses Bild aufgestellt. Sie haben deine Beerdigung organisiert, unsere Wohnung aufgeräumt, mich aus der Klinik abgeholt. Sie haben dein Lächeln in einen schwarzen Rahmen gepresst, das Foto aus unserer Jugend ausgesucht, als ob wir nicht das ganze Leben zusammen verbracht hätten. Du schenkst dein junges Lächeln meinem alten, grauen Gesicht.
Es herrscht Stille und das Regentropfenkonzert.
Während ich in der Klinik war, haben sich deine Kinder um alles gekümmert. Sie ließen dich in eine enge, hölzerne Kiste stecken und die Kiste in einen passenden Ofen. Deine Kinder haben dich verbrannt. Sie ließen es machen, weil das in deinem Testament stand. Ich habe nie mit dir über den Tod geredet, aber ich glaube deinen Kindern nicht.
Sie haben es getan, weil sie sich rächen wollten.
Du hast sie verlassen. Sie haben dich verbrannt.
Ich habe dich gestohlen. Sie nahmen dich mir weg.
Ich habe dein Grab gesehen, du bist nicht dort. Du gingst in Flammen auf. Du bist verschwunden, wie eine Rauchwolke. Du bist weggehuscht, geflogen. Ich konnte dich nicht festhalten. Meine lebenslangen Liebesketten sind bleischwer geworden und lasten auf meinen Schultern. Du warst mein Lebensmotor, gabst mir Energie. Ich kann dieses Gewicht alleine nicht aushalten.
Plopp, plopp, plopp.
Die Wassertropfen hören nicht auf. Draußen wird es dunkel. Ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Ich ziehe die Streichholzpackung zu mir herüber und zünde ein Streichholz an, um die Kerze neben deinem Porträt leuchten zu lassen. Die Flamme holt dein Lächeln aus der Dunkelheit.
Das Streichholz brennt lange in meinen Fingern, bis es sich krümmt und verkohlt. Ich puste es aus, um meine Finger zu schützen. Ich lege die schwarze, tote Holzleiche neben dein Porträt und hole ein neues aus der Schachtel. Ich streiche es schnell an und sehe, wie eine Rauchwolke entflieht und die Flamme gierig das Holz verschlingt. Deine Seele ist schon lange weggeflogen, dein Körper wurde von Flammen verkohlt und verkrümmt. Ich hole das nächste Streichholz, zünde es an und warte, bis die Flamme hochklettert. Sie steigt empor und erreicht fast meine Fingerkuppen.
Ich zucke zusammen und das glühende Holz fällt zu Boden. Es glimmt noch eine Zeit lang und stirbt. Ich greife schnell ein neues Streichholz, streiche es, zünde es an. Dein Gesicht leuchtet wieder auf. Feuer hat etwas Feierliches an sich.
Ich hole eine Zeitung aus dem ungelesenen Stapel, mache ein Rohr daraus und zünde es an. Diese Fackel schwenke ich vor dem Fotorahmen. Die tanzenden Funken wabern über dein Gesicht und machen dich wieder lebendig.
„Hast du immer noch Feuer?“ Ich zwinkere dir zu. „Schau mal! Ich habe hier Feuer! Los! Wir machen uns ein Feuerwerk!“
Ich werfe meine selbstgebastelte Fackel einfach hinter mich.
„Ha-ha! Das ist total lustig! Hast du gesehen?“ Ich hole die Streichhölzer aus der Packung.
„Weiß du, wie wir gespielt haben? Draußen auf der Wiese? Wer kann am weitesten Streichhölzer schießen?“
Ich stelle die Packung auf die Seite und presse ein Streichholz mit dem linken Zeigefinger fest. Es steht jetzt senkrecht auf der Streichseite. Jetzt schnippe ich es schnell mit zwei Fingern der Rechten weg. Das gelingt mir zunächst nicht. Die Streichhölzer wollen nicht richtig aufflackern. Die kleinen Feuerflämmchen bilden sich und sterben gleich danach. Aber Übung macht den Meister.
Stellen, drücken, schießen. Stellen, drücken, schießen. Bald fliegen die angezündeten Streichhölzer weit. Stellen, drücken, schießen. Stellen, drücken, schießen. Die Streichhölzer schwirren wie kleine, flammende Insekten und beißen alles, was sie erreichen: Vorhänge, Couch, Kommode. Die Vorhänge wehren sich zunächst wie schüchterne Jungfrauen, dann legen sie ihre Scheu ab und geben sich der heißen Sache hin. Feuer springt mit voller Leidenschaft auf sie zu.
Schmatz!
Die ganze Fensterseite steht in Flammen.
Der Funke springt von den Vorhängen auf die Couch, es schmeckt ihm immer mehr und mit einem Schub breitet die Flamme sich aus. Jetzt brennt es überall. Es knistert und knirscht und die Wassertropfen halten endlich das Maul!
„Feuer! Feuer! Ich habe auch Feuer, hörst du mich! Ich kann es auch!“
Ich sehe dein Lächeln. Das Feuer, das ich entfesselt habe, gefällt dir. Du bist nicht weggeflogen, du bist immer noch bei mir. Die Flammen tanzen ihren wilden Tanz und sind unersättlich. Sie fressen sich durch die Kommode, verschlingen Bücher, eines nach dem anderen, verlangen in wilder Umarmung die Couch.
„Feuer! Ich habe Feuer!“
Die ganze Wohnung steht in Flammen. Sie sind ganz hoch und umkreisen mich. Die Luft wird dick, ich muss husten. Durch den Rauch kann ich dein Gesicht nicht mehr erkennen.
„Nein, nein. Das wollte ich nicht. Ich muss hier raus.“
Ich mache mich auf den Weg zum Ausgang. Aber ich sehe nichts. Die dicken Schwaden sind überall. Ich weiß nicht mehr, wo der Ausgang ist. Die furchtbare Angst schnürt meine Kehle zu.
„Hil-fe! Hiiel-feee!“
Etwas kracht und Tausende Funken blitzen vor meinen Augen auf.
Angela Hoptich
DAS UNERWARTETE FEHLEN VON VANILLEKIPFERLN
I.
Wie Honig, der von einem Löffel troff, zähflüssig, langsam, aber geschmeidig, verließ mein Bewusstsein die wirkliche Welt und landete sanft in meinem Gedankenhaus. Sofort hüllte mich der süßliche Duft von Plätzchenteig ein – und wunderbare Stille.
Nun gut, ein Rest meiner Aufmerksamkeit blieb in der Realität zurück – genau so, wie ein Rest vom Honig auf dem Löffel kleben blieb. Reiner Selbsterhaltungstrieb. Im Hintergrund arbeitete mein Gehirn alle Gefahrenschutzpläne ab, die die Natur eingebaut hatte.
Der Großteil meines Bewusstseins befand sich jedoch nun in Omalindes Küche. Ich atmete das Aroma von Vanille, Butter und Zucker tief ein, das sich mit einem Hauch Bittermandel und Kakao mischte. Ein, zwei, drei Atemzüge und es ging mir besser. Die Küche war leer, aber ich hörte das leise Summen meiner Oma. „Zwei kleine Italiener“, das war ihr Lied. Sie hatte es mir stundenlang vorgesungen, und wenn ich mich anstrengte, konnte ich heute noch jede Zeile mitsingen.
Ich ging zum Tisch. Sicherlich stand dort bereits ein Teller mit Vanillekipferln für mich bereit – wie jedes Mal, wenn ich in die Küche kam. Der alte Holzstuhl wie auch der Tisch waren sehr hoch. Ich konnte nicht über die Tischkante gucken. Routiniert kletterte ich auf die untere Querstrebe des Stuhls und zog mich an der gedrechselten Lehne auf die mit rotem, weiß gepunkteten Stoff bezogene Sitzfläche hoch.
Da stand er, der Plätzchenteller. Mitten auf dem Tisch neben der Fliegenpilz-Zuckerdose. Die Tischplatte schien zu wachsen, als ich meinen Arm nach der süßen Versuchung ausstreckte. Der Teller rückte von mir weg, je weiter ich mich über den Tisch beugte. Das Grinsen der Vanillekipferl verspottete mich.
Plötzlich klirrte etwas neben dem Tisch.
Aus Versehen hatte ich einen Kuchenteller hinuntergestoßen. Die Dinger waren aber auch wirklich unsichtbar. Wer stellte rotweiß gepunktete Teller auf eine rotweiß gepunktete Tischdecke? So etwas machte nur Omalinde. Alles bei ihr war rot mit weißen Punkten, ihr absolutes Lieblingsmuster. Von der Schürze, die an einem Haken an der Wand mit der rotweißen Tüpfeltapete hing, über die Geschirrtücher bis zur Tischdecke und der Futterschale von Windsor, ihrem gehbehindertem Perserkater, vom Kakaobecher bis zum kleinsten Teller.
Der lag jetzt auf dem Boden, in drei scharfkantige Stücke zersprungen. Sollte ich ihn aufheben? Vielleicht verstecken? Omalinde – eigentlich hieß sie Heidelinde, aber mit drei Jahren hatte ich sie der Einfachheit halber umgetauft und das war bis heute geblieben – wurde selten sauer. Sie schimpfte nie. Ohne Umschweife würde sie einfach einen neuen Teller aus dem Schrank holen. Vielleicht allerdings würde mein Kakaobecher ungefüllt bleiben.
Mir fiel auf, dass das Summen aufgehört hatte.
Schnell kletterte ich vom Stuhl und hob die Scherben auf. Als ich sie in den – wie könnte es anders sein? – rotweiß gepünktelten Mülleimer warf, schnitt ich mir in die Daumenkuppe. Ein Blutstropfen quoll hervor und landete auf dem hellgrauen Linoleumbelag. Das war noch nie passiert. Ich starrte den Fleck an. Der rote Tupfen wirkte wie ein Eindringling in Omalindes rotweiß gepünktelter, heiler Welt.
Eine Glocke schrillte entsetzlich laut wie ein Feuermelder. Meine Trommelfelle vibrierten. Ich hielt mir die Ohren zu und presste die Lider fest zusammen.
„Ava. – Ava!“
Jemand rüttelte an meiner Aufmerksamkeit.
Jener Rest meines Bewusstseins, der in der Realität zurückgeblieben war, dehnte sich aus und mit ihm das Geschrei und der Tumult von mehr als fünfzehnhundert Schülern um mich herum. Mit einem Mal befand ich mich wieder auf dem Schulhof, auf dem es schlimmer zuging als auf dem Pavianfelsen im Zoo.
„Ava, wach auf, die Pause ist zu Ende.“
Herr Engelhardt, mein Englischlehrer und heutige Pausenaufsicht, wedelte hektisch mit der Hand, als wolle er Fliegen verscheuchen, dann drehte er sich um und ging Richtung Hauptgebäude, wo die Schülermasse behäbig durch den einzigen Eingang strömte.
Ich blieb auf meinem erhöhten Aussichtspunkt sitzen. Dank der Idee von humanistischer Bildung besaß unsere Schule eine Art Amphitheater aus großen Basaltquadern, in dem der Wahlpflichtkurs Deutsch-Theater im Sommer seinen Unterricht abhielt und gelegentlich Vorführungen oder Versammlungen der Schülervertretung stattfanden. Der oberste Rang war mein Lieblingsplatz, während sich die anderen Schüler lieber zwischen den Bäumen und auf dem Sportfeld tummelten. Meist war ich hier allein, ein wenig abseits vom Geschehen und erhoben über dem Gedränge.
Ich beobachtete die träge Herde, die nun zu zwei Dritteln im Haupthaus verschwunden war. Mittendrin entdeckte ich meine ex-beste Freundin Fenja, wie sie ekelhaft aufdringlich mit Mika flirtete. Der billige Geruch ihres Blümchen-Parfums schien mir selbst hier oben die Rezeptoren zu verkleben. Sie hatte sich heute wieder einmal aufgestylt, als erwartete sie, dass jeden Moment Heidi Klum durch die Tür träte und sie persönlich in die nächste Runde Demütigungsspektakel entführte. Wie sie mit den Hüften wackelte, als sie jetzt vor Mika durch die Tür ging. Dabei konnte sie auf den hohen Hacken gar nicht laufen.
Ein Schmerz zuckte durch meinen Daumen und ich bemerkte, dass ich den Nagel bis aufs Blut abgekaut hatte. Schnell spukte ich die Krümel aus und streifte meine Hand an der Jeans ab. Mit einem Seufzer zog ich die Strickmütze mit den Bommelöhrchen tiefer ins Gesicht und stand auf. Notgedrungen würde auch ich nun zum Unterricht gehen müssen.
II.
Die hellblaue Tür zwinkerte mir willkommen heißend zu. So sah es jedes Mal aus, wenn ich aus dem Bus ausstieg und um die Ecke bog. Der Briefschlitz und die beiden winzigen Fenster, die in das Türblatt eingelassen waren, wirkten auf mich wie ein freundlich lächelndes Gesicht. Der Druck auf der Brust ließ nach, sobald der Summer ertönte. Die Sprechstundenhilfe telefonierte gerade und winkte mich durch in Dr. Fredags Behandlungszimmer. Sie hielt zwei Finger in die Luft und bedeutete mir damit, dass ich noch ein wenig warten musste. Das machte mir gar nichts aus. Dr. Fredags Raum war ein entspannender, wohl temperierter Ort. Die rundfingrigen Blätter der Topfpflanze winkten ein zurückhaltendes Hallo, als sich die Tür hinter mir schloss. An den Wänden hingen Bilder, die den Raum heimelig erscheinen ließen. Das Sofa mit der Patchworkdecke war weich und bequem. Aus einer Stehlampe tropfte angenehm gelbes Licht. Kunstseidene Schleier vor den Fenstern sperrten die Welt aus und die von innen gepolsterte Tür sorgte für Diskretion und angenehme Stille. Doch das Schönste in Dr. Fredags Zimmer war das große Aquarium. Mit einem zarten Klopfen an das Glas begrüßte ich die Fische, die sofort neugierig angeschwommen kamen. Stundenlang hätte ich zusehen können, wie die bunt schillernden Geschöpfe ihre Bahnen zogen. Ich wusste genau, wie sie sich fühlten. Wie die Kühle des Wassers über die Haut streichelte. Wie die Welt zu unscharfen Flecken verschwamm, wenn man schnell durch das Becken kraulte. Wie der Lärm und Hall in den Hintergrund traten, sobald das Wasser den Gehörgang füllte. Seit ich vor ein paar Jahren den Schwimmsport für mich entdeckt hatte, verbrachte ich den größten Teil meiner Freizeit im nassen Element. Und falls ich einmal keine Gelegenheit dazu bekam, gab es das virtuelle Pendant des Schwimmbads in meinem Gedankenhaus. Ich brauchte nur die Milchglastür mit dem türkisfarbenen Streifen öffnen und war mit einem Sprung im Wasser.
Ein Schrecken fuhr mir in die Glieder, als draußen ein LKW vorbeiklapperte. Der Luftzug blähte die Vorhänge.
Oh nein, das Fenster sollte geschlossen sein.
„Hallo, Ava.“ Dr. Fredag stand hinter mir.
Völlig lautlos hatte sie den Raum betreten und musterte mich nun ausdruckslos. Ich murmelte eine Begrüßung. Sie nickte und wies mit der Hand zur Sitzgruppe.
„Möchtest du vielleicht deine Mütze abnehmen und mir dein bezauberndes Gesicht zeigen?“, fragte sie. „Die brauchst du hier nicht.“
Nein, möchte ich nicht, dachte ich, sagte es aber nicht. Stattdessen zuckte ich mit den Schultern. Sie lächelte mich an und nickte. Es war ein Ritual zwischen uns.
„Nun gut“, sagte die blassgesichtige Therapeutin, „dann setz dich doch bitte.“
Ich ließ mich in das Sofa sinken und zog die Mütze tiefer ins Gesicht. Die Haarspitzen meines Ponys piksten mir in die Augen, aber ich mochte ihn so lang. Dr. Fredag nahm in ihrem Sessel Platz, dem Sofa gegenüber.
„Wie war deine Woche, Ava?“, fragte sie und rückte ihre blaugeränderte Brille zurecht. Auf ihrem Schoß lag ihr Notizblock. Meist hielt sie ihre Hände darauf gefaltet. In meinem Beisein hatte sie noch nie etwas notiert.
„Gut“, antwortete ich zögernd, denn das war eine Frage der Perspektive. Was für mich „gut“ erschien, mochte für sie „katastrophal“ heißen. Und umgekehrt.
Draußen lärmte eine Horde Grundschulkinder vorbei. Das Fenster sollte eigentlich geschlossen sein.
„Können wir bitte das Fenster schließen?“, fragte ich leise.
„Meinst du nicht, ein wenig Frischluft würde uns beiden guttun?“, fragte sie zurück.
Ich beugte mich vor, bis meine verschränkten Arme die Knie berührten. Der Pony versperrte mir nun völlig die Sicht, aber das störte mich nicht. Ich wollte Dr. Fredags harmonisierendes Lächeln ohnehin nicht sehen.
„Bist du mit deiner Wochenaufgabe zurecht gekommen?“
Ich zuckte mit den Schultern.
„Möchtest du mir davon erzählen?“
Nein, das mochte ich nicht. Meine Wochenaufgabe hätte ein offenes Auf-jemanden-Zugehen erfordert. Möglicherweise ein lockeres Gespräch, ein Austausch von gehaltlosen Sätzen. Eine Disziplin, in der ich bei jedem Versuch versagte. Weil mein Gehirn seltsame Impulse an meinen Körper sandte, die die Hände feucht werden ließen, die Wangen heiß und den Hals staubtrocken. Impulse, die dem halbverdauten Frühstückshaferbrei in meinem Bauch eine Extraportion Magensäure spendierten, wenn es Mika war, der vor mir stand, mich erwartungsvoll ansah und auf eine Antwort wartete. Ich hatte wiederholt feststellen müssen, dass die hundert Millionen Neuronen in meinem Gehirn sich nicht so einfach kontrollieren ließen, nur weil Dr. Fredag mir eine Wochenaufgabe stellte. Ich war keine Neuronendompteurin. Meine Synapsen hatten einen natürlichen Drang zu impulsivem Ungehorsam. Sie spielten nach ihren eigenen Regeln. Vor meinem inneren Auge sah ich eine wilde Horde rot blinkender Impulse durch das feine Gitternetz der Nervenbahnen jagen – und folgte ihnen.
Wie ein Skispringer landete ich mit einem perfekten Telemark im Schlafzimmer meiner Eltern. Auf dem riesigem Bett in der Mitte des Raums türmte sich das Plumeau hoch auf wie eine wunderbare Schneelandschaft. Ich kroch hinein und genoss das Federgewicht der Bettdecke, die mich in Unbekümmertheit einhüllte. Es roch nach Mama und Papa, nach Lange-Schlafen und trägen Sonntagmorgen. Das leise Ticken von Papas Wecker gab meinen rasenden Herzschlägen einen ruhigeren Takt vor. Ich räkelte mich wohlig unter der Decke. Sonnenlicht fiel durch die Gardinen und warf verzerrte Muster auf Bett und Wände. Zwei Türen erschienen aus dem Nichts, die eine rot mit weißen Punkten, die andere hellblau mit lächelndem Gesicht. Doch plötzlich endete das Lächeln und wandelte sich zu einer strengen Miene. Eine vertraute, aber ungewohnt resolute Stimme brach laut in die tickende Stille ein:
„... Zeit, diese Barriere zu durchbrechen, meinst du nicht, Ava? Ich denke, wir beide sind an einem Punkt angelangt, an dem eine Pause einen größeren Fortschritt erzielen würde als eine Fortführung unserer Schweigesitzungen. Was hältst du davon, wenn wir etwas Neues versuchen? Ich werde dich an einen Kollegen überweisen.“
III.
Eine leise Irritation meiner Geruchsrezeptoren weckte mich noch vor dem Weckerklingeln. Ein heftiger Schreck durchzuckte mich. Rauch. Alarmiert setzte ich mich auf und lauschte.
Alles war still.
Das bedeutete: Papa rauchte am Badezimmerfenster und Mama schmollte in der Küche über einer Tasse „Guten-Morgen-Tee“. Sie hatten sich mal wieder gestritten, Papa hatte mal wieder den Kürzeren gezogen und Mama war mal wieder beleidigt, weil er sie nicht verstehen wollte. An solchen Morgen schien es mir, als lebten die beiden nicht nur in unterschiedlichen Welten, sondern in zwei verschiedenen Sonnensystemen, die regelmäßig in unserer Vier-Zimmer-Wohnung kollidierten, implodierten und die mühsam aufrecht erhaltene Ordnung mit schwarzen Löchern perforierten.
Mit einem aus der Tiefe aufsteigenden Seufzer ließ ich mich zurück in die Kissen fallen. Schlechtes Gewissen breitete sich wie ein Schwelbrand in mir aus. Hätte ich nur meinen Mund gehalten und Dr. Fredags Vorschlag stillschweigend akzeptiert. Ich hätte einfach am nächsten Freitag zu diesem Kollegen, diesem Dr. Alboroto, gehen können, ohne meine Eltern damit zu behelligen.
Dumm, dumm, dumm war ich!
Doch weil mir das Ganze so spanisch vorgekommen war, hatte ich diese Information leichtfertig geteilt und dadurch die beiden Heimatplaneten auf Kollisionskurs gebracht. Papa war nämlich der Meinung (und da wollte ich ihm gerne beipflichten), dass die Therapiestunden vergeudete Lebenszeit wären und ich das gar nicht nötig hätte. Meine Schüchternheit würde sich schlicht und einfach mit der Pubertät auswachsen, behauptete er.
Meine Mutter dagegen tutete mit Dr. Fredag in das gleiche Horn und sprach von Sozialphobie und Depressionen. Sie verstand nicht, dass ich einfach nur lieber für mich blieb, anstatt mich mit den hohlköpfigen Gleichaltrigen an meiner Schule abzugeben, und dass ich lieber meinen eigenen Gedanken nachhing – die, wohl gemerkt, durchaus unterhaltsamer waren als das Geschwätz meiner Mitschüler. Sie konnte auch nicht nachvollziehen, dass mich größere Menschenansammlungen nervös machten und diese Nervosität zu körperlichen Symptomen wie unkontrollierbarem Erröten, Zittern, Herzrasen, Schweißausbruch oder Sprechhemmung führte, die ich tunlichst in der Öffentlichkeit vermeiden wollte. Dabei war es völlig egal, ob es sich dabei um viele oder nur einen Zuschauer handelte. War es nicht normal, sich vor möglichen Demütigungen bewahren zu wollen? Also, für meine Begriffe schon. Am liebsten wollte ich in Ruhe gelassen werden, und zwar von allen – blutsverwandt oder nicht.
Der Wecker piepte durchdringend. Zehn vor sieben. Zeit, in den Kampf zu ziehen.
Widerstrebend hievte ich die Beine aus dem Bett. Der Boden unter meinen Füßen, graubraunes Schiffsparkett aus Eiche, war kalt und schien zu schwanken. Schnell fischte ich nach einem Paar geringelter Socken, das ich achtlos unter das Bett gekickt hatte – zu den anderen vierzehn (oder so) Paaren, die dort zwischen halbleeren Müslischalen, Wollmäusen und ungelesenen, aber nicht verschmähten Büchern ein geheimes Eigenleben führten und sich wöchentlich zu vermehren schienen. Ich verwarf die Idee, duschen zu gehen, und angelte nach meinen Klamotten, die dort lagen, wo sie mir am Abend zuvor vom Körper gerutscht waren. Die Jeans hatte ausgebeulte Knie und eine Wäsche dringend nötig. Ich überlegte kurz die Alternativen, entschied, dass es auf einen Tag mehr oder weniger nicht ankam, und schlüpfte hinein. Das dünne Trägerhemdchen, in dem ich geschlafen hatte, behielt ich an. Es auszuziehen hätte mich arge Überwindung und eine Menge Körperwärme gekostet. Ich versank dankbar in den wohligen Weiten meines Kapuzenpullis. Noch eben den wollenen Helm aufgesetzt – und schon fühlte ich mich halbwegs gewappnet für kommende Schlachten.
IV.