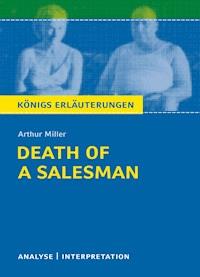8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ein unter die Haut gehendes Porträt des Rassismus in Brooklyn während der letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Mr. Newman ist ein kleiner Angestellter mit einem großen Ehrgeiz. Von seinem gläsernen Büro aus überwacht er die ihm unterstellten Stenotypistinnen. Doch eines Tages lässt seine Sehkraft nach. Als der Arzt ihm eine Brille verordnet, beginnt sein Leidensweg. Denn plötzlich wirkt Newman in den Augen seiner Mitmenschen irgendwie »jüdisch«. Newman, bislang rassistischen Diffamierungen gegenüber vollkommen gleichgültig, steht plötzlich selbst im Brennpunkt antisemitischer Hetze. Der einzige Roman des großen amerikanischen Dramatikers. Erstmals seit Jahrzehnten wieder lieferbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Ähnliche
Arthur Miller
Fokus
Roman
Aus dem Amerikanischen von Doris Brehm
FISCHER E-Books
Inhalt
»Mein Gott«, sagte sie schließlich lachend, »du siehst beinahe aus wie ein Jude.« Er lachte auch, wobei er das Gefühl hatte, als stünden seine Zähne hervor.
Vorwort
In der Entstehungsgeschichte dieses Romans nimmt die Schiffswerft der Navy in Brooklyn einen besonderen Platz ein. Dort habe ich während des Zweiten Weltkriegs in der Abteilung Bordmontage gearbeitet und Nachtschichten geleistet, als einer von gut sechzigtausend Männern und einigen wenigen Frauen jeder ethnischen Herkunft in New York. Heute lässt sich nicht mehr recht sagen, ob es der eigene, durch Hitler geschärfte Blick oder faktischer Antisemitismus war, der in mir so oft die bange Frage aufsteigen ließ, ob wir uns, wenn endlich Frieden wäre, auf eine rohe Politik der Rasse und Religion gefasst machen müssten, und zwar nicht etwa in den Südstaaten, sondern in New York. Auf jeden Fall nahm die Judenfeindlichkeit, ganz unabhängig davon, wie deutlich sie sich im täglichen Umgang zeigte, in meinem Kopf erschreckende Ausmaße angesichts der realen Bedrohung durch den Nazismus an. Hinzu kam, dass die Kollegen der vierzehnstündigen Nachtschichten so gut wie keinen Begriff davon hatten, was der Nazismus bedeutete – kämpften wir doch vor allem deshalb gegen Deutschland, weil sich das Deutsche Reich mit den Japanern verbündet hatte, den Angreifern von Pearl Harbor. Und nicht selten hörte man sagen, wir seien von einflussreichen Juden, den geheimen Drahtziehern hinter unserer Regierung, in diesen Krieg manövriert worden. Erst, als alliierte Truppen in die deutschen Konzentrationslager vordrangen und Fotos der Berge von ausgemergelten, oftmals verkohlten Leichen in den Zeitungen erschienen, wurde der Nazismus dem aufrechten Amerikaner wirklich ein Gräuel und rechtfertigte unsere eigenen Opfer. (Dass der nationale Konsens im Hinblick auf den Krieg damals bei einer Vielzahl der Leute so tief ging, halte ich für ein Märchen.)
Ich kann bis heute nicht in diesem Roman blättern, ohne erneut die Dringlichkeit zu empfinden, die das Schreiben begleitete. Damals war der Antisemitismus in Amerika meines Wissens literarisch ein wenn nicht tabuisiertes, so doch totgeschwiegenes Thema – zumindest hatte noch kein Roman ihn ins Zentrum gerückt, geschweige denn die Existenz von Fanatikern innerhalb des katholischen Klerus, die mit Pflichteifer und Vergnügen Judenhass schürten. Man mag der Ansicht zuneigen, dass die Welt sich kaum zum Besseren gewandelt hat, doch wenigstens hier gibt es rühmliche Ausnahmen.
Daran musste ich erst neulich denken, als ich ganz zufällig einen Lokalsender in Connecticut einschaltete und mithörte, wie ein katholischer Priester einem offenkundigen Antisemiten auszureden versuchte, dass die Schuld an mehreren Anschlägen auf jüdische Wohnhäuser und Synagogen in der Region Hartford diesen selbst zuzuschreiben wäre. Nach den Tätern wurde weiträumig gefahndet, und der Mann hatte sich in der Sendung des Geistlichen zu Wort gemeldet, um seine Vermutungen über mögliche Täter zu äußern. Für ihn stand außer Frage, dass es nur jemand getan haben konnte, der von Juden schlecht behandelt worden war, einer, der für Juden arbeitete oder dem von Juden schadhafte Ware angedreht, der von Juden um sein Geld gebracht worden war, der Mandant eines jüdischen Anwalts vielleicht, der sich betrogen fühlte. Es gebe, fand der Mann, alle möglichen Erklärungen, weil ja die Juden, wie jedermann wisse, Betrüger aus Gewohnheit und Ausbeuter ihrer Angestellten seien, weil sie grundsätzlich kein Rechtsbewusstsein und keinen Respekt hätten und sich nur ihresgleichen verpflichtet fühlten. (Der Brandstifter wurde wenige Wochen später gefasst – ein geistesverwirrter junger Jude.)
Diese Leier hatte ich seit den dreißiger und frühen vierziger Jahren nicht mehr gehört. In der Zeit vor den Zeitungsfotos der Leichenberge. Aber da war sie nun wieder, neuaufgelegt, brandneue Enthüllungen, von denen der Anrufer mit unüberbietbarer Selbstgewissheit annahm, sie seien Allgemeingut, nur gehöre es sich nicht, dergleichen laut zu sagen. Der Mann trat so selbstgewiss auf, dass er mit dem armen Geistlichen bald kurzen Prozess gemacht hatte und im Brustton der Überzeugung versichern konnte, er sage es bloß, wie’s ist, er sei kein Antisemit.
Geändert hat sich heute natürlich einerseits, dass kein Hitler der größten Streitmacht der Welt vorsteht und die Auslöschung des jüdischen Volks verspricht, und andererseits, dass es Israel gibt, das ungeachtet einer in vielem fehlgeleiteten Politik imstande ist, das Existenzrecht der Juden zu verteidigen. Der Roman Fokus hingegen entstand zu einer Zeit, als vernünftige Menschen sich durchaus fragen mussten, ob nicht schon die Annahme eines solchen Rechts jedem Realitätssinn widerspreche.
Heute fragt man sich unweigerlich, ob es je wieder zu einer Situation kommen könnte, wie sie in dem Roman beschrieben wird, und die Antwort kennt niemand. In den fünfziger und sechziger Jahren hätte ich mir vielleicht einreden können, dass es ziemlich unwahrscheinlich sei, und ich würde diese Einschätzung damit begründet haben, was damals Züge eines epochalen Sinneswandels in der Wahrnehmung der Juden annahm. Denn der Antisemitismus, der so untrennbar mit dem Totalitarismus verbunden war, galt nun als eine der Hauptursachen für die Aushöhlung der Demokratie und war somit, zumindest als politisches Programm, für alle indiskutabel geworden, die sich, ungeachtet etwaiger persönlicher Vorbehalte gegen Juden, noch zum freiheitlich verfassten Staat bekannten. Der Zusammenhang aber von individueller Voreingenommenheit und kollektiver Katastrophe war, als das Buch entstand, noch kein Thema, und doch bestimmt es dessen Struktur und Handlung. Am Ende des Zweiten Weltkriegs war der Antisemitismus keine Privatsache mehr.
Ein Sinneswandel in der Wahrnehmung der Juden begleitete auch, paradoxerweise, die ersten erfolgreichen Dekaden Israels nach seiner Staatsgründung. Die Juden waren, kurz gesagt, nicht länger nur Schemen, ein ghettoisiertes Enigma, sondern Farmer, Kampfflieger, Arbeiter. Sie legten die Opferrolle ab, erhoben sich und reihten sich plötzlich ein unter die gefährlichen Nationen – gefährlich im konventionellen militärischen wie im charakterologischen Sinn. Sie waren jetzt wie die anderen, und eine Zeitlang schien es undenkbar, dass herkömmliche antisemitische Ansichten sich an Kämpfern statt wehrlosen Opfern entzünden könnten. Eine Zeitlang strahlten die technischen und militärischen Visionen Israels in etliche afrikanische Länder aus, und Israels Beispiel schien als Vorbild für jedes Schwellenland geeignet, das Anschluss an die Industrienationen suchte.
Diese beispiellose Phase währte nicht lange. Eine Ironie so gigantischen Ausmaßes, dass sie einen zu mystischen Erklärungsversuchen verleiten könnte, ließ Israel, dieses einst von Agrarsozialisten und internationalistischen Bauernsoldaten besiedelte Land – faktisch graduell und aus globaler Sicht ganz – zu einer kriegerischen, hochgerüsteten Lagernation werden, deren rigorose kollektive Wehrhaftigkeit gegen seine Nachbarn sich seither unaufhaltsam bis hin zum Fanatismus verhärtet. Die jüdische Isolation ist wieder da, nur neuerdings bewaffnet. Und so wird eine weitere Rollenfigur der langen historischen Liste hinzugefügt, die schon so viele widersprüchliche Paarungen kennt – Einstein und Freud und/oder Meyer Lansky und ähnliche Gangster; Karl Marx und/oder das Haus Rothschild; der Prager KP-Chef Slánksý als Statthalter Stalins in der Tschechoslowakei und/oder der Jude Slánský am Galgen als Opfer des paranoiden Antisemitismus Stalins.
Fokus befasst sich mit Rollenbildern dieser Art. Zentrales Motiv ist der innere Sichtwechsel eines antisemitischen Mannes, den die Umstände zu einer veränderten Einstellung und Beziehung den Juden gegenüber zwingen. Meines Erachtens wurde Newmans Schritt in Richtung Empathie mit den Juden – zumindest für Teilaspekte ihrer Lage – seit Mitte der vierziger Jahre tatsächlich maßvoll in Teilen der demokratischen Welt vollzogen, und insofern erscheint die Vision einer inneren Wandlung wie die in dieser Geschichte nicht nur romantisch und unwahrscheinlich.
Aber in den vierzig Jahren seit der Entstehung von Fokus haben sich durchaus überraschend wieder andere Perspektiven zur Lage der Juden eröffnet. Interessant sind hier die Haltungen einiger asiatischen Völker gegenüber den erfolgreichen Fremden in ihrer Mitte, etwa der Chinesen in Thailand und der Vietnamesen im Kambodscha Sihanouks, vor der Besetzung des Landes durch vietnamesische Truppen. In Bangkok haben mich Charakterisierungen der ortsansässigen Chinesen erheitert, weil sie so sehr dem glichen, was die Leute früher über die Juden sagten und im Westen zweifellos immer noch sagen. »Die Chinesen kennen Loyalität eigentlich nur gegenüber ihresgleichen. Sie sind sehr schlau, lernen eifriger in der Schule, wollen überall immer die besten sein. Es gibt in Thailand viele chinesische Banker, zu viele; eigentlich war es ein Riesenfehler, den Chinesen die thailändische Staatsangehörigkeit zu gewähren, weil sie das Bankensystem unterwandert haben. Außerdem spionieren sie für China, oder würden es in Kriegszeiten ganz bestimmt. Im Grunde wollen sie nur eines: eine Revolution in Thailand (obwohl sie Banker und Kapitalisten sind), die uns zu Vasallen Chinas macht.«
Ähnlich widersprüchliche Aussagen konnte man über die Vietnamesen hören, die seit Generationen in Kambodscha lebten; auch sie waren fleißiger als die Einheimischen, von fragwürdiger Loyalität und ungeachtet dessen, dass sie eifrige Kapitalisten waren, praktisch Agenten des kommunistischen Vietnam et cetera. Zwei Parallelen fallen dabei auf: Die Chinesen in Thailand und die Vietnamesen in Kambodscha agierten häufig als Händler und Krämer, Laden- und Hausbesitzer, sie stellten einen hohen Anteil der Lehrer und Anwälte und Intellektuellen, sie erregten in einem Agrarland Neid. Sie waren es, die aus Sicht des durchschnittlichen Thailänders oder Kambodschaners sozusagen das Unrecht im Leben verwalteten, denn ihnen war die Miete oder waren die inflationären Preise für Lebensmittel und andere Bedarfsgüter zu zahlen, und man sah doch mit eigenen Augen, wie bequem sie als Elite lebten.
Entscheidend ist aber auch, dass die Bewohner des Gastlands sich selbst im Vergleich zu solchen Fremden als irgendwie naiver wahrnahmen, als weniger aufs Geld aus, als »natürlicher« – und somit kaum prädestiniert für die intellektuelle Elite. Ähnliche Vorwürfe wurden, offen oder implizit, in der Sowjetunion und den von ihr militärisch und kulturell beherrschten Ländern Osteuropas erhoben. Fokus ist in seiner Sicht auf den Antisemitismus vor allem in diesem Sinne gesellschaftspolitisch: Der Jude wird im antisemitischen Denken als Exponent eben der Fremdheit gesehen, die Einheimische übelnehmen und fürchten, als Teil einer verschwörerischen Ausbeutung. Ich möchte dazu anmerken, dass man solche Fremdheit wohl fürchtet, weil es die Entfremdung ist, die man in sich selbst spürt, ein Nichtdazugehören, ein hoffnungslos antisozialer Individualismus, der alle Sehnsucht Lügen straft, als Teil einem mythischen Ganzen, der einen großen »Nation«, zu dienen. Man fürchtet die Juden, so scheint es manchmal, als das jeder symbolischen Ordnung entzogene »Reale«. Und vielleicht liegt hierin der Grund, warum auf ein wahres Ende antisemitischer Gefühle kaum zu hoffen ist. In den Spiegel der Realität zu schauen, die unschöne Welt und sich selbst zu erkennen, ist wenig erhebend und erfordert Charakter.
1984
Erstes Kapitel
Erschöpft von der Hitze war er endlich eingeschlafen. Seine Knochen schmerzten. Er war lange wach gelegen und hatte nach einem Traum gesucht, der ihn ins Unbewusste hinüberziehen könnte. Dabei war er eingeschlafen, und ein Traum stieg in ihm auf.
Er befand sich auf einer Art von Rummelplatz. Eine Menschenmenge hörte einem Ausrufer zu, von dessen Gesicht Schweiß heruntertropfte. Er löste sich aus dem Gedränge und wanderte ziellos weiter. Das Meer war irgendwo in der Nähe. Dann stand er vor einem großen Karussell, das seltsam mit grünen und violetten Flächen bemalt war. Niemand war da, meilenweit kein Mensch. Und doch bewegte sich das Karussell. Die grellfarbigen leeren Wagen drehten sich im Kreis. Plötzlich hielten sie und drehten sich rückwärts. Wieder blieben sie stehen und nahmen die frühere Richtung von neuem auf. Erschrocken stand er da und beobachtete das Hin und Her des Karussells, und plötzlich wusste er, dass unter dem Boden, auf dem er stand, eine riesenhafte Maschine arbeitete: eine Fabrik. Unterhalb des Karussells wurde etwas erzeugt. Während er versuchte, dahinterzukommen, was es sein könnte, stieg Angst in ihm auf. Das leere Karussell drehte sich vorwärts und rückwärts, er ergriff die Flucht davor. Dann hörte er zum ersten Mal, dass ein Lärm davon ausging, ein stärker werdender Ton, ein Schrei: »Lorelei! Lorelei! Lorelei!«
Erschrocken wachte er auf. Es war wie eine Frauenstimme gewesen. Laut und eindringlich. Er keuchte. Mit offenen Augen lag er da und horchte.
Die Nacht war ruhig. Von der sanften sommerlichen Brise wurden die Vorhänge leicht bewegt. Er blickte auf sein Fenster hinüber und bedauerte, dass er es so weit offen gelassen hatte. Plötzlich hörte er wieder den Schrei. »Lorelei!« Rechts und links von ihm zuckten seine Arme. Er lag vollständig still. Wieder durchdrangen die drei Silben das Zimmer. Sie kamen von der Straße her. Träumte er noch? Er versuchte, ein Bein zu heben, es funktionierte. Er stieg aus dem Bett und ging barfuß aus dem Zimmer über den Korridor in das vordere Schlafzimmer. Er trat ans Fenster und hob die Jalousie.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße bemerkte er zwei sich bewegende Gestalten. Und wieder ertönte der Schrei, aber diesmal konnte Newman ihn richtig verstehen. Die Frauenstimme rief: »Polizei! Polizei! Bitte, Polizei!«
Er versuchte, das Dunkel zu durchdringen, und hockte unbeweglich beim Fenster. Eine Frau schien dort draußen mit einem Mann zu raufen. Es war ein kräftiger Mann, Newman konnte seine Stimme hören: eine betrunkene, drohende Bassstimme. Die Frau riss sich nun von ihm los und rannte in der Richtung auf Newmans Haus zu. Über dem Kanalgitter in der Mitte der Straße holte der Mann sie ein und schlug mit dem Arm gegen ihren Kopf. Das Kanalgitter klirrte unter seinem Gewicht. Während er sie festhielt, ließ sie einen schrillen Wortschwall los – die Worte hatten einen spanischen Klang. Wahrscheinlich ist sie aus Puerto Rico, dachte Newman. Der Mann aber stammelte englisch, stellte er erleichtert fest. Wieder hob sich der Arm des Betrunkenen, um die Frau zu schlagen, und wieder schrie sie nach der Polizei, diesmal mit flehender Stimme in die Dunkelheit hinausjammernd. Newman war nur zehn Meter von ihr entfernt, er konnte ihre heftigen Atemzüge hören, während sie die Polizei rief. Sie drehte sich jetzt seinem Fenster zu. Sie musste bemerkt haben, dass seine Jalousie soeben erst hinaufgeschnellt war. Rasch trat Newman ins Zimmer zurück. »Polizei!« Er dachte an seine nackten Füße; ohne Schuhe konnte ihm schwerlich zugemutet werden, hinauszugehen und dieser Sache ein Ende zu setzen. Schließlich war auch niemand anderer aus dem Häuserblock draußen. Wenn er die Polizei rief, würden die beiden wahrscheinlich längst fort sein, ehe jemand kam, und es wäre dann peinlich für ihn, zu erklären, warum er so viel Unruhe verursacht hatte. Die beiden rauften im Augenblick nur etwa zehn Fuß von seinem kleinen Vorgarten entfernt. Er konnte das Gesicht der Frau nicht sehen, denn sie stand vor der Laterne, doch glaubte er sekundenlang, durch das Dunkel ihre Augen wahrzunehmen. Das Weiße hob sich hell von ihrer dunklen Haut ab, sie warf hilflose Blicke auf sein Haus und auf all die anderen Häuser, aus denen zweifellos andere Leute sie beobachteten. Doch er zog sich vom Fenster zurück, während sie wieder mit ihrem fremden Akzent nach der Polizei schrie. Er drehte sich um und verließ das Zimmer.
»Polizei!« In seinem Schlafzimmer ließ er das Fenster herunter, bis nurmehr ein schmaler Spalt offen war, durch den niemand hereinkriechen konnte. Er lag auf seinem Rücken und horchte. Die Nacht war wieder ruhig geworden. Er wartete lange Zeit. Es war nichts mehr zu hören. Er schüttelte den Kopf und versuchte sich vorzustellen, welche Sorte von Frauenzimmer zu dieser Nachtstunde allein auf der Straße sein konnte. Oder, wenn nicht allein, dann mit dieser Sorte von Mann. Es wäre natürlich möglich, dass sie von einer Nachtschicht nach Hause ging und von einem fremden Mann belästigt worden war. Doch war das unwahrscheinlich. Ihre Aussprache war für Newman ein Beweis, dass sie zu keinem guten Zweck bei Nacht unterwegs war, außerdem gab sie ihm die Überzeugung, dass sie selber auf sich Acht geben konnte, da sie ja an diese Art Behandlung gewöhnt sein musste. Die Leute aus Puerto Rico waren so etwas gewohnt, das wusste er.
Müde, uninteressiert, kaum mehr wissend, dass er wach gewesen war, schloss er seine Augen und überließ sich dem Schlaf. Langsam öffneten sich seine fetten kleinen Finger, seine Lippen begannen den Atem einzusaugen, denn seine scharf gebogene Nase führte ihm zu wenig Luft zu. Wie immer lag er flach auf seinem Rücken, eine Hand auf dem Hügel seines Bauchs; seine kurzen, nicht ganz geraden Beine waren ausgestreckt, die Zehen tasteten am Leintuch. Sogar im Schlaf schien er an seiner Pedanterie festzuhalten, denn als die Brise bald darauf nachließ, legte seine Hand das Leintuch sorgfältig um und bewegte sich dann zu ihrem Platz auf dem Bauch zurück. Wenn er aufwachte, würde es kaum eine Falte im Bettzeug geben, und sein rötliches, flach niedergebürstetes Haar würde kaum eines Kamms bedürfen.
Zweites Kapitel
Es hatte eine Zeit gegeben – bis vor wenigen Wochen –, da es ihm Freude bereitet hatte, frühmorgens aus seinem Haus herauszutreten. Mit der Vitalität eines Vogels war er auf seine vordere Veranda geeilt, war die Ziegelstufen der Vortreppe hinuntergestiegen und hatte den kleinen Rasenplatz seines Gartens nach Papierfetzen abgesucht, die über Nacht hereingeweht waren. In flottem Tempo hatte er alles aufgesammelt und es in dem Abfalleimer am Randstein deponiert, dann hatte er einen flüchtigen, aber zärtlichen Blick auf sein Haus geworfen und sich auf den Weg zur Untergrundbahn gemacht. Er ging vorgebeugt, mit hastigen Schritten, wie gewisse Hunde die Straße hinuntertrotten, ohne nach rechts oder links zu schauen. Es war, als fürchtete er, dass man ihn für einen Müßiggänger halten könnte.
Doch als er an diesem Morgen auf die Veranda kam, schlug ihm die Hitze schmerzhaft ins Gesicht und erinnerte ihn an seinen Körper und an seine Beschwerde. Sekundenlang empfand er ein Schwäche- und Angstgefühl. Er ging bis zur Treppe und blieb stehen, als er es unter seinem Schuh knistern hörte. Sich tief hinunterbeugend, suchte er den Ziegelboden ab, hob seine polierte runde Schuhspitze und bemerkte ein Stückchen Cellophanpapier. Mit zwei Fingern hob er es auf, ging die Treppen hinunter und über den schmalen auszementierten Weg bis zum Randstein, wo er den Abfalleimer öffnete und das Cellophanstückchen hineinlegte. Einen Augenblick blieb er stehen und glättete seine dunkelblaue Sommerjacke über seinem Bauch, der sich zu einer Ausbuchtung, wie er es nannte, zu vergrößern begann. Dabei fühlte er, dass unter seinem gestärkten Kragen der Schweiß ausbrach. Mit leerem Blick starrte er sein Haus an.
Ein Fremder hätte absolut keinen Unterschied zwischen Newmans Haus und den anderen bemerkt. Gleichmäßig aneinandergereiht standen sie da: zweistöckige Ziegelgebäude mit flachen Dächern, die Garagen unter den erhöhten vorderen Terrassen eingebaut. Vor jedem Haus wuchs eine schlanke Ulme, die kaum dünner oder dicker als ihre Nachbarinnen war, da sie alle in derselben Woche gepflanzt worden waren – vor etwa sieben Jahren, als die Bauten vollendet wurden. Für Newman aber gab es bestimmte ausschlaggebende Unterschiede zwischen ihnen. Als er jetzt einen Augenblick neben dem Abfalleimer stand, blickte er auf seine Fensterläden, die er lichtgrün gestrichen hatte. Alle anderen Häuser hatten dunkelgrüne Faden. Oftmals hatte er sich leichtsinnigerweise gewünscht, dass das ganze Haus aus Holz bestünde, damit er mehr zu streichen hätte. Wie die Dinge lagen, konnte er sich nur mit seinem Auto beschäftigen, welches seit Kriegsbeginn in der Garage eingestellt war. Vor dem Krieg hatte er den Wagen jeden Sonntag herausgebracht, ihn mit einem Tuch poliert und das Innere sauber ausgebürstet, dann war er mit seiner Mutter in die Kirche gefahren. Ohne es sich einzugestehen, hatte er jedoch viel mehr Freude an dem Auto, seitdem es aufgebockt in der Garage stand. Da Rost eine große Gefahr für eine außer Gebrauch stehende Maschine ist, pflegte er nun jeden Sonntag den Motor einige Minuten laufen zu lassen. Dann wanderte er um den Wagen herum, suchte nach Rostflecken und drehte die Räder mit seinen Händen, damit das Schmieröl nicht stockte. Jeden Sonntag führte er sämtliche Manipulationen aus, die eigentlich nur zweimal jährlich nötig gewesen wären. Wenn er dann fertig war, wusch er seine Hände und setzte sich zu einer guten Mahlzeit nieder, wobei er seine Muskeln spürte und sich seiner Gesundheit freute.
Nachdem er sich nun überzeugt hatte, dass der Abfalleimer fest verschlossen war, wanderte er in seiner feierlichen Art die Straße hinunter; aber trotz seiner gleichmäßigen Schritte und seiner selbstbewussten, aufrechten Kopfhaltung fühlte er eine innere Unruhe. Um sich abzulenken, dachte er an seine Mutter, die nun in seinem Haus in der Küche saß und darauf wartete, dass das Mädchen kam und ihr Frühstück zubereitete. Sie war unterhalb der Hüfte gelähmt, und ihre einzigen Gesprächsthemen waren ihre Schmerzen und Kalifornien. Er versuchte, seine Gedanken auf sie zu konzentrieren; aber als er sich der Untergrundstation näherte, befiel ihn eine leichte Übelkeit, und er war froh, einen Augenblick in den kleinen Laden an der Ecke einzutreten, wo er seine Zeitung kaufte. Er wünschte dem Besitzer einen Guten Morgen und zahlte mit einer Münze, wobei er es vermied, die Hand des Mannes zu berühren. Der Gedanke an einen Kontakt mit dieser Hand war ihm irgendwie unangenehm. Er hatte den Eindruck, als ob ein abgestandener Küchengeruch an Herrn Finkelstein haftete. Er wollte mit diesem Geruch nicht in Berührung kommen. Herr Finkelstein grüßte wie gewöhnlich, und Newman begab sich mit seiner Zeitung um die Ecke zur Untergrundstation. An der Rolltreppe blieb er stehen, klammerte sich umständlich an das Geländer an und ließ sich abwärtsgleiten.
Er hatte die Münze für die Sperre bereit und warf sie ein, nachdem er mit den Händen nach der Einwurfspalte getastet hatte, obwohl er diese leicht hätte sehen können, wenn er seinen Kopf vorgebeugt hätte.
Er trat auf den Bahnsteig hinaus, wandte sich nach links, ging langsam weiter, wobei er feststellte, dass die meisten Leute sich, wie gewöhnlich, in der Mitte zusammendrängten. Er begab sich immer nach vorne, denn er war intelligent und hatte bemerkt, dass im vordersten Wagen immer am meisten Platz war. Als er eine Strecke von etwa zwanzig Metern zwischen sich und die anderen Wartenden gelegt hatte, verlangsamte er seine Schritte und blieb schließlich vor einer Stahlsäule stehen. Er stand mit dem Gesicht eine Handbreit von der Säule entfernt. Mit Schielen versetzte er die Pupillen seiner Augen in die richtige Einstellung. Er hob und senkte den Kopf, während er die mit weißer Ölfarbe gestrichene Säule absuchte. Wie gewöhnlich hatte jemand etwas hierhin geschrieben. Als er zu lesen begann, kribbelte seine Haut. Mit Bleistift hingekritzelt stand da: »Komm L A 4–4409 herrlich schön und diskret.« Wie schon so oft dachte er darüber nach, ob dies eine Form von Reklame oder nur der Scherz eines Wunschträumers sei. Ein Hauch des Abenteuerlichen berührte ihn, er hatte die Vision einer abgelegenen kleinen Wohnung … dunkel … erfüllt von Frauenduft …
Weiter unten stießen seine suchenden Blicke auf die gut ausgeführte Zeichnung eines menschlichen Ohres. Daneben einige algebraische Zeichen. Er fand die Säule heute sehr abwechslungsreich. An manchen Tagen war alles schon weggewaschen, ehe er hinkam. »Mein Name ist nicht Elsie«, las er kopfschüttelnd und lächelte beinahe darüber. Wie böse diese Elsie – oder wie immer sie hieß – gewesen sein musste, als sie das schrieb! Wo diese Elsie jetzt wohl war? Schlief sie irgendwo? War sie auf ihrem Weg zur Arbeit? War sie glücklich, oder ärgerte sie sich? Newman fühlte eine Bindung, eine Zuneigung zu den Leuten, die auf diese Säulen schrieben. Sie schienen wirklich das hinzuschreiben, was sie dachten. Es war, wie wenn man die private Post eines Menschen durchsieht …
Plötzlich hörte er auf, sich zu bewegen. Da stand in sorgfältigen Druckbuchstaben: »Kikes begannen den Krieg«, und darunter: »Bringt Kikes um, bringt sie um.« Newman schluckte und starrte wie hypnotisiert auf diese Worte. Etwas höher oben stand: »Faschisten!« Daneben ein Pfeil, der auf die Aufforderung zum Mord hinzeigte.
Er wandte sich ab und schaute die Gleise an. Sein Atem ging rascher, eine Vorahnung von Gefahr stieg in ihm auf – es war ihm, als hätte er soeben einen blutigen Faustkampf beobachtet. Die Luft um die Säule herum war Zeuge eines stummen, aber erbitterten Kampfes. Während oben in den Straßen der Verkehr weitergegangen war und die Menschen ruhig geschlafen hatten, war hier eine heftige Strömung vorübergezogen und hatte ihre Spuren hinterlassen.
Unbeweglich stand er da. Nichts, was er sonst wo las, konnte ihn so erschüttern wie diese hingekritzelten Drohungen. Für ihn waren sie eine Art von stummem Protokoll, das die schlafende Stadt mechanisch aufzeichnete; eine geheime Zeitung, die das veröffentlichte, was die Leute wirklich dachten, wenn die Hemmungen egoistischer Privatinteressen ausgeschaltet waren. Es war, als entdeckte man die verborgenen Augen der Stadt und sähe ihr bis auf den Grund der Seele.
Die ersten entfernten Geräusche des nahenden Zugs weckten ihn aus seinen Gedanken. Er wandte sich wieder zur Säule. Da bemerkte er neben sich zwei Frauen, die nach parfümierter Seife dufteten. Er schielte zu ihnen hinüber. Warum, überlegte er, müssen solche Aufzeichnungen immer von so offensichtlich ungebildeten Menschen gemacht werden? Diese zwei Damen beispielsweise waren bestimmt einer Meinung mit dem, der die Schlagworte aufgeschrieben hatte. Und doch blieb es immer der untersten Gesellschaftsschicht überlassen, in den Vordergrund zu treten und die Wahrheit zu verkünden.
Ein Luftstrom begann um seine Beine zu wirbeln, während der Zug, wie ein Kolben in einen Hohlzylinder, in die Station einfuhr. Newman trat einen Schritt zurück, sein Ellbogen streifte das Kleid einer der Damen. Der Seifengeruch war vorübergehend sehr stark wahrnehmbar, und Newman war froh, eine gepflegte Frau vor sich zu haben. Er schätzte es, mit gepflegten Leuten in einem Zug zu sitzen.
Die Tür öffnete sich zischend, die beiden Frauen stiegen ein. Newman wartete einen Augenblick und folgte ihnen dann mit großer Vorsicht, denn er konnte nicht vergessen, dass er vor einer Woche eingestiegen war, ehe die Tür sich vollständig geöffnet hatte, und an sie geprallt war. Während er jetzt hinauflangte und sich am herabhängenden Porzellangriff festhielt, errötete er in der Erinnerung an diese Ungeschicklichkeit. Sein Blut pulsierte rasch.
Der Zug sauste in der Richtung nach Manhattan. Unwiderruflich und rücksichtslos trug er ihn zu dieser Insel. Er schloss die Augen, wie um seine Furcht zu verbergen.
Seine Zeitung steckte immer noch unter seinem Arm. Er erinnerte sich an sie, entfaltete sie und tat, als ob er darin läse. Es gab heute keinerlei bedeutsame Überschrift. Die Worte schienen vor seinen Augen zu kriechen. Während er die Zeitung vor sich ausbreitete, als wäre er in sie vertieft, schielte er über ihren Rand auf den Mitfahrenden, der ihm gegenübersaß. Ein polnischer Ukrainer – stellte er ohne Überlegung fest. Er musterte den Mann so genau, wie es ihm möglich war. Seine Augen konnte er nicht sehen, doch nahm er an, dass sie klein waren. Ein polnischer Ukrainer, ein schweigsamer, schwer arbeitender Mensch, der gern trank und ziemlich dumm war.
Seine Blicke schweiften zu dem Nachbarn des polnischen Arbeiters. Ein Neger. Seine Blicke wanderten zum nächsten in der Reihe und blieben an ihm hängen. Er versuchte, ihm einen Schritt näher zu kommen. Dies war ein Typus, der ihm so interessant erschien wie eine seltene Uhr einem Sammler. Der Mann las aufmerksam in der Times. Seine Haut war hell, sein Nacken flach und gerade, sein Haar unter dem neuen Hut war höchstwahrscheinlich blond; mit einiger Anstrengung konnte Newman erkennen, dass er unter seinen Augen Tränensäcke hatte wie der selige Hindenburg. Den Mund konnte er nicht wahrnehmen, doch vermutete er ihn breit und voll. Er empfand ein Gefühl der Befriedigung, wie es immer in ihm aufstieg, wenn er auf seinem Weg zur Arbeit dieses heimliche Spiel spielte. Wahrscheinlich war er der Einzige im Abteil, der wusste, dass dieser Herr mit dem eckigen Kopf und der hellen Haut weder ein Schwede noch ein Norweger, noch ein Deutscher war, sondern ein Jude.
Er blickte wieder zum Neger hinüber und starrte ihn eine Weile an. Wie immer, wenn er ein Negergesicht vor sich sah, dachte er daran, dass er sich irgendeinmal näher mit den verschiedenen Typen dieser Rasse befassen wollte. Es war dies ein rein akademisches Interesse, denn beruflich hatte er nichts mit solchen Leuten zu tun.
Eine Hand berührte seine Schulter. Ehe er sich umwandte, richtete er sich unwillkürlich sehr gerade auf.
»Hallo, Newman, soeben habe ich mich umgedreht und Sie gesehen.«
Mit dem Ausdruck liebenswürdiger Herablassung, der sich jedes Mal, wenn er Fred begegnete, auf seinem Gesicht verbreitete, fragte er: »Wie war es gestern Abend bei euch im Haus? Sehr heiß?« Fred wohnte im benachbarten Haus. »Wir bekommen immer eine Brise durch die hinteren Fenster. Sie nicht?«, fragte Fred, als ob er in einem luftigeren Stadtteil lebte.
»Oh, gewiss«, sagte Newman, »ich habe sogar mit einer Decke geschlafen.«
»Ich stelle ein Bett in den Keller hinunter«, sagte Fred. »Nun, da er hergerichtet wurde, ist es dort schön kühl.«
»Es wird aber feucht sein«, vermutete Newman.
»Nicht jetzt, wo er ausgebaut ist«, erwiderte Fred.
Newman blickte unsicher vor sich hin. Fred war in der Ernährungsabteilung desselben Betriebs beschäftigt, in dem Newman arbeitete, allerdings in einem anderen Gebäude. Er trug einen Overall bei der Arbeit und benahm sich auch entsprechend. Wie schon oft, wenn er Fred begegnete, fühlte sich Newman gereizt und erwog, auch seinen eigenen Keller ausbauen zu lassen, obwohl das eigentlich über seine Verhältnisse ging.
Er konnte es nie verstehen, dass dieser polternde Bauernlümmel der Firma doppelt so viel wert war wie er selbst, trotz der Wichtigkeit seiner Arbeit und der Besonderheit seiner Begabung. Er schätzte es nicht, mit Fred in der Untergrundbahn gesehen zu werden, zumal ihn Fred beim Sprechen immer anstieß.
»Was sagen Sie zu dem Krach heute Nacht auf der Straße?«, fragte Fred. Ein verbissenes, schlüpfriges Lächeln lag auf seinem massiven Unterkiefer, von dem rechts und links zwei tiefe Falten hinaufgingen.
»Ich habe ihn gehört. Wie ist die Sache denn ausgegangen?«, fragte Newman, während seine wohlgeformte Unterlippe sich vorschob, wie immer, wenn er sich für etwas interessierte.
»Oh, wir sind hinausgegangen und haben Peter in sein Bett gebracht. Gott, war der besoffen!«
»Was – das war Ahearn?«, flüsterte Newman erstaunt.
»Jawohl. Er kam mit schwerer Ladung heim, und da sah er dieses Weibsstück. Sie war nicht übel, soweit ich feststellen konnte …« Fred hatte die Gewohnheit, beim Sprechen hinter sich zu blicken.
»Ist die Polizei gekommen?«
»Nein. Wir haben sie davongejagt und Peter nach Hause gebracht.«
Der Zug fuhr in eine Station ein, und sie wurden einen Augenblick getrennt. Als die Türen sich geschlossen hatten, trat Fred wieder auf Newman zu. Mehrere Minuten standen sie schweigend beieinander. Newman musste immer wieder Freds haariges Handgelenk betrachten, das sehr herb und anscheinend ungewöhnlich kräftig war. Er dachte daran, wie gut Fred im vorigen Sommer gekegelt hatte. Es war seltsam: Zuweilen machte es ihm Vergnügen, mit Fred und dessen Freunden zusammen zu sein, zeitweise aber, wie gerade jetzt, konnte er seine Gegenwart kaum ertragen. Er erinnerte sich an ein Picknick, das sie im Marinepark gehabt hatten und bei dem Fred eine Rauferei angestiftet hatte.
»Was sagen Sie zu den Vorgängen?« Freds Lächeln war geschwunden, aber die langgezogenen Falten blieben wie Narben auf seinen Wangen. Mit seinen angeschwollenen Schlitzaugen blickte er neugierig in Newmans Gesicht.
»Welche Vorgänge?«, fragte Newman.
»In der Nachbarschaft. Es wird noch dazu kommen, dass sie Neger in unserem Block einmieten!«
»Das kann schon noch passieren.«
»Alle Leute reden von den neuen Elementen, die sich da breitmachen.«
»Tatsächlich?«
»Der einzige Grund, warum die meisten unserer Nachbarn so weit herausgezogen sind, war, von diesen Elementen wegzukommen. Und jetzt verfolgen sie uns hierher. Kennen Sie diesen Finkelstein?«
»Von dem Süßwarenladen?«
»Er will seine sämtlichen Verwandten bei sich im Eckhaus einquartieren. Das erste Haus links vom Laden.«
Er blickte hinter sich.
Dies war es, was ihn an Fred faszinierte. Obwohl er gewünscht hätte, dass er leiser wäre, hörte er ihm doch gern zu, denn Fred sagte Dinge, die Newman selber nicht auszusprechen wagte. Durch seine Worte entstand in Newman die Vorahnung irgendwelcher Aktivität – ein ähnliches Gefühl wie vor den Säulen der Untergrundbahn. Etwas bereitete sich in dieser Stadt vor, etwas erregend Sensationelles.
»Wir denken daran, eine Zusammenkunft einzuberufen. Jerry Buhl sprach darüber mit Peter.«
»Ich dachte, diese Dinge seien nicht mehr modern.«
»Im Gegenteil«, sagte Fred stolz und zog seine Mundwinkel herunter. Seine Augenlider waren besonders in der Frühe so verschwollen, dass sie seine Augen kaum freigaben. »Sobald der Krieg vorüber ist und die Jungens zurückkommen, wird es hier losgehen wie noch nie. Wir warten nur ab, bis die Jungens zurückkommen. Diese Zusammenkunft wird eine Art Vorspiel sein – verstehen Sie? Der Krieg kann nun jeden Tag zum Ende kommen –, sieht schon ganz danach aus. Und da wollen wir bereit sein, verstehen Sie?« Er schien eine Bestätigung von Newman zu brauchen. Sein Gesichtsausdruck wurde unsicher.
»Hm«, machte Newman und wartete, bis Fred weitersprach.
»Kommen Sie hin? Ich könnte Sie im Wagen hinfahren.«
»Ich überlasse euch anderen die Zusammenkünfte.« Newman lächelte ermutigend, gewissermaßen vertrauensvoll. In Wirklichkeit schätzte er die Menschen nicht, die solche Zusammenkünfte veranstalteten. Bei den meisten von ihnen war eine Schraube los, und die Übrigen sahen aus, als hätten sie seit Jahren keinen neuen Anzug gehabt. »Ich habe für Versammlungen nicht viel übrig.«
Fred nickte, seine Zunge glitt über seine zigarrengebräunten Zähne, er schaute aus dem Fenster auf die vorüberschaukelnden Lichter.
»Na schön«, sagte er, gekränkt blinzelnd, »ich dachte, ich würde Sie einladen. Wir wollen doch die Nachbarschaft rein halten. Ich dachte, dass Sie auch daran interessiert sind. Wir brauchen es denen ja nur ungemütlich zu machen, dann werden sie schon einpacken.«
»Wer?«, fragte Newman begierig, mit einem interessierten Ausdruck auf seinem runden Gesicht.
»Die Juden in unserem Block. Und dann werden wir den Leuten gegenüber mit den Spics helfen. Bald wird es Möbelwagen auf unseren Straßen geben.« Er schien sich über Newman zu ärgern. Auf seinem vorstehenden Kinn zeigten sich kleine rote Flecken.
Wieder fühlte sich Newman von einer leichten Gefahr angeweht. Er wollte antworten, da fiel sein Blick auf den Juden mit den Hindenburg-Tränensäcken, der ihn eindringlich ansah.
Er wandte sich zu Fred und sagte: »Ich werde Sie noch verständigen. Es ist möglich, dass ich Donnerstag länger im Büro sein muss.« Er hatte dem Juden den Rücken gekehrt. Der Zug näherte sich seiner Station.
»Okay«, sagte Fred. Die Tür ging auf, und Newman stieg rasch auf den Bahnsteig hinaus. Als er die Rolltreppe sah, empfand er wieder eine leichte Übelkeit im Magen. Der Zug verschwand, und Newman bewegte sich dem Ausgang zu, wobei er darauf achtete, dem Rand des Bahnsteigs nicht zu nahe zu kommen.
Draußen auf der sonnigen Straße blieb er einen Augenblick stehen und atmete tief. Als er seinen Arm hob, um seinen Panamahut fester auf den Kopf zu drücken, rollte ein kühler Schweißtropfen aus seiner Achselhöhle über seine Rippen hinunter. In den letzten Wochen hatte er jeden Tag an dieser Straßenecke haltgemacht, in angstvoller Erwartung dessen, was ihm im Büro bevorstand. Wie immer in diesen Atempausen wurde seine Haut gelb wie Käse, teils von der Sonnenglut, teils von seiner Beängstigung. Dann ging er in gleichmäßigem Schritt weiter und versuchte, seine Gedanken abzulenken: Er dachte an sein Haus und an die vielen anderen gleichartigen Häuser, die rechts und links davon aufgereiht standen. Die Vorstellung ihrer Gleichartigkeit befriedigte sein Ordnungsbedürfnis. Er wanderte weiter auf das große Gebäude zu und nahm alle seine geistigen Kräfte zusammen.
Drittes Kapitel
Mit Ausnahme einiger alter Jahrgänge war jede Einzelne der siebzig weiblichen Angestellten von Newman engagiert worden. Sie arbeiteten an siebzig Schreibpulten in einem großen Saal im sechzehnten Stock dieses Gebäudes.
Als er ihm näher kam, hatte er einen verstörten Ausdruck, und seine Lippen bewegten sich krampfhaft, als suchten sie ihren richtigen Platz auf seinem Gesicht. Doch als er durch das gotische Tor des Wolkenkratzers schritt, wurden die Lippen ganz still, als wären sie gestorben, und während der Fahrstuhl ihn aufwärtstrug, wurden sie immer härter und trockener. Als er im sechzehnten Stock ausstieg, war sein Mund fest und streng verschlossen, als ob er Nahrung verweigerte.
Diese Verwandlung seines Gesichts war eine alte Gewohnheit. Seit zwanzig Jahren und länger hatte die gewaltige Größe dieser Gesellschaft, bei der er angestellt war, sie ihm aufgezwungen. Er wusste, dass die Gesellschaft hundert solcher Wolkenkratzer besaß – einen in jedem nordamerikanischen Staat und einen in fast jedem fremden Land. Der Gedanke an diese Größe lag wie ein Gewicht auf ihm und drückte ihn nieder, sooft die Gefahr drohte, dass er sich gegen die Gesellschaft würde verteidigen müssen. Er hatte gesehen, wie andere Männer versuchten, sich ihr gegenüber zu behaupten, und er hatte gesehen, dass sie unterlagen. Darum betrat er dieses sechzehnte Stockwerk mit einer Maske strengen Verantwortungsgefühls auf seinem Gesicht, so dass jeder, der ihn ansah, glauben musste, dass er innerlich bereits mit seiner Tagesarbeit beschäftigt sei. Sein Gesicht war wie das eines Pfarrers, der bei besonders feierlichem Anlass auf den Altar zuschreitet. Die Mädchen an ihren Schreibpulten reagierten auf diese Zeremonie, indem sie wegschauten und verstummten.
Er durchquerte den mit Schreibpulten angefüllten Saal und betrat seinen Büroraum. Während er seinen Hut an den Haken hängte, fühlte er eine tiefe Gereiztheit in sich aufsteigen. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und schaute weder rechts noch links, sondern hielt seinen Kopf gesenkt, als wäre er im Begriff, einen Fluch auszustoßen.
Ein grässlicher Streich war ihm gespielt worden, und er selber war dessen Urheber.
Es war nun mehrere Jahre her, dass er in übereifriger Dienstfertigkeit gegenüber seinen Arbeitgebern diese Idee eines Büroraums mit einer gläsernen Wand gehabt hatte. Der Gedanke gefiel und wurde ausgeführt. Und von da an brauchte er nur von seinem Schreibtisch aufzublicken, um festzustellen, ob alles im Saal in Ordnung war. Wenn ein Mädchen eine Frage zu stellen hatte, konnte sie nun nicht mehr ihren Platz verlassen und nach einem halbstündigen Umweg durch das Ankleidezimmer schließlich in seinem Büro landen, um eine Auskunft einzuholen. Sie brauchte nun bloß ihren Arm zu heben, und er konnte gleich darauf bei ihr sein. Durch diese Neuerung war einer der ärgsten Missstände des Betriebs abgestellt worden. Denn Newman hatte es oft bemerkt: Sobald eine ihren Platz verließ, folgte alsbald eine Zweite, und nach wenigen Stunden war im Saal ein Kommen und Gehen wie auf der Endstation eines Bahnhofs.
Sein Glashaus-Büro gab ihm ein ständiges Gefühl der Befriedigung. Es war eine Tat gewesen – seine Tat. Sie hatte ihm damals – vor etwa neun Jahren – die Anerkennung eines Vizepräsidenten eingetragen. Als man während der Krisenzeit sein Gehalt nicht kürzte, war er sicher gewesen, dass seine Vorgesetzten erkannt hatten: Einen Mann mit der Fähigkeit zu solch einem Einfall durfte man unter keinen Umständen schädigen.
Doch in letzter Zeit war es für ihn zu einem fürchterlichen Erlebnis geworden, hier unter den Augen der Stenotypistinnen zu sitzen. Denn wenn er durch das Glas spähte, konnte er nichts sehen. In diesem Augenblick war es möglich, dass eine ihm ein Zeichen machte; er wusste nichts davon. Seine Arbeitstage waren nun damit ausgefüllt, in Abständen zwischen den Reihen der Schreibpulte hin und her zu wandern, als hätte er wichtige Dinge zu erledigen, während er in Wirklichkeit immer nur verzweifelt horchte, ob jemand nach ihm rief.
So saß er an diesem Morgen vor seinem Tisch und wartete, bis genügend Zeit verstrichen sein würde, um sich mit gewichtiger Miene in den Saal hinauszuwagen. Und er wusste, dass die Mädchen sein Theater durchschauten und ihn auslachten. Aber er würde auf jeden Fall zu ihnen hinausgehen. Es war furchtbar, aber es musste sein, denn im Verlauf dieser Wochen hatte er gefühlt, dass sich in diesem Saal etwas Verhängnisvolles breitmachte. Ein wiederholter Irrtum einiger Mädchen konnte sich zu einem Komplex von Fehlern auswachsen, der, wenn er erst durch die labyrinthischen Eingeweide der Gesellschaft hindurchgegangen war, in einer Katastrophe zur Explosion kommen und ihn als Arbeitslosen auf die Straße schleudern würde.
Er tat, als studierte er einen Stoß Akten, der auf seinem Schreibtisch lag. Als er dann aufstehen und sich hinausbegeben wollte, summte sein Telefon. Der Apparat war stark abgedämpft, damit die Stenotypistinnen nicht gestört wurden. Newman griff mit einer Selbstverständlichkeit nach dem Hörer, als sei es für ihn nichts Ungewöhnliches, fünf Minuten nach seiner Ankunft angerufen zu werden. Aber es war etwas Ungewöhnliches, und er fühlte bereits den beschleunigten Schlag seines Herzens bis in seine Kehle hinauf.
»Newman«, sagte er.
»Hier Keller.«
»Ja, bitte, Fräulein Keller?«
»Herr Gargan lässt Sie in sein Büro bitten. Sobald es Ihnen möglich ist, denn er hat noch eine Verabredung.«
»Ich komme gleich hinüber.«
Er legte den Hörer auf. Es ließ sich unmöglich leugnen, dass er beängstigt war. Er stand auf und ging quer durch den Saal bis zu einer elfenbeinfarbenen Tür, durch welche er Fräulein Kellers Büro betrat. Diese deutete mit freundlichem Lächeln auf eine zweite elfenbeinfarbene Tür, die direkt in Gargans Zimmer führte. Gargan saß vor seinem breiten Schreibtisch mit dem Rücken zum großen Fenster, das zum Fluss hinaussah. Er hatte dichtes schwarzes, in der Mitte gescheiteltes Haar, das im Morgenlicht schimmerte. Die einzigen Kennzeichen seiner Bedeutsamkeit waren die beiden gerahmten Fotografien auf seinem Schreibtisch – niemandem anderen war es gestattet, private Gegenstände auf dem Tisch zu haben. Eines dieser Bilder stellte Gargans kleines Motorboot auf Long Island dar, das andere zeigte seine beiden Schnauzer, mit seinem Sechs-Zimmer-Haus als Hintergrund. Als Newman eintrat, war Gargan damit beschäftigt, den Fluss zu bewundern. Er drehte sich um.
»’n Morgen«, sagte er. Sonst nichts.
»Wie geht es Ihnen heute, Herr Gargan?«
»Leidlich. Nehmen Sie Platz.«
Newman setzte sich in den Lederfauteuil neben dem Schreibtisch. Er liebte es nicht, so tief in seinen Sitz einzusinken; es beunruhigte ihn immer, wenn er etwas von seiner Höhe einbüßen musste. Gargan hob eine Zeitung auf, in der er anscheinend gelesen hatte, und schob sie auf die Seite des Schreibtischs, wo Newman saß.
»Was sagen Sie zu diesen Nachrichten?«