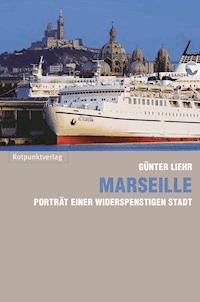9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Links, Ch
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Länderporträts
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Die aktuelle Politik hat unser Frankreich-Bild erschüttert. Galt der Nachbar bislang als Freund des guten Weins und exzellenten Essens, die Männer als einfühlsame Liebhaber und die Frauen als stets modisch gekleidete, emanzipierte Schönheiten, so zeigt sich langsam ein anderes Bild: das von hoffnungslosen und in den Terror abrutschenden Migranten in der Banlieue und fremdenfeindlichen Wählern des Front National. Doch wie sieht Frankreich im Alltag wirklich aus, warum stimmen die alten Klischees zum Teil immer noch und wie versucht das Land seine Probleme zu lösen? Günter Liehr liefert eine facettenreiche Erkundung unseres Nachbarn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Ähnliche
Günter Liehr
FrankreichEin Länderporträt
Günter Liehr
Frankreich
Ein Länderporträt
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
2. Auflage als E-Book, August 2016
entspricht der 3., aktualisierten und erweiterten Druckauflage vom Juli 2016
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 440232-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Cover: Stephanie Raubach, Berlin. Dächer über Paris mit Eiffelturm, © iStock/Oktay Ortakcioglu
Karte: Christopher Volle, Freiburg
Lektorat: Günther Wessel, Berlin
eISBN 978-3-86284-349-7
Inhalt
Vorbemerkung
Geschichte: Von der Erbfeindschaft zur offiziellen Freundschaft
Die Französische Revolution: Schreckensbild oder Verheißung?
Krieg gegen Napoleon
Germanischer Chauvinismus
Der Krieg von 1870/71
Der große Krieg
Zwischen den Kriegen
»Monsieur Hitler«
Vier Jahre Besatzung
Der Mythos der Résistance
Die französische Zone
Der Saarstaat
Annäherung mit Hindernissen
Abschied von den Kolonialreichen in Indochina und Algerien
Der Freundschaftsvertrag
Die Mairevolte und ihre Folgen
Das andere Deutschland
Trauma »réunification«
Der steinige Weg nach Europa
Die Republik: Stärken und Schwächen
Die großen Erinnerungen
Die Idee der Größe
Trennung von Staat und Kirche
Glaubensfragen
Islam und Islamismus
Je suis Charlie
Schändlichkeit und Perversion
Bevölkerung: Jeder Dritte kommt von auswärts
Korrekturen am Geschichtsbild
Bedrohtes Franzosentum
Explosion der Vorstädte: Unruhe in den Randzonen der Republik
Die Hauptstadt: befriedetes Machtreservat
Zentralismus und Dezentralisierung
Die Sprache als nationales Heiligtum
Probleminsel Korsika
Elsässische Identitätsfragen
Staat und Politik
Die Parteien: ein schillerndes Spektrum
Die extreme Rechte nistet sich ein
Eine Verfassung für den General
Vom Hyperpräsidenten zum »président normal«
Der Staat als Wirtschaftslenker
Kostspieliges Scheitern
Atomkraft als nationales Projekt
Lob des Gesundheitssystems
Der Bürger als Rebell
Konfliktkultur
Empörung und Ungehorsam
Gesellschaft: Hierarchie und Eigensinn
Das heilige Privatleben
Kinder, Karriere, Familie
Schule als Schicksal
Grande École oder Universität?
Betriebskultur
La Bouffe: eine verzehrende Leidenschaft
Einladung zum Dîner
Zivilisationsgetränk Wein
Die Liebe zum Land
Week-end und Ferien
Kultur und Kommunikation
Die Rückkehr der Bücher
Kino als »kulturelle Ausnahme«
Die Musikszene: Belebung durch die Quote
Medien unter Einfluss
Arte: das deutsch-französische Fernsehexperiment
Nachbemerkung
Anhang
Überblick zur Geschichte seit der Französischen Revolution
Literatur
Abkürzungsverzeichnis
Kontaktadressen
Übersichtskarte
Basisdaten Frankreich
Über den Autor
Vorbemerkung
Der Parc des Buttes-Chaumont ist für mich der schönste Park von Paris, eine romantische Phantasielandschaft, geschaffen von den Gartenarchitekten des Zweiten Kaiserreichs, nur zehn Minuten zu Fuß von meiner Wohnung. Mit Entsetzen erfuhr ich von der Existenz der sogenannten Buttes-Chaumont-Bande, zu der Chérif Kouachi, einer der Killer der Charlie-Hebdo-Redaktion, gehörte. Die radikalen Islamisten, aus denen diese Gruppe bestand, trafen sich regelmäßig in diesem lauschigen Park zu Fitness-Übungen. Gut möglich, dass sie mir da mal beim Jogging entgegengekommen sind. Außerdem haben sie die in meinem Quartier gelegene Adda’wa-Moschee frequentiert.
Ebenfalls in meiner Nachbarschaft, im Pariser Nordosten, fanden die Massaker vom 13. November 2015 statt, bei denen Leute, die friedlich im Café saßen, mit Kalaschnikows niedergemäht wurden. Bei der Tante eines Freundes, die mit ihrer Familie beim Abendessen saß, zischte eine Kugel durchs Fenster. Das Unheil ereignet sich nicht mehr bloß in fernen Ländern. Es holt uns ein, rückt nahe heran. Und im Dezember 2015 brachte die Tageszeitung Libération ein Titelbild mit der Zeile »Ça se rapproche« – »Es kommt näher«. Man sah dazu das verschwommene, aber erkennbare Antlitz von Marine Le Pen. Anlass war das beispiellose Auftrumpfen der Rechtsextremisten bei den Regionalwahlen. Das war der nächste Tiefschlag. Die Front National konnte prächtig von den Anschlägen profitieren. Wie Jeanne d’Arc, als Retterin des Vaterlandes, trat die Parteichefin auf. Madame Le Pen an der Schwelle zur Macht?
Es war wahrhaftig reich an Erschütterungen und Zumutungen, dieses Jahr 2015. Was sich da ereignete, stellte bisherige Gewissheiten in Frage, löste ungeahnte Verstörungen aus. Das Selbstverständnis der Franzosen ist angeknackst, und dies nicht erst seit den Anschlägen von Paris. Diese ereigneten sich in einem Land, das sich bereits in einem Zustand größerer Verunsicherung befand. Die wirtschaftliche Lage ist besorgniserregend. Das Wachstum bleibt nun schon so lange aus, die Arbeitslosigkeit will nicht zurückgehen, die Reformen greifen nicht, dafür wachsen Unzufriedenheit, Wahlverdrossenheit, Misstrauen gegenüber der Politikerkaste und der Europäischen Union.
»Der kranke Mann Europas«, »Problemkind Europas«, »Europas gefährlichster Krisenstaat«,– dergleichen liest man schon seit Längerem über Frankreich in der deutschen Presse. »Immer tiefer versinkt das Nachbarland in einer wirtschaftlichen wie längst auch seelischen Krise« hieß es gar in der Süddeutschen Zeitung. Ist das nicht ein wenig anmaßend und selbstgerecht?
Unbestreitbar scheint allerdings, dass Frankreich den einstigen Vorbild- und Wohlfühl-Charakter verloren hat. Wie sehr hatte man dieses Land früher verehrt und glorifiziert! Vielen war Frankreich die Heimat des guten Lebens, der kulinarischen Verheißungen, aber auch der kritischen Köpfe, der fortschrittlichen Geister, und dies ungeachtet der seit langem schon schwächeren Wirtschaftsleistungen. Nun ist so etwas natürlich immer mit Illusionen verbunden. Je intensiver man sich hingegen auf dieses Hexagon einlässt, desto mehr entfaltet sich seine Komplexität, desto faszinierender wird es. Es gibt gewiss hinreichend Gründe, sich über Frankreich aufzuregen, aber es ist, mit all seinen Widerhaken und Schattenseiten, weiterhin ein großartiges Land, und es verlangt danach, kennengelernt zu werden.
Meine erste Reise als Student nach Frankreich führte per Anhalter in den Süden. Ich trampte zwischen Avignon, Nîmes und Sète herum und landete schließlich bei der Weinlese zu Füßen des Mont Canigou am Rande der Pyrenäen. Alles war gut: das flimmernde Licht unter den Platanen, die plätschernden Dorfbrunnen, der Pastis-Geruch in den Cafés, die melodiös und genussvoll plaudernden Menschen auf den Märkten, die Chansons von Georges Brassens und Jacques Brel, die ich zum ersten Mal hörte. Groß war gleich die Begeisterung.
Von da an ging es immer wieder hinein in dieses weite Land.
Was für einen großen Reichtum an Landschaften haben sie da, in ihrem heiligen Sechseck, dazu schnurgerade Straßen bis zum Horizont, Dörfer und Städte mit Patina. Und wie angenehm sind die Leute! Sie haben sonntags ihr Huhn im Topf und zuckeln gemächlich mit ihren zerbeulten 2 CVs und R4s umher, eine Gauloise im Mundwinkel, ja, damals rauchte man noch, und wie … Es war nicht schwer, dieses Frankreich zu mystifizieren. Viele verehrten das Land als Gegenmodell zum eigenen. Leben und leben lassen schien hier die Devise, auch war nicht alles so saubergekratzt und abgezirkelt wie daheim, manchmal gar ein wenig schmuddelig, mit Sägespänen auf dem Kneipenboden, in die man gleich auch die Erdnussschalen hinschmiss und die Zigarettenasche. Ich erinnere mich, wie ein deutscher Elektriker-Freund fassungslos die lose von Haus zu Haus baumelnden, verknoteten Stromleitungen betrachtete. Ein bisschen chaotisch-improvisiert, aber irgendwie sympathisch. Die Franzosen konzentrieren sich eben mehr aufs Wesentliche.
Und dazu die politische Gesinnung, diese erfrischende Radikalität! Im Lande des Mai 68, dieser großartigen Aufwallung, schienen auch noch in den siebziger Jahren geistige Freiheit und kritisches Engagement zu Hause zu sein. »Schaffen wir französische Zustände!«, hatte Hans Magnus Enzensberger damals in einer Rede gerufen. Man hatte gelernt, dass unterm Pflaster der Strand lag und dass man Voltaire nicht verhaftet. Der konservative de Gaulle hatte dies zu bedenken gegeben, als seine Anhänger 1960 zur Zeit des Algerienkriegs ein Exempel gegen den unbotmäßigen Jean-Paul Sartre statuieren wollten, während daheim kritische Intellektuelle von führenden Politikern mal als »Pinscher«, mal als »Ratten und Schmeißfliegen« tituliert wurden. Wie anders dagegen dieses Land, in dem sich Politik und Poesie zu verbinden schienen, wo in den Cafés Surrealisten, Rebellen und Lebenskünstler beim Aperitif saßen!
»Frankreich ist der Inbegriff all dessen, was das Menschenleben schön und würdig macht.« So heißt es in Friedrich Sieburgs 1929 erschienenem Buch Gott in Frankreich?. Diese immer wieder neu aufgelegte Bibel der Frankophilen hat beim deutschen Publikum in besonderem Maße die Vorstellungen über das Nachbarland geprägt. Warum schätzte Sieburg Frankreich? »… weil ich schwach genug bin, mich in einem altmodischen und unordentlichen Paradies lieber aufzuhalten als in einer blitzblanken und trostlosen Musterwelt.« Wie spätere Frankreich-Pilger litt auch er schon unter Deutschlands moderner Kälte und fand hier die vormoderne, charmant zurückgebliebene Gegenwelt.
Sieburg selbst hatte übrigens zeitweilig andere Töne angeschlagen: Als frankophiler Nazi war er 1941 mit einer Propagandatruppe durch Frankreich gezogen und hatte sich als »Kämpfer und Nationalsozialist« präsentiert, auf die Franzosen eingeredet, sich einzubringen ins neue Nazi-Europa, und sie aufgefordert, »Schluss zu machen mit dem ewigen Durchwursteln, den schlichten Glücksvorstellungen von Freizeitanglern … wovon sich Deutschland längst mutig befreit hat«.
Dennoch hatte Sieburgs idyllisierendes Frankreich-Bild lange Nachwirkungen und schlägt sich noch heute in gewissen Stereotypen nieder. Dabei wird die wirtschaftliche und gesellschaftliche Realität des industrialisierten Frankreich allerdings gern ausgeblendet. Das war lange ein Problem deutscher Frankreich-Schwärmer, in deren Vorstellungen sich die Franzosen nicht recht wiedererkennen konnten und wollten.
Es dauerte eine Weile, bis sich in der Wahrnehmung der Deutschen das moderne Frankreich, voller Ungleichzeitigkeiten und mit Schönheitsfehlern behaftet, an die Stelle des imaginierten Idylls setzte. Die vielen Begegnungen und Austauschprogramme, die nach dem 1963 geschlossenen Elysée-Vertrag zustande kamen, haben dazu zweifellos einiges beigetragen. Tatsächlich kann sich die Freundschaftsbilanz sehen lassen. 2000 Städtepartnerschaften wurden geschlossen, über sieben Millionen junge Franzosen und Deutsche haben an Programmen zum Jugend- und Schüleraustausch, zur Berufs- und Sprachausbildung teilgenommen. Partnerschaften von Regionen, Universitäten, Schulen wurden gegründet, kulturelle Großveranstaltungen wie »Paris–Berlin« oder »Germania und Marianne« fanden statt. Der deutsch-französische Kulturfernsehkanal Arte nahm den Sendebetrieb auf, eine deutsch-französische Brigade wurde aufgebaut, eine gemeinsame Adenauer-de-Gaulle-Briefmarke herausgegeben und sogar gemeinsame Geschichtsbücher für den Schulgebrauch.
Im Januar 2013 wurde das 50. Freundschaftsjubiläum gefeiert. Es reiste die Pariser Nationalversammlung, 577 Abgeordnete, nach Berlin zu einer gemeinsamen Sondersitzung mit den Kollegen vom Bundestag, in der Philharmonie gab es ein Konzert mit Stücken von Beethoven und Saint Saens. Allerdings fiel das Jubiläum in eine wenig enthusiastische Phase, in der »mehr Grabenkämpfe als Gemeinsamkeiten« herrschten, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung feststellte. Französischerseits war man verschnupft darüber, dass sich Deutschland nicht recht an dem gerade begonnenen Mali-Krieg beteiligen wollte. Eine »verdrießliche Goldene Hochzeit« sei das, klagte Le Monde.
Es fehle die Leidenschaft bei diesem alten Paar, das die Krise weiter auseinanderdividiert habe anstatt es enger zusammenzubringen, nörgelte Le Point. Aber auch wenn das neue Paar Merkel-Hollande eine etwas verkrampft wirkende Freundschafts-Demonstration hinlegte, um interne Unstimmigkeiten zu kaschieren, wies L’Obs (früher: Nouvel Observateur) doch darauf hin, dass es nirgendwo auf der Welt ein anderes Zweistaatenbündnis gebe, das derart dichte und vielgestaltige gemeinsame Strukturen hervorgebracht habe.
Wie sehr mag man in Frankreich die offiziell befreundeten östlichen Nachbarn? Recht beliebt sind deutsche Unterhaltungs-künstler, vor allem, wenn sie sich »französisieren«. Hanna Schygulla, Ingrid Caven, Ute Lemper, Diane Kruger oder gerne auch Menschen aus der Modebranche wie Claudia Schiffer oder Karl Lagerfeld – alle, die kommen, um dem Pariser Betrieb zu huldigen, werden gern aufgenommen, gelegentlich gar adoptiert.
Jemand, den die Franzosen auch mochten, war Kanzler Helmut Kohl, der immer wieder versicherte, wie tief er Frankreich verbunden sei. Dann allerdings ereignete sich das Größte Annehmbare Unglück: die deutsche Wiedervereinigung. Und für eine Weile verwandelte sich der gemütlich-behäbige Koloss in ein gefährliches Monstrum, dem in den Presse-Karikaturen prompt eine Pickelhaube aufgesetzt wurde. Als »Bismarck im Pullover« wurde er apostrophiert. »Wird der deutsche Riese alles verschlingen?«, fragte bang eine Überschrift, andere riefen auf Deutsch: »Achtung!«, beschworen den »Blitzkrieg« des »chancelier Kohl« oder »La Grosse Allemagne« – das fette Deutschland.
Diese Aufregung legte sich bald wieder, man beruhigte sich. Allerdings verringerte sich das Interesse am Nachbarn, zum Beispiel an der Sprache. Entgegen den politischen Willensbekundungen spielt sie an französischen Schulen eine immer geringere Rolle. Früher war Deutsch ein Prestigefach für begabte Kinder und wurde aus diesem Grund als zweite Fremdsprache gewählt, aber das ist vorbei. Es haftet ihm der Ruf eines schwierigen und unschönen Idioms an, unverdrossen werden damit bisweilen immer noch bellende Nazi-Schergen assoziiert.
Zur bislang letzten Schulreform von 2016 gehörte obendrein die Streichung der »classes bi-langues«, die das simultane Erlernen von zwei Fremdsprachen, in der Regel Deutsch und Englisch, gestatteten. Diese Klassen funktionierten zwar recht gut, aber die Bildungsministerin Najad Vallaud-Belkacem hielt das Modell für zu elitär, also weg damit. Eine »Katastrophe«, eine »zerstörerische Reform« sei dies, schimpfte Alfred Grosser. Deutsch laufe Gefahr, ein Orchideenfach zu werden, warnte der Direktor des Pariser Goethe-Instituts. Auch der ehemalige Premierminister und frühere Deutschlehrer Jean-Marc Ayrault mischte sich ein. So ruderte die Ministerin unter dem Eindruck der Kritik ein wenig zurück. In den Pariser Schulen darf es diese Klassen nun doch weiter geben, draußen in den Regionen freilich wurden sie weitgehend abgeschafft. Von wegen »égalité« … .
Rückläufig ist das Interesse aber auch in Frankreichs Medien. Seit jeher gibt es viel weniger französische Korrespondenten in Deutschland als umgekehrt. Und das Missverhältnis wird immer krasser. Als vor einigen Jahren Frankreichs meistgesehener Fernsehsender TF1 sein Berliner Büro dichtmachte, musste sich der abservierte Deutschlandkorrespondent von einem Kollegen von Le Monde sagen lassen: »L’Allemagne, c’est chiant et ça ne fait bander personne.« – sinngemäß: Deutschland ist stinklangweilig und macht niemanden an.
Ist die deutsch-französische Freundschaft womöglich eine Einbahnstraße? Eine recht unausgewogene Angelegenheit? Zwar erhalten die Deutschen bei Umfragen allgemein hohe Sympathiewerte und werden als die wichtigsten Partner in Europa bezeichnet, aber darin scheint vor allem der offizielle Diskurs nachzuwirken. Während es die Deutschen nach Frankreich drängt, nicht nur nach Paris, sondern auch in die Bretagne, die Provence, ins Elsass, ins Périgord oder in die Pyrenäen, mag von französischer Seite kaum jemand ins Nachbarland reisen. »Deutschland? Das ist nun wirklich das letzte Land, wo ich Lust hätte, meine Ferien zu verbringen!« musste die derzeitige Generalsekretärin des Deutsch-Französischen Jugendwerks, Béatrice Angrand, hören, als sie ihrer französischen Umgebung vom Nachbarland vorschwärmte.
Die große Ausnahme ist Berlin. Die deutsche Hauptstadt übt seit einigen Jahren eine unglaubliche Anziehungskraft aus. Bei jungen Leuten gilt sie als Hochburg des coolen Amüsements. Mit Lowcost-Fliegern kommen sie Woche für Woche in Scharen in die Arm-aber-sexy-Metropole, um die Nächte durchzumachen und tagsüber zu schlafen. Berlin ist Kult. Sogar die Currywurst wird verehrt.
Über diese Party-Touristen hinaus haben sich auch größere Mengen Franzosen für länger dort angesiedelt. Schätzungen zufolge liegt ihre Zahl zwischen 20 000 und 35 000. Berlin bietet ihnen günstige, große Wohnungen, das Leben ist entspannter und stressfreier als in Paris, die Stadt gilt als kulturell attraktiv, vital und kosmopolitisch, gleichzeitig wird die ruhigere Gangart gepriesen, die grünere und sauberere Umwelt. Berlin ist gewissermaßen das Anti-Paris. Künstler finden leistbare Atelierräume und ein kreatives Reizklima. Auch bei französischen Schriftstellern wirkt der Zauber. Schon kursiert der Ausdruck »Saint-Berlin-des-Prés«. Man weiß zwar nicht, wie lange diese Faszination anhält, aber dies sind zweifellos ermutigende Entwicklungen.
Über den aktuellen Drang nach Berlin hinaus haben schon über viele Jahre hinweg Städtepartnerschaften, Jugendaustausch- und Erasmusprogramme Kontakte gefördert, Freundschaften entstehen lassen und zahlreiche deutsch-französische Ehen gestiftet. Nur sollte man sich darüber im Klaren sein, dass dieses relativ neue Freundschaftsverhältnis zwischen beiden Ländern konkurriert mit einem tief verwurzelten Unbehagen, das weit zurückreicht.
Geschichte: Von der Erbfeindschaft zur offiziellen Freundschaft
Die Französische Revolution: Schreckensbild oder Verheißung?
Eine deutsch-französische Freundschaft lag angesichts der Beziehungsgeschichte beider Länder nicht auf der Hand. Das Spezialverhältnis zwischen den Nachbarn ähnelte über lange Phasen einem verbissenen Gerangel. »Stets war es beiden unmöglich, einander gleichgültig zu sein«, schrieb Ludwig Börne, »denn entweder mussten sie einander hassen oder lieben«. Periodisch machte sich Hass in extremer Weise bemerkbar. Immer aber gab es hüben wie drüben Leute, die für den Chauvinismus nichts übrig hatten, der sich gegen die Nachbarn richtete.
Zentraler Ausgangspunkt für franzosenfeindliche Delirien wie für Hochrufe war die Französische Revolution. Mit dem Sturm Pariser Volksmassen auf die Bastille am 14. Juli 1789 wurde der Untergang des Ancien Régime besiegelt. Eine tiefgreifende Umgestaltung von Staat und Gesellschaft setzte ein, Feudalrechte wurden abgeschafft, die Erklärung der Menschenrechte verabschiedet.
Ein Funke der Begeisterung sprang auch auf andere europäische Länder über. Gottes- und obrigkeitsfürchtige Deutsche verteufelten die Revolution mitsamt den Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, denn auch die Machtstrukturen in den vereinzelten deutschen Kleinstaaten waren dadurch gefährdet. Bei unabhängigeren Geistern allerdings stieß das Ereignis – anfangs zumindest – auf sehr positive Resonanz: »Von diesem Moment an erwachte neues Leben in mir, voller unerhörter Hoffnung auf eine vollkommene Veränderung der Welt«, jubelte Johanna Schopenhauer, als sie vom Sturm auf die Bastille hörte. Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel schwärmte vom »herrlichen Sonnenaufgang«, während Friedrich Gottlieb Klopstock 1789 in seinem Gedicht »Kennet euch selbst« ausführlich »des Jahrhunderts edelste That« besang, wofür ihn die Pariser Nationalversammlung mit einem Bürgerdiplom ehrte. »Wer hätte den französischen Sprudelköpfen die Besonnenheit zugetraut, mit der sie jetzt zu Werke gehen?«, staunte auch der Literat Johann Heinrich Voß. Im liberalen Hamburg organisierten weltoffene Kaufleute 1790 eine Bastille-Feier und erhoben ihre Gläser auf die Abschaffung des Fürsten-Despotismus. »Es war ein herrlicher Tag, und es wurde manche Thräne der Rührung vergossen«, berichtete Adolph Freiherr von Knigge. Der Gastgeber, der Kaufmann Georg Heinrich Sieveking, hatte eigens für das Fest ein Lied gedichtet: »Freye Deutsche! Singt die Stunde, / Die der Knechtschaft Ketten brach, / Schwöret Treu’ dem großen Bunde / Unsrer Schwester Frankreich nach!« Als Sieg des Lichts über die Finsternis wurde von kritischen Geistern in deutschen Landen die Revolution gefeiert. An deutschen Universitäten begann es zu gären. Die Pariser Vorgänge lösten die erste deutsche Studentenbewegung aus. Professoren wetterten gegen die Kleinstaaterei und riskierten Berufsverbot. Unzählige reisten als deutsche Revolutionspilger nach Paris, um das weltgeschichtliche Ereignis in Augenschein zu nehmen oder, wie es Joachim Heinrich Campe in seinen Briefen aus Paris ausdrückte, »dem Leichenbegängnis des französischen Despotismus beizuwohnen«. Campe beschwerte sich über die böswillige, ungerechte »Beurtheilung der großen, für die gesammte Menschheit so überaus wohlthätigen französischen Revolution«, die die deutschen Medien durchzog. Den Besuchern, die sich ins Pariser Getümmel stürzten, musste die Allgegenwart der ungehinderten politischen Debatten wie ein Wunder erschienen sein, und sie ließen sich von der revolutionären Begeisterung mitreißen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!