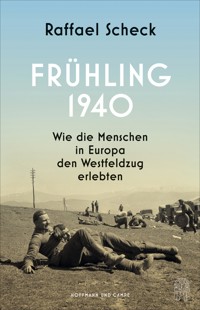
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Als sich im Frühling 1940 Soldaten auf den einstigen Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges erneut feindselig und erbittert gegenüberstanden, kämpften sie nicht nur um ihr eigenes Überleben, sondern auch mit der schmerzlichen Vergangenheit. Während die Soldaten mit traumatischen Erlebnissen und der Trauer um viele der dort gefallenen Verwandten konfrontiert waren, wurden bei den dort lebenden Zivilisten dramatische Erinnerungen an die deutschen Gräueltaten wach. Auf Grundlage von zum Teil unveröffentlichten Berichten, Briefen und Tagebucheinträgen erzählt der renommierte Historiker Raffael Scheck eindrucksvoll von den Monaten Mai und Juni 1940 aus der Sicht gewöhnlicher Soldaten und Zivilisten auf beiden Seiten der Front.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Ähnliche
Raffael Scheck
Frühling 1940
Wie die Menschen in Europa den Westfeldzug erlebten
Sachbuch
Für Rainer Hering
Prolog
»Wipe your feet please. 1918.« Diese Worte, in großen Kreidebuchstaben an die Wand hinter der Eingangstür geschrieben, empfangen den Artillerieoffizier John Austin, als er im Herbst 1939 in einem heruntergekommenen Bauernhaus im nordfranzösischen Sommegebiet Quartier bezieht. Austin hat das Gefühl, er habe Gespenster geweckt. Instinktiv will er gehorchen und sich die Füße abtreten. Beinahe vergisst er, dass er sich nicht mehr im Jahr 1918 befindet und dass er nur Ärger mit den Geistern einer Offiziersmesse bekäme, sollte er sich nicht an den Befehl halten. Bei näherer Untersuchung des Hauses findet er ein rostiges Bajonett, Ketchup, Nestle-Trockenmilch, ein paar Sardinendosen und vier angebrochene Weinflaschen: »Es lag etwas Rührendes in diesem kleinen Haufen von verloren aussehenden Resten, der Erbschaft einer britischen Armee für eine andere, schwarz und schimmlig, aber eine Erinnerung an vieles.«[1]
Ein paar Wochen später legt Horace Barnet, Mitglied einer britischen Signaleinheit, in klirrender Kälte Verteidigungsgräben an. Er arbeitet in Sichtweite des kanadischen Weltkriegsdenkmals von Vimy bei Arras, einer prächtigen Anlage mit zwei hohen weißen Türmen, die erst wenige Jahre zuvor eingeweiht worden ist. Mit seinen Kameraden besichtigt Barnet das Denkmal und den umgebenden Friedhof: »Ich wusste alles darüber. Mein Vater hatte mir davon erzählt. Tausende von weißen Kreuzen, alle sehr schön geordnet. 75000 Kanadier waren hier gefallen. Die alten Schützengräben waren in dieser Gegend noch sichtbar.« Besonders beeindruckt Barnet ein großer Krater an der Stelle, wo die Briten eine gewaltige Mine unter der deutschen Stellung angebracht und gezündet hatten. Mit Erstaunen bemerkt er, dass nur 50 bis 60 Meter die feindlichen Gräben trennten. Er findet Stacheldrahtzäune. Alles ist ein bisschen überwachsen. Er sieht französische Schilder: »Lebensgefahr! Nicht betreten!« Er beachtet sie nicht. Mit Kameraden steigt er in einen Graben voller Einschusslöcher. Sie finden ein Stück Stahl. Es ist ein Gewehr. Der Holzgriff ist vermodert, aber man kann noch glänzendes Blech und Kupferkugeln im Lauf sehen. Barnet versucht das Gewehr auszugraben und als Souvenir mitzunehmen, aber es zerfällt. Immer wieder findet er Granaten. Einmal entdecken seine Kameraden etwas, das wie eine Zuckerrübe aussieht. »Sie nahmen es in die Hand und merkten, es war ein Schädel. Er gehörte zu einem Soldaten, der dort in voller Uniform lag.«[2]
Austin und Barnet befinden sich im Gebiet der Westfront aus dem Ersten Weltkrieg (damals noch einfach »der Weltkrieg«). Als Teil des britischen Expeditionskorps (British Expeditionary Force, BEF) besetzen sie Stellungen nördlich der Somme, wo 1916 die erste BEF die schwersten Verluste der britischen Militärgeschichte erlitt. Die Vergangenheit ist in diesem Gebiet sozusagen allgegenwärtig. Früher oder später stößt jeder Soldat auf die Schlachtfelder, Denkmäler und Friedhöfe aus dem Weltkrieg. Briten und Franzosen begegnen ihnen bereits in der Wartezeit zwischen Kriegsausbruch und dem deutschen Angriff am 10. Mai 1940, Deutsche und Belgier erst während der Kämpfe im Frühling 1940. Soldaten aller Armeen finden irgendwann Überreste aus dem Grabenkrieg von 1914–1918. Mitunter erweisen sich die alten Schützengräben und Unterstände sogar als nützlich, und manche Erinnerungsorte, einschließlich Vimy, werden erneut zu Kampfstätten. Die älteren Kriegsteilnehmer erkennen Orte, an denen sie schon einmal gekämpft oder geruht haben. Die Erinnerung ist ergreifend und manchmal gespenstisch, wie ein Traum. Jüngere Soldaten kommen durch Dörfer und Felder, wo ihre Väter kämpften und vielleicht fielen. Der Bezug auf den Weltkrieg ist auch für Zivilisten bestimmend. In den Nachrichten hört man Ortsnamen, die damals traurige Berühmtheit erlangt hatten: Arras, Vimy, Cambrai und Verdun in Frankreich; Ypern, Kemmelberg und Langemark in Belgien. Die Erinnerung an die deutschen Gräuel in den ersten Kriegswochen 1914 und an die brutale Besatzung in den vier folgenden Jahren veranlasst Millionen Belgier und Franzosen, sich auf die Flucht zu begeben. Egal, ob jemand den Weltkrieg selbst erlebt hat oder aus der Erzählung anderer kennt – er ist der überragende Bezugspunkt für die Menschen in Europa im Frühling 1940.
Von militärischer Seite her ist der Feldzug von 1940 gut erforscht.[3] Der überraschende und schnelle Sieg der Wehrmacht über die Streitkräfte Frankreichs, Großbritanniens, Belgiens und der Niederlande gilt als Paradebeispiel für militärische Innovation und gehört zur Ausbildung an vielen Militärakademien. Der konzentrierte Einsatz von Panzerverbänden, die gezielte Luftunterstützung, die taktischen Freiheiten der Offiziere im Feld sowie die gute Kommunikationsstruktur mit Tausenden von Funkgeräten erlaubten es der Wehrmacht, auch in schwierigen Situationen die Initiative zu behalten. Entscheidend war der Plan von General (später Feldmarschall) Erich von Manstein, der auf einem überraschenden Panzervorstoß durch die Ardennen beruhte. Der Durchbruch motorisierter Einheiten von Sedan in Frankreich bis Dinant in Südbelgien zielte darauf ab, die nach Belgien vordringenden französischen und britischen Kräfte durch ein Vorrücken bis zur Kanalküste abzuschneiden. Dieser »Sichelschnitt« traf die alliierten Streitkräfte auf dem falschen Fuß und führte zu einer katastrophalen Niederlage in den ersten drei Wochen, obwohl manche deutsche Kommandeure – auch Hitler selbst – den Erfolg durch diverse Haltebefehle gefährdeten.[4] Es erwies sich als fatal, dass die Belgier noch im Januar 1940 nach einer Bruchlandung eines deutschen Flugzeugs einen Teil des ursprünglichen deutschen Angriffsplans erbeutet hatten: Dieser Plan sah einen uninspirierten Vormarsch in die Niederlande und nach Belgien vor. Dass sich die Wehrmacht inzwischen für ein anderes Vorgehen entschieden hatte, war den alliierten Geheimdiensten entgangen.
Die Militärführung Frankreichs und seiner Verbündeten war stärker auf einen statischen und methodischen Krieg ausgerichtet, der individuellen Kommandeuren keine Freiheit ließ. Ihr Kommunikationssystem war weniger entwickelt. Der Oberbefehlshaber der französischen Armee, General Maurice Gamelin, rechnete mit einem deutschen Überfall auf die neutralen Benelux-Länder und wollte in diesem Fall den stark motorisierten linken Flügel der französisch-britischen Kräfte an die Dijle (Dyle) nach Belgien und bis Breda im Süden der Niederlande schicken (Plan D, mit Breda-Variante). Gestützt auf die Festungen der Maginot-Linie an der Grenze zu Deutschland sollten die mobilen Verbände in Belgien eine Entscheidung erzwingen. Dieser Plan spielte jedoch der Wehrmacht in die Hände, weil er die besten Kräfte am Rand der Front konzentrierte. Sie fehlten am 13. Mai, als der Durchbruch deutscher Panzerdivisionen bei Sedan gelang. Siegessicher und seinem Plan vertrauend, hatte Gamelin keine Reserven bereitgehalten.[5] Die Vorteile, die er sich erhofft hatte, nämlich eine Verbindung mit der belgischen und der niederländischen Armee sowie die Verlegung der Kämpfe auf nichtfranzösische Gebiete, lösten sich in Luft auf. Die niederländische Armee kapitulierte, kurz nachdem die Franzosen das niederländische Hoheitsgebiet erreicht hatten (14. Mai), und die Leistung der belgischen Armee enttäuschte Gamelin und seine britischen Partner trotz ihrer numerischen Stärke, die die BEF um mehr als das Doppelte übertraf.
Die Erlebniswelt des Westfeldzugs ist weit weniger erforscht als seine militärischen Seiten. Dieses Buch folgt deutschen, französischen und belgischen Soldaten und Zivilisten sowie den britischen Soldaten, die am Feldzug teilnahmen. Es basiert auf teils unveröffentlichten Tagebüchern, Erinnerungen und Interviews und versucht die Dramatik der Ereignisse ebenso wie die Offenheit des historischen Moments einzufangen. Schwerpunkte bilden die Erfahrungen der Flüchtlinge, besonders der Belgier, sowie die Folgerungen, die Soldaten und Zivilisten aus den Ereignissen im Licht der Weltkriegsvergangenheit zogen. Es gilt, Sonden in den komplexen Zeitstrom einzulassen und die Gefühle und Erwartungen von Menschen zu beleuchten, die ja nur die Vergangenheit und nicht die Zukunft kannten. Der schnelle deutsche Sieg kam für alle total überraschend. Das Offene und Unvorhergesehene der Situation barg sowohl ungeahnte Möglichkeiten als auch Gefahren. Wie formte das Erbe des Weltkriegs die unmittelbare Wahrnehmung der Menschen im Frühling 1940? Wie stellte sich für sie die Zukunft dar? Wie können wir die europäische und deutsche Geschichte aufgrund dieses direkten Einblicks in den historischen Moment besser verstehen?
Während der Arbeit an dem Buch begann in Europa ein neuer Angriffskrieg, auch er unter dem Vorwand, dass die angegriffenen Gegner selbst eine Aggression planten, auch er mit Massen von Flüchtlingen und mit Massakern und auch er mit intensivem Bezug auf einen traumatischen früheren Krieg (der allerdings vor allem als zynisch manipulierte mediale Darstellung betrachtet werden muss und schon allein aufgrund des größeren zeitlichen Abstands kaum noch auf persönlich Erlebtes referieren kann). Als Historiker bin ich zwar geschult, Vergleiche zwischen Gegenwart und Vergangenheit skeptisch zu betrachten, aber es fiel mir oft schwer, beim Lesen aktueller Nachrichten nicht an den Krieg von 1940 zu denken. Bezüge zu gegenwärtigen Konflikten lassen sich in diesem Buch an vielen Punkten herstellen, aber ich überlasse das vertrauensvoll den Lesenden.
Einleitung: Der unnötige Krieg?
Im Mai 1927 besichtigt Gertrud Bäumer, eine führende demokratische Politikerin in Deutschland, die Schlachtfelder Verduns. Angesichts der seltsam stillen Geisterlandschaft voller spärlich überwachsener Granattrichter, wo Helfer immer noch Berge von Knochen sammeln und in Kisten packen, denkt sie über den Sinn des Krieges nach. Wozu sind hier viele Hunderttausend Menschen gestorben? Ein französischer Führer zeigt ihr die Reste der 1916 schwer umkämpften Festungen Douaumont und Fort Vaux, die sie an mittelalterliche Verliese erinnern. Bäumer besichtigt den berühmten Bajonettgraben, wo angeblich zwei Dutzend französische Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett bei einem Granattreffer verschüttet und getötet wurden und ein amerikanischer Bankier 1922 ein Denkmal spendete (die Geschichte von den verschütteten Soldaten wurde später als Legende entlarvt).[6] Sie versteht, 18 Jahre vor der ersten Atombombe, dass das Zerstörungspotenzial des modernen Krieges die Existenz der Menschheit bedroht. »Und darum sind diese Massenopfer doch in einem tiefsten Sinn verschwendet. […] Es dürfte nicht noch einmal wieder ein solches Schlachtfeld geben, nicht noch so einen riesenhaften, ewig unfruchtbaren Weinberg von Kreuzen.« Vorsichtig deutet sie an, dass internationale Verständigung den sonst sinnlosen Opfern einen Sinn geben könnte. Ihre Gespräche mit dem französischen Führer und mit freundlichen Hotelbediensteten, abwechselnd auf Französisch und Deutsch, vermitteln den Eindruck, dass auf der anderen Seite durchaus Versöhnungsbereitschaft besteht.[7]
Bäumers Gedanken, im Juniheft der Zeitschrift Die Frau veröffentlicht, provozieren sofort bittere Kritik von rechts stehenden Frauen und Männern. Eine deutschnationale Politikerin, Führerin des »Bundes des Kinderreichen«, wirft Bäumer vor, ein »undeutsches Herz« zu haben und die zwei Millionen deutschen Gefallenen zu beleidigen, indem sie es wage, deren Opfer als sinnlos und unfruchtbar zu beschreiben. Die Kontroverse löst ein großes Echo aus. Die rechte Presse diffamiert »Fräulein Dr. Bäumer« als ein Werkzeug der volksverseuchenden »jüdischen« und internationalistischen Presse. Leserbriefe fordern Bäumer auf, sich lieber dem Kochen zu widmen und ihrem Mann die Hosen zu flicken (Bäumer war nicht verheiratet). Manche beschuldigen sie, von Juden bezahlt zu werden.[8]
Angesichts dieser bitteren Kritik von rechts erstaunt es, dass Bäumers Verständigungsbereitschaft nur wenige Jahre später ausgerechnet unter den Nazis breite Resonanz findet. Versöhnungsbemühungen kommen von allen Seiten, und Veteranen sind oft federführend daran beteiligt. Die Dachorganisation der französischen Weltkriegsveteranen knüpfte zum Beispiel 1934 Kontakte mit deutschen Veteranenorganisationen an.[9] Hitler und sein Stellvertreter Rudolf Heß, beide ehemalige Weltkriegsteilnehmer, förderten diese Kontakte. Die deutschen und französischen Veteranenverbände organisierten gegenseitige Besuche, bei denen sie einander in Gastfreundschaft zu überbieten suchten. Politiker versicherten den Veteranen immer wieder, dass sie aufgrund ihrer intimen Kenntnis des Krieges wie niemand anders dazu berufen seien, für den Frieden einzutreten. Mit höchster deutscher Unterstützung beschworen diese Treffen eine Frontgemeinschaft jenseits der nationalen Trennlinien, obwohl den französischen Vertretern mulmig zumute wurde, wenn irgendein uniformierter Nazi gegen die Demokratie, die Juden oder die Linke wetterte oder drohte, alle Friedensbrecher erbarmungslos zu zermalmen.[10]Vertrauenerweckend erschien jedoch, dass die Naziführer stets an die Gräuel des Krieges erinnerten und ihren Friedenswillen bekundeten.
Als im Oktober 1934 der Führer der Nationalsozialistischen Kriegsopferversorgung (NSKOV), Hanns Oberlindober, mit einer Delegation Frankreich besuchte, wurde er herzlich von Henri Pichot, dem Vorsitzenden der führenden französischen Veteranenorganisation, empfangen. In seiner Rede vor der deutschen Delegation argumentierte Pichot, dass die Toten des Weltkriegs in Wirklichkeit nicht tot seien: Sie seien für Frieden und Freiheit gestorben, nicht dafür, dass man auf ihren Gräbern weiterkämpfe. Pichot besuchte mit einer Delegation Ende 1934 Deutschland und traf sich mit Hitler, Oberlindober, Ribbentrop und Heß. Beide Seiten beschworen den Frieden und die Gemeinschaft ehemaliger Frontkämpfer über die früheren Frontlinien hinweg. Vom Gespräch mit Hitler berichtet Pichots Kamerad Maurice Randoux, Hitler sehe nach der Saarabstimmung (Januar 1935) keine Streitfragen mehr zwischen Deutschland und Frankreich. Das Geld für Festungsanlagen solle lieber in billigen Mietwohnungen angelegt werden. Randoux gibt zu, dass Hitler Abscheuliches über Frankreich geschrieben hatte und dass der deutsche Austritt aus dem Völkerbund im Oktober 1933 nicht vertrauenerweckend wirkte, aber er betont die Möglichkeit zur Verständigung. Es werde keine glühende Freundschaft mit wilden Umarmungen geben, aber, so Randoux: »wir können Streitfragen lösen – in geduldiger Diskussion. Wir gehören zur selben Familie. Vielleicht muss man manchmal auf den Tisch hauen. Das ist viel besser, als einander mit Granaten zu bewerfen.«[11] Pichot selbst schrieb, er habe in Hitler besonders den ehemaligen Frontsoldaten geschätzt. Hitler sei des Krieges überdrüssig und habe kein Interesse an einer Wiedergewinnung Elsass-Lothringens. Hitler, so meint Pichot, habe Deutschland geeint und spreche für die große Mehrheit der Deutschen. Ein deutsch-französischer Krieg wäre heute ein Anachronismus: »Zwischen uns ist der Krieg vorbei.«[12] Auf der Gegenseite bestätigte ein deutscher Veteranenführer im Januar 1935 in der Zeitschrift Die Tat, dass die deutsch-französische Versöhnung unter Veteranen eine abgeschlossene Sache sei.[13]
Hitlers Lob für die Opfer der Soldaten auf beiden Seiten sprach auch französische Veteranen mit linker Orientierung an, da sie sich oft von den französischen Behörden nicht verstanden und geschätzt fühlten.[14] Hitlers Versicherungen, er habe als ehemaliger Frontsoldat das Leiden in den Schützengräben selbst erlitten, gab ihm nicht nur in Deutschland einen Sympathiebonus. In Anspielung auf die Feiern für den toten »unbekannten Soldaten«, in der Regel ein nicht identifizierter Leichnam, dem in vielen Ländern stellvertretend für alle Opfer ein Denkmal gesetzt wurde, erschien Hitler als der »lebende unbekannte Soldat« und somit als Symbolfigur des Frontkämpfers. Dabei war sein Anspruch, ein Frontsoldat gewesen zu sein, zweifelhaft. Hitler hatte zwar direkte Gefechte erlebt, war aber zumeist als Meldeläufer zwischen verschiedenen Befehlsposten hinter der eigentlichen Frontlinie beschäftigt gewesen.[15]
Auch Verbindungen zwischen deutschen und britischen Veteranen existierten, wenn auch weniger intensive. Ein einflussreiches Signal sendete der Autor und Kriegsveteran Ernst Jünger, indem er 1929 ein versöhnliches Vorwort für die englische Übersetzung seines Kriegsbuches In Stahlgewittern (1920) verfasste. Jünger spricht seine englischen Leser direkt an und mutmaßt, einige von ihnen hätten ihm vielleicht 1915 und 1916 bei Monchy-au-Bois, südlich von Arras, gegenübergelegen. Er erinnert diese Leser an eine Katze mit einem angeschossenen Bein, die im Niemandsland zwischen den feindlichen Schützengräben hauste und die einzige Kreatur war, die mit den Soldaten auf beiden Seiten der Front gute Beziehungen unterhielt. Es folgen schmeichelnde Bemerkungen über die damaligen Gegner:
»In unseren Gesprächen in den Gräben und den Unterständen, oder auf den Schussrampen, kamen wir oft auf den ›Tommy‹ zu sprechen; wie jeder richtige Soldat sofort verstehen wird, sprachen wir von ihm mit viel mehr Respekt, als es in den Zeitungen jener Tage üblich war. Niemand widersteht der Versuchung besser, den Löwen herabzusetzen, als der Löwenjäger. […] Von all den Truppen, welche den Deutschen auf den großen Schlachtfeldern gegenüberstanden, waren die englischen nicht nur die beachtlichsten, sondern auch die mannhaftesten und die ritterlichsten.«[16]
Nach dem Vorbild der deutsch-französischen Kontakte lud im Frühling 1935 die Dienststelle Ribbentrop, ein außenpolitischer »think tank« der NSDAP, auch britische Veteranen nach Deutschland ein. Die größte britische Veteranenvereinigung, die British Legion, reagierte mit einhelliger und begeisterter Zustimmung. Ihr Schutzherr, der Prinz von Wales, plädierte in einer vielbeachteten Rede für die Annahme der Einladung, und auch Außenminister Anthony Eden war einverstanden. Mitte Juli reiste eine Delegation der British Legion nach Deutschland. Als die Briten am Anhalter Bahnhof in Berlin ankamen, wurden sie von einer jubelnden Menge begrüßt. Hitler empfing die Delegierten, und sie wurden anschließend von Oberlindober im Hotel Kaiserhof zum Mittagessen geladen. Ribbentrop, der damals noch nicht Botschafter in London und Außenminister war, sich aber als Hitlers außenpolitischer Ratgeber ausgab, spielte sich als hingebungsvoller Gastgeber auf und hielt eine Festrede. Ähnlich wie Jünger beschwor er darin den Geist der Freundschaft, der sich schon in den Schützengräben angebahnt habe. Wie Jünger rühmte auch die deutsche Presse in ihren Berichten über den Besuch die Tugenden des britischen Soldaten und begrüßte die Freundschaft mit Großbritannien. Die britische Delegation kehrte am 26. Juli nach London zurück.
Die euphorischen deutschen Presseberichte konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass den Briten die propagandistische Ausschlachtung ihrer Reise übel aufgestoßen war. Es hatte bereits während des Besuches Misstöne gegeben, als die britische Delegation sich nach Rücksprache mit ihrem Außenministerium weigerte, vor dem Denkmal für den Münchner Putsch von 1923 einen Kranz niederzulegen. Die Gleichsetzung der deutschen Weltkriegstoten mit den »Märtyrern« der NSDAP war ein beliebtes Propagandamotiv der Nazis. Ribbentrop hatte deshalb die Kranzniederlegung eigenmächtig in den Reiseplan der britischen Delegation eingefügt und bereits der Presse angekündigt. Der Führer der britischen Delegation war zwar vom Friedenswillen in Deutschland beeindruckt und fand es wichtig, die ausgestreckte deutsche Hand nicht abzuweisen. Andererseits war er enttäuscht, dass seine Delegation nur Mitglieder von NSDAP-Organisationen treffen durfte. Er hatte sich eine offenere Begegnung mit deutschen Veteranen gewünscht.[17]
Der Besuch im Juli 1935 blieb das einzige deutsch-britische Treffen dieser Art, aber die Versöhnungsbemühungen unter Veteranen lebten weiter. So lud etwa die britische Kriegsgräberkommission Veteranen aller Länder zu den ehemaligen Schlachtfeldern in der Gegend von Ypern ein. Dort war 1927 ein aufwendiges Denkmal errichtet worden, das Menin-Tor, und in der Nähe legten die Briten riesige Friedhöfe für ihre Gefallenen an. Obwohl diese Gedenkstätten als Erinnerung an die britischen und alliierten Opfer gedacht waren, wollte die Kriegsgräberkommission in den dreißiger Jahren das Menin-Tor als Zentrum eines Gedenkraums für internationale Versöhnung gestalten. Man hoffte, auch deutsche Veteranen und ihre Angehörigen anzulocken, zumal sich in der Nähe der große deutsche Soldatenfriedhof von Langemark befand. Ein britisch-französisch-deutsches Abkommen ermutigte Veteranen, die Friedhöfe und Gedenkstätten aller Armeen zu besuchen und sich dabei freundschaftlich auszutauschen, um einen neuen Krieg zu verhindern. Solche Besuche fanden noch bis kurz vor Kriegsausbruch statt.[18]
Ein tragischer Unfall im Frühling 1936 gab NS-Funktionären nochmals eine Gelegenheit, die deutsch-britische Freundschaft zu beschwören.[19] Diesmal ging es nicht um Veteranen, sondern um Pfadfinder, also um zukünftige Soldaten. Am 17. April begab sich eine Gruppe von 27 Jungen aus einer Londoner Schule unter der Leitung ihres Lehrers in Freiburg im Breisgau auf eine beliebte Schwarzwaldwanderung auf den Schauinsland. Der Lehrer ignorierte Warnungen vor schlechtem Wetter (in London hatte schon der Flieder geblüht, und auch in Freiburg war es am Vortag frühlingshaft mild gewesen) und weigerte sich auch umzukehren, als es stark zu schneien begann, obwohl manche Jungen in kurzen Hosen und Sandalen unterwegs waren. Die Gruppe kletterte über steile Felswände und versuchte das Dorf Hofsgrund zu erreichen, verirrte sich aber im Schnee. Die ältesten und stärksten Jungen konnten am Abend die Bewohner von Hofsgrund alarmieren, die die versprengten Pfadfinder bargen und pflegten. Für fünf der Jungen kam jedoch jede Hilfe zu spät.
Außenminister Konstantin von Neurath und der Führer der Hitlerjugend (HJ) Baldur von Schirach kondolierten sofort dem britischen Botschafter in Berlin. Mitglieder der HJ bewachten die Särge der fünf verstorbenen Jungen im Freiburger Münster rund um die Uhr, bis sie nach London abtransportiert wurden.[20] Als die überlebenden britischen Schüler am 20. April, Hitlers Geburtstag, mit den Särgen abreisten, begleiteten sie uniformierte Gruppen der HJ und des Bundes Deutscher Mädel (BDM) zum Hauptbahnhof. Tausende Freiburger Bürger und Bürgerinnen besuchten die Prozession und drückten ihr Beileid aus. Der örtliche HJ-Führer beschwor in einer Rede den Willen zur Völkerverständigung und zum Frieden. Auf dem Weg zur Grenze in Aachen wurden die Eisenbahnwagen immer wieder von der Bevölkerung umringt, die den Reisenden Süßigkeiten zuwarf und ihr Beileid ausdrückte. Eine Delegation der HJ begleitete sie bis zur Grenze. Der deutsche Jugendpressedienst feierte den Überlebenskampf der britischen Jungen wie eine heroische Kriegsleistung und sprach von den Verstorbenen als Helden, die im Kampf für die Freundschaft zwischen den Völkern gefallen seien. In manchen Artikeln erschien es so, als habe die HJ die britischen Jungen gerettet, nicht die mutigen und hilfsbereiten Bürger von Hofsgrund. Die fünf toten Jungen wurden ein paar Tage später unter großer medialer Aufmerksamkeit in London bestattet.
Die Hilfsbereitschaft der Hofsgrunder Bevölkerung bekam in der britischen Presse viel Lob. Ein Leserbrief an die London Times vom 22. April benutzte sie als Vorbild für die Völkerverständigung. Mit Bezug auf die italienische Aggression gegen Äthiopien (1935) warnte der Leser auch vor einem Hass auf Italien und schrieb:
»Ich glaube, dass die Völker der verschiedenen Nationen einander noch nie näherstanden als heute. Die große Freundlichkeit der Dorfbewohner von Hofsgrund in der Tragödie der Schuljungen ist viel bedeutsamer als alle angeblichen bösen Absichten Hitlers. Wäre diese Tragödie in Italien passiert, wer kann bezweifeln, dass das gemeinsame Band der Menschlichkeit in Italien ebenso stark gewesen wäre?«[21]
Die Freiburger Staatsanwaltschaft wollte einen Prozess gegen den Lehrer eröffnen, wurde aber von höherer Stelle zurückgepfiffen. Auch von britischer Seite gab es Widerstände dagegen. Die Schule, für die er arbeitete, wollte sich nicht blamieren, obwohl die Schulleitung seine Fahrlässigkeit hinter geschlossenen Türen scharf kritisierte. Außenminister Eden winkte ab, als Beamte seines Ministeriums auf eine rechtliche Verfolgung des Lehrers drängten. Eden, der schon den Bürgern von Freiburg und Hofsgrund gedankt hatte, fürchtete, ein Prozess würde die Beziehungen zu Nazideutschland trüben, denn die deutsche Seite hatte offensichtlich kein Interesse daran. Zu gut war der Stoff, den die Tragödie für ein heroisches Drama im Dienste der Völkerverständigung lieferte, als dass man ihn durch die Wahrheit verderben wollte.
Auch auf kultureller Ebene gab es intensive Kontakte und freundliche Kooperation zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern. So drehte zum Beispiel der belgische Regisseur Jacques Feyder im Herbst 1935 in einem Vorort von Paris einen Film mit einer französischen und einer deutschen Schauspielertruppe, der in einer flämischen Kleinstadt Anfang des 17. Jahrhunderts spielte und eine versöhnliche Tendenz beinhaltete. Die französische Version, mit dem Titel La Kermesse héroïque (Die heldenhafte Kirmes), kam Ende 1935 in die Kinos und fand begeisterten Zuspruch. Auch die deutsche Version unter dem Titel Die klugen Frauen wurde ein Erfolg. Zur Premiere im Capitol-Kino in Berlin am 15. Januar 1936 erschienen hohe Vertreter aus Politik und Militär, darunter Propagandaminister Joseph Goebbels und der französische Botschafter. Feyder und seine Frau Françoise Rosay, die wegen ihrer guten Deutschkenntnisse als einzige Hauptdarstellerin in beiden Versionen mitspielte, wurden gefeiert. Ursprünglich wollte Feyder auch eine englische Fassung des Films einspielen, aber sein britischer Partner sprang im letzten Moment ab, weil er fand, dass Frauen in flämischen Spitzenkrägen nicht »sexy« genug für die moderne Leinwand seien.[22]
Im flämischen Teil Belgiens und teilweise auch in den Niederlanden provozierte der Film allerdings Entrüstung, weil Kritiker fanden, dass er die Flamen als unheroisch und lächerlich darstelle und somit die belgischen, besonders flämischen, Opfer des Weltkriegs verhöhne. Auch weckte der Film, der im spanisch besetzten Flandern spielte, bittere Erinnerungen an die deutsche Besetzung Belgiens. Flämische Nationalisten warfen in den Kinosälen Stinkbomben und ließen Ratten frei, es gab außerdem Krawalle in den Kinos und auf den Straßen.[23] Dennoch zeigte der Film, eine von mehreren französisch-deutschen Co-Produktionen, dass man auch im kulturellen Bereich die Feindschaft zwischen Frankreich und Deutschland für überwunden hielt. Françoise Rosay berichtet sogar, dass sie bei der Berliner Premiere Goebbels darauf hingewiesen habe, dass in deutschen Kaufhäusern Zinnsoldaten immer in Schlachtszenen zwischen Deutschen und Franzosen ausgestellt seien. Das mache ihr als französische Mutter, die ihren Söhnen gerne Zinnsoldaten mitbringe, Sorgen und überrasche sie, da sie von Bemühungen um deutsch-französische Verständigung gehört habe. Goebbels fragte genau nach den Kaufhäusern, die sie besucht hatte, und Rosay bemerkte später, dass die deutsch-französischen Kampfszenen tatsächlich verschwunden waren.[24]
Bald allerdings überschatteten die wachsenden internationalen Spannungen infolge von Hitlers aggressiver Außenpolitik und der Behandlung der deutschen Juden die Versöhnungsbemühungen. Als am 12. Oktober 1938 die HJ auf Betreiben von Schirachs ein Denkmal für die gestorbenen britischen Pfadfinder am Hang des Schauinsland einweihte, sollte ein Mitglied der königlichen Familie aus London anreisen, zusammen mit dem Führer der britischen Pfadfinderbewegung und dem britischen Botschafter in Berlin. Aber zwei Wochen nach der Unterzeichnung des Münchner Abkommens, das die Tschechoslowakei nach massiven Kriegsdrohungen Hitlers zerstückelte, waren die britisch-deutschen Beziehungen zu angespannt. Zwar berichtete die London Times über das Denkmal, das noch heute als »Engländerdenkmal« besteht, und lobte die Anteilnahme der deutschen Behörden, aber die britischen Prominenten sagten ab.[25] Ribbentrop, inzwischen Außenminister, verbot ein paar Monate später jeglichen Kontakt mit der British Legion, nachdem er erfahren hatte, dass sie eine Gruppe geflohener deutsch-jüdischer Veteranen empfangen hatte. Deutsche Delegationen besuchten zwar weiterhin das Menin-Tor und die britischen Friedhöfe in der Nähe, aber die Niederlegung von Kränzen mit Hakenkreuzen wurde zum Problem, denn sie wurden gestohlen oder zerstört.[26]
Die Pogromnacht am 9. November 1938 führte schließlich auch zum offenen Bruch zwischen den französischen und deutschen Veteranenverbänden, nachdem ihre Kontakte schon im Zuge der Remilitarisierung des Rheinlandes im März 1936 und der Annexion Österreichs zwei Jahre später schwere Krisen erlebt hatten. Pichot wendete sich jetzt entsetzt von Deutschland ab, obwohl er der deutschen Propaganda nicht glaubte, dass die Gewalt gegen Juden und jüdische Institutionen einer spontanen Volksregung entsprungen sei. Er kritisierte die Politik Nazideutschlands scharf. Mit dem Pogrom stelle sich das Land abseits der Völkergemeinschaft. Er sei kein Feind Deutschlands, so Pichot, aber Frankreich müsse forthin diesem Deutschland entschlossen entgegentreten. Sonst drohe eine Katastrophe.[27]
Sicher zielte das Bemühen Nazideutschlands um freundliche Beziehungen mit Großbritannien und Frankreich darauf, der deutschen Aufrüstung und Ostexpansion Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Aber die Versöhnung an sich erfreute sich großer Zustimmung auf beiden Seiten. Viele Zeitgenossen hielten in den dreißiger Jahren einen neuen Krieg in Westeuropa für fatal und überflüssig. Weltkriegsveteranen wünschten Verständigung und Frieden. Sie respektierten einander. Die Veteranentreffen waren überall populär, und bei der Behandlung der Schwarzwaldtragödie sendeten die ehemaligen Kriegsgegner einander versöhnliche Zeichen. Wie bei der Münchner Konferenz Ende September 1938 deutlich wurde, als die Bevölkerung den Premierministern Neville Chamberlain und Édouard Daladier zujubelte, wollte die große Mehrheit der Deutschen keinen Krieg – und ganz sicher keinen Krieg mit den Westmächten. Das Problem war, dass die deutsche Außenpolitik unter Hitlers Leitung auf eine Dominanz Osteuropas und eventuell des ganzen Kontinents abzielte, was für Großbritannien und Frankreich natürlich nicht akzeptabel war.[28] Die Bereitschaft zu Versöhnung und Frieden war weit verbreitet, aber nicht um jeden Preis. Angesichts der zunehmenden Spannungen kam der Kriegsausbruch am 1. September 1939 nicht überraschend, löste aber weder in Deutschland noch in Frankreich oder Großbritannien Begeisterung aus.
Kriegsausbruch und Sitzkrieg
Frankreichs Eintritt in den Krieg
In den letzten Augusttagen 1939 folgt der Journalist Jacques Benoist-Méchin einer Einladung zum Mittagessen in der Wohnung eines einflussreichen Freundes in einer vornehmen Pariser Wohngegend. Ganz überraschend stellt ihm sein Freund den französischen Oberbefehlshaber General Gamelin vor. Benoist-Méchin staunt, dass Gamelin in einer so angespannten internationalen Lage Zeit hat für ein Mittagessen im kleinsten Kreis. Benoist-Méchin ist gerade durch ein mehrbändiges Werk über die deutsche Armee bekannt geworden, und Gamelin erwähnt es auch gleich lobend. Er fragt Benoist-Méchin, wie er die Stärke und Kampfkraft der deutschen Armee einschätze. Benoist-Méchin antwortet, Gamelin habe sicher bessere Informationen als er, denn er selbst hat seine Forschungen bereits vor drei Jahren abgeschlossen. Gamelin insistiert aber, und als Benoist-Méchin weiter ausweicht, meint er: »Nun gut, hören Sie mir zu: Ich sage Ihnen etwas, das Sie vielleicht überraschen wird, aber es ist so. Ob die Wehrmacht nun zwanzig, hundert oder zweihundert Divisionen besitzt, das ist ganz gleichgültig, denn wenn Hitler uns den Krieg erklärt, werde ich wahrscheinlich gar nicht mit ihr kämpfen müssen.« Als ihn Benoist-Méchin erstaunt ansieht, fährt Gamelin fort:
»Verstehen Sie nicht? Das ist doch ganz einfach. […] An dem Tag, an dem Deutschland der Krieg erklärt wird, wird Hitler zusammenbrechen. Es wird Unruhen in Berlin geben. Statt die Reichsgrenzen zu verteidigen, wird die deutsche Armee in die Hauptstadt zurückströmen, um die Ordnung wiederherzustellen. Die Truppen in den Festungen im Westen werden wenig Widerstand leisten. Wir werden nach Deutschland hineinstoßen wie in ein Stück Butter.«[29]
Während sich Benoist-Méchin nach dieser überraschenden Erklärung zu sammeln sucht, gehen ihm Bilder von seinen Deutschlandreisen der letzten Jahre durch den Kopf: das Begräbnis Hindenburgs in Tannenberg 1934, die Sommerolympiade 1936 und ein Aufenthalt an der Ostseeküste, den er erst vor ein paar Tagen wegen der internationalen Spannungen abgebrochen hat. Er erinnert sich an Menschen, die keineswegs kriegsbegeistert sind, die aber still entschlossen hinter dem Regime stehen. Auf seinen Reisen hat Benoist-Méchin keine einzige Anfeindung erlebt, obwohl er sich überall als Franzose vorstellte. Aber er hat auch nicht die geringste Kritik an der deutschen Regierung gehört. Es ist ihm vollkommen unklar, wie und durch wen es zu einem Sturz Hitlers kommen könnte. Als er seine Zweifel ausdrückt, zeigt ihm Gamelin Geheimdienstdokumente, die tatsächlich auf eine breite Missstimmung in Deutschland hinweisen (Gamelin veröffentlicht diese Berichte später).[30] Wenn man Benoist-Méchin Glauben schenken kann, so ließ ihn diese Begegnung mit Gamelin zutiefst verstört zurück, auch deshalb, weil Gamelin hartnäckig die Möglichkeit bestritt, dass konzentrierte deutsche Panzerverbände die französische Front durchbrechen und ins Hinterland vorstoßen könnten, wovor Benoist-Méchin eindringlich warnte.[31]
Der Eindruck, dass die Deutschen nicht hinter dem Krieg stünden, ist in Frankreich (und auch in Großbritannien) weit verbreitet. Der französische Wirtschaftsfachmann Charles Rist hat durch eigene Kontakte Nachrichten über mangelnde deutsche Kriegsbegeisterung, glaubt aber im Gegensatz zu Gamelin nicht, dass diese Stimmung das Hitlerregime gefährden könne. Rist trifft in den ersten Septembertagen den französischen Konsul aus Düsseldorf, der gerade zurückgekehrt ist und behauptet, 85 Prozent der deutschen Generäle seien gegen den Krieg und die rheinischen Industriellen hofften auf eine deutsche Niederlage. Arbeiter hätten ihm Pläne von Flugplätzen und Festungen gegeben. Der amerikanische Botschafter William Bullitt erzählt Rist, die deutschen Generäle seien zwar gegen den Krieg, würden sich aber fügen. Bullitt zeigt Rist ein Dokument von Carl Goerdeler aus dem deutschen Widerstand, das konkrete Umsturzpläne enthält. Rist traut dem Friedenswillen vieler Deutscher aber nicht. Er sieht die Deutschen als ein Volk, das ein Jahrhundert lang systematisch zur Verherrlichung der Gewalt erzogen worden ist. Dennoch verdichtet sich für ihn der Eindruck, dass Deutschland nicht hinter der Kriegspolitik Hitlers steht. Er erfährt mehr über Goerdelers Aktivitäten, die offenbar von Stabschef General Franz Halder unterstützt werden, und er hört immer wieder Gerüchte, dass Hitler zugunsten des friedenswilligen Reichsmarschalls Hermann Göring gestürzt werden solle. Rist hat selber Kontakte zu Kreisen des deutschen Widerstands und erfährt durch sie, dass schon im November eine Offensive im Westen mit Angriff auf die Niederlande befohlen wurde, dass sich aber die deutschen Generäle erfolgreich dagegengestemmt hatten.[32] Die Wahrheit war, dass die meisten Generäle zwar eine Offensive ablehnten, dass die Verschiebung aber dem schlechten Wetter geschuldet war.
Frankreich zögerte nach dem deutschen Angriff auf Polen zunächst mit der Kriegserklärung, obwohl es, wie Großbritannien, eine Garantieerklärung für Polen abgegeben hatte. Der französische Außenminister Georges Bonnet hoffte auf ein Vermittlungsangebot durch Mussolini und seinen Außenminister Graf Galeazzo Ciano. Mussolini hatte zwar eine internationale Konferenz nach dem Muster der Münchner Konferenz vom September 1938 vorgeschlagen, insgeheim aber in Berlin verlauten lassen, dass er keine Einwände haben würde, sollte Deutschland das unter Völkerbundmandat stehende Danzig und die bereits eroberten Gebiete Polens behalten wollen. Hitler interessierte das italienische Angebot nicht, und die britische Regierung insistierte auf einem vollständigen Rückzug der deutschen Truppen aus Polen. Diese Bedingung war in Berlin nicht annehmbar, ebenso wenig wie das französische Begehren, zu der Konferenz auch Polen einzuladen – im Gegensatz zur Münchner Konferenz, wo die tschechoslowakische Regierung ignoriert worden war. Die Verzögerung des französischen Ultimatums geschah auch auf Betreiben Gamelins, der Zeit für die Mobilmachung gewinnen wollte. Er erwartete, dass Deutschland eine Kriegserklärung sofort mit schweren Bombenangriffen beantworten würde, die Mobilmachung wie auch die Evakuierung von Zivilisten aus den bedrohten Städten sollte hingegen ohne Bombengefahr fortgesetzt werden. Im Gegensatz zur französischen Regierung drängte die britische Regierung jedoch auf eine schnelle Kriegserklärung, da die britische Flotte deutsche Handelsschiffe, die sich auf der Rückreise nach Deutschland befanden, abfangen und deutsche U-Boote auf dem Weg zu ihren Operationsgebieten angreifen wollte.[33]
Das französische Parlament genehmigte Kriegskredite, und Premierminister Daladier erklärte am 2. September in einer feurigen Rede vor dem Parlament, dass Frankreich dem Aggressor die Stirn bieten müsse, wolle es nicht seine Ehre verlieren und sich isolieren. Überzeugend argumentierte er, dass niemand Hitlers Versicherungen glauben könne, Deutschland werde nach Befriedigung seiner Forderungen an Polen einen langen Frieden akzeptieren. Im Gegenteil, die Niederschlagung Polens würde die deutsche Aggression nur befeuern und zu weiteren Friedensbrüchen führen. Dennoch betonte Daladier, dass Frankreich weiterhin offen sei für Friedensverhandlungen, sollte Deutschland seine Truppen zurückziehen. Seine wiederholten Friedensangebote lösten einmütigen Applaus im Parlament aus. Zweifellos sehnten die französische Regierung und das französische Volk weiterhin eine friedliche Lösung herbei. Der Schriftsteller Jean Bloch-Michel formulierte es treffend: »Nun ist es so, dass auch die leidenschaftlichsten Befürworter des Friedens diesmal durch die Absurdität der Geschichte gezwungen wurden, in den Krieg zu gehen und ihn zu akzeptieren.«[34]
Die Stimmung in Frankreich war nüchtern, aber entschlossen. Es gab diesmal, anders als 1914, kein Elsass-Lothringen, das man zurückerobern wollte. Es gab keine demütigende Niederlage von 1870, die man vergessen machen wollte, und auch keine prompte deutsche Invasion, die eine schnelle Reaktion erforderte. Das einzige Ziel war, den Frieden wiederherzustellen und eine dauerhafte Friedensordnung zu schaffen. Das bedeutete, die Ursache der Friedensstörung zu beseitigen. Es bestand in Frankreich kein Zweifel darüber, dass Nazideutschland, vielleicht Hitler persönlich, diesen Krieg verschuldet hatte. Vielleicht reichte es, Hitler zu stürzen, eventuell mithilfe der deutschen Opposition, deren Macht nicht nur Gamelin überschätzte. Wahrscheinlich aber erforderte ein dauerhafter Friede die Zerschlagung des deutschen Staates, ein Ziel, das französische Politiker und Militärs 1919 vergeblich verfolgt hatten.[35]
Die Mobilmachung geht friedlich vonstatten. Kinder werden aus Paris evakuiert, die Kunstschätze des Louvre verhüllt und in Sicherheit gebracht. Die befürchtete deutsche Bomberoffensive bleibt aus, zur Überraschung der Franzosen wie auch der Briten. Die Stimmung der Truppen beschreibt der französische Offizier Daniel Barlone am 24. August 1939 in seinem Tagebuch:
»Die Reservisten erscheinen ohne unnötige Hast, ohne den Enthusiasmus von 1914 oder auch nur vom letzten Jahr [während der Krise um die Tschechoslowakei im September – d.A.]. Sie sind ganz und gar überzeugt, dass sie in zwei Wochen wieder heimgeschickt werden, und es ärgert sie, dass sie die Ernte nicht fertig einbringen konnten. Aber wenn man einrücken muss, so tut man es eben. Man wird dann in Frieden und Ruhe nach Hause zurückkehren, nachdem man Hitler eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht hat. Die große Hoffnung der Männer ist, dass Hitler ermordet wird; in ihrer Vorstellung trennen sie Hitler und Deutschland von einander. Sobald er geschlagen ist, so denken sie, ist alles vorbei.«
Barlone findet aber, dass seine Soldaten die Gefahr nicht ernst genug nehmen: »Sie realisieren nicht, dass Hitler Deutschlands Beuteinstinkt repräsentiert, die Inkarnation eines auserwählten Volkes, dessen Mission es ist, die Welt zu dominieren.« Daladiers Rede vom 2. September gibt ihm Mut, wie auch die Bemerkung eines Generals, die Situation sei wesentlich besser als 1914. Ein Kollege versichert ihm, dass die Maginot-Linie halten werde und dass Frankreich eine tiefe Verteidigung vorbereitet habe, um eventuelle Durchbrüche aufzufangen. Voller Tatendrang und mit glühendem Patriotismus hofft Barlone Mitte September auf einen französischen Angriff auf die deutsche Siegfried-Linie, obwohl er weiß, dass es um Polen bereits schlecht steht. Die Untätigkeit der französischen Armee beunruhigt ihn.[36]
Diese Untätigkeit führt bald zu einer Krise der Moral unter den Soldaten, von denen viele Bauern sind, die sich um ihre Höfe sorgen. Als die französische Regierung beginnt, Industriearbeiter aus der Armee an ihre Arbeitsplätze zurückzuschicken, um die Rüstungsproduktion aufrechtzuerhalten, murren die Bauern. Warum müssen sie in der Armee bleiben? Die Untätigkeit und die bald einsetzende Kälte führen zu Depressionen. Die Suizidrate steigt. Die Tatenlosigkeit sei demoralisierend, schreibt Barlone: »Sollen wir wirklich Krieg haben? Oder sollen wir uns einfach jahrelang gegenüberstehen?«[37] Gerüchte verbreiten sich schnell und Barlone schreibt einige davon auf, ohne recht an sie zu glauben. Soldaten reden davon, dass Nazideutschland die Luft ausgehe und dass Hitler wahnsinnig geworden sei.[38]
Barlone, wie auch andere Franzosen, ist besorgt über den Einfluss der deutschen Propaganda in Frankreich. Er fragt sich, warum Daladier nicht rücksichtsloser dagegen vorgeht. Tatsächlich war die deutsche Propaganda in Frankreich sehr aktiv. Der Rundfunksender Stuttgart, der dem Propagandaministerium unterstellt war, sendete auf Französisch unter der Regie des französischen Nazisympathisanten Paul Ferdonnet, und zwei deutsche Schwarzsender gaben vor, in Frankreich zu operieren, einer davon angeblich ein kommunistischer Untergrundsender. Zusätzlich warfen deutsche Flugzeuge Flugblätter über den feindlichen Linien ab. Die Botschaft war meist, dass England der eigentliche Urheber des Krieges sei und dass Frankreich kein Interesse an einem Konflikt mit Deutschland habe. Mit Verweis auf die schleppende Überführung der BEF nach Frankreich und ihre geringe Stärke wurde immer wieder betont, dass England und die englischen Bankiers gerne »bis zum letzten Franzosen« kämpfen würden. Die Tatsache, dass die BEF in einem passiven Sektor stand, während die französischen Truppen an der deutschen Grenze gelegentlich in Kampfhandlungen verwickelt wurden, schien dieser Propaganda Plausibilität zu verleihen. Angeblich amüsierten sich die »Tommies« mit den französischen Frauen, während die französischen Männer ihre Pflicht an der Front taten.
Der Major Raymond hört Ende Oktober diese Botschaften über Lautsprecher an der Grenze in Lothringen, in der Nähe des französisch-luxemburgisch-deutschen Länderdreiecks:
»Während der letzten Zeit hat der Feind ein Propagandasystem mit Lautsprecher organisiert. Das graue und trübe Wetter ausnutzend, kommt er mit einem kräftigen Plattenspieler auf die Straße nach Ritzing. Er lädt dort einen 15-minütigen Redeschwall über der Landschaft ab, dessen Folgerung immer dieselbe ist: ›England hat diesen Krieg gewollt, der für seinen Handel notwendig ist. Es ist allein schuldig. Wir haben nichts zu gewinnen, wenn wir uns für England schlagen. Es gibt keinen Streitpunkt zwischen Frankreich und Deutschland. Nichts steht unserer Freundschaft im Wege.‹«
Raymond beschreibt die Wirkung der Propaganda auf seine Leute:
»Diese Stimme, die aus dem leeren Horizont unter tief hängendem Himmel kommt, hat etwas Teuflisches; die Leute, die angesichts der Untätigkeit in diesem Abschnitt eine Tendenz haben, sich zu sehr gehen zu lassen, fühlen sich belauscht und überwacht von einem Feind, der unsichtbar, aber wachsam ist. Das macht sie nervös.«[39]
Zeitzeugen schrieben der deutschen Propaganda größere Wirkung zu als der französischen Gegenpropaganda, die darauf abzielte, Widerstand gegen Hitler anzufachen, und die immer wieder auf den unpopulären Pakt mit Stalin hinwies. Im Rückblick meinten Vertreter der Wehrmacht und der Propagandaminister Goebbels sogar, die »vierte Waffe« (Propaganda) habe den Feldzug entschieden, was aber nicht zutrifft.[40] Viele französische Soldaten und Zivilisten hörten Radio Stuttgart, um Nachrichten von Kriegsgefangenen zu bekommen, die zwischen propagandistischen Sendungen zu ihren Angehörigen sprechen konnten. Besonders nach dem Beginn des deutschen Angriffs wurde Radio Stuttgart oft auch deshalb gesucht, weil es zuverlässigere Information über Truppenbewegungen und Kriegshandlungen lieferte als der französische Rundfunk, der unter strenger militärischer Zensur arbeitete. Die Leute von Radio Stuttgart galten aber schlichtweg als Verräter, und viele Soldaten stellten den Sender nur ein, um sich über sie lustig zu machen. Die angeblich französischen Untergrundsender waren unwirksam, denn Sprecher mit deutschem Akzent verrieten ihre wahren Betreiber. Natürlich gab es Spannungen zwischen französischen und britischen Soldaten. Er war bekannt, dass die Briten viel besser bezahlt wurden als die Franzosen, was Eifersucht provozierte. Dass die Briten in einem passiven Sektor standen, erzeugte ebenfalls Unwillen, obwohl die Briten versuchten, durch Entsendung einzelner Truppenteile an die Grenze zu Deutschland Solidarität zu demonstrieren. Im Allgemeinen jedoch waren die Beziehungen in den ersten Monaten des Krieges relativ freundlich und herzlich, auch wenn die Schwäche der BEF Frankreich enttäuschte.[41] Im April verbesserte sich dann die französische Moral, teils wegen des wärmeren Wetters und teils, weil die deutschen Aktionen in Dänemark und Norwegen die Hoffnung nährten, dass auch im Westen bald eine Entscheidungsschlacht beginnen werde, deren Ausgang man zuversichtlich entgegensah.[42]
Die französischen und britischen Armeeführer erwarteten, zumindest einen deutschen Angriff abwehren zu können, auch wenn ihre eigenen Armeen aufgrund der schleppenden Aufrüstung erst in ein bis zwei Jahren bereit sein würden, anzugreifen. Aber viele alliierte Offiziere und Soldaten glaubten nicht, dass die Deutschen eine Offensive gegen die Maginot-Linie und die starken französisch-britischen Armeen riskieren würden. Rist notiert am 6. November 1939, er sei sich sicher, dass Deutschland nicht angreifen werde. Aber er sorgt sich um die Stimmung in der französischen Armee. Wie kann man die Moral von vier Millionen Mann hochhalten, wenn nichts passiert?[43] Der Schriftsteller André Maurois, damals französischer Vertreter bei der BEF, bemerkt immer wieder Trägheit in beiden Armeen, weil sie nicht mit einem deutschen Angriff rechnen. Maurois sieht, wie französische Soldaten bei Arras Gemüsegärten anlegen und Hasen züchten, statt Verteidigungsgräben zu bauen. Als ein Soldat einem General vorschlägt, mit Schanzarbeiten zu beginnen, herrscht ihn der General an: »Soweit kommt der Feind nie und nimmer. Sie sind ein Defaitist!«[44]
An der deutsch-französischen Grenze bleibt es zunächst ruhig, obwohl Artilleriegefechte und Luftangriffe gelegentlich Opfer fordern. Unteroffizier Jean Vetel schreibt am 15. Dezember an seine Schwester und seinen Schwager:
»Es fällt Euch vielleicht auf, dass die ›Boches‹ [verachtungsvoller Ausdruck für Deutsche; d.A.] eigentlich nicht böse sind, wenn man es so ausdrücken kann. Sie überblicken von ihrem Aussichtspunkt, bloß 800 Meter entfernt, unser Kommen und Gehen, aber wenn sie nur einen einzelnen Menschen sehen, dann schießen sie nicht. Trotzdem hat es ziemlich viele Tote, Verletzte und Gefangene gegeben […].«[45]
Tatsächlich hatte die französische Armee während des »Sitzkrieges« überraschend viele Tote zu beklagen (10410), überwiegend durch Krankheiten und Unfälle. Soldaten waren es nicht gewohnt, mit scharfer Munition umzugehen, und viele starben bei Verkehrsunfällen. Etwa 400 Todesfälle waren Suizide, mit dem Höchststand im Januar 1940, dem Tiefpunkt der französischen Moral. Die außerordentliche Kälte trug zu vielen Todesfällen bei – auch in der Zivilbevölkerung.[46]
In Frankreich verbreitete sich bald der Ausdruck drôle de guerre (komischer Krieg – »komisch« im Sinn von »seltsam«) für diese überraschend ruhige Phase des Krieges. Die Bezeichnung ging auf einen Zeitungsartikel des Journalisten Roland Dorgelès vom Oktober 1939 zurück: »Nein, dieser Krieg ist nicht komisch, aber es ist dennoch ein komischer Krieg.« Der Ausdruck verbreitete sich in Großbritannien als phoney war (unechter Krieg). Wann und wie das deutsche Wort »Sitzkrieg« in Gebrauch kam, ist unklar. Möglicherweise war es die britische Presse, die Anfang 1940 den Ausdruck prägte, worauf er von der deutschen Presse übernommen wurde. »Sitzkrieg« wurde in britischen Artikeln als Gegensatz zu »Blitzkrieg« verwendet, einem Begriff, der oft auf den schnellen deutschen Feldzug in Polen angewendet wurde.[47] Daladier betonte in einer Rede im Dezember 1939, dass Frankreich Ende 1914 etwa 450000 Tote zu beklagen hatte, Ende 1939 aber nur 1534. Sicher sprach er vielen Franzosen aus dem Herzen, als er fortfuhr: »Ich ziehe weiterhin die Situation des Dezember 1939 derjenigen von 1914 vor.«[48]
Die Trennung der Soldaten von ihren Familien wird in dieser Phase oft als schmerzhaft empfunden, wobei manche die Beziehungen zwischen Zivilleben und Armee als bedrückende Kluft wahrnehmen, während andere daraus Kraft und Mut schöpfen. Der Major Raymond geht kurz vor Weihnachten auf Heimaturlaub. Wie schon im Weltkrieg ist der Urlaub für ihn eine befremdende Erfahrung. In seinem Tagebuch schreibt er, im Geiste an die Kameraden gerichtet:
»Sobald die erste Wiedersehensfreude verflogen ist, wandelt man ratlos unter den Seinigen. Eine unsichtbare Welt trennt euch, eine deutliche Bruchstelle hat sich aufgetan, eine Scheidung offenbart sich. Die Eurigen sind in ihrer Welt mit ihren täglichen Sorgen geblieben, aber die Bezüge, welche ihr einst mit ihnen teiltet, sind nicht mehr die euren. Ihr fühlt nicht mehr wie sie; ihr denkt nicht mehr wie sie. Der Schein hat sich nicht verändert, aber in Wirklichkeit ist alles anders geworden. Jeder folgt seiner eigenen Bahn, aber die Gleise sind nicht parallel und entfernen sich immer mehr voneinander, je länger die Reise dauert.«[49]
Für andere Soldaten ist die Verbindung zur Familie eine Kraftquelle. Der Soldat Jean Fougedoire aus dem Dorf Prades in den Pyrenäen führt eine liebevolle und zärtliche Korrespondenz mit seiner Frau Lydia und seinem Sohn Max. Lydia und Jean tauschen sich über allerlei Alltagsdinge aus. Die Briefe ersetzen die abendlichen Tischgespräche.[50] Lydia sorgt sich, wenn längere Zeit kein Brief von Jean kommt. Jean geht nach der Mobilmachung zunächst nicht an die Grenze, sondern muss mit seinen Kameraden in der Camargue bei Winzerarbeiten helfen. Sein Sohn Max schreibt ihm am 11. Oktober 1939 eine Karte: »Lieber Papa, ich schicke Dir große Küsschen. Heute ist Donnerstag und schulfrei. Ich amüsiere mich mit Ginette, und dann essen wir zu Abend und danach machen wir Pasteten und spielen Milchmann, was Spaß macht. Dein kleiner Max, der Dich sehr lieb hat.« Max überlegt dann offenbar, wie er seine Sehnsucht nach dem Vater ausdrücken soll; in einem Zusatz schreibt er: »Papa, wir haben ein Flugzeug gesehen. Hast Du es auch gesehen? Um halb zehn?«[51] Am 28. Dezember schreibt Max erneut:
»Lieber Papa, ich wünsche Dir ein gutes und glückliches neues Jahr [sic] hol dir keinen Schnupfen und hoffentlich frierst Du nicht. Mama tippt gerade auf der Maschine ich habe meine Hausaufgaben fast fertig ich muss nur noch die Multiplikationen machen dann bin ich fertig. […] Du Papa ich wollte Du wärest da mit der Mama und mir. Wir wären wenigstens alle zufrieden. Dein kleiner Max schickt Dir seine besten Wünsche und besten Küsse.«[52]
Die Bruchlandung eines deutschen Generalstabsoffiziers am 10. Januar 1940 bei Maasmechelen in Belgien verursacht plötzlich hektische Tage: Der Offizier, dessen Pilot sich bei nebligem Wetter verirrt hatte, trägt deutsche Planungsdokumente für den Angriff im Westen in der Aktentasche und kann nur einen Teil davon verbrennen, bevor ihn belgische Polizisten überwältigen. Die Belgier informieren sofort Paris und London und die Alarmbereitschaft in den Armeen wird erhöht, wobei der Vorfall an sich geheim gehalten wird.[53] Am 12. Januar hört Barlone, dass es jetzt ernst werde. Er und seine Leute reagieren mit Begeisterung. Endlich kommt es zur Schlacht! Aber am 18. Januar sickert durch, dass alles nur ein falscher Alarm war. Barlone argwöhnt, dass die ganze Sache ein britischer Trick ist, um Belgien zu erhöhter Wachsamkeit und besserer Kriegsvorbereitung zu veranlassen.[54] Der Fund bestärkt Gamelin in seiner Gewissheit, dass die Deutschen wie 1914 einen massiven Angriff durch Belgien ausführen werden. Das wird genau die Situation herstellen, auf die er vorbereitet ist.
Nach weiteren ereignisarmen Wochen unterbricht ein Besuch Gamelins bei Barlones Einheit Anfang März den Alltag. Barlone weiß, dass manche Offiziere Gamelin für senil halten, aber er selbst ist von dessen Bescheidenheit und der ruhigen, ernsthaften Art beeindruckt und kontrastiert sie mit dem aufgeblasenen Pathos Hitlers und Mussolinis. Die Niederlage Finnlands gegen die Sowjetunion, die nach anfänglich erfolgreichem finnischem Widerstand im Frieden von Moskau am 13. März 1940 besiegelt wurde, ärgert ihn allerdings. Hatten denn die Alliierten Finnland nicht helfen können? »Die Gangster« (Hitler und Stalin) siegen wieder![55] Die Missstimmung führt in Frankreich zum Sturz von Premierminister Daladier, der durch den entschlosseneren Paul Reynaud ersetzt wird. Daladier bleibt gleichwohl Verteidigungsminister. Mit Besorgnis kommentiert Barlone wenig später den Besuch des amerikanischen stellvertretenden Außenministers Sumner Welles in Berlin; was soll man machen, wenn Hitler ihm sagt, dass der Krieg jederzeit aufhören kann? Niemand will ja den Konflikt im Westen, aber die Eroberungen der Diktatoren werden durch das Stillhalten im Westen nicht ungeschehen gemacht. Barlone glaubt nun nicht mehr, dass Deutschland die belgische Neutralität verletzen wird, denn das würde die Amerikaner gegen Deutschland aufbringen. Der sich abzeichnende Rückschlag der Alliierten in Norwegen im April beschäftigt Barlone dennoch und nährt seine Zweifel an der Kampfkraft des britischen Verbündeten. Kollegen sagen, die britischen Offiziere seien nur Mittelmaß und ihre Truppen nicht abgehärtet gegen den Krieg. Es scheint, als rechneten die Briten mit einem langen Konflikt, in dem sie viel Zeit haben werden, sich vorzubereiten, vielleicht drei Jahre. Barlone fragt sich, warum sich die Briten neben einer guten Flotte nicht auch eine gute Armee leisten können.[56]
Charles Rist reist im März 1940 in die Vereinigten Staaten, um Handels- und Blockadefragen zu besprechen. Nach Gesprächen mit dem amerikanischen Außenminister Cordell Hull und Präsident Roosevelt notiert er, dass die Amerikaner großes Vertrauen in die französische Armee haben, aber doch noch weit davon entfernt sind, den Ernst der Bedrohung zu erkennen. Hulls größte Sorge, so Rist, ist die britisch-französische Entscheidung, aus Kostengründen Tabakkäufe aus den Vereinigten Staaten einzustellen. Offenbar braucht Roosevelt für seine Wiederwahl die Unterstützung von Senatoren aus den Tabak produzierenden Staaten, die über den kriegsbedingten Importstopp verärgert sind. Rist verspricht, dass Frankreich die Tabakkäufe in beschränktem Maße wieder aufnehmen werde. Er bemerkt auch, dass die Amerikaner ziemlich verärgert über die Briten sind, die sie immer noch ein bisschen als Kolonie betrachten. Nach seiner Rückkehr erstattet Rist Reynaud Bericht.[57]
Frankreichs Mobilmachung erfasste auch das Kolonialgebiet Französisch-Westafrika. Die meisten westafrikanischen Soldaten kamen vom Land und hatten keine Schulbildung, aber es gab zugleich Gebildete unter ihnen (die évolués), die manchmal als Unteroffiziere oder (selten) in höheren Rängen dienten, wenn auch nie höher als im Rang eines Hauptmanns.[58] Da die meisten Westafrikaner vollständig oder teilweise Analphabeten waren und meist kaum Französisch sprachen, publizierte die französische Armee einen Seriencomic unter dem Titel »Mamadou zieht in den Krieg«, in dem erklärt wurde, dass Hitler verrückt geworden sei und Frankreich zur Mobilmachung gezwungen habe. Der Comic warnte vor Hitlers Kolonialplänen, die sich auch auf Westafrika erstrecken könnten. Die Geschichte folgt dem westafrikanischen Soldaten Mamadou, der sich als Freiwilliger meldet und mit seinem Freund Ibrahima nach Frankreich geht. Auf der Überfahrt nach Marseille sieht Mamadou zwar deutsche U-Boote, aber die französische Luftwaffe beschützt sein Truppenschiff und er bekommt Gelegenheit, bei Gibraltar die große Macht der alliierten britischen Flotte zu bewundern. In Frankreich werden Mamadou und Ibrahima herzlich von Zivilisten empfangen und in deren Häuser aufgenommen. Sie besuchen touristische Attraktionen und eine Parfumfabrik. In der letzten Folge, die am 1. Juni 1940 erschien, nehmen Mamadou und Ibrahima den Zug nach Nordosten an die Front.[59]
Insgesamt mobilisiert Frankreich bis Juni 1940 über 100000 Westafrikaner, auch Senegalschützen genannt, obwohl die große Mehrheit nicht aus dem heutigen Senegal stammte. Bis zum Zeitpunkt des Waffenstillstandes sind allerdings weniger als drei Viertel dieser Soldaten in Frankreich angekommen. Die meisten Senegalschützen sind, anders als Mamadou, keine Freiwilligen (es gab seit 1918 eine Militärdienstpflicht). Dennoch verläuft die Rekrutierung reibungslos. Es hilft vielleicht, dass die französische Kolonialverwaltung verkündet hat, dass Hitler schwarze Afrikaner für Halbaffen halte.[60] Manche Westafrikaner werden mit Europäern in sogenannten gemischten Kolonialregimentern gruppiert; andere bleiben selbstständig, sind aber oft im Divisionsverband mit Einheiten aus Frankreich vereint. Die ersten Senegalschützen kommen bereits im September 1939 an die Maginot-Linie und nehmen an einem kurzen französischen Vorstoß ins Saargebiet teil. Viele westafrikanische Regimenter verbringen jedoch die ersten Monate des Krieges in Ausbildungslagern in Südfrankreich oder in Afrika.[61]
Wie der Comic andeutet, nimmt die französische Bevölkerung die Senegalschützen meist freundlich und dankbar auf. Manche Französinnen gehen sogenannte Kriegspatenschaften mit einem westafrikanischen Soldaten ein. Sie schicken »ihrem« Soldaten Pakete und Briefe, die er sich von lesekundigen Unteroffizieren vorlesen und übersetzen lassen kann. Es gibt Liebesbeziehungen und sogar Heiratspläne.[62] Für die Ivorer, die die Anthropologin Nancy Lawler in den achtziger Jahren interviewte, wirkte die Begegnung mit der französischen Bevölkerung befreiend. Ihnen fiel auf, dass französische Landwirte selbst auf ihren Feldern arbeiteten, im Gegensatz zu den Franzosen in den Kolonien, die als Grundbesitzer meist die afrikanische Bevölkerung auf ihren Ländereien arbeiten ließen. Manche Afrikaner fühlten, dass sie den Franzosen ähnlicher waren als angenommen.[63]
Die meisten Senegalschützen kannten den Weltkrieg aus den Erzählungen ihrer Väter. Über 170000 Soldaten waren damals in Westafrika rekrutiert worden, und 30000 waren gefallen. Die Senegalschützen von 1939 redeten meist mit Achtung über die Veteranen von 1914/18. Diese Leute hatten einiges erlebt, waren viel herumgekommen und hatten oft etwas Französisch gelernt – wenn auch meist eine infantile Version, das sogenannte petit tirailleur. Dass sie Erfahrung mit Europäern hatten, gab ihnen zu Hause eine Aura der Respektabilität.[64] Nur wenige Afrikaner, die 1939/40 am Krieg teilnahmen, hatten schon im Weltkrieg gekämpft. Dazu zählte der Hauptmann Charles N’Tchoréré, der aus Gabun stammte und sich als Freiwilliger gemeldet hatte.
Im November 1939 wurden die in Nordfrankreich stationierten Senegalschützen, wie schon im Weltkrieg, in den wärmeren Süden Frankreichs verlegt, wo sie während des Winters weiter ausgebildet wurden. Man glaubte, dass die aus tropischen Regionen stammenden Soldaten besonders anfällig für Erkrankungen der Atemwege seien und den Winter im Norden schlecht vertrügen. Diese Maßnahme ersparte ihnen den ungewöhnlich kalten nordfranzösischen Winter von 1939/40.
Gerade als die westafrikanischen Soldaten im April 1940 wieder ihre Plätze an der Grenze einnehmen, läuft in Deutschland eine rassistische Propagandawelle an. Ihr zufolge hat Frankreich seit der Revolution von 1789 durch seinen Liberalismus und seine gesellschaftliche Toleranz einen Prozess der »Degeneration« erlebt. Dadurch seien die »natürlichen, biologischen Grenzen« zwischen der germanischen Oberschicht Frankreichs und seinen »minderwertigen« Rassen aufgeweicht worden. Die hohen Verluste Frankreichs im Weltkrieg und eine niedrige Geburtenrate hätten die Rassenmischung intensiviert. Laut Nazipropaganda sind die Franzosen so zu einer »Mischrasse« geworden, die keine schöpferische Rolle in der Geschichte mehr spielen kann. Denn Mischung ist in der nationalsozialistischen Rassenlehre gleichbedeutend mit Niedergang. Natürlich werden die Juden für diese Entwicklung verantwortlich gemacht. Eine beliebte Zielscheibe ist Georges Mandel, der seit 1938 Kolonialminister im französischen Kabinett ist und dadurch mit der Rekrutierung schwarzer Soldaten zu tun hat. Als Mandel im Mai 1940 Innenminister wird, beschuldigt ihn die Nazipresse, jetzt erst recht die schwarze und weiße Rasse in Frankreich vermischen zu wollen, um Frankreich der Herrschaft des internationalen Judentums auszuliefern.[65]
To France (again)! Das zweite britische Expeditionskorps
Die Stimmung in Großbritannien war bei Kriegsausbruch ernst und gefasst. Zwar herrschte Angst vor Bombenangriffen und die Kinder aus London wurden zum Teil in ländliche Regionen evakuiert. Diese Maßnahme war aber schon lange vorbereitet und bereits während der Sudetenkrise geprobt worden.[66] Die Spannungen der letzten zwölf Monate hatten in breiten Kreisen Kriegserwartung erzeugt. Zwar war die Erleichterung groß, als die Münchner Konferenz scheinbar eine friedliche Lösung der Sudetenkrise erbrachte, und auch, als der deutsche Einmarsch in die Tschechoslowakei im März 1939 keinen Flächenbrand erzeugte, aber die öffentliche Stimmung änderte sich. Man hielt nun einen Krieg zunehmend für unausweichlich, wenn auch wegen der Blutopfer von 1914/18 weiterhin für unerwünscht. Allerdings glaubten viele in Großbritannien, dass der britische Beitrag zu einem westeuropäischen Krieg vorwiegend die Luft- und Seestreitkräfte involvieren würde, da Frankreich durch die Maginot-Linie und seine starke Armee ausreichend geschützt schien. Nur gegen einige Widerstände konnte Chamberlain durchsetzen, dass Großbritannien Frankreich mit Landstreitkräften beistehen würde, was von Frankreich aufgrund seiner demographischen Schwäche dringend gewünscht wurde.[67] Manche Briten fragten sich, ob die Generation von 1939 auch eine Armee mit der Kraft von 1914 bilden könnte, denn sie war gegenüber Autoritäten kritischer, relativ gut gebildet, unabhängiger, demokratischer und gesünder, vielleicht auch mehr am Lebensgenuss interessiert. Jedenfalls schien sie schlechter auf das Leben in der Armee vorbereitet. Die brutale Erbschaft des Weltkrieges hatte zudem die Autorität des Militärs untergraben. Sogar Winston Churchill, sonst ein unbeugsamer Patriot, zweifelte gelegentlich am Sinn der britischen Opfer von damals.[68]
Kaum ein britischer Veteran erinnerte sich an den Kriegsausbruch als Überraschung. Der Artillerist Edward Palmer sprach sogar von Erleichterung, als der Krieg ausbrach. Es war in den Augen vieler wirklich Zeit, dass etwas passierte, und die Stimmung war siegesgewiss. »Wir waren unglaublich selbstsicher. Wir erwarteten nicht [wie 1914], dass der Krieg bis zu Weihnachten zu Ende sein würde, aber wir hatten absolutes Vertrauen.« Es bestand kein Zweifel an der Gerechtigkeit der britischen Kriegserklärung: »Wir hatten die Nase voll von Hitler mit seinen falschen Versprechungen, dass er keine weiteren territorialen Forderungen habe.« Ähnlich erinnert sich auch der Artillerist Thomas O’Brien. Die Truppe sei voller Begeisterung gewesen, und auch die Bevölkerung in England habe Erleichterung darüber gespürt, dass der Krieg endlich gekommen sei. Der Infanterieoffizier Ian Roger erlebte die Stimmung zu diesem Zeitpunkt als entschlossen, aber nicht enthusiastisch wie 1914.[69] Bei vielen britischen Soldaten löste der Kriegsausbruch bedrückende Erinnerungen aus. Der Panzersoldat James Palmer berichtet zum Beispiel von dem Tag, als er einrückte:
»Der Zug fuhr dampfend ein, und wir liefen langsam durch die Absperrung hindurch. Es war fast Zeit. Vater war sehr erschüttert, nicht nur, weil ich in den Krieg zog, sondern auch, weil er dieselben Gefühle wieder erlebte, die er vor über zwanzig Jahren gehabt hatte, als er an demselben Bahnsteig stand und einen Zug bestieg, der ihn zu irgendeiner gottverlassenen Armeekaserne brachte, bevor er nach Frankreich musste und an der Somme im Weltkrieg kämpfte.«[70]
Zunächst sollten sieben britische Divisionen, später zehn, ein neues britisches Expeditionskorps bilden. Die BEF war damit beauftragt, die belgisch-französische Grenze im Umkreis der Stadt Lille zu bewachen und im Ernstfall zu verteidigen. Absprachen existierten auch für die Luftstreitkräfte und Marinen beider Länder. Im Herbst und Winter bezog die BEF Stellungen im Norden Frankreichs. Die Vorbereitungen und Übungen, die sie in diesem Zeitraum veranstaltete, waren nach Ansicht von Militärexperten wenig hilfreich. Zwar hatten britische und französische Generäle die Gründe für den schnellen Erfolg der Wehrmacht in Polen richtig analysiert, sie glaubten aber nicht, dass diese Erkenntnisse im Kampf gegen die modernen westlichen Armeen eine Rolle spielen würden (eine Meinung, die auch viele deutsche Experten teilten[71]). Die britische Armee war in der Zwischenkriegszeit gegenüber der Royal Air Force (RAF) und Royal Navy vernachlässigt worden. Ihr wichtigstes Aufgabengebiet war die Wahrung der Ordnung in den Kolonien gewesen, wo sie es mit technologisch unterlegenen Gegnern zu tun hatte. Zwar war sie, teils wegen ihres geringen Umfangs, viel stärker motorisiert als die deutsche Armee, aber einige Divisionen in Frankreich beklagten das zögerliche Eintreffen ihrer Ausrüstung.[72]
Die BEF beschäftigte sich zunächst mit dem Anlegen von Befestigungen, Panzersperren und Bunkern, der sogenannten Gort-Linie (nach ihrem Kommandeur, General John Gort, benannt) entlang der französisch-belgischen Grenze. Natürlich erschien das fragwürdig, da ja der Plan Gamelins im Falle eines deutschen Angriffs auf Belgien einen Vormarsch der BEF zusammen mit der Elite der französischen Armee Richtung Brüssel und bis zur Südspitze der Niederlande vorsah. Allerdings gab es britische Einheiten, die diese Stellungen in den letzten Maitagen 1940 nach dem Rückzug aus Belgien nutzten, um sich gegen die Deutschen zu verteidigen. Weil Belgien seit 1936 neutral war, konnten die Briten und Franzosen keine Stellungen in Belgien vorbereiten und beziehen, was viele ärgerte.
Britische Soldaten fühlten sich oft an den Grabenkrieg von 1914/18 erinnert, als sie im Winter 1939/40 Schützengräben aushoben, Bunker bauten und Stacheldraht verlegten. So schilderte zum Beispiel der Soldat Cyril Feebery:
»Wir mussten die Verteidigungsstellungen der Gort-Linie bis zur Küste errichten, und das geschah ganz nach dem Lehrbuch aus dem Ersten Weltkrieg. Die Offiziere maßen Grabenlinien an Abhängen ab und markierten mit weißem Band die Streifen, wo wir dann mit Picke und Schaufel graben mussten. Wir gruben Löcher für Verteidigungsstellungen und Bunker, Sanitätsstationen und Sammelpunkte. Wir fällten Bäume, um ein freies Schussfeld zu bekommen, und benutzten die Stämme, um die steilen Seiten unserer Gräben zu verstärken, sodass sie auch als Panzerfallen dienen konnten. Wenn man zurückschaut, kann man sehen, dass wir ausgezeichnet ausgebildet und ausgerüstet waren, um den Ersten Weltkrieg zu gewinnen. Hätten wir die Sommeschlacht so ausgerüstet und ausgebildet kämpfen können, wie wir es 1939 waren, dann wäre der Krieg damals [1916] an Weihnachten zu Ende gegangen – ganz ohne Schweiß. […] So besetzten wir diese Gräben, wie es unsere Väter vor zwanzig Jahren getan hatten, bereit, die massierten Infanterieangriffe abzuwehren, welche die Deutschen, genau wie ihre Väter vor zwanzig Jahren, ausführen würden.«[73]
Langeweile und die ungewöhnliche Kälte des Winters von 1939/40 dominieren die Erinnerung der BEF-Soldaten. Viele von ihnen froren erbärmlich in ungeheizten Scheunen oder Ställen. Das Graben im teilweise gefrorenen Boden war harte Arbeit.[74] Die Quartiere boten oft wenig Schutz vor der Witterung. Der Gefreite Geoff Nickholds, bei Arras stationiert, musste mit seinen Kameraden in Schweineställen übernachten: »Zwar hatte man die Ställe gründlich gereinigt, aber den Regen hielten sie nicht auf. Mein Stall hatte ein Sieb als Dach, das ständig tropfte.« Als Nickholds an die belgische Grenze verlegt wurde, mussten er und seine Kameraden bei Frost auf der Ladefläche eines Lastwagens unter freiem Himmel schlafen. Einer seiner Kameraden konnte sich nicht an die Bedingungen gewöhnen: Eines Tages lief er bei Frost nackt die Hauptstraße hinunter und schrie, dass er einen Weg gefunden habe, um die Welt zu retten. Nickholds fragte sich, ob der Kamerad einfach nach Hause wollte oder wirklich verrückt geworden war. Er beschloss, dass Letzteres wahrscheinlicher war, denn man musste verrückt sein, um bei dieser Kälte draußen nackt herumzulaufen.[75]
Die Beziehungen zur französischen Bevölkerung waren meist gut. Viele Franzosen erinnerten sich dankbar an den britischen Beitrag zur Verteidigung Frankreichs im Ersten Weltkrieg, und auch die BEF-Soldaten, die schon damals gedient hatten, bewahrten häufig freundliche Erinnerungen an die Zivilisten. Besonders die im Norden Frankreichs und im angrenzenden Belgien sehr zahlreichen Schenken (estaminets) waren ein fester Bestandteil der kollektiven Erinnerung der ersten BEF. Oft von Frauen bewirtschaftet, servierten sie Bier, Wein, Spirituosen, Kaffee und lokale Gerichte wie Spiegelei mit Pommes frites.[76] Die Soldaten der zweiten BEF





























