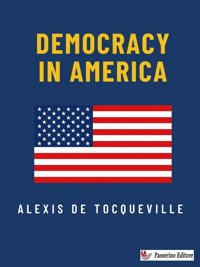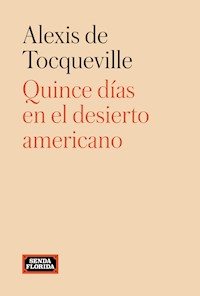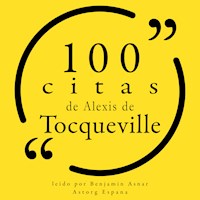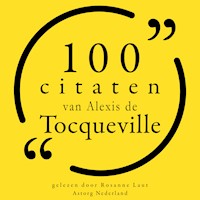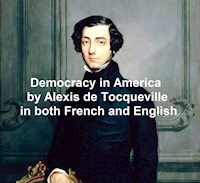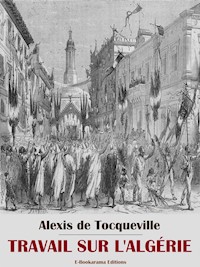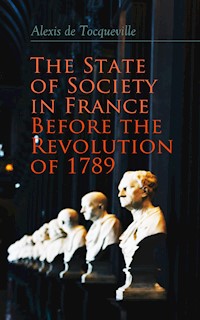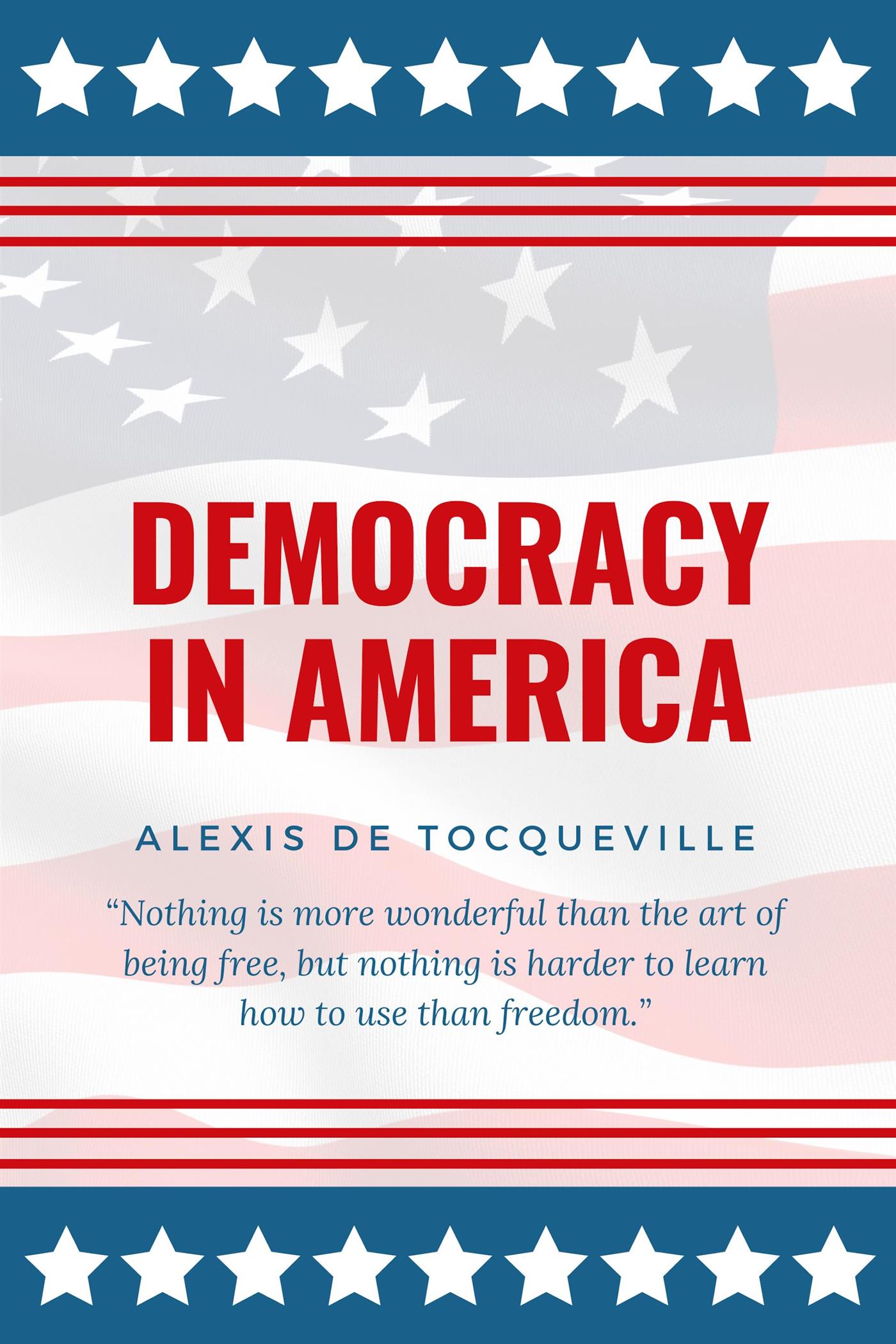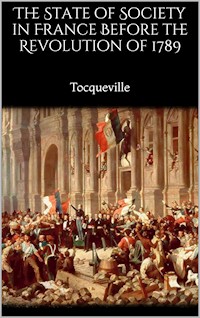12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: diaphanes Broschur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Während seiner großen Nordamerikareise, die eigentlich den Beobachtungen des amerikanischen Rechtssystems gewidmet war und der wir letztendlich auch sein Hauptwerk »Die Demokratie in Amerika« verdanken, begab sich Alexis de Tocqueville für zwei Wochen auf Abwege. Auf der Suche nach der Wildnis und den Ureinwohnern des Kontinents durchreist er den Bundesstaat New York, überquert den Eriesee und findet schließlich fast unberührte Täler im Distrikt Michigan. Der Bericht seiner Eindrücke und Begegnungen zeichnet ein unmittelbares Bild von der Verheerung und Erschließung, der Zerstörung und Zivilisierung des Kontinents und seiner Bevölkerung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Ähnliche
Alexis de Tocqueville Fünfzehn Tage in der Wildnis
gefolgt von
Gustave de Beaumont
Die Amerikareise
Aus dem Französischen von Heinz Jatho
Mit einem Nachwort von
Inhalt
Fünfzehn Tage in der Wildnis
Am Oneida-See
Gustave de Beaumont
Fünfzehn Tage in der Wildnis
Geschrieben auf dem SteamboatThe Superior,August 1831
Zu den Dingen, die bei unserer Amerika-Reise unsere Neugier am meisten reizten, gehörte ein Streifzug an die äußersten Grenzen der europäischen Zivilisation und, sofern uns genügend Zeit bliebe, vielleicht auch ein Besuch bei einigen der indianischen Stämme, die lieber in die wildeste Einsamkeit geflohen sind, als sich dem, was die Weißen die Annehmlichkeiten des sozialen Lebens nennen, zu beugen. Aber heute ist eine Begegnung mit der Wildnis schwieriger als man denkt. Ab New York schien das Ziel unserer Reise, je weiter wir uns nach Nordosten bewegten, vor uns her zu fliehen. Wir kamen durch Orte, die in der Geschichte der Indianer berühmt waren; wir trafen auf Täler, die sie benannt hatten; wir überquerten Flüsse, die noch den Namen ihrer Stämme trugen, aber überall war die Hütte des Wilden dem Haus des zivilisierten Mannes gewichen, die Wälder waren gefallen, und die Einsamkeit nahm Leben an.
Allerdings schienen wir auf den Spuren der Eingeborenen zu wandeln. Vor zehn Jahren, so hieß es, waren sie hier, vor fünf Jahren da, vor zwei Jahren da. »Wo Sie die schönste Kirche des Dorfs sehen«, erzählte uns einer, »da habe ich im Wald den ersten Baum gefällt«. »Hier«, erzählte ein anderer, »fand der große Rat des Bundes der Irokesen statt.«
»Und was ist aus den Indianern geworden?«, sagte ich.
»Die Indianer«, entgegnete unser Gastgeber, »ich weiß nicht genau, wo sie hin sind, irgendwo hinter den großen Seen werden sie sein. Sie sind eine Rasse, mit der es zu Ende geht; sie sind für die Zivilisation nicht geschaffen, sie tötet sie.«
Der Mensch gewöhnt sich an alles, an den Tod auf dem Schlachtfeld, an den Tod im Spital, ans Töten und ans Leiden. Es gibt kein Schauspiel, mit dem er sich nicht arrangierte. Ein altes Volk, erster und legitimer Herr des amerikanischen Kontinents, schmilzt tagtäglich dahin wie Schnee unter den Strahlen der Sonne und verschwindet vor unseren Augen vom Erdboden. An denselben Orten und statt seiner wächst – und das mit einer wahrhaft erstaunlichen Schnelligkeit – eine andere Rasse heran. Durch sie fallen die Wälder und werden die Sümpfe trockengelegt; ungeheure Flüsse und Seen, die groß sind wie Meere, widersetzen sich vergebens ihrem triumphalen Vormarsch. Wildnisse werden zu Dörfern, Dörfer zu Städten. Als täglicher Zeuge dieser Wunder findet der Amerikaner an alledem nichts Besonderes. Diese unglaubliche Zerstörung, dieses noch überraschendere Wachstum – es erscheint ihm wie der gewöhnliche Gang der Dinge in dieser Welt. Er gewöhnt sich daran wie an die unverrückbare Ordnung der Natur.
So, ständig auf der Suche nach den Wilden und der Wildnis, brachten wir die dreihundertsechzig Meilen hinter uns, die New York von Buffalo trennen.
Was uns als Erstes ins Auge fiel, war eine große Zahl von Indianern, die an diesem Tag in Buffalo versammelt waren, um die Bezahlung für das Land, das sie den Vereinigten Staaten überlassen hatten, in Empfang zu nehmen.
Ich glaube nicht, dass ich je eine tiefere Enttäuschung empfunden habe als beim Anblick dieser Indianer. Ich war erfüllt von Erinnerungen aus Chateaubriand und Cooper, und ich erwartete, in den Eingeborenen Amerikas Wilde zu finden, auf deren Antlitz die Natur die Spur einiger jener stolzen Tugenden hinterlassen hatte, wie der Geist der Freiheit sie hervorbringt. Ich glaubte in ihnen Menschen zu treffen, deren Körper die Jagd und der Krieg gestählt hatte und die nichts verloren, wenn man sie nackt erblickte. Man stelle sich meine Verwunderung beim Anblick des Folgenden vor.
Die Indianer, die ich an diesem Tag sah, waren von kleinem Wuchs; ihre Glieder, soweit man sie unter der Kleidung erkennen konnte, waren schmächtig; ihre Haut war, statt, wie man gewöhnlich meint, rotbraun, tief bronzefarben, so dass sie auf den ersten Blick stark an die von Mulatten erinnerte. Ihr schwarzes und glänzendes Haar fiel ihnen steif auf Hals und Schultern. Ihre Münder waren meist enorm groß, ihr Gesichtsausdruck gemein und bösartig. Ihre Physiognomie war von einer Verkommenheit, wie sie nur ein lang dauernder Missbrauch zivilisatorischer Wohltaten bewirken kann. Man hätte sie für Menschen aus dem niedersten Pöbel unserer großen europäischen Städte halten können, aber es waren noch Wilde. In die Laster, die sie von uns übernommen hatten, mischte sich noch etwas Barbarisches und Unzivilisiertes, das sie noch hundertmal abstoßender machte. Diese Indianer trugen keine Waffen, sie steckten in europäischer Kleidung, benutzten sie aber anders als wir. Man sah, dass sie mit ihr überhaupt nicht vertraut waren und sich in ihren Falten wie gefangen fühlten. Den Zierrat Europas ergänzten sie mit den Produkten eines barbarischen Luxus, wie Federn, enorme Ohrringe und Halsbänder aus Muscheln. Die Bewegungen dieser Menschen waren schnell und unkoordiniert, ihre Stimmen schrill und misstönend, ihre Blicke unruhig und wild. Auf Anhieb hätte man versucht sein können, nichts weiter als Tiere des Waldes in ihnen zu sehen, denen die Erziehung menschliches Aussehen gegeben hatte, die aber nichtsdestoweniger Tiere geblieben waren. Diese schwachen und heruntergekommenen Wesen gehörten jedoch zu einem der bedeutendsten Stämme der altamerikanischen Welt. Vor uns hatten wir – es tut weh, es zu sagen – die letzten Reste jener berühmten Föderation der Irokesen, deren männliche Weisheit nicht weniger bekannt war als ihr Mut, und die lange Zeit zwischen den beiden größten Nationen Europas neutral geblieben waren.
Man hätte allerdings Unrecht, die indianische Rasse nach jenem formlosen Probestück, jenem verirrten Spross eines wilden Baums, der im Schmutz unserer Städte gewachsen war, zu beurteilen. Es hieße, den Irrtum zu wiederholen, den wir selbst begingen und den einzusehen wir später Gelegenheit fanden.
Des Abends verließen wir die Stadt, und kurz nach den letzten Häusern gewahrten wir am Straßenrand liegend einen Indianer. Es war ein junger Mann. Er war reglos, und wir hielten ihn für tot. Ein ersticktes Stöhnen, das sich mühsam seiner Brust entwand, zeigte uns jedoch, dass er noch lebte und mit einem jener gefährlichen Räusche kämpfte, die der Schnaps verursacht. Die Sonne war schon untergegangen, der Boden wurde nach und nach feuchter. Alles deutete darauf hin, dass der Unglückliche, wenn ihm nicht geholfen würde, seinen letzten Seufzer tat. Es war die Stunde, da die Indianer Buffalo verließen, um in ihr Dorf zurückzukehren; von Zeit zu Zeit kam eine Gruppe an uns vorbei. Sie näherten sich, drehten, um ihn erkennen zu können, den Körper ihres Landsmannes brutal um und setzten dann ihren Weg fort, ohne unsere Bemerkungen im Mindesten zur Kenntnis zu nehmen. Die meisten von diesen Männern waren selbst betrunken. Schließlich kam eine junge Indianerin, die zunächst ein gewisses Interesse zu zeigen schien. Ich hielt sie für die Frau oder die Schwester des Sterbenden. Sie betrachtete ihn aufmerksam, nannte ihn laut beim Namen, betastete sein Herz und versuchte, nachdem sie sich überzeugt hatte, dass er lebte, ihn seiner Lethargie zu entreißen. Aber als diese Versuche vergeblich blieben, sahen wir, wie sie gegen diesen leblosen Körper, der vor ihr lag, in Zorn geriet. Sie schlug gegen seinen Kopf, kniff das Gesicht mit ihren Händen, trat ihn mit Füßen. In ihrer Raserei stieß sie unartikulierte und wilde Schreie aus, die mir noch jetzt in den Ohren klingen. Schließlich glaubten wir, eingreifen zu müssen, und befahlen ihr mit Entschiedenheit, von ihm abzulassen. Sie gehorchte, aber als sie sich entfernte, hörten wir sie in ein barbarisches Gelächter ausbrechen.
In die Stadt zurückgekehrt, sprechen wir mit mehreren Leuten über den jungen Indianer. Wir sprechen von der unmittelbaren Gefahr, in der er schwebt; wir bieten sogar an, für ihn eine Herberge zu bezahlen. All das ist nutzlos. Wir können keinen bewegen, sich um ihn zu kümmern. Die einen sagten: Diese Leute sind gewohnt, maßlos zu trinken und auf dem Boden zu schlafen; sie sterben nicht bei solchen Gelegenheiten. Andere gaben zu, dass der Indianer vermutlich sterben werde, aber auf ihren Lippen war jener halb ausgesprochene Gedanke abzulesen: Was ist das Leben eines Indianers schon wert? Dies war das allgemeine Grundgefühl. Mitten in dieser Gesellschaft, die so eifersüchtig auf Moralität und Philanthropie bedacht ist, trifft man auf komplette Gleichgültigkeit, auf eine Art kalten und unbarmherzigen Egoismus, wenn es um die Eingeborenen von Amerika geht. Anders als es die Spanier in Mexiko taten, veranstalten die Bewohner der Vereinigten Staaten keine Hetzjagd auf die Indianer. Aber es ist derselbe unbarmherzige Instinkt, der hier wie überall die europäische Rasse erfüllt.
Wie oft haben wir auf unseren Reisen nicht ehrsame Bürger getroffen, die uns des Abends, in aller Ruhe am Kamin sitzend, sagten: Die Indianer werden jeden Tag weniger! Nicht dass wir oft Krieg gegen sie führen würden, aber der Schnaps, den wir ihnen billig verkaufen, bringt jedes Jahr mehr von ihnen um die Ecke, als unsere Waffen es könnten. Diese Welt hier gehört uns, fügten sie hinzu; indem er ihren ersten Bewohnern die Fähigkeit, sich zu zivilisieren, verweigert hat, hat Gott sie im Voraus einem unvermeidlichen Untergang geweiht. Die wahren Eigentümer dieses Kontinents sind die, die sich seine Reichtümer zunutze zu machen wissen.
Von solchen Vorstellungen erfüllt, geht der Amerikaner zufrieden in die Kirche, wo er einem Prediger des Evangeliums lauscht, der ihm einschärft, dass die Menschen Brüder sind und dass das ewige Wesen, das sie alle nach demselben Bild gemacht hat, sie zu gegenseitiger Hilfe verpflichtet.
Am 19. Juli bestiegen wir um zehn Uhr morgens das Dampfschiff Ohio mit Kurs auf Detroit. Von Nordwesten wehte eine starke Brise, die die Fluten des Eriesees wie Wogen des Ozeans aussehen ließ. Rechts erstreckte sich ein Horizont ohne Grenzen; links folgten wir der Südküste des Sees, der wir uns oft bis auf Rufweite näherten. Diese Küsten sind vollkommen flach und sind ganz anders als die der Seen, die ich in Europa zu Gesicht bekommen hatte. Sie hatten auch keine Ähnlichkeit mit dem Strand des Meeres: Ungeheure Wälder beschatteten sie, die sich wie ein dichter und nur selten unterbrochener Gürtel um den See legten. Von Zeit zu Zeit jedoch änderte sich das Bild der Landschaft. Hinter einem Wald gewahrt man die elegante Spitze eines Kirchturms, strahlend weiße, saubere Häuser und Läden. Zwei Schritt weiter beginnt dann wieder das Reich des ursprünglichen und, wie es scheint, undurchdringlichen Waldes, der sein Laub erneut in den Wassern des Sees spiegelt.
Wer sich in den Vereinigten Staaten etwas umgesehen hat, wird in diesem Gemälde ein frappierendes Emblem der amerikanischen Gesellschaft finden. Alles ist zusammenhanglos, unvorhergesehen. Die höchste Zivilisation und die sich selbst überlassene Natur sind überall gegenwärtig und stehen sich gewissermaßen Auge in Auge gegenüber. Das ist es, was man sich in Frankreich nicht vorstellen kann. Ich, in meinen Illusionen als Reisender – und welche Menschenklasse hat nicht die ihren? –, hatte ganz andere Vorstellungen. In Europa war mir aufgefallen, dass die mehr oder weniger abgeschiedene Lage einer Provinz oder einer Stadt, ihr Reichtum oder ihre Armut, ihre Kleinheit oder ihre Größe, einen ungeheuren Einfluss auf die Ideen, die Sitten und die gesamte Kultur der Bewohner ausüben und oftmals zwischen die diversen Parteien desselben Territoriums einen Unterschied von mehreren Jahrhunderten schieben.
Ich dachte, dass es in der Neuen Welt ebenso und erst recht so wäre und ein wie Amerika unvollständig und nach und nach besiedeltes Land alle Zustände der Existenz zeigen und das Bild der Gesellschaft in allen Altersstufen bieten müsste. Für mich war Amerika das einzige Land, in dem man Schritt für Schritt alle Transformationen, die der gesellschaftliche Zustand den Menschen hatte durchlaufen lassen, verfolgen konnte und wo es möglich wäre, etwas wie eine lange, Glied für Glied vom reichen städtischen Patrizier bis zum Wilden verlaufende Kette zu beobachten. Mit einem Wort, ich glaubte dort zwischen ein paar Längengraden die gesamte Geschichte der Menschheit eingerahmt zu finden.
Nichts an dieser Einbildung ist wahr. Von allen Ländern der Welt ist Amerika am wenigsten geeignet, das Schauspiel, das ich suchte, zu liefern. Mehr noch als in Europa gibt es in Amerika nur eine einzige Gesellschaft. Sie kann reich sein oder arm, bescheiden oder glänzend, Handel treiben oder Landwirtschaft; aber sie besteht überall aus denselben Elementen. Überall ist ein gleiches Zivilisationsniveau maßgebend. Den Mann, den man in den Straßen von New York verlassen hat, findet man in den Einsamkeiten des Westens wieder; dieselbe Kleidung, derselbe Geist, dieselbe Sprache, dieselben Gewohnheiten, dieselben Vergnügungen. Nichts Rustikales, nichts Naives, nichts, was nach Wildnis aussieht, nicht einmal etwas, was unseren Dörfern ähnlich sähe. Der Grund für diesen eigenartigen Sachverhalt ist leicht einzusehen. Die Landesteile, die am längsten und am vollständigsten besiedelt sind, haben einen hohen Grad an Zivilisation erreicht. Das Bildungsniveau ist allgemein hoch; der Geist der Gleichheit hat den inneren Gewohnheiten des Lebens eine besonders uniforme Färbung gegeben. Es sind aber wohlgemerkt eben diese Menschen, die sich jedes Jahr aufmachen, die Wildnis zu bevölkern. In Europa lebt und stirbt jeder auf dem Boden, auf dem er geboren wurde. In Amerika trifft man nirgends auf Vertreter einer Rasse, die sich in der Einsamkeit, ohne Wissen von der Welt und auf sich selbst gestellt, vermehrt hätte. Wer an isolierten Orten wohnt, ist gestern gekommen; ist gekommen mit den Sitten, den Ideen, den Bedürfnissen der Zivilisation; sein Leben unterwirft sich der Wildnis nur in dem Maß, wie es die Notwendigkeit gebietet; daher die seltsamsten Kontraste. Man wechselt übergangslos von einer Wildnis in die Straße einer Stadt, von den wildesten Szenen zu den heitersten Bildern des zivilisierten Lebens. Wenn einen die hereinbrechende Nacht nicht zwingt, sich am Fuß eines Baumes ein Obdach zu suchen, hat man gute Chancen, in ein Dorf zu kommen, wo bis zu den französischen Moden und Karikaturen von den Boulevards alles zu finden ist. Der Händler in Buffalo und Detroit ist so gut versehen wie der in New York. Die Fabriken von Lyon arbeiten für den einen wie für den anderen. Man verlässt die großen Straßen, man arbeitet sich vor auf kaum gebahnten Pfaden; schließlich erblickt man ein eben urbar gemachtes Feld, eine Hütte aus kaum behauenen Stämmen, in die nur durch ein schmales Fenster Licht dringt; endlich glaubt man, die Behausung des amerikanischen Bauern vor sich zu haben: Irrtum. Man tritt ein in diese Hütte, die eine Zuflucht allen Elends zu sein scheint, aber der Besitzer trägt dieselbe Kleidung wie man selbst; er spricht die Sprache der Städte. Auf seinem rohen Tisch liegen Bücher und Zeitungen; er selbst beeilt sich, einen beiseite zu nehmen, um sich genau zu erkundigen, was im alten Europa passiert, und bittet um Auskunft, was einen in seinem Land am meisten frappiert hat. Er wird dir einen Feldzugsplan für die Belgier aufs Papier skizzieren* und dich mit ernster Miene darüber belehren, was dem Gedeihen Frankreichs am zuträglichsten ist. Man glaubt es mit einem reichen Grundherrn zu tun zu haben, der nur momentan und für ein paar Nächte, für einen Jagdausflug, hier wohnt. Und wirklich ist die Holzhütte für den Amerikaner nur ein momentanes Asyl, ein vorübergehendes Zugeständnis an die Notwendigkeit der Umstände. Wenn die umgebenden Felder erst Frucht tragen und der neue Eigentümer Muße hat, sich mit den angenehmen Dingen des Lebens zu beschäftigen, wird ein geräumigeres und seinen Bedürfnissen besser entsprechendes Haus das log house ersetzen und zahlreichen Kindern Asyl bieten, Kindern, die sich eines Tages gleichfalls eine Heimstatt in der Wildnis schaffen können.
Um nun auf unsere Reise zurückzukommen, so kämpften wir uns den ganzen Tag mühsam in Sichtweite des Ufers an den Küsten Pennsylvanias und später Ohios entlang. In Presqu’Ile, heute Erie, machten wir einen Augenblick Halt.
Abends, als das Wetter günstiger geworden war, nahmen wir mitten über den See schnell Kurs auf Detroit. Am nächsten Morgen war die kleine Insel namens Middle Sister in Sicht, in deren Nähe der Commodore Parry 1814 einen berühmten Seesieg über die Engländer errungen hatte.