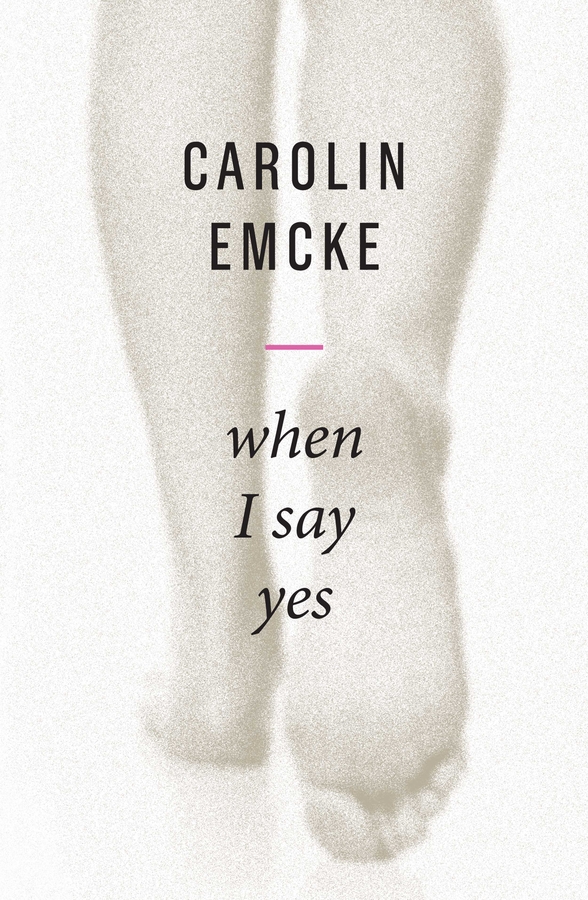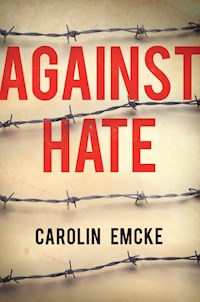Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Kampa Salon
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Vielfältig sind die Themen, mit denen sich Carolin Emcke beschäftigt, und vielfältig sind auch die Perspektiven, die sie einnimmt. Nichts liegt ihr ferner als Stereotype. Und so finden sich auch in diesen Gesprächen mit dem Literaturwissenschaftler Thomas Strässle keine einfachen Antworten. Vielmehr stellt Emcke ihre eigenen Positionen immer wieder auf den Prüfstand. Weit und offen ist auch ihr Blick auf die Welt: Als Reporterin in Krisengebieten, ob im Kosovo, in Afghanistan oder in Nicaragua, hat sie den Umgang mit Gewalt betrachtet und ihre eigene Rolle als Zeugin fremden Leids und die der Medien reflektiert. Als Philosophin fragt sie danach, wie wir Hass und Fanatismus begegnen können in einer offenen Gesellschaft – und welche Rolle dabei eine fragmentierte Öffentlichkeit spielt, in der Desinformation und Lüge ungefiltert zirkulieren. Die Achtung vor dem Anderen steht dabei immer im Zentrum ihres zutiefst humanistischen Denkens. Was heißt es, wenn Menschen ihren Glauben oder ihr Begehren nicht zeigen, nicht artikulieren, nicht ausleben können? Welche Praktiken und Normen schließen aus oder ein? Bei alldem lässt Emcke sich selbst nicht außen vor. So erzählt sie in diesem Buch auch von der Geschichte ihres eigenen Begehrens, davon, welche Texte sie geprägt haben und von ihrer großen Liebe zur klassischen Musik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carolin Emcke
Für den Zweifel
Gespräche mit Thomas Strässle
Kampa
Erzählen trotz allem
Erstes Gespräch
Ich möchte in unsere Gespräche einsteigen mit Ihrer Zeit als Kriegsreporterin. Sie sind viele Jahre durch Krisenregionen gereist, von Pakistan, Afghanistan, Irak über den Libanon und Gaza, über Rumänien und den Kosovo bis nach Nicaragua und Kolumbien. Und in einem Ihrer Bücher, Weil es sagbar ist, schreiben Sie, Sie hätten sich schon als Studentin der Diskursethik in Frankfurt für den Zusammenhang von Gewalt und Sprachlosigkeit interessiert. Wie kann ich mir den Schritt vorstellen von diesem akademischen Interesse zur Tätigkeit als Kriegsreporterin?
Ich habe mir nie vorgestellt, in Krisenregionen als Reporterin unterwegs zu sein. Es gab dafür keine Absicht, keinen Plan, sondern es ist entstanden. Aber die Fragen von Gewalt und Sprachlosigkeit, die für diese Reisen so prägend sein sollten, die waren vorher da. Das hatte mich schon lange existenziell berührt und dann auch theoretisch beschäftigt. Schon bei der ersten Lektüre der Überlebendenberichte von Primo Levi und Jean Améry war es dieser markante Unterschied zwischen beiden, der mir nachging: Auf der einen Seite Primo Levi, der sofort, schon auf der verschlungenen Rückkehr von Auschwitz nach Italien, begann, das Erzählen zu probieren. Das ist bemerkenswert, dass er, gerade dem absoluten Grauen entronnen, das Erlebte in Worte zu fassen versucht. Er testet dabei nicht nur, ob er selber fähig wäre zu beschreiben, was er durchlitten hat, sondern ob seine Gegenüber fähig wären zuzuhören, ob sie es ertragen, ob sie mehr wissen wollen. Und Levi veröffentlicht seine Erinnerungen an Auschwitz Ist das ein Mensch? gleich 1947. Und auf der anderen Seite Jean Améry, der zuerst still blieb, der nichts schreiben konnte oder wollte, zwanzig Jahre lang, und der dann erst 1966Jenseits von Schuld und Sühne veröffentlichte. Mich hat gerade Jean Améry immer besonders berührt. Das hat mit diesem Schweigen zu tun. Und mit dem Zorn in den Texten, die er dann geschrieben hat. Es waren diese beiden, die Spannung zwischen ihnen, durch die die Frage des Erzählens aufgeworfen wurde.
Wie lautet diese Frage genau?
Dass es Erfahrungen geben kann, die sich nicht sofort beschreiben lassen, ja, dass es Erfahrungen gibt, die sich nicht einmal sofort verstehen lassen, weil sie uns überfordern, weil sie alles das außer Kraft setzen, was sonst gilt, weil sie alle Erwartungen an das, was Menschen einander antun können, übersteigen – das ist ungeheuerlich. Weil es letztlich bedeuten kann, dass Verbrechen nicht bezeugt werden können, dass die Erfahrungen von Folter, von physischer und psychischer Qual, von Erniedrigung und sexualisierter Gewalt nicht erzählt werden. Das ist natürlich genau die Absicht der Täter: alle Spuren ihrer Taten zu tilgen, die Opfer so zu versehren, dass sie nicht mehr Auskunft geben können über das, was ihnen angetan wurde. Das ist ultimative Vernichtung – und auch eine Gerechtigkeitsfrage.
Was bedeutete die Frage der Zeugenschaft für Sie in der philosophischen Tradition der Frankfurter Schule?
Als Studierende in Frankfurt, im Kontext Diskursethik, standen die Fragen des kommunikativen Handelns und der Verständigung im Zentrum des philosophischen Denkens. Die Möglichkeit, dass eine Erfahrung nicht erzählbar sein könnte oder nur anders, als normalerweise erwartet wird, ist in dieser Tradition eine Herausforderung. Denn hier wird angenommen, dass die eigene Perspektive, die eigenen Erfahrungen diskursiv eingebracht und verhandelt werden können. Und letztlich, dass sie auch verstehbar sind. Diese Bedingungen sind ausgesprochen voraussetzungsvoll, und es hat mich beschäftigt, ob die Ansprüche und die Erwartungen an die Diskursteilnehmenden nicht möglicherweise zu hoch sind. Was, wenn jemand nicht sprechen kann oder nicht das Vertrauen hat, dass das Gegenüber wirklich zuhören kann? Was, wenn jemand nur stotternd, nicht linear, nur in Bruchstücken erzählen kann? Was, wenn jemand nicht rational klingt? Das hat mich schon theoretisch ungeheuer umgetrieben. Und mit der ersten Reise in eine Krisenregion, 1999 nach Mazedonien und Albanien im Kosovo-Krieg, ist diese Frage dann in einer Weise relevant geworden, wie ich es natürlich vorher theoretisch nicht geahnt hatte. Sie bekam auf einmal eine ganz andere Wucht, eine ganz andere Schwerkraft.
Bleiben wir noch kurz beim philosophischen Interesse: Inwiefern war die Diskursethik eine Folie, durch die Sie Ihr Verständnis von Zeugenschaft ausgebildet haben?
Ist sie immer noch. Ich denke immer noch mit und in den Begriffen dieser Tradition. Zunächst einmal stand da die Frage, wie Menschen überhaupt so etwas einander antun können. Mich beschäftigten schon sehr früh die Mechanismen der Exklusion, die Frage nach der Methodik der Konstruktion als anders und dann eben als minderwertig. Die Blickregime, mit denen ausgesondert und operationalisiert wird, haben mich, glaube ich, schon als Schülerin umgetrieben. Natürlich nicht in diesen Begriffen oder mit einem philosophischen Instrumentarium. Was für mich dann später mit dem theoretischen Wissen in der Praxis entscheidend war, ist Folgendes: Die Erwartungen an eine ungebrochene, rationale Erzählung von extremen Erfahrungen der Gewalt sind mitunter zu anspruchsvoll. Sie gehen an dem Kern solcher Erlebnisse vorbei, die eben vor allem eine Disruption mit allem zuvor Dagewesenen darstellen. Umgekehrt dürfen die Opfer von Gewalt auch nicht einfach pathologisiert werden, ihnen darf auch nicht einfach die Sprechfähigkeit abgesprochen werden. Das scheint mir bei Autoren wie Giorgio Agamben in Was von Auschwitz bleibt fatal.
Als studierter Jurist hat Agamben vielleicht auch einen ganz anderen Anspruch an das, was ein Zeuge …
Ja, aber der Gestus bei Agamben ist ja einer, der das Ereignis und die Beschädigung und die Gewaltförmigkeit ernst nehmen will. Das ist zuerst einmal das, was ich mit ihm teile. Aber meiner Ansicht nach überhöht er dann die Versehrung so sehr, dass daraus etwas behauptet wird wie das Ereignis, das nicht beschreibbar ist, das Ereignis, das keinen Zeugen hat. Das halte ich für fatal. Es gab immer Zeug:innen. Und auch die noch so brutal gezeichneten Überlebenden haben später erzählt. Vom Ereignis, das nicht beschrieben werden kann, vom Ereignis ohne Zeug:innen zu sprechen negiert und entmündigt sie. Gewiss gab es Orte des Todes, die niemand überlebt hat, und in dem Sinne kann man sagen, es gab keine Innen-Zeug:innen, aber dann gab es Beobachter:innen von außen, es gibt Bilder trotz allem, wie Georges Didi-Huberman es genannt hat.
Und wie verorten Sie sich als Autorin demgegenüber?
Mein ganzes Schreiben aus diesen Gegenden, mein ganzes Schreiben über Gewalt entspringt der Überzeugung, dass alle Ereignisse beschreibbar sind, dass die Innen-Zeug:innen erzählen können, wenn man ihnen nur ernsthaft zuhört, und dass es auch verstehbar und erzählbar ist für mich, als Reporterin, als Autorin. Insofern bleibe ich da ganz in der habermasianischen Tradition. Worin ich mich absetze oder wo ich diese Linie gern weiterentwickeln wollte, ist die Frage, was alles als rationale, vernünftige Erzählung gilt. Diejenigen, die stottern oder aufschrecken, die Lücken haben und Pausen machen, die rückwärts erzählen oder ein traumatisches Erlebnis nur in Chiffren umkreisen können – sie liefern für mich durchaus angemessene Beschreibungen für ihre Erfahrung. Ich möchte sie nicht einfach pathologisiert sehen.
Sie hätten sich auch ein Leben lang aus akademisch-philosophischer Perspektive mit diesen Fragen beschäftigen können. Es ist etwas ganz anderes, eines Tages zu sagen: Nein, ich fahre da hin, ich will es mit eigenen Augen sehen.
So hat es nicht funktioniert. Ich habe im Studium immer schon nebenher journalistisch gearbeitet, erst Praktika, dann freie Mitarbeiterschaften. Und dadurch gab es immer die Unterbrechung des geschlossenen Raums der Universität. Es gab immer diese Sehnsucht nach Welthaltigkeit, nach Konfrontation mit anderen sozialen und kulturellen Kontexten. Und ich würde sagen, beide Modi des Seins, das Theoretische und das Praktische, waren schon da. Ich wollte als Typ immer draußen sein, unterwegs, im ungeschützten Raum. Die einzige vage Phantasie, die ich schon als Kind hatte für mich als Erwachsene, war, dass ich im Ausland sein würde. Der konkrete Schritt zum Reisen in die Krisenregionen erfolgte dann als Redakteurin beim Spiegel und war eher spontan.
Spontan?
Ja. Ich war eigentlich angestellt als Redakteurin im Deutschlandressort. Ich weiß noch, wie ich damals, 1999, in der Kosovo-Krise diese Bilder im Fernsehen sah. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, die Bilder von den kosovarischen Geflüchteten? Man sah Frauen mit Kindern im Arm und Babys im Arm und Menschen, die nur gerade ihre paar Habseligkeiten durch diese hügelige Landschaft trugen. Bei schlechtem Wetter. Das Bild hat sicherlich nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen ältere Bilder aufgerufen, historische Bilder. Ich glaube, da reagiert jede:r natürlich erst einmal als Person mit einem bestimmten historischen Bewusstsein, mit einem bestimmten inneren Bildarchiv, auch aus der Literatur, aus Texten. Als Journalistin war ich aber in der Lage, sagen zu können: »Ich melde mich, ich möchte von dort berichten.« Es meldeten sich nicht so viele, das muss man auch sagen.
Sie meldeten sich innerhalb des Spiegels bei der Auslandsredaktion.
Genau. Das war eine historische Krise, und sie fand in Europa statt. Und ich wollte sie begleiten. So bin ich dann mit einigen Kolleg:innen hingereist, komplett unvorbereitet auf das, was mich erwarten würde.
Was überraschend ist: Sie sind ja in erster Linie Autorin, eine Frau des Wortes. Und trotzdem waren es Bilder, die Sie so getroffen haben, und nicht eine Reportage oder ein Artikel, also kein geschriebener Text. Sondern es waren Bilder, eigentlich eine Form von medialer Augenzeugenschaft.
Es ist nicht ein einzelnes Bild ohne Kontext. Es gab eine politische Vorgeschichte zum Kosovo-Konflikt. Es hatte den Bosnien-Krieg schon gegeben, die Blauhelmsoldaten hatten wenige Jahre zuvor das Massaker von Srebrenica zugelassen, es gab die ganze wechselvolle, verwickelte, schmerzensreiche Geschichte der gewaltförmigen Auseinandersetzungen in dieser Gegend. Es gab auch die Vorgeschichte der umstrittenen Verhandlungen von Rambouillet und schließlich dann den NATO-Einsatz. Insofern waren diese Bilder nur Verdichtungen einer steten Eskalation, einer sich akkumulierenden Gewaltförmigkeit. Aber sie haben getriggert, sie riefen andere Bilder und Erinnerungen wach.
Sie haben gesagt, Sie seien da völlig unvorbereitet hingegangen. Als jemand, der das nie gemacht hat, stelle ich mir vor, dass man recherchiert, dass man versucht, die Lage abzuklären, dass man mit Leuten spricht, die dort gewesen sind, bevor man zu einer solchen Reise aufbricht.
Ja. Anders als Korrespondent:innen vor Ort, die sich über Jahre Wissen und Kontakte haben aufbauen können, sind Reporter:innen, die in eine unbekannte Gegend reisen, immer im Nachteil. Da gilt es, so viel Material wie möglich zu fressen (lacht), also zu lesen, zu sortieren, historische und aktuelle Entwicklungen nachzuvollziehen. Andererseits muss man sagen: Nicht alle informierten Korrespondent:innen finden sich dann in einem brutalen, unübersichtlichen Krieg zurecht. Da braucht es noch andere Eigenschaften oder Qualitäten. Aber dann stellen sich natürlich auch ganz praktische Fragen. Was steckt man ein? Was braucht man?
Woher weiß man das?
Gar nicht.
Aber irgendwann weiß man es.
Ja. Aber allein die technischen Bedingungen sind aus heutiger Perspektive kaum vorstellbar: 1999 mussten wir die Texte mit einem Satellitentelefon durchdiktieren an eine Sekretärin. Da gab es kein Netz, keine E-Mail. Man hoffte immer, dass gerade die richtige Sekretärin in der Redaktion in Hamburg Dienst hatte, Frau Hüttenberger, das war jemand, die sensationell Ruhe bewahrte und schnell schreiben konnte. Es waren damals auch mehrere Fotografen für den Spiegel im Kosovo unterwegs. Da musste im Wechsel immer einer zurückfliegen mit den Filmrollen. Allein ökologisch schon wahnwitzig. Aber ich meinte eigentlich mit Nicht-vorbereitet-Sein weniger die logistischen Fragen. Sondern wie man psychisch oder politisch nicht vorbereitet ist auf das, womit man konfrontiert wird. Gar nicht unbedingt die Gefahr. Die war hier weniger gegeben. Wir waren nicht im Kosovo während des Bombardements, sondern erst in Albanien. Aber das, womit man konfrontiert wird und was es so belastend macht, ist das Elend und die Verzweiflung. Als wir eintrafen in Kukes, im Norden Albaniens, waren kaum Hilfsorganisationen da. Die geflüchteten und vertriebenen Kosovo-Albaner hausten auf einer Wiese. Und wir haben privat bei Albanern gewohnt, die uns ihr Wohnzimmer und ihr Schlafzimmer freigeräumt haben und zu Verwandten gezogen sind. Letztlich war ich unvorbereitet in dem Sinne, dass ich nicht ahnen konnte, was für eine Zäsur das für mein Leben sein würde.
Worin bestand diese Zäsur?
Ich würde schon sagen, dass das eine Bruchstelle war. Danach war nichts mehr so wie vorher. Das Entsetzen darüber, was Menschen einander antun können, und die Herausforderung, ihnen gegenüber im Gespräch bestehen zu müssen. Es darf da nicht um ein rein instrumentelles Verhältnis gehen, in dem ich das Gegenüber nur als Quelle für Informationen wahrnehme. Sondern die Aufgabe besteht darin, respektvoll und aufmerksam mit einer Person umzugehen, die zuallererst ein Mensch ist. Oft sind das Gespräche mit Menschen, die über Jahre hinweg als Individuen negiert wurden, denen ihre Gleichwertigkeit abgesprochen wurde. Da geht es nicht um bloße Informationen, die berichtet werden und die es aufzunehmen gilt. Sondern da erzählt jemand, der es aberzogen werden sollte, sich als Mensch mit Rechten zu verstehen, da erzählt jemand, die vielleicht kaum glauben kann, dass es jemanden interessiert, da erzählt jemand von Verbrechen, die keine Spuren haben sollten und keine Erinnerung. In diesen Gesprächen werden auch Hoffnungen und Erwartungen in mich gelegt, das, was mir erzählt wird, auch anzuerkennen und zu bezeugen. Diese Gespräche muss man erst mal als Mensch bestehen – das ist die eigentliche Aufgabe, vor jedem Text, den man dann vielleicht schreibt.
Wie kommt man in solchen Situationen ins Gespräch? Ich stelle mir vor: Man kommt aus einer anderen Kultur. Man hat andere Referenzsysteme. Man hat andere Umgangsformen. Man spricht nicht dieselbe Sprache. Die Leute haben vielleicht jemanden wie Sie noch nie gesehen. Und sie haben die schlimmsten Dinge erlebt. Wie geht man in ein solches Gespräch hinein?
Das Wichtigste ist: nicht die Erwartung zu haben, dass jemand mit mir, einer Fremden, reden müsste. Es braucht Respekt vor Menschen, die nicht mit einem reden wollen. Man muss ein Gespür dafür entwickeln, wer braucht seine Ruhe, wer möchte wirklich gar nicht. Und ehrlich gesagt ist das auch keine Magie. Ich finde, so ein Grundrepertoire an Höflichkeit hilft schon. Erst einmal Raum zu lassen, zu sehen, ob Vertrauen entsteht, und das heißt, zuerst einmal Gespräche zu führen, ohne sich schon Notizen zu machen. Dass ich mich vorstelle, mich hinsetze und man sich kennenlernt. Und so eine Situation entsteht, in der man dann irgendwann vielleicht fragt: »Dürfte ich mir Notizen machen? Wären Sie einverstanden damit, dass ich mir was aufschreibe?« Es gibt in einer solchen Begegnung eine ganze Abfolge an Schwellen. Da muss man sich immer wieder versichern, ob das Gegenüber einverstanden ist, was jemand preisgeben und notiert sehen möchte. Nicht zuletzt, ob jemand mir seinen Namen oder ihren Namen sagen möchte. Natürlich gibt es die Option, dass jemand sagt: »Bitte schreiben Sie das nicht auf!« Oder: »Bitte ohne Namen!« Oder, oder, oder. Und ich würde sagen, der Großteil der Gespräche, die ich in Krisenregionen geführt habe, wurde nie aufgeschrieben. Der Großteil der Gespräche sind eben Begegnungen, in denen man zuhört und etwas miteinander teilt.
Und die dann in anderer Form in die Texte einfließen?
Manchmal. Aber oft blieben sie einfach in mir. Es gibt einen unsichtbaren Teil von Erfahrungen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in Texte geflossen sind. Manches bleibt außen vor, weil man immer auswählen muss, was wichtig ist oder eindrücklich. Manches bleibt außen vor, weil eine Situation zu flüchtig war und sich nicht aufzeichnen ließ. Und vieles bleibt außen vor, weil es schambesetzt ist, weil es jemanden entblößen würde. Ich weiß, es gibt diese Vorstellung, da laufen grobe, quotengeile Medienfuzzis durch Krisenregionen und bedrängen Menschen mit einer Kamera. Das hat zumindest mit dem, was ich gemacht habe, nichts zu tun. Auch der Fotograf, mit dem ich in dieser Zeit immer gereist bin, Sebastian Bolesch, war sehr behutsam. Sehr oft aber bitten Menschen: »Schreibst du das auf?«
Warum wollen sie das? Sie haben diese Problematik ja am Beispiel von Anna Achmatowa ausführlich reflektiert, die in einem Gefängnis in Leningrad von einer Frau mit blauen Lippen gefragt wurde: »Und Sie können dies beschreiben?«
Viele Menschen, die jahrelang ausgeschlossen oder eingeschlossen waren, die in einem Kontext leben mussten, in dem sie unterdrückt und gequält wurden, kennen nur noch diesen Zustand der permanenten Leugnung ihrer Humanität. Sie haben erlebt, dass sie nichts zählen, dass nicht zählt, was sie empfinden, dass ihre Körper nicht zählen, dass ihre Sexualität nicht zählt, dass ihre Ansprüche auf Eigentum nicht zählen …
Das ist ja auch etwas, das sie selbst vermutlich kaum begreifen können …
Ja. Dass solche Verbrechen geschehen können, ist zuallererst ein kognitiver Schock. Auch das kann man bei Primo Levi lernen. In Ist das ein Mensch? beschreibt Levi, wie er bei seiner Ankunft in Auschwitz orientierungslos vor dieser menschenverachtenden Ordnung steht. Er kann es nicht begreifen. Es gibt diesen ungarischen Mithäftling, der schon länger im Lager lebt, ich glaube, der hieß Steinlauf, der ihm rät: »Du darfst nicht versuchen, es zu verstehen.« Dieser Schock entspricht dem, was ich auch aus Kontexten in Krisengebieten kenne: dass Menschen etwas erzählen wollen, von dem sie selber gar nicht glauben können, dass es ihnen widerfahren ist. Sie wollen ein Gegenüber, das ihnen bestätigt, dass unrecht ist, was dort als rechtens galt. Es bedeutet, dass sie als Subjekte anerkannt werden, als Menschen, deren Erfahrungen etwas zählen, als Menschen mit einem Namen.
Haben Sie auch mit Leuten geredet, von denen Sie wussten oder ahnten, das sind eigentlich Verbrecher?
Ja. Manchmal weiß man das. Manchmal lässt es sich nur vermuten. Ich habe mal eine lange Reportage geschrieben, abgedruckt in Weil es sagbar ist, über einen der amerikanischen Folterer von Abu Ghuraib, Ivan Frederick. Da wusste ich es, denn ihm wurde der Prozess gemacht. Auch der, also einer, der Gewalt ausgeübt, nicht erlitten hatte, wollte sprechen und gehört werden. Aber aus anderen Motiven heraus. Er wollte nicht als Einzeltäter gelten, sondern er wollte die Strukturen beschreiben, in denen die Misshandlung irakischer Gefangener befohlen worden war. Und das hat mich interessiert. Ich wollte die Ordnung rekonstruieren, in der Menschenrechte außer Kraft gesetzt waren, in der es nicht nur normal war, Gefangene zu demütigen und zu quälen, sondern erwünscht und gefordert. Was es politisch so brisant machte: Die Darstellung von Ivan Frederick widersprach der des damaligen Verteidigungsministers Donald Rumsfeld. Rumsfeld hatte zu leugnen versucht, dass es systematisch Folter als angeordnete Praxis der ›Informationsgewinnung‹ im Krieg gegen den Terror gegeben hatte. Die Gewalt in Abu Ghuraib sollte unbedingt nur als das Fehlverhalten einiger isolierter Soldaten banalisiert werden. Ivan Frederick sprach auch, weil er nicht verstand, warum er auf einmal als schlechter Soldat angeklagt wurde, da er doch nur Befehle befolgt hatte. Trotzdem bekannte er sich im Prozess später als Einziger schuldig. Er hatte erkannt, dass er moralisch falsch gehandelt hatte.
Wenn wir über Gespräche reden mit Menschen, deren Erfahrungen sich nur unter bestimmten Umständen überhaupt verbalisieren lassen, kommt mir eine Szene aus Shoah von Claude Lanzmann in den Sinn. Ich habe den Film zum ersten Mal in voller Länge gesehen, als ich in Cambridge studierte. Er wurde in einem kleinen Kino gezeigt, nicht sehr gut gefüllt, und Lanzmann selber war da. Die meiste Zeit saß er im Foyer, kam aber alle paar Stunden in den Saal, ging nach vorne und schritt dann ganz langsam die Reihen ab, um die Leute im Publikum einzeln zu betrachten, während sie den Film schauten. Es gibt darin eine Szene in einem Friseursalon in Tel Aviv, wo Claude Lanzmann Abraham Bomba befragt, der in Treblinka in einem Sonderkommando ankommenden Frauen den Kopf scheren musste, bevor sie vergast wurden. Er erzählt es Lanzmann, während er einem Kunden die Haare schneidet. Er spricht sehr gefasst, er spricht sogar außerordentlich gefasst, doch dann kommt er an einen Punkt, an dem er nicht mehr weitererzählen kann. Es ist der Moment, da er sich erinnert, wie ein Transport mit Leuten eintraf, die er kannte. Er versucht sich zu beherrschen, kann aber nicht fortfahren. Lanzmann sagt, mit ruhiger Stimme: »Go on, Abe. You must go.« Doch Bomba kann nicht. Lanzmann beharrt: »You have to.« Bomba schüttelt den Kopf und sagt dann: »I can’t do it, it’s too horrible.« Lanzmann: »Please. We have to do it. You know it.« Bomba: »I won’t be able to do it.« Lanzmann, immer noch mit ruhiger Stimme: »You have to do it. I know it’s very hard. I know, and I apologize.« Als ich diese Szene sah, dachte ich unwillkürlich: Lass ihn! Bitte lass ihn! Es ist qualvoll. Doch schließlich fährt Bomba fort. Und nach der Episode hat man den Eindruck: Endlich konnte er es erzählen. – Finden Sie dieses Vorgehen legitim?
Mir steht es nicht zu, Claude Lanzmann zu kritisieren. Wenn Lanzmann sagt: »You have to«, dann spricht da jemand aus einer anderen Erfahrung heraus, als wenn ich als Nicht-Jüdin dasäße und sagte: »You have to.« Das Insistieren von Lanzmann, auch wenn es unangenehm wirkt und ich dazu nicht in der Lage gewesen wäre, entspringt einer anderen … Not. Wenn er sagt: »You have to«, klingt es nach einer Bitte. Wenn ich das sagte, würde es eher übergriffig klingen, es käme rücksichtslos daher. Wenn Lanzmann das sagt, ist es nicht: »Sie müssen das können«, sondern ich denke, es ist ein Appell an das, was sie gemeinsam haben als Aufgabe: »Wir haben die Pflicht, diese Geschichten zu erzählen.«
You have to do it, and we have to do it.
Genau. Und insofern ist das schon etwas anderes. Ich hoffe, ich bin nie übergriffig gewesen in meiner Arbeit. Aber natürlich kann niemand von sich wissen, ob nicht allein schon die eigene Präsenz das Gegenüber belastet. Und natürlich kann ich auch nicht sagen, wie oft es Menschen vielleicht nicht gut bekommen ist, mit mir zu sprechen. In der Situation hatte ich eher den Eindruck, dass es guttut. Und die Male, die ich wieder zurückkommen konnte an dieselben Orte, an denen ich schon mal war, und dann auch die Menschen wiedergetroffen habe, bestätigte sich das auch. Aber ich will nicht so vermessen sein, ein Gefühl dafür zu haben (zögert) …
Das wollte ich nicht unterstellen. Es hat mich einfach interessiert, was Sie zu der Szene bei Lanzmann denken, die mich selber so beschäftigt hat.
Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Aber ich würde gerne zu Lanzmann noch etwas anderes sagen, nämlich dass Lanzmann in seinen Erinnerungen Der patagonische Hase beschreibt, dass er sich Videos von Hinrichtungen angeschaut hat. Ich bin nicht ganz sicher, mit welchen er begonnen hat. Lanzmann erzählt, dass er sich diese brutalen Filme, die terrorisieren wollen, angeschaut hat, weil er fand, er müsse sich dem aussetzen. Und da war er schon über achtzig. Ich habe das gelesen und gedacht: »Meine Güte, er hat recht!« Wenn man sich mit diesen Fragen von Gewalt und Terror beschäftigt, wenn man diese Ideologien und ihre Methoden verstehen und letztlich verhindern will, muss man sich dem auch aussetzen. Dann habe ich mir das vorgenommen und mir diese absolut schauerlichen Filme von Al-Qaida und dem IS angetan. Aber ich würde das niemandem empfehlen. Ich habe darüber Jahre später auch geschrieben, in der Dankesrede für den Merck-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
Was hat Sie daran so beeindruckt, dass Lanzmann sich das anschaut?
Dass er sich dem als älterer Herr noch aussetzt. Nach so einem Leben hätte er auch sagen können: Ich will mir das nicht mehr zumuten. Man könnte sagen: Ich muss mir diese