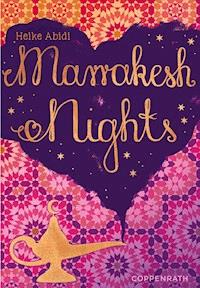9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Warmherzig, einfühlsam und voller Zuversicht: der wunderbare Wohlfühlroman der SPIEGEL-Bestsellerautorin
Johanna ist mit Anfang 50 plötzlich Witwe. Ihre Ehe war schon lange zerrüttet. Und doch fühlt sie sich plötzlich allein und verloren. Als sie die Trauerkarten durchgeht, findet sie ein leeres Notizbuch, das ihr eine frühere Freundin geschenkt hat. Sie hatte vergessen, wie gern sie als junge Frau Tagebuch geschrieben hat. Auch jetzt füllen sich schnell die Seiten, und Johanna merkt, dass sie neu anfangen muss, um sich selbst zu finden. Als Erstes will sie dieses schicke, aber seelenlose Haus loswerden, das ihr nie ein richtiges Zuhause war. Sie beauftragt einen Makler und ist vollkommen überrascht, als plötzlich ihr Exfreund vor ihr steht. Henry, mit dem sie vor ihrer Ehe eine kurze, aber intensive Affäre hatte. Henry, der sie an die junge, lebenslustige Frau erinnert, die sie einmal war – und der offenbar immer noch einen Platz in ihrem Herzen hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Sammlungen
Ähnliche
Johanna ist mit Anfang 50 plötzlich Witwe. Ihre Ehe war schon lange zerrüttet. Und doch fühlt sie sich nun allein und verloren. Als sie die Trauerkarten durchgeht, findet sie ein leeres Notizbuch, das ihr eine frühere Freundin geschenkt hat. Sie hatte vergessen, wie gern sie als junge Frau Tagebuch geschrieben hat. Auch jetzt füllen sich schnell die Seiten, und Johanna merkt, dass sie neu anfangen muss, um sich selbst zu finden. Als Erstes will sie dieses schicke, aber seelenlose Haus loswerden, das ihr nie ein richtiges Zuhause war. Sie beauftragt einen Makler und ist vollkommen überrascht, als plötzlich ihr Ex-Freund vor ihr steht. Henry, mit dem sie vor ihrer Ehe eine kurze, aber intensive Affäre hatte. Henry, der sie an die junge, lebenslustige Frau erinnert, die sie einmal war – und der offenbar immer noch einen Platz in ihrem Herzen hat …
Gemeinsam mit ihren Freundinnen schreibt HEIKE ABIDI ebenso witzige wie erfolgreiche Sachbücher, die eines nach dem anderen die SPIEGEL-Bestsellerliste stürmen. Doch auch mit ihren Romanen schafft sie es, ihre Leserinnen jedes Mal aufs Neue zu begeistern. Ihre Geschichten gehen ans Herz und sind die perfekte Leseauszeit vom Alltag.
Heike Abidi lebt mit Mann, Sohn und Hund als freie Autorin in der Pfalz und schreibt bereits an weiteren Büchern.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
HEIKE ABIDI
Für Glückist es nie zu spät
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angela Küpper
Umschlaggestaltung: bürosüd
Umschlagabbildung: www.buerosued.de
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25124-6V001
www.penguin-verlag.de
ERSTER TEIL Abschied
1 Ein Tag am Meer wäre definitiv schöner
Nun bin ich also Witwe, schoss es Johanna durch den Kopf. Witwe, was für ein seltsames Wort. Man spürte regelrecht, dass es uralte Wurzeln hatte. Sie dachte an ihre Großmutter, die schon verwitwet war, als Johanna zur Welt kam. Unwillkürlich tastete sie nach der Halskette mit dem Aquamarinanhänger, den sie von ihr geerbt hatte. Er fühlte sich wunderbar kühl und beruhigend an. Ihre Gedanken sprangen zu Witwe Bolte, dann kam ihr die Die lustige Witwe in den Sinn und seltsamerweise ihre frühere Lateinlehrerin, die sich selbst als »Witweee« bezeichnete, mit Betonung auf der zweiten Silbe.
Johanna fühlte sich nicht wie eine Großmutter, obwohl sie es vom Alter her durchaus hätte sein können, und auch nicht wie eine verschrobene Lateinlehrerin. Sie fühlte sich nur verwirrt, innerlich leer und von der Gesamtsituation überfordert.
»Du musst jetzt ganz stark sein«, raunte eine weißhaarige Frau mit stechend blauen Augen ihr eindringlich zu und umfasste Johannas Hände mit knochigen Klauen. Ihre Stimme war gedämpft, ihr Tonfall angemessen pietätvoll.
Johanna nickte, während sie fieberhaft versuchte, auf den Namen der Blauäugigen zu kommen. Es musste eine von Renés zahllosen Großtanten oder Urgroßcousinen sein, die sie maximal ein oder zwei Mal im Leben getroffen hatte.
Irgendwas mit T vielleicht. Thekla? Thea? Therese? Wie auch immer sie hieß, sie hatte sich bereits von ihr abgewandt und ein paar Rosenblätter in das offene Grab geworfen.
Was für eine unwirkliche Situation!
Johanna fühlte sich wie die unfreiwillige Hauptfigur eines schlechten Films, in den sie zufällig hineingeraten war. Doch es gab keinen Regisseur, der »Cut!« rief und die Szene beendete. Es gab nur sie, das Grab, in das gerade der Sarg mit Renés Leichnam hinabgelassen worden war, und unzählige Menschen in Schwarz, die ihr kondolierten.
»Mein allerherzlichstes Beileid.«
»Wenn ich irgendwas für dich tun kann …«
»Viel Kraft. Wir sind für dich da.«
Johanna kannte die wenigsten von ihnen. Eigentlich nur die Nachbarn. René war der Kontakt zu seiner Verwandtschaft nicht wichtig genug gewesen, um ihn zu Lebzeiten zu pflegen, doch ihnen war es offensichtlich ein Bedürfnis, Abschied für immer von ihm zu nehmen. Johanna selbst hatte weder Geschwister noch andere Angehörige. Von Annika einmal abgesehen, aber die war nicht gekommen.
Ihr Blick schweifte über die Schar der Anwesenden. War Renés Sippe wirklich so vielköpfig, oder was waren das alles für Leute, die sich einen halben Tag freigenommen hatten, um ihm die letzte Ehre zu erweisen? Und was sollte das überhaupt bedeuten – letzte Ehre? Noch so ein merkwürdiges Wort.
»Er war ein feiner Kerl.«
»Dieser verdammte Krebs.«
»Die Besten müssen viel zu früh gehen.«
»Wir werden sein Andenken immer in Ehren halten.«
Da war sie schon wieder, die vielbeschworene Ehre. Das mussten Kollegen aus der Klinik sein. Oder Netzwerkpartner aus einem seiner Businessclubs, die nach außen hin Wohltätigkeit vorgaben, in denen aber vor allen Dingen geklüngelt wurde. Von wegen: Wie du mir, so ich dir. Gemeinsam sind wir stark. Aber immerhin waren die elitären Herren gekommen. Und nicht wenige Frauen. Dankbare Patientinnen? Kolleginnen? Krankenschwestern? Wie viele von ihnen er wohl nackt gesehen hatte?
Zum Glück erwartete niemand von ihr, dass sie viel sprach. So beschränkte Johanna ihre Antworten auf ein leise hervorgepresstes »Danke« und einen Händedruck.
Was hätte sie auch sagen sollen? Etwa, dass sie nichts weiter spürte als eine tiefe Leere?
»Du bist so tapfer, Liebes.« Carina, ihre Nachbarin. Anwaltsgattin, Yogatrainerin, begeisterte Töpferkursbesucherin. Johanna ließ sich von ihr umarmen und hoffte, dass dieser Moment der Nähe schnell vorüberging. Sie mochte es nicht, von Leuten, die ihr im Grunde fremd waren, auf so vertrauliche Weise berührt zu werden. Wenn sie Carina am Bäckerwagen oder beim Heckeschneiden traf, nickten sie einander ja auch bloß zu oder wechselten ein paar unverbindliche Worte. Warum ausgerechnet jetzt etwas daran ändern, bloß weil sie nun allein war? Zum Glück dauerte die Umarmung nur geschätzte drei Sekunden, maximal vier.
»Das wird eine schwere Zeit für dich. Du musst die Trauer verarbeiten!« Vanessa, Ex-Frau von Renés ehemaligem Chefarzt, die seit der Scheidung wieder halbtags als Lebensberaterin arbeitete und für ihre bedeutungsschwangeren Betonungen bekannt war. Offenbar war ihre Praxis nicht ausgelastet, sonst würde sie eine Beerdigung nicht als Akquisemarkt missbrauchen. Oder war die Floskel zum Thema Trauerarbeit nichts als berufsbedingtes Gerede, das sie nun mal nicht abstellen konnte?
»Ich komme zurecht«, erwiderte Johanna sicherheitshalber. Nur um ein für alle Mal klarzustellen, dass sie an einer Therapie nicht interessiert war. Schon gar nicht bei Vanessa, die sicher vollauf damit beschäftigt war, ihre gescheiterte Ehe zu verarbeiten. Johanna erinnerte sich mit Grauen an diverse nächtliche Anrufe, bei denen Vanessa schluchzend und mit vom Merlot verwaschener Stimme ihr Leid geklagt hatte. Irgendwann hatte Johanna angefangen, vor dem Schlafengehen das Telefon auf lautlos zu stellen, und von da an war Ruhe gewesen. Hoffentlich blieb es auch weiterhin dabei! Nicht dass Vanessa glaubte, mit ihr einen Club der einsamen Vorstadtweiber gründen zu müssen.
»Ja, wirklich – ich komme sehr gut allein klar«, wiederholte sie und fuhr sich dabei mit dem Handrücken über die Augen, als müsste sie eine Träne abwischen. Nicht weil da tatsächlich eine gewesen wäre, sondern um ihrer Abfuhr die Schärfe zu nehmen und Vanessa zugleich daran zu erinnern, in welcher Situation sie sich gerade befand. Als trauernde Witwe hatte man schließlich Narrenfreiheit, oder?
Dann stand sie allein vor dem gähnenden Erdloch. Der blaue Junihimmel schien sie zu verhöhnen. Graues Novemberwetter wäre ihr angemessener vorgekommen. Oder wenigstens ein Sommergewitter.
Während ein Großteil der Beerdigungsgesellschaft in Richtung Parkplatz strömte, um den traurigen Anlass hinter sich zu lassen, machte sich eine deutlich kleinere Gruppe auf den Weg zu dem Café gleich gegenüber des Friedhofseingangs, wo das anschließende »Beisammensein bei Kaffee und Kuchen« stattfinden würde, zu dem der Pfarrer in ihrem Namen mit salbungsvoller Stimme eingeladen hatte.
Johanna hätte diesen Teil der Veranstaltung am liebsten geschwänzt, aber das würde sie jetzt auch noch irgendwie überstehen. Schließlich war sie eine Meisterin darin, sich zusammenzureißen und eigene Wünsche hintanzustellen.
Wenigstens hatte sie noch einen Moment für sich – jeder sah ein, dass Johanna als nächste Angehörige noch für ein paar Minuten allein am Grab bleiben wollte. Das war zwar lange nicht so gut, wie einfach in den Wagen zu steigen und ans Meer zu fahren, aber besser, als sich mit irgendwelchen Tanten und Cousinen von René darüber auszutauschen, wie tragisch ihr Verlust doch sei und wie traurig sie gewiss sein müsse.
Da stand sie nun also und blickte hinunter auf den Sarg. Genauer gesagt auf den Mahagoni-Qualitätssarg mit Messingbeschlägen aus der obersten Preiskategorie. Das hatte René noch selbst bestimmt, doch auch wenn er das nicht getan hätte, wäre kein anderes Modell infrage gekommen. Johanna kannte schließlich den erlesenen Geschmack ihres Mannes – und seine Vorliebe für Statussymbole. Ihn in einem Kiefernsarg zur letzten Ruhe zu tragen, wäre ihr schlichtweg falsch erschienen.
Johanna wollte sich gar nicht vorstellen, wie er da unten lag und nach und nach verrotten würde, von Würmern aufgefressen, bis irgendwann nur noch das Skelett übrig sein würde.
Keine tröstliche Vorstellung.
Aber sie war nicht auf der Suche nach Trost. Sondern nach Halt.
In den letzten Wochen und Monaten hatte sie einfach nur funktioniert. Mit Renés Pflege war sie rund um die Uhr beschäftigt gewesen. Dann waren die Formalitäten, die der Tod mit sich brachte, zu erledigen gewesen. Sie hatte die Annonce in Auftrag gegeben, mit dem Pfarrer gesprochen, die Trauerfeier organisiert, Blumen bestellt, die Grabstätte ausgesucht, den Anzug ausgewählt, den René im Sarg tragen sollte.
Und nun war es vorbei.
Um dieser Leere in ihrem Innern etwas entgegenzusetzen, versuchte sie, sich an die schönen Zeiten zu erinnern. Ihre erste Verabredung. Seinen unfassbar romantischen Heiratsantrag. Die Reisen. Annikas Geburt. Das Strahlen in seinen Augen, als er das kleine Wesen zum ersten Mal im Arm hielt …
Doch diese Bilder wurden überlagert von anderen, weniger schönen Erinnerungen. Vor allem die letzten Wochen waren die Hölle gewesen – für ihn, aber auch für Johanna selbst. Mit anzusehen, wie sein Körper ihn immer mehr im Stich gelassen hatte, und zu beobachten, wie wenig sein Geist dies akzeptieren konnte, hatte sie am Ende mehr Kraft gekostet als die eigentliche Pflege. Vor allem aber spürte sie, dass Mitleid das letzte Gefühl war, das sie für ihn übrighatte. Und nun stand sie vor seinem Grab und empfand rein gar nichts.
Vielleicht hätten ihr Tränen Erleichterung gebracht. Aber es kamen keine. Stattdessen fühlte sie sich, als läge ein Felsbrocken auf ihrer Brust.
Die Plätze im Café waren fast alle belegt. Sie hatte also gut geschätzt – etwa dreißig Personen, hatte sie bei der Reservierung angegeben. Auf den Tischen standen Kaffeekannen sowie Platten mit Hefekuchen – gefüllter Kranz, Streuselkuchen, Käsekuchen – und belegten Brötchen, die trotz Dekoration mit aufgeschnittenen Gürkchen und Eischeiben irgendwie lieblos gemacht wirkten. Jedenfalls verlockten sie Johanna nicht gerade zum Zugreifen. Was vermutlich daran lag, dass sie ohnehin keinen Appetit hatte – schon seit Tagen nicht, und heute ganz besonders.
Den Gästen ging es offensichtlich anders, denn sie langten beherzt zu. Johanna hatte noch nie begriffen, warum Beerdigungen manchen Leuten so auf den Magen schlugen, während andere, kaum dass die Tränen getrocknet waren, Berge von Kuchen in sich hineinstopfen konnten. Als müssten sie sich selbst beweisen, noch am Leben zu sein und einen funktionierenden Stoffwechsel zu haben.
»Hier ist ein Platz für dich frei!« Die blauäugige Großtante schwenkte die Arme über dem Kopf, als wäre sie eine Boden-Lotsin am Flughafen und Johanna eine Pilotin, der sie den Weg zur Startbahn wies.
Um nicht unhöflich zu sein und weil sie schließlich irgendwo sitzen musste, schob sich Johanna durch die Stuhlreihen und ließ sich auf den angewiesenen Platz sinken. Wenigstens war ihr inzwischen der Name ihres Gegenübers eingefallen: Großtante Thilda.
Während Johanna eine Tasse Kaffee hinunterwürgte, ließ sich Thilda darüber aus, was für ein cleveres Kerlchen René als Kind gewesen war. Und so drollig. Runde rote Wangen und diese herrlichen Löckchen.
Johanna musste an Renés eingefallenes, von der Krankheit gezeichnetes Gesicht denken, die chemobedingte Glatze, die dunklen Ränder unter den wimpernlosen Augen. Doch sie sagte nichts. Sie ließ Thilda reden und nickte nur hin und wieder mechanisch.
Wie gern hätte sie jetzt Annika an ihrer Seite gehabt. Und wie sehr sehnte sie sich danach, ihre Tochter stünde ihr näher. Aber das war ein anderes Thema … Dass sie heute nicht da war, hatte nachvollziehbare Gründe. Johanna sah ein, dass ihr Einsatz im Amazonasgebiet wichtig war und sie dort nicht so einfach wegkonnte. Und doch tat es weh.
Inzwischen hatte Thilda das Thema gewechselt und zählte die Krebserkrankungen in ihrem Umfeld auf. Der Postbote hatte ein bösartiges Magengeschwür, die nette Bedienung in der Bäckerei Leukämie und der Neffe der Schwiegertochter ihrer Nachbarin Stimmbandkrebs.
»Stimmbandkrebs! Das muss man sich mal vorstellen.« Vor lauter Entrüstung bebte Thildas Truthahnhals.
»Schlimme Sache«, sagte Johanna hilflos. Diese Frau überforderte sie definitiv. Wie lange dauerte so ein Leichenschmaus eigentlich? Sie hätte sich vorher informieren sollen. Musste sie als Gastgeberin bis zum Schluss bleiben?
»Frau Landgraf, was machen wir denn mit dem übrig gebliebenen Kuchen? Nehmen Sie den mit?«
Johanna fuhr zusammen. Sie hatte die Bedienung gar nicht kommen sehen.
»Nein, bloß nicht – ich …« Sie stockte. Es erschien ihr doch ein wenig taktlos, zu sagen, dass sie diesen Kuchen unter keinen Umständen in ihrem Haus haben wollte. »Ich vertrage kein, äh, Gluten«, beendete sie den Satz stattdessen. Eine Höflichkeitslüge. Darin war sie zwar nicht so gut, wie René es gewesen war, aber die gestammelte Antwort würde man heute sicher auf ihren Zustand schieben.
Zum Glück hatte die resolute Bedienung gleich einen Alternativvorschlag parat: »Soll ich ihn also auf kleine Päckchen verteilen und Ihren Gästen mitgeben?«
Sehr gute Idee! Zumal der Kuchen ihnen ja vorzüglich zu schmecken schien. Und vielleicht betrachteten sie es als Startsignal zum Aufbruch, wenn ihnen so ein Restepäckchen überreicht würde.
»Ja, bitte tun Sie das«, erwiderte Johanna erleichtert darüber, dass damit zumindest das Kuchenproblem gelöst wäre.
Wenig später verabschiedeten sich die ersten Gäste, und als ob sie damit eine Lawine losgetreten hätten, folgten auch alle anderen, sodass die Bedienung kaum mit dem Kuchenverteilen hinterherkam.
Mechanisch drückte Johanna Hände, ließ Umarmungen und aufmunternd gemeinte Phrasen über sich ergehen, dankte fürs Kommen, für die Kränze und Blumenbouquets, für die lieben Worte. Als sie versprach, Annika bei nächster Gelegenheit liebe Grüße auszurichten, wirkte sie zwar gefasst, doch innerlich zerriss es sie beinahe. Die Frage, warum ihre Tochter nicht gekommen war, stand im Raum. Glücklicherweise stellte sie keiner.
Schließlich blieben nur noch Johanna und der Bestatter übrig – ein kleiner Mann mit schütterem Haar und Spitzbauch, der sich so dezent verhielt, dass man ihn beinahe übersah. Johanna fiel erst jetzt auf, dass er überhaupt gewartet hatte.
Der Bestatter überreichte ihr das Kondolenzbuch, in das sich alle eingetragen hatten, die gekommen waren, und eine dicke Mappe voller Trauerkarten, die man bei ihm abgegeben hatte.
Mit feierlicher Miene und gesenkter Stimme informierte er Johanna darüber, welche amtlichen Vorgänge er bereits für sie übernommen hatte oder noch erledigen würde, zählte auf, was für sie noch zu tun blieb, und kündigte die Kostennote an, die er ihr demnächst zukommen lassen würde. Johanna brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass er damit die Rechnung meinte. Vermutlich war ihm dieser Ausdruck zu profan. Dabei war es doch völlig klar, dass niemand einen Job – und schon gar nicht diesen! – ausüben würde, wenn es nicht ums Geldverdienen ginge. Keiner erwartete von einem Bestatter, dass er seine Leistungen aus purer Betroffenheit verrichtete.
Wieder nickte sie, während er ihr ein Blatt überreichte.
Ihre To-do-Liste.
Danksagung, stand da. Erbschein beantragen. Grabstein aussuchen.
Was nicht da stand: Weiterleben. Und herausfinden, wie das geht.
Vorhin hatte Johanna noch vollmundig behauptet, sie würde schon zurechtkommen. Doch als sie jetzt im Auto saß, war sie da nicht mehr so sicher. Sie brachte nicht einmal den Motor zum Laufen! Bei den ersten beiden Versuchen würgte sie ihn ab wie eine blutige Anfängerin. Nachdem sie ein paarmal tief durchgeatmet hatte, klappte es endlich, und sie machte sich auf den Heimweg.
Der Briefkasten quoll beinahe über. Die Umschläge mit schwarzem Rand stopfte sie in die Mappe zu den anderen Trauerkarten, übrig blieben zwei Rechnungen und ein bisschen Werbung.
Als sie das geräumige Wohnzimmer betrat, überlief sie trotz der frühsommerlichen Wärme ein Schauer. Für einen Moment, der ihr wie eine halbe Ewigkeit vorkam, verharrte sie unentschlossen und starrte auf die Stelle, an der bis vor ein paar Tagen Renés Pflegebett gestanden hatte. Dann gab sie sich einen Ruck. Sie musste schließlich weiter funktionieren. Sich um sich selbst kümmern. Sich etwas Gutes tun – wer sonst sollte das übernehmen? Ein bisschen Wärme, etwas Musik und Ruhe, das wäre jetzt genau das Richtige.
Johanna legte Fleetwood Mac auf, dann bereitete sie sich eine Tasse Kräutertee zu und machte es sich auf dem Sofa bequem. Den Tee in Reichweite und die Mappe mit den Kondolenzschreiben auf dem Schoß. Sie zog die Umschläge hervor, öffnete einen nach dem anderen.
Seltsam, wie die Motive der Karten einander ähnelten. Betende Hände, Trauerweiden, abgeknickte Ähren, Kreuze, einsame Segelbote auf dem Meer, Wege, die ins Nichts führten – natürlich alles in pietätvollem Schwarz-Weiß. Darüber standen die typischen Floskeln wie »Aufrichtige Anteilnahme« oder »Herzliches Beileid«.
Was die handschriftlichen Inhalte der Trauerkarten betraf, gab es im Grunde drei Varianten: Manche hatten sich auf die typischen Beileidsbekundungen oder gar auf ihre Unterschrift beschränkt. Andere hatten Kalendersprüche abgeschrieben und dazu ein paar unbeholfene Zeilen ergänzt, die Johanna aufmuntern sollten. Einige wenige hatten wunderbare Worte gefunden, die in Zeiten der Trauer Trost spenden sollten. Johanna wusste, dass sie gut gemeint waren. Nur leider blieb die beabsichtigte Wirkung aus.
Erstaunlicherweise war den meisten Karten auch ein Geldschein beigelegt. Meistens ein Zwanziger, hin und wieder sogar ein Fünfziger, selten ein Zehner, noch seltener gar nichts.
Damit hatte Johanna überhaupt nicht gerechnet. Es war ihr fast unangenehm, diese Gaben anzunehmen, aber sie konnte sie ja schlecht zurückschicken.
Für späteren Grabschmuck, stand in einer Karte. Ach, so war das also gedacht. Aber Johanna hatte vor, das Grab mit einer Granitplatte vollständig abzudecken. Das Geld würde sie lieber spenden. Für Greenpeace oder Unicef oder Amnesty International oder … Ihr würde schon was einfallen.
Dennoch erschien es ihr wichtig, zu vermerken, wer welchen Betrag beigelegt hatte, daher holte sie Block und Kugelschreiber und legte eine Liste an. Und da sie schon mal dabei war, fügte sie auch hinzu, wer nur eine Floskel geschrieben und wer ein paar persönliche Worte des Trostes gefunden hatte. Erstaunlicherweise gehörte die sonst so wortreiche Großtante Thilda zu denjenigen, die sich für die Minimalversion entschieden hatten: Th. Berger stand da auf der ansonsten leeren Innenseite. Johanna hatte zuerst nichts mit diesem Namen anfangen können, aber der Absenderaufkleber auf dem Umschlag verriet ihr, wer sich dahinter verbarg.
Am Ende blieb nur noch ein Umschlag übrig. Er war deutlich dicker als die anderen und auch größer. Neugierig las Johanna den Absender. Sofort schlug ihr Herz schneller. Er war von einer Ines Falk. Etwa ihrer Ines? Der Ines, mit der sie früher, vor ihrer Ehe, so eng befreundet gewesen war! Sie hatten alles voneinander gewusst – jeden Wunsch, jeden Traum, jede noch so verrückte Idee.
Das Klingeln des Telefons riss sie aus den Gedanken. Johanna zuckte zusammen, rührte sich aber nicht von der Stelle. Sie wollte jetzt mit niemandem reden. Ihre Selbstbeherrschung hatte gerade ausgereicht, um die Beerdigung zu überstehen – und das ohne die Beruhigungstabletten, die der Hausarzt ihr aufgedrängt hatte.
Der Anrufbeantworter sprang an. Sie konnte mithören, was draufgesprochen wurde. Wenn es Annika wäre, würde sie das Gespräch doch noch schnell annehmen. Doch es war nur eine dieser angeblichen Gewinnbenachrichtigungen vom Band. Pure Abzocke. Zum Glück war sie nicht rangegangen.
Ihr Blick fiel auf den Umschlag, den sie noch immer in Händen hielt. Fühlte sich an wie ein Buch. Die gute Ines – sicher hatte sie auf irgendwelchen verschlungenen Wegen von Renés Tod erfahren und überlegt, womit sie ihrer alten Freundin eine Freude machen konnte. Vielleicht ein Schmöker, in dem man sich so richtig verlieren konnte. Oder ein packender Thriller, der einen derart fesselte, dass man alles andere um sich herum vergaß. Oder ein Ratgeber über Trauerarbeit. Oder über Achtsamkeit. Oder eine Sammlung mit frommen Sprüchen. Wobei – nein, das würde nicht zu Ines passen. Nicht zu der Ines, die sie gekannt hatte.
Andererseits hatte sie selbst mit der Johanna von damals auch nicht mehr viel gemein. Von der jungen, umschwärmten Frau, die sie einmal gewesen war, war kaum etwas übrig geblieben. Nicht die schlanke, fast knabenhafte Figur, nicht der lange Zopf, nicht die hochfliegenden Ziele, nicht die romantischen Träume.
Die Zeit heilte eben nicht nur Wunden, sondern entfernte einen auch von dem unerschütterlichen Optimismus der Jugend.
Johanna konnte sich zwar noch lebhaft daran erinnern, wie sehr sie sich auf eine glanzvolle Zukunft gefreut hatte. Sie war eine ehrgeizige Studentin gewesen, der eine große Karriere bevorstand. Sie hatte erfolgreich und glücklich werden wollen, und nichts, so hatte sie gedacht, würde sie davon abhalten, ihre Träume zu verwirklichen.
Was würde Ines von ihr denken, wenn sie sähe, was aus ihr geworden war? Ein Häufchen Elend. Eine Frau, die ihr Leben in den Sand gesetzt hatte und ein Ratgeberbuch wahrlich nötiger gebraucht hätte als einen Schmöker oder …
Was war das? Verblüfft zog Johanna das leinengebundene Büchlein aus dem Umschlag. Sie schlug es auf. Es enthielt nur leere karierte Seiten. Nicht blanko, nicht liniert – sie hatte schon immer karierte Blätter bevorzugt. Dass sich Ines daran erinnerte!
Eine Karte war beigefügt. Keine der üblichen schwarz-weißen Trauerkarten, sondern eine mit Sonnenblumenmotiv. Johanna schlug sie auf.
Meine liebe Jo,
ich wünschte, ich hätte dir früher geschrieben und nicht gewartet, bis es einen »Anlass« gibt – dazu noch so einen traurigen.
Ach Mensch, Jo, ich drück dich! Ganz fest! Ich weiß, du kannst es nicht leiden, jedenfalls nicht bei Fremden, doch ganz fremd bin ich dir ja (noch) nicht …
Auch wenn so viel Zeit vergangen ist, seit wir uns zuletzt gesehen haben, stehst du mir tief im Innern ganz nahe.
Aber heute geht es nicht um meine Gefühle, sondern um deine. Ich wünsche dir so sehr, dass du eines Tages wieder Glück und Freude empfinden kannst, auch wenn vorerst noch die Dunkelheit dominiert.
Du weißt ja, dass alles Erlebte direkt aus der Seele durch die Hand über den Kugelschreiber ins Tagebuch fließen muss, damit daraus etwas Neues, Schönes entstehen kann.
Du schreibst doch noch, oder?
Falls nicht: Dieses Büchlein ist alles, was du für einen Neuanfang brauchst.
Deine Ines
Und daneben, in einer anderen, eckigeren Handschrift: Tom.
Johanna schluckte. Bis eben war ihr gar nicht bewusst gewesen, wie sehr ihre einstige beste Freundin ihr fehlte. Oder besser: wie sehr sie Ines vermisste. Ihr wortloses Einander-Verstehen, das uneingeschränkte Vertrauen, diese unendliche Verbundenheit, der auch ein paar Jahrzehnte Abstand nichts anhaben konnten …
Andererseits kannte Ines die Johanna von heute doch gar nicht mehr. Das bewies allein schon ihr Geschenk. Sollte sie etwa wieder anfangen, Tagebuch zu schreiben? Nach all den Jahren? Nach allem, was passiert war? Sie war doch kein Teenie mehr, und auch keine Studentin … Damals hatten Ines und sie sogar ihre Tagebücher getauscht und die Geheimnisse der jeweils anderen gelesen.
Johanna war viele Jahre lang eine leidenschaftliche Tagebuchschreiberin gewesen. Eigentlich hatte sie schon von Jugend an eines geführt. Wann hatte sie damit aufgehört? Kurz nach der Hochzeit musste das wohl gewesen sein. Damals war es ihr irgendwie kindisch vorgekommen, so viele Worte über ihre Gefühle zu verlieren – zumal alles, wonach sie sich gesehnt hatte, gerade Wirklichkeit geworden war.
Rückblickend war das vielleicht ein Fehler gewesen. Denn ohne es zu bemerken, hatte sie es nicht nur aufgegeben, ihre Wünsche und Träume aufzuschreiben, sondern überhaupt zu wünschen und zu träumen.
Jetzt wusste sie nicht einmal mehr, wie das ging. Sie träumte nur noch nachts, und wenn sie sich überhaupt daran erinnern konnte, war das meist wirres Zeug.
Johanna hatte einmal gehört, dass es Leute gab, die ein Traumtagebuch führten. Sie fand das überflüssig. Genauso wie Traumdeutung. Alles Hokuspokus.
Aber ein Tagebuch zu führen, hatte ihr früher gutgetan. Es hatte dabei geholfen, die eigenen Gedanken zu sortieren.
Vielleicht hatte Ines ja recht, und es wäre jetzt genau das Richtige? Zumindest wäre das Schreiben eine Aufgabe. Und es würde ihrem Alltag Struktur geben. Zwei große Pluspunkte.
Andererseits – wo sollte sie anfangen?
Was sie heute erlebt hatte, wollte sie so schnell wie möglich abhaken. Und was sollte es bringen, die letzten Wochen, die von Renés Krankheit geprägt waren, wieder aufzuwärmen?
Und davor …
Nachdenklich starrte Johanna auf die leere erste Seite, die darauf wartete, von ihr gefüllt zu werden. Genau wie die Minuten, Tage, Wochen und Monate, die vor ihr lagen. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, was sie mit all der Zeit anfangen sollte.
Ines würde laut losprusten, wenn sie das hörte. Ausgerechnet Johanna, die früher immer geklagt hatte, dass ein Tag mit vierundzwanzig Stunden einfach zu kurz sei, wusste nicht, wie sie die Zeit rumbringen sollte.
Sie brauchte neue Aufgaben. Oder zumindest Hobbys. Ein Tagebuch zu führen, war immerhin besser als nichts.
Trotz ihrer Zweifel nahm Johanna einen Stift zur Hand, klappte das Büchlein auf und fing schließlich an zu schreiben.
Die ersten Zeilen gerieten etwas krakelig – in den letzten Jahren hatte Johanna eigentlich nur noch Einkaufszettel mit der Hand geschrieben. Ihre ehemals so schöne Schrift war eingerostet. Doch dann fühlte es sich auf einmal an, als hätte sie nie damit aufgehört …
Liebe Ines,
vermutlich bist du die Einzige, zu der ich jemals richtig ehrlich war – vielleicht sogar ehrlicher als zu mir selbst. Deshalb tue ich so, als würde ich diesen Eintrag an dich richten, auch wenn du ihn wohl nie lesen wirst.
Denn ich will schonungslos aufrichtig sein. Und fange auch gleich mit einem Geständnis an, das ich nie laut auszusprechen gewagt hätte:
Endlich bin ich frei.
Die letzten Wochen waren wahnsinnig schwierig. Einen todkranken Mann zu pflegen, den man nicht mehr liebt, ist eine zermürbende Erfahrung.
Vom heutigen Tag ganz zu schweigen …
Natürlich war ich fix und fertig. Aber ich habe nicht geweint. Weil ich mehr um die verlorenen Jahre trauere als um René.
Natürlich habe ich niemandem auf die Nase gebunden, wie es wirklich um unsere Ehe stand. Ich begriff es ja selbst lange nicht. Und dann kam diese Diagnose …
Warum ich dennoch bei ihm geblieben bin? Aus demselben Grund, warum ich den teuersten Sarg für ihn ausgewählt habe, den er sich gewünscht hat. Diesen Wunsch nicht zu erfüllen, wäre mir wie ein billiges Nachtreten vorgekommen. Das habe ich nicht nötig. Schließlich habe ich noch mein Leben – im Gegensatz zu ihm.
Und, na ja, es hat schließlich auch gute Zeiten gegeben. Jedenfalls in den ersten Jahren unserer Ehe. Da waren zum Beispiel Renés wunderbare Komplimente. Seine Begeisterungsfähigkeit. Seine Zielstrebigkeit, die mir anfangs so imponiert hat. Sein guter Geschmack. Seine selbstbewusste Haltung. Wenn er einen Raum betrat, schien er automatisch die Aufmerksamkeit aller auf sich zu ziehen. Im Gespräch gab er mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein – als existierte in diesem Moment für ihn niemand sonst auf der Welt.
Damals, in der Kennenlernphase, hat mir seine vollkommene Konzentration auf mich wahnsinnig geschmeichelt. Dann wurde mir klar, dass er allen so begegnete – auch seinen Patienten, die ihn deswegen vergötterten.
Nach und nach spürte ich, dass sich René im Grunde nur für einen Menschen wirklich interessierte: sich selbst. Für niemand anderen. Und am allerwenigsten für mich. Auch wenn er nach außen den vorbildlichen Ehemann spielte. Der mir Blumen schenkte und Komplimente machte. Doch die Blumen waren nichts weiter als eine Geste, und die Komplimente wurden seltener, bis er sie nur noch im Beisein anderer aussprach. Reine Imagepflege.
All das ging mir vorhin auf dem Friedhof durch den Kopf, bevor Renés Sarg hinabgelassen wurde. Doch ich wollte nicht schlecht von ihm denken. Nicht an seinem Grab. Das wäre unangebracht gewesen.
Jetzt bin ich allein zu Hause und kann denken, was ich will. Aber mein Kopf ist leer. Ich fühle mich nicht einmal erleichtert, obwohl ich das doch sein sollte.
Wenn du mein wirres Geschreibsel tatsächlich zu lesen bekämst, würdest du dich bestimmt wundern. Und mich fragen, warum zur Hölle ich es zugelassen habe, dass mein Leben so unglücklich wurde. Und warum ich aufgehört habe, René zu lieben.
Ehrlich gesagt könnte ich das aus dem Stand heraus kaum beantworten. Eigentlich müsste ich die Geschichte meiner Ehe von Anfang an erzählen, um mir selbst darüber klar zu werden, wie es so enden konnte. Aber nicht heute. Heute will ich nur noch die Decke über den Kopf ziehen und schlafen …
2 Der erste Tag vom Rest des Lebens
Johanna war schon immer eine Frühaufsteherin gewesen. »Ich bin nun mal die geborene Lerche«, hatte sie früher gewitzelt. Zum Beispiel in ihrer WG-Zeit mit Ines, wenn die am Wochenende erst gegen Mittag aus den Federn kroch, während Johanna selbst nach einer durchtanzten Nacht schon seit Stunden wach war und bereits die Hälfte ihres Lernpensums für diesen Tag geschafft hatte.
Aber das war nur die halbe Wahrheit. Denn eigentlich brachte weniger ihr Biorhythmus Johanna zum frühen Aufstehen, sondern vielmehr ihr Wunsch, das Richtige zu tun. Beziehungsweise das, was sie dafür hielt.
In der Schule waren es ihre Eltern gewesen, die ihr eingeimpft hatten, dass man es nur mit Fleiß und Disziplin zu etwas brachte. Als Studentin hatte sie diese Einstellung so weit verinnerlicht, dass sie gar nicht weiter darüber nachdachte, ob es wirklich ihr eigener Ehrgeiz war, der sie so kompromisslos sich selbst gegenüber machte.
Später, mit kleinem Kind, war an Ausschlafen ohnehin nicht mehr zu denken gewesen. Und irgendwann hatte sich ihre innere Uhr so daran gewöhnt, dass sie nicht einmal mehr einen Wecker brauchte, um spätestens gegen halb sechs von selbst aufzuwachen.
So auch an diesem Tag – dem Morgen nach Renés Begräbnis.
Im ersten Moment wusste Johanna nicht, wo sie war. Sie fror, und als sie nach der Nachttischlampe tastete, um sie einzuschalten, griff sie ins Leere. Wo normalerweise die Digitalanzeige ihres Radioweckers hätte leuchten sollen, blieb alles dunkel. Sie tastete weiter und erkannte, dass ihre Bettdecke verschwunden war. Und ihr Lieblingskissen ebenso – es war schmal und fest und schmiegte sich perfekt an ihren Nacken. Stattdessen fühlte sie ein kleines quadratisches Kissen aus grobem Stoff und eine glatte, kühle Unterlage dort, wo eigentlich das weiche Jersey-Spannbettlaken sein sollte.
Da begriff Johanna, dass sie wohl auf dem Sofa eingeschlafen sein musste. In Straßenkleidung! Das war ihr ja noch nie passiert.
Fröstelnd rappelte sie sich auf und streckte sich. Den Weg ins Badezimmer fand sie mühelos im Dunkeln. Ihre Blase drückte. Kein Wunder, nach dem vielen Tee.
Nachdem sie, wie jeden Morgen, noch vor dem Duschen die Zähne geputzt hatte, um den schalen Geschmack der Nacht loszuwerden, zog sie sich aus und stopfte ihre Kleidung in den Wäschekorb. Da fiel ihr Blick auf die Badezimmeruhr. Viertel nach fünf. Spontan beschloss sie, den Rest ihrer Morgentoilette auf später zu verschieben. Sie hüllte sich in den Bademantel und machte sich auf den Weg ins Schlafzimmer. Warum nicht noch ein halbes Stündchen ausruhen? Jedenfalls so lange, bis sie einigermaßen aufgewärmt war.
Als Johanna das nächste Mal erwachte, war es halb elf. Wenn sie dem Wecker trauen konnte. Was sie nicht tat. So lange hatte sie seit ihrer Lungenentzündung nicht mehr geschlafen! Damals war sie siebzehn gewesen und hatte vierzig Grad Fieber gehabt.
Doch wie groß war schon die Wahrscheinlichkeit, dass nicht nur der Radiowecker, sondern auch ihre Armbanduhr kaputt war? Sie sank zurück in ihr perfekt geformtes Kissen und zog die kuschelige Decke bis zum Hals.
Am liebsten würde sie ewig so liegen bleiben. Aber das ging natürlich nicht. Sie musste ja …
Doch dann fiel ihr nicht ein, wie sie diesen Gedanken vernünftigerweise beenden könnte. Denn im Grunde gab es nicht das Geringste für sie zu tun. Sie hatte keine Termine. Keine dringend zu erledigende Aufgabe. Niemanden, den sie pflegen oder um den sie sich kümmern musste. Wenn wenigstens Annika gekommen wäre …
Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens, schoss es ihr durch den Kopf.
Ihre unglückliche Ehe war vorbei, Renés Leidenszeit ebenso. Sie war frei. Es sollte ein Neubeginn werden. Und den hatte sie nun verschlafen! Doch was noch schlimmer war: Sie hatte keine Ahnung, wie dieser Neubeginn genau aussehen sollte. Sie hatte sich das nie konkret vorgestellt. Es wäre ihr pietätlos erschienen, sich auszumalen, wie ihr Leben nach Renés Tod weitergehen würde, während er im Sterben lag. Das würde sich alles von selbst fügen, hatte sie geglaubt.
Doch offenbar fügte sich gar nichts. Im Gegenteil – ihr Alltag geriet aus den Fugen. Das, was sie von Kindesbeinen an für ihren angeborenen Rhythmus gehalten hatte, funktionierte nicht mehr.
Sie musste nachdenken.
Energisch schlug sie die Decke zurück, doch statt sich aufzusetzen und die Beine aus dem Bett zu schwingen, blieb sie liegen und deckte sich wieder zu.
Nachdenken konnte sie schließlich auch im Liegen.
Und mit geschlossenen Augen.
Diesmal war sie nur für eine halbe Stunde eingenickt. Und jetzt siegte auch Johannas Disziplin. Sie konnte schließlich nicht den ganzen Tag im Bett herumliegen. Wo sollte das hinführen? Am Ende würde sie noch vollends verwahrlosen! Das durfte sie nicht zulassen.
Johanna zwang sich, aufzustehen, auch wenn sie sich noch erstaunlich müde fühlte. Obwohl sie fast zwölf Stunden geschlafen hatte! Oder vielleicht gerade deswegen?
Die heiße Dusche tat gut, das kalte Abbrausen danach ebenso. Dann siegte die Lust auf Koffein. Die Haare konnte sie auch anschließend noch föhnen. Barfuß, nur in Jeans und T-Shirt, betrat sie die Küche. Es war zwar schon fast Mittag, aber sie hatte Lust auf Frühstück. Mit einem großen Milchkaffee und einer Scheibe Toast mit Mirabellenmarmelade setzte sie sich auf den Balkon.
Die Sonne schien, und die Geranien blühten prachtvoll. Johanna atmete tief durch und stellte fest, wie angespannt sie doch war. Kein Wunder nach all dem, was sie hinter sich hatte. Wann hatte sie zuletzt die Muße gehabt, in aller Ruhe eine Hummel zu beobachten, die sich auf einer Blüte niedergelassen hatte, die Sonne auf ihrer Haut zu spüren und ansonsten gar nichts zu tun? Einfach den Moment genießen – hatte sie sich das überhaupt jemals erlaubt?
Johanna beschloss, so lange hier sitzen zu bleiben, bis ihre Haare trocken waren. Ganz ohne Föhn und Stylingbürste. Völlig egal, wie ungepflegt das womöglich aussah. Sie erwartete schließlich keinen Besuch.
Die Kaffeetasse war noch nicht ganz leer, da wurde sie jedoch schon unruhig. Müßiggang ist aller Laster Anfang, sagte die mahnende Stimme ihres Gewissens, die auf verblüffende Weise an die ihrer Mutter erinnerte. Müßiggang ist eine Kunst, widersprach eine andere Stimme. Das hatte Ines damals immer gesagt. Daran hatte sie schon ewig nicht mehr gedacht!
Ob Ines diese Kunst noch immer beherrschte? Johanna jedenfalls war nach wie vor ganz schlecht darin, wie sie nun erkannte. Unruhig rutschte sie auf der Teakholzbank herum, und statt mit den Gedanken im Hier und Jetzt zu bleiben, grübelte sie darüber nach, wie sie den Rest dieses Tages am effektivsten verbringen könnte. Sie sollte mal wieder die Fenster putzen. Oder die Danksagungsanzeige entwerfen. Oder einen der anderen Punkte von der To-do-Liste des Bestatters erledigen. Was war das noch gleich? Ach ja: den Erbschein beantragen und den Grabstein aussuchen. Aber für beides musste sie wohl erst einmal einen Termin vereinbaren, und das würde heute schlecht möglich sein, schließlich war es Samstag, da hatten weder Ämter noch Steinmetzbetriebe geöffnet. Sie nahm sich vor, diese Punkte gleich am Montag anzugehen und das auch entsprechend in ihrem Küchenkalender zu notieren, damit sie es nicht vergaß.
Sie stand auf, denn sie wollte das gleich erledigen. Das Geschirr nahm sie mit, um es in die Spülmaschine zu stellen. Dann entschied sie sich um und stellte nur den Teller hinein. Eine zweite Tasse Kaffee konnte sicher nicht schaden. Die würde ihr beim Nachdenken helfen. Denn eigentlich hatte sie sich ja vorgenommen, den Rest ihres Lebens zu planen – nicht nur die nächsten drei Tage.
Automatisch lief sie damit ins Wohnzimmer statt wieder hinaus auf den Balkon. Nur mal eben nach René sehen, dachte sie – und erstarrte. Für einen kurzen Moment hatte sie vollkommen vergessen, dass er nicht mehr da war.
Johanna blieb im Türrahmen stehen, den dampfenden Kaffee in der Hand, und ließ den Raum auf sich wirken, als sähe sie ihn zum ersten Mal.
Sie betrachtete die holzvertäfelten Wände und Türrahmen, die kalten Marmorfliesen, das schwarze Ledersofa, den edlen Glastisch, die teuren Landschaftsgemälde mit ihren protzigen Rahmen …
René war stolz auf seinen erlesenen Geschmack gewesen, und Johanna hatte gar nicht mitbekommen, wie nach und nach alles, womit sie für ein bisschen Behaglichkeit sorgen wollte, ausgemustert wurde. Das geblümte Sofa ihrer Oma hatte er auf den Dachboden verbannt, ihre bunten Webteppiche in den Keller verfrachtet, ihre Bücher in das sogenannte Lesezimmer, das im Grunde nichts weiter als ein Abstellraum war. Dekoartikel waren meist nach einer kurzen Duldungsphase erst in die Garage und dann in den Müll gewandert – René hatte Kerzenständer, Vasen und Familienfotos als Firlefanz bezeichnet. Irgendwann hatte Johanna ihre Verschönerungsversuche aufgegeben und dabei gar nicht gemerkt, wie unwohl sie sich in ihrem Zuhause fühlte.
Nun würde sie den Räumen ihren eigenen Stempel aufdrücken können.
Irgendwann. Heute nicht.
Aber immerhin war das doch schon mal ein Plan!
Ihr Blick fiel auf das Ledersofa, auf dem sie unfreiwillig die Nacht verbracht hatte, und das Tagebuch, das neben der Mappe mit den Trauerkarten auf dem Tisch lag.
Unglaublich, dass Ines sie dazu gebracht hatte, sich alles von der Seele zu schreiben. Sie erinnerte sich daran, gestern Abend Seite um Seite gefüllt zu haben. Doch womit eigentlich? Was war da, um es mit Ines’ Worten zu formulieren, direkt aus ihrer Seele durch die Hand über den Kugelschreiber in das neue Tagebuch geflossen?
Sie beschloss, ihr Geschreibsel vom Vortag zu lesen, und nahm das Büchlein mit hinaus auf den Balkon.
Doch kaum hatte sie sich draußen niedergelassen, klingelte es an der Haustür. Ausgerechnet! Kam da etwa noch mehr Post?
Seufzend und etwas verstimmt stand sie auf und ging wieder hinein, um zu öffnen.
»Hallo. Mein Ball ist in deinen Garten geflogen. Darf ich ihn holen?«
Vor ihr stand ein weizenblondes Mädchen mit Pferdeschwanz, Sommersprossen und Zahnlücke. Sie sah sich verstohlen um, als täte sie gerade etwas Verbotenes.
War das Ganze etwa eine Mutprobe? Aber machte man in dem Alter überhaupt schon so was? Sie war allerhöchstens sieben. Eher sechs.
»Ein Ball? Na, das ist doch kein Problem«, sagte Johanna. »Komm einfach mit.«
Sie ging voraus. Durch die Gräser und Sträucher, die den ziemlich lieblos angelegten Vorgarten zuwucherten, markierten bemooste Steinplatten einen Pfad ums Haus herum.
Im Garten stand ihr das Gras fast bis zu den Knien. Höchste Zeit, wieder einmal zu mähen!
»Siehst du ihn?«, fragte sie das Mädchen, das sich bereits suchend umschaute.
»Ja, dort drüben liegt er«, rief sie und trabte los. Tatsächlich – neben der Hecke zum Nachbargrundstück schimmerte es knallrot durch die Halme.
»Nächstes Mal darfst du ihn einfach holen gehen, das ist dann schon okay«, erklärte Johanna, als die Kleine mit dem Ball unterm Arm zurückkam.
»Aber Oma sagt, ich muss erst klingeln und fragen.« Dabei sah sie hinüber zum Haus der Wilkenbrinks, eines sehr zurückgezogen lebenden Paares um die sechzig, mit dem Johanna bisher höchstens ein paar Alltagsfloskeln gewechselt hatte, obwohl es schon seit gut fünf Jahren gleich nebenan wohnte. Sie hatte nicht einmal geahnt, dass sie Kinder hatten, viel weniger eine Enkelin. Die jetzt nachdenklich die Stirn runzelte. »Aber Oma sagt auch, bei dir darf ich eigentlich nicht klingeln, weil du gerade einen Verlust erlebt hast. Ich finde allerdings gar nicht, dass du verlustig aussiehst.«
Johanna musste unwillkürlich lachen. »Verlustig? So wie das Gegenteil von lustig?«
Das Mädchen nickte.
»Eigentlich gibt es dieses Wort so gar nicht«, erklärte Johanna. »Mit ›Verlust‹ meint deine Oma, dass ich gerade meinen Mann verloren habe.«
Erschrocken riss das Mädchen die Augen auf. »Verloren? Aber hast du denn nicht auf ihn aufgepasst?«
Nein, hatte sie nicht. Weder auf ihn noch auf sich und schon gar nicht auf ihre Beziehung.
»Das bedeutet, dass er gestorben ist. Er war sehr krank.«
Die Kleine wirkte erleichtert, als wäre ein Todesfall lange nicht so schlimm wie ein Verlust durch Unachtsamkeit oder chronische Unlust. Dann legte sie den Kopf schief, als müsste sie eine irrwitzig komplizierte Rechenaufgabe lösen.
»Also, ich glaube, wenn mir wieder mal der Ball rüberfliegt, werde ich auf jeden Fall klingeln. Du bist nett.«
Johanna lächelte. »Du auch. Verrätst du mir noch deinen Namen?«
»Darf ich eigentlich nicht. Oma sagt, Fremden darf man nie sagen, wie man heißt. Aber du wohnst ja gleich nebenan, also bist du nicht fremd. Ich bin Mia, und du?«
»Johanna. Freut mich sehr, Mia.«
Nachdenklich blinzelte Johanna in die Sonne. Was für eine ungewöhnliche Begegnung. Die kleine Mia hatte sie zum Lachen, aber auch zum Nachdenken gebracht. Irgendwie erinnerte sie Johanna an Annika, als die im gleichen Alter gewesen war. So zwischen Kindergarten und Grundschule. Naiv und aufgeweckt zugleich. Mit der Weisheit einer Ahnungslosen hatte sie Johanna immer wieder verblüfft. Genauso wie Mia.
Lächelnd wandte Johanna sich nun dem Tagebuch zu, das sie vorhin zur Seite gelegt hatte, und las noch einmal in aller Ruhe ihren spontanen Eintrag vom gestrigen Abend durch.
Was sie da geschrieben hatte, brachte sie ins Grübeln. Warum zur Hölle habe ich es zugelassen, dass mein Leben so unglücklich wurde … Wann war sie zuletzt so gnadenlos ehrlich gewesen? Sie konnte sich nicht entsinnen.
Nun musste sie sich entscheiden: Wollte sie einen Strich unter die Vergangenheit ziehen und einfach neu anfangen – oder sollte sie die Aufarbeitung durch gnadenlose Ehrlichkeit tatsächlich weiterführen?
In ihr sträubte sich alles dagegen, die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen. Denn das würde zwangsläufig bedeuten, alles, was sie bedrückt und geplagt und verletzt hatte, noch einmal zu durchleiden. Wollte sie das? Ganz sicher nicht!
Andererseits war ihr inzwischen klar, dass sie, wenn ihr Neuanfang gelingen sollte, wohl oder übel verstehen musste, was in ihrem alten Leben schiefgelaufen war.
Wo lag ihr Fehler?
Wann war sie vom Weg abgekommen?
Warum hatte sie das nicht bemerkt – oder jedenfalls erst, als es viel zu spät gewesen war?
Eins war klar: Ihr jüngeres Ich wäre entsetzt, wenn sie die Johanna von heute träfe.
Aber ging das nicht den meisten Menschen so? Wessen Leben verlief schon so, wie mit achtzehn erträumt?
Johanna schüttelte den Kopf, wie um sich selbst zu widersprechen. Das war kein Argument, das sie gelten lassen konnte. Schließlich ging es hier um sie, nicht um andere. Außerdem war sie, wenn sie die Sache objektiv betrachtete, vermutlich Weltmeisterin darin, einen Lebensweg minutiös zu planen und dann mit Anlauf in den Sand zu setzen. Der Unterschied zwischen dem, was sie angepeilt, und dem, was sie erreicht hatte, könnte größer kaum sein.
Und das ließ nur einen Schluss zu, ob es ihr nun gefiel oder nicht: Sie musste dieses Scheitern analysieren, damit es sich nicht wiederholte.
Sie war jetzt zweiundfünfzig Jahre alt. Kein junges Mädchen mehr, dem das Leben zu Füßen lag und das sich der Illusion hingab, alles sei möglich, machbar und erreichbar.
Aber sie war auch noch nicht zu alt, um sich eine neue Existenz aufzubauen, die sie glücklich machte. Oder zumindest ein Arrangement, mit dem sie zufrieden leben konnte. Einfach so weitermachen wie bisher, nur ohne René, das kam nicht infrage. Denn in ihrem alten Leben hatte sich alles um ihn gedreht. Worum würde sich ihre Zukunft drehen? Sie würde es herausfinden müssen. Und sie spürte, das konnte nur gelingen, wenn sie sich ihrer Vergangenheit stellte.
Entschlossen öffnete Johanna das Tagebuch, nahm den Kuli zur Hand und begann weiterzuschreiben.
Okay, fangen wir vorne an. Ganz am Anfang.
Ich war, wie die gelb- und rotstichigen Farbfotos aus den frühen Siebzigern zeigen, ein bezauberndes Kleinkind. Rotblonde Zöpfchen, ein breites Strahlen, riesige Knopfaugen, ein entzückendes Grübchen. Doch anders als René, dessen Großtante seine einstige Niedlichkeit sogar noch bei seiner eigenen Trauerfeier lobte und pries, verlor man in meiner Familie nicht viele Worte darüber. Ich hätte aussehen können wie eine Vogelscheuche, man hätte mich wohl nicht anders behandelt. Und zwar nicht, weil meine Eltern keinen Wert auf Äußerlichkeiten gelegt hätten, sondern weil sie einfach nicht zu Komplimenten und Liebesbekundungen neigten.
Für meinen Vater war ich ohnehin von Geburt an eine einzige Enttäuschung. Er hatte sich einen Sohn gewünscht. Einen Richard. Der eines Tages in seine Fußstapfen treten und die Schlosserei übernehmen sollte, die sich schon seit Ende des Ersten Weltkriegs in Familienbesitz befand. Ich kam dafür nicht infrage.
Gern geschehen, Richard! Dieses Schicksal habe ich ihm erspart.