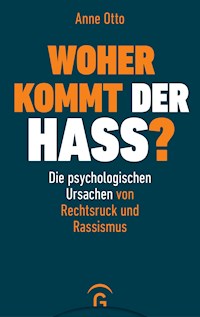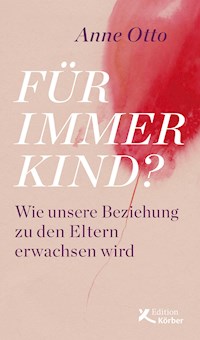
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Körber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Kaum eine Beziehung prägt uns so wie die zu unseren Eltern, egal wie alt wir werden. Nicht selten verbringen wir heute 50 oder 60 gemeinsame Jahre, viele mehr als je zuvor. Das stellt uns vor neue gesellschaftliche, aber vor allem individuelle Aufgaben: Wie gestalten wir diese lebenslange Beziehung für beide Seiten stimmig? Wie können sich erwachsene Kinder abgrenzen, wenn alte Eltern noch lange an ihrem Leben teilhaben? Sind Kinder ihren Eltern etwas schuldig – und umgekehrt? Anschaulich und psychologisch fundiert erzählt Anne Otto von den unterschiedlichen Lebenssituationen erwachsener Kinder und ihrer Eltern. Ausgehend von konkreten Beispielen beleuchtet sie die Entwicklungsaufgaben, die Eltern und Kinder gemeinsam zu lösen haben. Denn egal ob wir uns aus konfliktbeladenen Verstrickungen befreien wollen oder eine bestehende Verbundenheit pflegen: Erst wenn die Beziehung zu unseren Eltern geklärt ist, können wir wirklich erwachsen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Otto
FÜR IMMER KIND?
Wie unsere Beziehung zu den Eltern erwachsen wird
Inhalt
Für immer Kind?
1.Kapitel: »Sie ist so, ich bin anders.«Oder: Alle Phasen der Eltern-Kind-Beziehung gestalten
2.Kapitel: »Ich werde sie nicht selbst pflegen.«Oder: Eltern in der letzten Lebensphase begleiten
3.Kapitel: »Sie stehen mir im Weg!«Oder: Alte Eltern, immer jung?
4.Kapitel: »Das sind nicht meine Leute.«Oder: Schwierige und distanzierte Beziehungen
5.Kapitel: »Jeder hat einen Fuß in meiner Wohnung.«Oder: Leben im Mehrgenerationenhaus
6.Kapitel: »Weiter als Zugvögel leben.«Oder: Alte Eltern zwischen zwei Kulturen
7.Kapitel: »Ich will selbst entscheiden.«Oder: Hilfebedürftige Eltern begleiten
Für immer Kind?
Neulich im Supermarkt: In der Schlange an der Fleischtheke steht eine Greisin mit Rollator, neben ihr zwei gestylte Endfünfziger. Während die alte Dame mit der Verkäuferin tratscht, weist sie mit großer Geste auf ihre Begleitung: »Kennen Sie eigentlich meine Kinder? Sie besuchen mich heute aus München.« Ein verlegendes Hallo auf Seiten der Erwachsenen in Kostüm und Anzug, beide schauen auf ihre Schuhspitzen. Doch die Verkäuferin strahlt: »Ja, so was. Wie schön. Wie reizend.« Fehlt nur noch, dass sie den Kindern eine Scheibe Fleischwurst über die Theke reicht.
Die Szene ist ebenso alltäglich wie seltsam. Denn wir sind alle die Kinder unserer Eltern, bleiben es lebenslang. Vierzigjährige Familienväter, fünfzigjährige Topmanagerinnen oder sechzigjährige Umweltaktivisten werden selbstverständlich als Kinder bezeichnet, sobald sie sich in der Nähe ihrer Eltern aufhalten. Da können sie in anderen Zusammenhängen noch so erwachsen sein. Auch die Verbindungen und Verstrickungen aus Kindheit und Jugend werden dann oft wieder lebendig. Manchmal scheint es, als sei man durch einen Zeittunnel gefallen, hinein in eine Phase, in der die Gartenzäune höher waren und man an der Fleischtheke tatsächlich noch nicht über den Rand schauen konnte.
Dass es in den letzten Jahrzehnten immer häufiger Gelegenheiten gibt, über »erwachsene Kinder und ihre alten Eltern« zu sprechen, hat aber nichts damit zu tun, dass Erwachsene zu Beginn des 21.Jahrhunderts infantiler wären als früher. Nur brauchen wir dringend Worte, um die langjährigen familiären Beziehungen zwischen den verschiedenen Generationen in all ihren Facetten zu beschreiben. Denn in den letzten Dekaden hat sich in Familien etwas Entscheidendes verändert: Eltern und Kinder erleben heute mehr gemeinsame Jahrzehnte. Waren zu Beginn des 20.Jahrhunderts Väter und ihre Kinder im Schnitt 15 bis 20Jahre gemeinsam auf der Welt, sind es seit einigen Jahrzehnten 50 bis 60 gemeinsame Jahre, so eine Einschätzung des Berliner Sozialwissenschaftlers Hans Bertram.1 Eigentlich eine gute Nachricht. Denn sie zeigt, dass wir alle immer älter werden, in einer »Gesellschaft des langen Lebens«2 angekommen sind. Noch ein weiterer Früher-heute-Vergleich: Die fernere Lebenserwartung, also die Anzahl der Jahre, die Menschen über 60 durchschnittlich noch leben werden, beträgt heute für Frauen 25,9Jahre, für Männer 21,8Jahre. Vor 100 Jahren waren es um die zehn Jahre weniger.3
Wenn Sie diese Zahlen ein bisschen in Kopf und Herz bewegen, wird deutlich, wie viel sie mit uns und unseren Familien zu tun haben: Wir alle haben es nicht nur unter politischen oder wirtschaftlichen Aspekten mit der Veränderung der Bevölkerungsstruktur zu tun. Der demografische Wandel hat auch eine persönliche, psychologische, familiendynamische Dimension. Doch während wir die gesellschaftspolitische Tragweite der Langlebigkeit – von Altersarmut bis Pflegenotstand – bereits seit Jahrzehnten diskutieren, bleiben die psychosozialen Konsequenzen für Einzelne und Familien oft außen vor.
In familiären Beziehungen stehen wir vor einer neuen Entwicklung. Es gibt wenig Vorbilder, Erfahrungen, Best-Practice-Beispiele. Vor allem fehlt ein Bewusstsein darüber, dass Menschen heute viel älter werden und sich dadurch die Struktur und die Dynamik in Familien grundlegend ändert. Bisher unbekannte Fragen auftauchen. Neue Routinen fehlen bisher. Wie so oft bei gesellschaftlichen Umwälzungen haben viele das Gefühl, einsam vor bestimmten Schwierigkeiten zu stehen, für die sie keine sicheren Lösungen finden. Mittelalte und ältere Menschen überlegen dann im kleinen Kreis der Familie, wie sie damit umgehen könnten, dass ihre betagten Eltern sehr lange Begleitung und Pflege brauchen. Und das in einer Phase, in der sie selbst berufstätig sind, sich oft auch noch um ihre Kinder kümmern. Andere fragen sich, wie sie mit ihren sehr aktiven alten Eltern umgehen sollen, die den Staffelstab in keinem Lebensbereich an die nächste Generation weitergeben wollen. Und wieder andere realisieren, dass sich belastende Familienverhältnisse nicht dadurch auflösen, dass alte Eltern irgendwann sterben – sondern alter Zoff und Zweifel eine feste Größe im eigenen Leben bleiben.
Natürlich wird über diese Themen zum Teil auch in Freundeskreisen gesprochen. Vor allem bei Menschen zwischen 45 und 65Jahren. Manchmal wird der Umgang mit den alten Eltern bei Abendeinladungen beinahe zum Top-Thema. Gespräche über Urlaub, Job, Trends oder die Schoten der pubertären Kinder treten in den Hintergrund. Aufmerksam lauscht man den anderen, wenn sie erzählen, wie es deren Eltern gesundheitlich geht, was für Probleme es gibt und was das alles an Stress mit sich bringt. Auch wenn in solchen Runden manchmal Lösungsansätze greifbar werden und zum Teil witzige oder versöhnliche Anekdoten erzählt werden – Ratlosigkeit und Unsicherheit bleiben. Es fehlt eine Landkarte, eine Zeitkarte, ein Überblick, wie man alte Eltern begleiten kann, wie man sich abgrenzt und für sich selbst sorgt, welche Unterstützung angeboten wird und welche praktischen Ideen und Tricks es geben könnte, mit den vielen gemeinsamen Jahren umzugehen.
Dieses Buch kann Ihnen Orientierung geben. Es schlägt die Brücke zwischen den demografischen Entwicklungen und den psychologischen Fragen, die auf viele Familien zukommen. Es ist ausdrücklich für all die halbjungen, mittelalten und älteren Söhne und Töchter gedacht, die mit ihren alten oder sehr alten Eltern einen passenden Umgang finden wollen – praktisch, persönlich und seelisch. Falls Sie sich davon angesprochen fühlen: Willkommen im Club.
Um das Thema umfassend greifbar zu machen, habe ich zum einen Interviews mit erwachsenen Söhnen und Töchtern geführt, die mir überraschend offen erzählten, wie sie die Verbindung zu ihren immer älter werdenden Eltern erleben. Dazu ordne ich das Erzählte psychologisch ein, beleuchte häufig auftretende familiäre Muster, prototypische Entwicklungen, Wendungen und Schwierigkeiten. Außerdem gibt es konkrete Anregungen für den Umgang mit alten Eltern bei Konflikten, in der Pflege und Begleitung im Alter: Im ersten Kapitel erzählt die 54-jährige Elke, wie sich die Beziehung zu ihrer Mutter lebenslang immer wieder verändert hat und warum es für sie wichtig ist, ihre Mutter gelegentlich zu enttäuschen. Im zweiten Kapitel beschreibt eine Tochter, wie sie ihre demente Mutter über zehn Jahre lang begleitet hat und wie erschöpft sie dabei selbst oft gewesen ist. Das dritte Kapitel dreht sich um alte Eltern, die aktiv bis dominant sind, und wie man ihnen als erwachsenes Kind dennoch auf Augenhöhe begegnen kann. Das schwierige Thema belasteter Eltern-Kind-Beziehungen ist Gegenstand des vierten Kapitels. Hier erzählt Michael vom stets unterkühlten Verhältnis zu seinen Eltern. Ein Happy End gibt es nicht. Nur ein paar Vorschläge für eine angemessene Art, mit alten Eltern umzugehen, denen man sich entfremdet fühlt. Das oft idealisierte Wohnen einer Mehrgenerationenfamilie unter einem Dach ist Thema des fünften Kapitels. Und im sechsten Kapitel geht es um die Frage, wie Mütter und Väter aus der ersten Generation der sogenannten Arbeitsmigranten hierzulande gut alt werden können. In einem letzten, siebten Kapitel gibt Ihnen die eher alltägliche Geschichte von Jens und seiner Mutter Luise Impulse, wie Sie alte Eltern gut begleiten können, wenn diese irgendwann mehr Hilfe brauchen.
Am Schluss eines jeden Kapitels weitet sich der Blick auf die gesellschaftliche Perspektive. Der Fokus wird von der rein familiären Situation auf das größere Ganze gelenkt. Gesellschaftliche und zum Teil auch sozialpolitische Entwicklungen werden schlaglichtartig hervorgehoben. Denn es gibt immer auch Grenzen des eigenen Einflussbereichs. Es kann uns nicht reichen, dass jede und jeder sich den Schwierigkeiten der alternden Gesellschaft ausschließlich in der eigenen Familie stellt. Alles, was wir mit unseren Eltern erleben, findet in einem bestimmten Rahmen statt. Politik und Gesellschaft könnten diesen erweitern und uns so einen anderen Umgang mit dem Alter der Eltern ermöglichen. Außerdem bekommen Sie am Ende jedes Kapitels unter »Was kann ich selbst tun?« einige praktische Tipps und Anregungen zum Umgang mit Ihren Eltern und mit Ihren eigenen Fragen und Emotionen.
Vielleicht fragen Sie sich nun, was es Ihnen nützt, sich all diese Familienkonstellationen vor Augen zu führen? Was es Ihnen bringen könnte, die psychologischen Mechanismen in alternden Familien zu kennen und zu verstehen? Als Psychologin und Wissenschaftsjournalistin bin ich davon überzeugt, dass es sich für Sie lohnen kann, sich bestimmte gesellschaftliche Lagen bewusst zu machen und klar zu sehen, was all das mit Ihnen und Ihrem Leben zu tun hat. In Untersuchungen über die Wirkung von Coaching- und Beratungsprozessen wird beispielsweise immer wieder belegt, dass die Möglichkeit zur Selbstreflexion und zur Bewusstwerdung der eigenen Situation dabei hilft, anstehende Entwicklungen im Berufs- oder Privatleben mit mehr Zuversicht und Geschick zu meistern.4 Die hier geschilderten Beispiele regen diese Art von Reflexion konkret an und helfen Ihnen bei der Standortbestimmung und der Planung zukünftiger Schritte im Zusammenhang mit Ihren alten Eltern. Und für Ihr eigenes Leben in den nächsten Jahren.
Dabei gebe ich zu: Die Themen dieses Buches sind immer nur in einem bestimmten Zeitfenster des Lebens interessant. Sie betreffen die meisten Menschen etwa ein bis zwei Jahrzehnte lang – dann aber umso dringlicher. Davor und danach ist das Fenster geschlossen. Niemand hat Lust, sich bevor die Zeit reif ist, mit Vorsorgevollmachten, Treppenliften oder schwelenden Konflikten in der Familie zu beschäftigen. Und das ist auch verständlich. Wie phasengetrieben familiäre Themen sind, weiß jede und jeder, der eine Zeit mit Kleinkindern erlebt hat. Frischgebackene Eltern schlagen sich ständig mit Spezialproblemen herum. Egal, ob Säuglinge Zähne kriegen, Beikost ausspucken oder sich in Spielplatzraufereien stürzen, Kleinkind-Eltern finden das alles wichtig und hoch spannend. Außenstehenden Zuhörerinnen und Zuhörern, die gerade in anderen Lebensphasen stecken, entlocken diese Gespräche dagegen oft nur ein herzhaftes Gähnen. Doch für Eltern sind diese Fragen geradezu existenziell – sie suchen händeringend nach einem Schlüssel für einen passenden Umgang mit den vielen Neuerungen in ihrem Leben.
Es darf verraten werden, dass es für alternde Familien psychologisch gesehen eine Art Generalschlüssel gibt: Es ist ratsam, sich darum zu kümmern, selbst immer reifer und erwachsener zu werden. Phase für Phase. Und so auch die Beziehung zu den alten Eltern stabil und auf Augenhöhe zu gestalten. So wird es leichter, die Eltern als das zu sehen, was sie heute sind: Menschen, die schwächer werden und oft Unterstützung brauchen.
Für alle Ungeduldigen, die sich vor allem dafür interessieren, wie es praktisch gelingen kann, aus dem Für-immer-Kind-Modus herauszukommen und das Erwachsensein zu stärken, gibt es einen kompakten Praxisteil am Ende des Buches, ein Coaching in acht Schritten, das Ihnen hilft, die Beziehung zu den Eltern erwachsen werden zu lassen. Sie lernen dort nicht nur, alte Verstrickungen zu erkennen und zum Teil zu entwirren. Sie bekommen auch Anregungen, wie Sie mit Ihren alten Eltern lebendiger und klarer kommunizieren können als bisher. Und Sie reflektieren, wie Sie mit Phasen der Pflege- und Hilfebedürftigkeit umgehen können und wollen. Zwar ist dieses Buch kein Pflegeratgeber. Es schafft aber die psychischen Voraussetzungen, die oft belastenden letzten Phasen mit den eigenen Eltern gut zu gestalten.
Dass es sich lohnt, die Beziehung zu den Eltern immer wieder neu auszurichten, habe ich in den letzten Jahren selbst erfahren. Während ich für dieses Buch recherchierte, starb mein Vater, er wurde 80Jahre alt. In den letzten fünf Jahren vor seinem Tod haben wir mehrmals in der Woche telefoniert. Er ließ sich von mir fernmündlich kleine Computerlektionen geben – »Wie verschicke ich ein PDF?« –, wir besprachen Themen aus seinem Fachbereich, der Psychiatrie, oder lästerten über entfernte Bekannte, Prominente oder Politiker – »Gestern ›Hart aber fair‹ war wieder nur furchtbar!« Die selbstverständliche Vertrautheit, die in dieser Zeit entstand, war schön. Geschenkt wurde sie uns nicht. Mein Vater und ich haben beide aktiv versucht, ein Verhältnis auf Augenhöhe aufzubauen. Wer damit angefangen hat, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls haben wir nach einer jahrzehntelangen Phase, in der jeder seiner Wege ging, wir eher ein Mal pro Monat als drei Mal pro Woche miteinander sprachen, bewusst neue Routinen aufgenommen, verlässliche Zeiten, passende Themen gefunden. Und das Telefon als Medium entdeckt, obwohl mein Vater telefonieren hasste. In der Rückschau würde ich sagen: Als wir beide merkten, dass es ihm gesundheitlich schlechter ging, haben wir diesen Wendepunkt angenommen und genutzt, um unsere Beziehung zu intensivieren. Ich bin dankbar dafür, dass wir hier ein gutes Timing hinbekommen haben. Nicht immer ist mir das in engen Beziehungen gelungen.
Dass sich Familienmitglieder besonders in den letzten Lebensphasen wieder ein bisschen annähern, zeigen auch einige der Beispiele in diesem Buch. Allerdings bleiben in allen Familien Fragen offen und manche Probleme unlösbar. Allein deshalb liegt es mir fern, traditionelle Familienideale anzupreisen oder mich auf Blut-ist-dicker-als-Wasser-Schwärmereien einzulassen. Denn so bedeutsam Familienbeziehungen sind, so halte ich es dennoch für wichtig, innige Verbindungen immer auch über die Verwandtschaft hinaus zu suchen und zu pflegen. Auch Wahlverwandtschaften haben Kraft. Oft geben sie uns erst die Inspiration, bestimmte Probleme mit den Eltern anders zu sehen und zu lösen als bisher. Nachbarinnen, Partnerinnen und Best Friends Forever stärken uns, sehen in uns vielleicht die Seiten, die unsere Eltern an uns nie entdecken wollten. Eine Öffnung der Beziehungswelten über die eigene Familie hinaus empfinde ich jedenfalls als eine gesellschaftliche Errungenschaft der letzten Jahrzehnte. Für alle Generationen.
Und dennoch bleiben wir die Kinder unserer Eltern. Dieses Band zu fühlen und die Beziehung immer wieder stimmig zu gestalten kann uns heute vielleicht sogar leichter gelingen als in anderen Dekaden. Schließlich haben wir dafür ein paar Jahrzehnte mehr Zeit.
Anne Otto
Hamburg, im März 2022
1. KAPITEL
»Sie ist so, ich bin anders.«
Oder: Alle Phasen der Eltern-Kind-Beziehung gestalten
In der Beziehung zu den Eltern werden Nähe und Distanz ständig neu justiert. Einige Schlüsselfähigkeiten tragen aus Sicht der Psychologie dazu dabei, dass wir diese Beziehung konstruktiver gestalten können: Indem wir persönlich reifen, uns von kindlichen Sehnsüchten verabschieden und verstehen, dass die Eltern auch nur Menschen sind.
Die unterschiedlichen Phasen, die Eltern und erwachsene Kinder auf ihrem gemeinsamen Weg durchleben, reflektiert die 54-jährige Elke Ludwig5. Sie erzählt vom Verhältnis zu ihrer heute 82-jährigen Mutter Marianne. Da Mutter und Tochter nach eigenen Angaben »einen halbwegs guten Kontakt« pflegen, zeigt Elkes Schilderung die ebenso beiläufigen wie zwangsläufigen Entwicklungen, Abgrenzungen und Annäherungen zwischen den Generationen. Es wird deutlich, wie viele psychologischen Aspekte dabei eine Rolle spielen.
»Das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden.«
SØREN KIERKEGAARD, DÄNISCHER PHILOSOPHUND SCHRIFTSTELLER
Drei Kilometer Luftlinie – das ist der Abstand, den Elke Ludwig und ihre Mutter Marianne mindestens brauchen, um gut miteinander umgehen zu können. Ihr ganzes Leben lang wohnen beide Frauen schon in Düsseldorf, beide sind in der Stadt mehrfach umgezogen, beide sprechen sich ungefähr einmal in der Woche, seit Jahren und Jahrzehnten. Elke Ludwigs Kinder, mittlerweile beide erwachsen, hatten früher ebenfalls regelmäßig Kontakt zur Großmutter – Mittwoch war Marianne-Tag. So weit, so alltäglich. Doch auch wenn die Mutter-Tochter-Konstellation äußerlich harmonisch und gleichförmig wie ein langer, ruhiger Fluss wirkt, so ist die Beziehung doch von vielen Aufs und Abs geprägt. »Wenn ich mir mein Verhältnis zu meiner Mutter vor Augen führe, dann sehe ich ganz unterschiedliche Phasen«, sagt Elke Ludwig. Sie habe lange damit gerungen, der Beziehung einen guten Platz in ihrem Leben zu geben, habe eher Jahrzehnte als Jahre gebraucht, um sich von der Mutter zu emanzipieren, sich als eigenständiger Mensch zu fühlen. »Es ist vor allem ein Reflexionsprozess gewesen, in dem mir immer deutlicher wurde, wo Marianne und ich stehen, was ich im Leben brauche und in welchen Bereichen ich komplett anders bin als meine Mutter«, erzählt sie im Rückblick. Die Abgrenzungsphase war schwer, mit Schuldgefühlen und Zaudern verbunden. Wie ihre Mutter diese Zeit erlebte, kann Elke nicht genau sagen.
Nach dem Abitur und während ihrer Studienzeit sei die Beziehung jedenfalls noch eng gewesen. Anders als bei den Familien ihrer Freundinnen habe Elke ihre Mutter immer noch um Rat gefragt, habe diese auch in einem wilden Auslandsjahr in den USA während des Studiums stets angerufen, wenn sie Sorgen oder Liebeskummer hatte – und das zu einer Zeit, in der Telefonieren über Kontinente hinweg teuer war. »Meine Mutter war für mich in meinen Zwanzigern noch eine wichtige Vertraute. Vielleicht auch, weil sie alleinerziehend war, haben wir uns beide lange Zeit sehr stark aufeinander bezogen«, sagt die 54-Jährige. Die Idee einer »Mutter als beste Freundin« habe sie dennoch immer abgelehnt. »Wenn ich das nur höre, dann schaudert es mich. Das finde ich ungesund«, sagt Elke Ludwig und rutscht dabei aufgebracht auf ihrem Stuhl herum. Vielleicht vertritt sie diese Ansicht heute auch deshalb so vehement, weil sie selbst erfahren hat, wie schwer sein kann, eine gleichermaßen zugewandte wie harmoniebedürftige Mutter auch einmal abzuweisen.
Erst als Elke selbst Kinder bekam, mit einem Partner zusammenlebte, gab es konsequente Veränderungen: Plötzlich merkte sie, dass ihr Mariannes Interesse an ihr und ihrem Leben zu viel wurde. »Ich habe fast körperlich gespürt, dass meine Mutter mir zu nahekam, hatte keine Lust mehr, Zeit mit ihr zu verbringen, wollte die ewig gleichen Gespräche über das Wetter oder die Müllabfuhr nicht mehr führen. Wenn sie anrief, mich was fragte, Privates wissen wollte, habe ich auf stur geschaltet, blieb kurz angebunden«, sagt sie. In der Zeit, als die Kinder im Vorschulalter waren, trennte sich Elke von deren Vater, lebte allein und entwickelte ein starkes Bedürfnis, generell unabhängiger zu werden und herauszufinden, wer sie selbst ist und was sie ausmacht. Obwohl sie damals schon Mitte dreißig gewesen sei, habe sie sich ihrer Mutter gegenüber wie ein Teenager verhalten, habe sie regelrecht abblitzen lassen. »Ich habe kindische Sachen gemacht«, erinnert sich Elke. »Zum Beispiel versuchte meine Mutter oft, mit mir ein Gespräch über Mode zu führen und dadurch in einen vertrauten Kontakt zu kommen. Wenn sie zu mir sagte ›Ach, dieser Schal ist ja schön, wo hast du denn den her?‹ habe ich nur ganz knapp gesagt ›H&M‹, obwohl das gar nicht stimmte, und dann sofort geschwiegen. Um ihr zu verstehen zu geben, dass es mir vollkommen egal ist, was sie zu meinen Sachen sagt. Solche kleinen, bissigen Ablehnungen habe ich immer wieder eingestreut. Irgendwann hat Marianne verstanden, dass sich etwas in unserer Beziehung ändert, dass ich mich verändere.« Ihre Mutter habe sich dann zurückgezogen, habe nicht mehr so oft angerufen, sei auch nicht mehr spontan vorbeigekommen. Nur die Kinder waren weiterhin mittwochs bei der Oma. »Wenn der Bezug zu Juri und Karla in der Zeit nicht gewesen wäre, vielleicht hätten wir den Kontakt zeitweise ganz verloren«, sagt Elke. So hatten Mutter und Tochter wenigstens einmal in der Woche kurz miteinander zu tun, besprachen Formalitäten, tranken einen Tee. Auch Feste wie Weihnachten und Ostern hat die Familie alle Jahre wieder gemeinsam gefeiert. Es gab keinen Bruch. Doch es war ein bisschen so, als sei die Beziehung in einen Winterschlaf gefallen.
Jedes Jahr mehr Distanz
Abblitzen lassen. Nichts mehr erzählen. Nicht mehr zuhören. Was ein bisschen nach »Fifty ways to leave your mother« klingt, ist laut Untersuchungen aus der Entwicklungspsychologie eine typische Erscheinung im frühen Erwachsenenalter. Die Psychologieprofessorin Heike M. Buhl von der Universität Paderborn hat mehrere umfangreiche Forschungsprojekte zur Beziehung zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern durchgeführt. Nach der Auswertung verschiedener Fragebögen und Tagebucheinträge von 200 Familien mit erwachsenen Kindern zwischen 20 bis 45 Jahren fand sie heraus, dass die Ablösung vom Elternhaus ein Prozess ist, der sich oftmals über mehrere Jahrzehnte erstreckt. So deuten die Forschungsergebnisse von Heike Buhl und ihrem Team durchweg darauf hin, dass die Vorstellung, Kinder zögen um die zwanzig aus dem Elternhaus aus und würden durch diese Zäsur ad hoc unabhängig, veraltet ist bzw. ohnehin nie gestimmt hat. Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern verändert sich in kleinen Schritten, nach und nach entwickeln erwachsene Kinder mehr Eigenständigkeit und Eigensinn, werden autonomer. Dieser Prozess geht auch in späteren Lebensphasen des mittleren Erwachsenenalters weiter, wenn auch nicht mehr mit der gleichen Dringlichkeit.6 »Die Beziehung zwischen Kindern und ihren Eltern erfährt über die Lebensspanne hinweg wesentliche Veränderungen, bleibt aber wichtig«, schreibt Heike M. Buhl. Es sei hilfreich, diese Phasen im Blick zu haben. Denn so könne man erkennen, wann es ansteht, aus dem Elternhaus auszuziehen, finanziell komplett unabhängig zu werden oder den Eltern zu sagen, in welchen Belangen man ab jetzt nach eigenen Vorstellungen vorgehen wird und Wünsche der Eltern nicht mehr berücksichtigen kann.7
Es lohnt sich also, darauf zu schauen, ob die Beziehung zu den Eltern im Alter von 30, 40 oder 50Jahren stimmig erscheint, und sich klarzumachen, dass diese Verbindung auch dann wichtig ist, wenn sie zwischendurch für Jahre aus dem Fokus rückt. Denn Phasen, in denen die Beziehung zu den Eltern ruht oder sehr ritualisiert und distanziert verläuft, erleben viele erwachsene Kinder. Laut Heike M. Buhl verändert sich die Beziehung zwischen Kindern und Eltern in den Phasen nach dem Auszug aus dem Elternhaus Schritt für Schritt. »Eltern und Kinder begegnen sich oft erst mit etwa 45Jahren vollständig auf Augenhöhe«, sagt Buhl.8 Der Weg zur Selbstständigkeit dauert also länger als noch vor einigen Jahrzehnten. Die verlängerten Ausbildungszeiten, ein zugewandtes, wenig autoritäres Verhältnis zwischen Eltern und Kindern und auch die steigende Lebenserwartung spielen dabei eine Rolle.
Die Entwicklungspsychologin Heike M. Buhl ist jedenfalls sicher, dass der Begriff einer »Ablösung« von den Eltern heute grundsätzlich nicht mehr passt, denn die Beziehung wird nicht komplett gelöst. »Eher sprechen wir von Interdependenz, einer gegenseitigen Bezogenheit«, erklärt Heike M. Buhl. Natürlich verläuft diese nicht immer harmonisch. Laut entwicklungspsychologischen Studien gibt es in der Eltern-Kind-Beziehung im Erwachsenenalter letztlich zwei Tendenzen: Es geht darum, Verbundenheit und Nähe zu empfinden und aufrechtzuerhalten und gleichzeitig, die eigenen Ziele zu entwickeln und sich abzugrenzen. Buhl konnte auch messen, dass bei erwachsenen Kindern zwischen 20 und 45 die Abgrenzung immer stärker zunimmt, während die empfundene Nähe die ganze Zeit erhalten bleibt.9 Interessant ist dabei, dass für Eltern die Beziehung zu ihren Kindern oft irgendwann bedeutsamer wird als für den Nachwuchs. In zahlreichen Befragungsstudien beschreiben sie diese als eng oder sehr gut, während sich erwachsene Kinder etwas verhaltener, kritischer oder distanzierter äußern. Laut Entwicklungspsychologen wie Frieder R. Lang ist das damit zu erklären, dass Eltern viel mehr Mühe und Aufwand in die Beziehung zu den Kindern investieren und ihr deshalb mehr Bedeutung beimessen. Manchmal beschönigen sie sogar die Qualität der Verbindung. Das Phänomen wird in der Wissenschaft unter dem Stichwort intergenerational stake, also »Einsatz zwischen den Generationen« diskutiert.10
Väter und Mütter bewerten hierzulande familiäre Beziehungen jedenfalls in hohem Maß positiv. In aktuellen Umfragen des Deutschen Alterssurveys gaben beispielsweise 88Prozent der befragten Eltern an, eine enge Beziehung zu den eigenen Kindern zu haben. 78Prozent der Befragten berichteten außerdem, dass sie mindestens einmal die Woche Kontakt mit ihren erwachsenen Kindern haben.11 Doch auch die erwachsenen Kinder fühlen sich oft sehr verbunden. Heike Buhl berichtet: »Über die Innigkeit der Beziehung, die wir messen konnten, war ich überrascht.«12 Die Entwicklungspsychologin stellt dabei auch fest, dass sich Eltern und Kinder bemühen, das gute Verhältnis nicht zu gefährden, indem sie offenen Streit vermeiden. Zoff und emotionale Szenen behält man sich eher für Partnerschaften vor oder wenn es mit Kindern Konflikte gibt, die noch im Elternhaus leben.
Unter der Oberfläche der Eltern-Kind-Beziehung können also trotzdem größere Konflikte und Kränkungen schlummern. Wie viel Wut auf die Eltern auch noch im Erwachsenenalter bestehen kann, weiß jeder, der mit Freundinnen oder Bekannten über Erlebnisse aus der Kindheit spricht. Sehr oft geht es dann sofort um Altlasten oder Zerwürfnisse, um Momente, in denen Eltern wenig unterstützend oder sehr hart waren. Und auch in durchaus liebevollen Schilderungen von schrulligen oder nervigen Eigenarten alter Eltern schwingen manchmal Gekränktheit und Unverständnis mit. Auch hier zeigt sich eine seltsame Ambivalenz. Eine Gleichzeitigkeit von Nähe und Abstand. Manchmal auch von Liebe und Abneigung.
Nicht alles teilen
Bleibt also der Eindruck, dass die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern am ehesten mit der Statusmeldung »Es ist kompliziert« zu beschreiben ist. Für viele Menschen, auch für Elke Ludwig, ist die zunehmende Abgrenzung von den Eltern bei gleichzeitiger Wertschätzung kein einfaches Unterfangen, denn Altlasten und emotionale Verstrickungen haben oft viel Macht. Nicht jeder braucht professionelle Hilfe, um sich über Muster und Prägungen aus der Kindheit bewusst zu werden. Doch ein gewisses Maß an Klärung hilft oft weiter, um sich den eigenen Eltern gegenüber in den verschiedenen Lebensphasen stimmiger zu positionieren. Für Elke Ludwig war es enorm wichtig, ihren eigenen Weg zu gehen und die Beziehung zu ihrer Mutter bewusst in Frage zu stellen. In der Phase der Distanzierung machte sie einige Jahre lang eine Psychotherapie, in der sie lernte, sich bewusster und auf erwachsene Art gegenüber der Mutter abzugrenzen. Gerade zu Beginn habe die Therapeutin ihr signalisiert, sie dürfe ihrer Mutter nicht mehr alles erzählen, was sie in der Therapie bespreche, sie müsse sich ein bisschen zurückhalten, die neuesten Erkenntnisse und Empfindungen nicht mehr mit Marianne teilen. »Anfangs, als wir noch mehr Kontakt hatten, musste ich mich wirklich immer wieder selbst ermahnen, meiner Mutter nicht zu viel von mir zu erzählen. Nach und nach lernte ich das aber«, erinnert sich Elke.
Den bewussten Abstand zum Elternhaus erlebte sie als regelrechten Entwicklungs-Booster. Es seien intensive Jahre gewesen: Sie fand einen neuen Partner, reiste viel, wurde mutiger. Sie bekam beruflich mehr Verantwortung, wurde in ihren Fähigkeiten bestärkt. All das sei letztlich aber nur möglich gewesen, weil sie sich getraut habe, bestimmte Schuldgefühle ihrer Mutter gegenüber zu überwinden und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Elke betont in diesem Zusammenhang immer wieder, dass ihre Mutter allein für sie gesorgt habe. Dafür ist sie Marianne bis heute sehr dankbar. Lange habe sie Skrupel gehabt, den Kontakt zur Mutter zu reduzieren, denn Marianne wünschte sich ausdrücklich ein harmonisches Miteinander. Dennoch sei, Dankbarkeit hin oder her, irgendwann Abstand fällig gewesen. Marianne sei zwar bestimmt gekränkt gewesen, habe auf die Abgrenzung aber letztlich defensiv reagiert. »Meine Mutter ist eine Frau, die nicht gern streitet«, sagt Elke. »Das ist bis heute so: Wenn es einen Konflikt um irgendeine Kleinigkeit gibt und ich sie darauf anspreche, sagt sie meist ›Aber wir sind uns doch jetzt wieder gut, oder? Wenn wir uns jetzt verabschieden, sind wir doch nicht im Groll?‹ Das ist ihr sehr wichtig.« In der Distanzphase habe Marianne stumm gelitten, nicht viel gesagt, keine Vorwürfe gemacht. Das hat es Elke leichter gemacht: »Ich finde es mittlerweile ziemlich gut von meiner Mutter, dass sie nicht nachtragend ist, dass sie mir den Raum irgendwie gelassen hat, auch wenn ihr das wahrscheinlich schwergefallen ist«, sagt Elke. Sie selbst habe sich mit zunehmender Unabhängigkeit von ihrer Mutter immer stärker gefühlt. »Ich hatte schlicht etwas nachzuholen und habe diese distanzierte Phase später als andere durchlebt«, sagt Elke. »Es hat uns, glaube ich, beiden gutgetan.«
Raus aus Kindheitsgefühlen
Die persönliche Individuation und Autonomie-Entwicklung ist nicht nur eine wichtige Schlüsselkompetenz, um im eigenen Leben klarzukommen. Sie hilft auch, den Kontakt zu Vater und Mutter lebenslang konstruktiv zu gestalten. Darüber sind sich Psychologinnen und Familienforscher unterschiedlicher Fachrichtungen mittlerweile einig. In der Entwicklungspsychologie belegen zahlreiche Untersuchungen, dass erwachsene Kinder, die sich gut abgrenzen können, oft zufriedener sind. Corinne Nydegger und andere Entwicklungspsychologinnen vertreten die These, dass Eltern und Kinder einen Reifungsprozess durchlaufen müssen: Die sogenannte »filiale Reife« bestehe für die erwachsenen Kinder darin, sich emotional zu emanzipieren, die Eltern müssten dagegen loslassen, also »parentale Reife« beweisen.13 Bestenfalls erfolgt diese Entwicklung als Beziehungsprozess, doch es hilft auch, wenn erwachsene Kinder sich selbst aktiv um diese Art der Reife bemühen.
Psychotherapeuten weisen darauf hin, dass zunehmende emotionale Reife oft auch einen Abschied von alten kindlichen Rollen bedeutet. So legt der Autor und Therapeut Heinz-Peter Röhr in seinen Büchern dar, dass man kindliche Sehnsüchte nach Halt und Bestätigung loslassen muss, um von den Eltern unabhängiger zu werden. Es geht darum, für sich selbst einzustehen. »Gelungenes Leben hat häufig damit zu tun, dass man bereit ist, die eigenen Eltern zu enttäuschen«, sagt Röhr.14 »Das gilt für junge Erwachsene, aber auch in späteren Jahren spielt diese Bereitschaft immer wieder eine Rolle: Man entwickelt Lebensentwürfe, die anders sind, als es sich Mutter und Vater erhofft haben, entwickelt sich eigenständig weiter. Oder man enttäuscht elterliche Erwartungen nach Nähe, Hilfe oder Verbundenheit, die einfach nicht mehr passend sind.« Wer das Risiko eingeht, von den eigenen Eltern abgelehnt zu werden oder deren Wünsche nicht mehr unreflektiert zu erfüllen, ist also schon einen Schritt weiter auf seinem Weg zum Erwachsensein. Wer diesen Prozess durchlebt hat, kann sich den Eltern oft auch wieder annähern. Eine Garantie, dass die Beziehung dadurch besser wird, gibt es allerdings nicht.
Das Ausfüllen der Erwachsenenrolle erleichtert auch in späteren Lebensphasen die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern – etwa dann, wenn Vater oder Mutter pflegebedürftig werden. Das Konzept der filialen Reife wurde zunächst in der Gerontopsychologie mit Blick auf die Frage entwickelt, wie erwachsene Kinder lernen können, mit Demenz oder anderen ernsten Erkrankungen der Eltern zurechtzukommen. Es geht dabei letztlich um ein paar wenige konkrete Fähigkeiten, die erwachsenen Kindern den Umgang mit der letzten Lebensphase ihrer Eltern erleichtern. Wichtig ist die Haltung, von den eigenen Eltern emotional unabhängig zu sein und keine Versorgung mehr von ihnen zu fordern. Eine andere Kompetenz besteht darin, die Eltern mit Distanz zu betrachten, sie als die Menschen zu sehen, die sie heute sind und wer sie unabhängig von der Elternrolle noch sind. Und eine weitere wichtige Säule der Reife ist es, sich von den Eltern abgrenzen zu können, ohne dabei allzu große Schuldgefühle zu entwickeln. Es geht also um ein weitsichtiges, selbstbewusstes Standing als Erwachsener im eigenen Leben und im Kontakt mit anderen. Dass ein »Nach-Reifen« der erwachsenen Kinder die Kommunikation mit alten oder pflegebedürftigen Eltern erleichtert, zeigt etwa die Masterarbeit der Psychologin Anita Bisig-Theiler von der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften.15 In der Studie durchliefen Frauen zwischen 42 und 58Jahren ein Training, in dem sie lernten, ihren alten Eltern gegenüber erwachsener zu agieren. So lernten sie unter anderem, besser Nein zu sagen, Konflikte auf ruhige Art zu regeln und unangemessene Schuldgefühle weniger wichtig zu nehmen. In einer Befragung nach dem Training gaben viele Frauen an, nun besser mit ihren alten Müttern umgehen zu können, die sie zum Teil täglich unterstützten, zum Teil in regelmäßigen Abständen besuchten. Der Prozess der Individuation, der in der Adoleszenz beginnt und im Erwachsenenalter weitergeht, wird also in der letzten gemeinsamen Beziehungsphase noch einmal besonders wichtig. Eigentlich klar: Die Fähigkeit, kindliche Rollen komplett über Bord zu werfen, wird spätestens dann essenziell, wenn man die eigenen Eltern während einer Krankheit und letztlich in den Tod begleitet. Diese Art erwachsener Haltung kann man zwar gezielt durch ein Training üben. Es bietet sich aber an, sie über die verschiedenen Phasen der Eltern-Kind-Beziehung immer mal wieder neu zu justieren – und so nach und nach mehr zu reifen.
Zurück zu mehr Nähe
Elke Ludwig kannte das Konzept der filialen Reife vorher nicht. Die Beschreibung passt allerdings gut zu ihren eigenen Erfahrungen. Sie habe sich nicht bewusst von der Mutter zurückgezogen, sondern intuitiv. Je länger die distanzierte Phase andauerte, umso souveräner fühlte sich Elke. In dieser Zeit lebte sie nicht nur in einer neuen Partnerschaft, sondern entwickelte auch enge, fast familiäre Freundschaften: »Menschen, die ich mir ausgesucht und mit denen ich bis heute viel Kontakt habe«, sagt Elke. Sie und ihre beiden Kinder sind mit einer Familie befreundet, die drei Kinder haben. Irgendwann erkrankte der Mann an Krebs. Elke stand der ganzen Familie während zweier Chemotherapien zur Seite, sie und ihre Kinder waren auch in die Gestaltung der letzten Lebensmonate des Freundes eingebunden. In dieser Zeit hat sich auch ihre Haltung gegenüber Krankheit, Tod und Sterben verändert. »Mir war vorher nicht klar, dass ich ein Mensch bin, der Krisen gut aushalten kann, sie machen mir nicht so viel Angst«, erzählt Elke. Wenn sie sich selbst beschreiben müsste, würde sie mittlerweile sagen, dass es eine ihrer Stärken ist, auch mit großem Leid gut umgehen zu können. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass das auch für mich einer der Gründe war, Elke für ein Interview anzufragen: Wir kannten uns flüchtig aus einer Fortbildung und mir war aufgefallen, wie weise sie gelegentlich auf Unvorhergesehenes blickte und wie reflektiert und gelassen sie dabei wirkte.
Denn eins ist bedenkenswert: Auch wenn die Forschung schon seit einigen Jahren weiß, wie viele Phasen der Neupositionierung es in der Beziehung von Eltern und Kindern gibt – den meisten von uns sind diese Mechanismen nicht bewusst. Ein klarer und reflektierter Blick auf die Beziehung zu den Eltern findet oft nicht statt. Man kommt im Alltag schlicht nicht dazu, steckt in tausend Kleinigkeiten. In der medialen und terminlichen Reizüberflutung ist es kaum möglich, den Überblick zu bewahren. Erschwerend kommt hinzu, dass es meist Krisenzeiten sind, in denen die Beziehung zu den Eltern wieder in den Fokus rückt. »In Übergangsphasen wird für viele Erwachsene greifbar, wie wichtig die Beziehung zu den eigenen Eltern immer noch ist«, sagt Entwicklungspsychologin Heike M. Buhl.16 Oft sind es Phasen, in denen Eltern fragiler oder krank werden, häufig stehen aber auch die erwachsenen Kinder vor Schwierigkeiten, erleben Arbeitslosigkeit oder stehen vor dem Scherbenhaufen einer Beziehung. Auch wenn es dann besonders schwer ist, besonnen und konzentriert zu bleiben – es lohnt sich. Oft ergeben sich für Familien dann Möglichkeiten, die Beziehungen zueinander stimmiger zu gestalten als bisher.
Auch bei Elke Ludwig zeichnete sich eine solche Entwicklung ab: Als Marianne nach vielen Jahren des sporadischen Kontakts schließlich mehr Hilfe brauchte, fiel es Elke nicht schwer, sich ihr erneut anzunähern. »Das war eine Zeit, in der meine Mutter schon deutlich über 70 und seit einigen Jahren pensioniert war, ich spürte bei ihr eine Unsicherheit, die es früher nicht gab«, sagt Elke. Diese hat sich in den letzten Jahren verstärkt, die Mutter ist mittlerweile 82Jahre, gehört nun laut Definition von Demografinnen zur Gruppe der Hochaltrigen. In den letzten Jahren fühlte Marianne sich in dem gemieteten Reihenhaus überfordert, wurde fahrig, klagte über Einsamkeit und darüber, dass sie mit dem Haushalt nicht mehr allein klarkäme. Elke schaute nun häufiger im Haus der Mutter vorbei, half beim Aufräumen und Einkaufen. Vor zwei Jahren organisierten die beiden auf Wunsch der Mutter einen Umzug in ein Seniorenstift, nicht weit von ihrer bisherigen Adresse entfernt. Dieser Umzug war ein Prozess, bei dem Elke ihre Mutter über Wochen begleitete. »Ich habe mir bei der Arbeit vier Wochen frei genommen. Marianne und ich haben gemeinsam alles so organisiert, dass es für sie gut passte«, sagt Elke. Das sei schön gewesen, Mutter und Tochter hätten gemeinsam einen Modus gefunden, wie man mit den unzähligen Büchern und Zeitschriften, Kleidungsstücken, Möbeln und Bildern verfahren wolle. Man war sich rasch einig, was die Mutter mitnehmen konnte und was sie lieber weggab. Mehrfach fuhr Elke nur mit einer Kiste Bilder oder mit drei Stühlen in das Apartment im Seniorenstift, weil sie merkte, dass es ihre Mutter beruhigte, wenn sie die Kontrolle behielt und bestimmte Dinge, die ihr wichtig waren, schon in den neuen Räumen wusste. »Die Geduld und auch das Verständnis, das ich für Marianne aufbringen konnte, haben mich selbst überrascht«, sagt Elke, »vor zehn Jahren hätte ich das nicht geschafft.« Sie spürt heute selbst, dass die zunehmende eigene Reife ihr ein gutes Gefühl im Umgang mit ihrer Mutter gibt. Natürlich sei sie zwischendurch auch mal aus der Haut gefahren, etwa wenn die Mutter überall die großzügigsten Trinkgelder gab, die sich kaum mit ihrer Rente vereinbaren ließen, aber das seien nur kurze Irritationen gewesen.