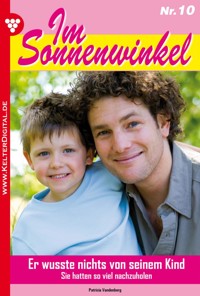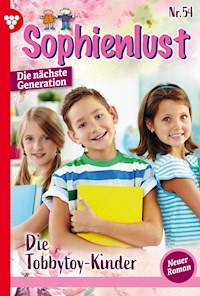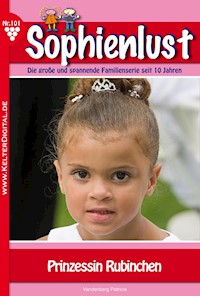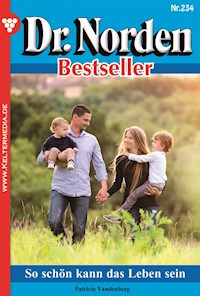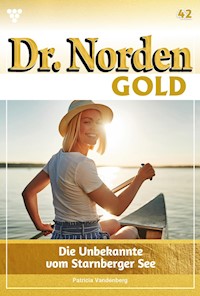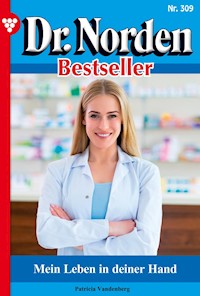Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dr. Norden Aktuell
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Nun gibt es eine Sonderausgabe – Dr. Norden Aktuell Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten. Mehr als 1.000 Romane wurden bereits geschrieben. Für Dr. Norden ist kein Mensch nur ein 'Fall', er sieht immer den ganzen Menschen in seinem Patienten. Er gibt nicht auf, wenn er auf schwierige Fälle stößt, bei denen kein sichtbarer Erfolg der Heilung zu erkennen ist. Immer an seiner Seite ist seine Frau Fee, selbst eine großartige Ärztin, die ihn mit feinem, häufig detektivischem Spürsinn unterstützt. Auf sie kann er sich immer verlassen, wenn es darum geht zu helfen. Die Nebel wollten nicht weichen an diesem unfreundlichen Novembertag, und deshalb geriet auch der Verkehr immer wieder ins Stocken. Dr. Daniel Norden brauchte für seine Krankenbesuche noch mehr Zeit als sonst. Nun hatte er den letzten und dreizehnten noch vor sich. Er war nicht abergläubisch, doch den Besuch bei Maria Hellbrügg hatte er sich deshalb bis zuletzt aufgehoben, weil er wusste, dass Schwester Rosmarie sich seiner Patientin angenommen hatte, und dass diese bestens versorgt wurde. Seit zwei Monaten waltete die Gemeindeschwester Rosmarie Brink mit einer Aufopferung ohnegleichen ihres nicht leichten Amtes. Hin und wieder begegnete ihr Dr. Norden, wenn er Hausbesuche machte, aber weitaus öfter hörte er lobende und dankbare Worte über sie. An ihr hatten selbst die schwierigsten Patienten nichts auszusetzen. Ihn freute es. Er hatte seine Bedenken gehabt, ob sie mit diesen oft so unduldsamen Kranken zurechtkommen würde, als er sie kennenlernte, da sie einen eher verschlossenen Eindruck machte, doch ihre Taten zählten wohl mehr als Worte. Sie erfreute sich schon nach kurzer Zeit großer Beliebtheit. Als er vor der alten und sehr gepflegten Villa aus seinem Wagen stieg, öffnete ihm Schwester Rosmarie schon stürmisch die Tür. Offensichtlich hatte sie auf ihn gewartet. Etwas mehr als mittelgroß, schlank und biegsam, stand sie vor ihm. Ihr schmales ernstes Gesicht zeigte einen besonders sorgenvollen Ausdruck. Das lange rötlich-braune Haar war hochgesteckt und kringelte sich nur über der klaren, hohen Stirn in kleinen Löckchen. »Es geht Frau Hellbrügg gar nicht gut, Herr Doktor«, sagte sie leise. »Sie hatte eine schlechte Nacht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Norden Aktuell – 40 –
Gemeindeschwester Rosmarie
Patricia Vandenberg
Die Nebel wollten nicht weichen an diesem unfreundlichen Novembertag, und deshalb geriet auch der Verkehr immer wieder ins Stocken. Dr. Daniel Norden brauchte für seine Krankenbesuche noch mehr Zeit als sonst. Nun hatte er den letzten und dreizehnten noch vor sich. Er war nicht abergläubisch, doch den Besuch bei Maria Hellbrügg hatte er sich deshalb bis zuletzt aufgehoben, weil er wusste, dass Schwester Rosmarie sich seiner Patientin angenommen hatte, und dass diese bestens versorgt wurde.
Seit zwei Monaten waltete die Gemeindeschwester Rosmarie Brink mit einer Aufopferung ohnegleichen ihres nicht leichten Amtes. Hin und wieder begegnete ihr Dr. Norden, wenn er Hausbesuche machte, aber weitaus öfter hörte er lobende und dankbare Worte über sie. An ihr hatten selbst die schwierigsten Patienten nichts auszusetzen.
Ihn freute es. Er hatte seine Bedenken gehabt, ob sie mit diesen oft so unduldsamen Kranken zurechtkommen würde, als er sie kennenlernte, da sie einen eher verschlossenen Eindruck machte, doch ihre Taten zählten wohl mehr als Worte. Sie erfreute sich schon nach kurzer Zeit großer Beliebtheit.
Als er vor der alten und sehr gepflegten Villa aus seinem Wagen stieg, öffnete ihm Schwester Rosmarie schon stürmisch die Tür. Offensichtlich hatte sie auf ihn gewartet.
Etwas mehr als mittelgroß, schlank und biegsam, stand sie vor ihm. Ihr schmales ernstes Gesicht zeigte einen besonders sorgenvollen Ausdruck. Das lange rötlich-braune Haar war hochgesteckt und kringelte sich nur über der klaren, hohen Stirn in kleinen Löckchen.
»Es geht Frau Hellbrügg gar nicht gut, Herr Doktor«, sagte sie leise. »Sie hatte eine schlechte Nacht. Sie verzehrt sich in Sorge um ihren Sohn.«
»Hat sie noch immer keine Nachricht von ihm?«, fragte er leise flüsternd. Rosmarie schüttelte verneinend den Kopf.
»Sie hat in den Nachrichten gehört, dass wieder so viel passiert ist«, murmelte sie. »Es ist ja auch schrecklich genug.«
Ja, es war schrecklich. Daniel Norden hatte nicht gedacht, dass es im fernen Afrika so schlimm kommen würde, als sein junger Kollege Dr. Martin Hellbrügg die Entscheidung getroffen hatte, für drei Jahre an ein Urwaldhospital zu gehen, um sein Können und auch seinen Willen zu helfen, gleich richtig unter Beweis zu stellen. Tragisch war es für Maria Hellbrügg gewesen, dass dann ihr Mann so plötzlich starb und Martin dort nicht alles stehen und liegen lassen konnte. Nun bangte sie auch um das Leben ihres einzigen Sohnes.
Sie selbst hatte gerade eine schwere Grippe überwunden. Zwei Wochen hatte sie in der Klinik gelegen, aber dann hatte sie sich nach ihrem gemütlichen Heim gesehnt, obgleich sie noch sehr geschwächt war. Aber es war auch in ihrem Fall gut, dass man die Gemeindeschwester Rosmarie hatte, denn Hauspflegerinnen waren dünn gesät, und es gab zu viele Schwerkranke, die sich gar nicht allein behelfen konnten.
Maria Hellbrügg war keine wehleidige Frau. Wenn sie litt, litt sie still. Sie zeigte nun, als Dr. Norden ihr Zimmer betrat, ein tapferes Lächeln.
»Bei Wind und Wetter und Nebel, immer unterwegs«, sagte sie mit ihrer leisen, angenehmen Stimme. »Und spät ist es auch schon wieder. Ihre Frau wird sich sorgen, lieber Dr. Norden.«
»Jetzt bin ich ja bald zu Hause«, erwiderte er, während er ihren Puls fühlte.
»Der hat es aber eilig«, stellte er beiläufig fest. »Sie müssen sich noch mehr schonen.«
»Es ist nur die Angst um Martin«, erklärte sie mit erstickter Stimme. »Ich fühle, dass etwas ist mit ihm, etwas Schlimmes.«
»Das machen diese Nachrichten, liebe Frau Hellbrügg«, sagte Dr. Norden. »Sie dürfen sich nicht damit quälen.«
»Wenn ich doch nur eine Nachricht von ihm hätte«, sagte sie bebend.
»Die Post wird lange unterwegs sein«, meinte er tröstend, und für sich dachte er, dass man schlechte Nachrichten meist schneller bekam als gute. Aber solche Andeutung wollte er doch lieber nicht machen. Er hoffte, dass sein junger Kollege gesund zurückkehren würde zu seiner Mutter, denn die drei Jahre waren nun bereits abgelaufen.
*
Dr. Martin Hellbrügg dachte zu dieser Stunde auch daran, dass er eigentlich schon mehr als eine Woche in der Heimat sein könnte, aber es sah nicht so aus, als würde er die Heimreise in absehbarer Zeit antreten können. Sie saßen fest in ihrem Hospital, das von den Aufständischen umzingelt war. Wie es weitergehen sollte, wusste niemand, und er wollte darüber auch gar nicht nachdenken. Viel Zeit zur Besinnung blieb den drei Ärzten sowieso nicht, die hier die Kranken und Verwundeten zu betreuen hatten. Nur die Hoffnung blieb ihnen, dass sie von irregeleiteten Söldnern verschont bleiben würden.
Dr. Hellbrügg stand am Bett einer jungen Frau, die sich in Fieberträumen hin und her wälzte, stöhnte und ab und zu angstvoll aufschrie.
»Kai, wo ist Kai?«, stöhnte sie jetzt wieder, und nun riss sie ihre Augen auf, nachtdunkle, schreckensvolle Augen.
»Er wird bald kommen, Leila«, sagte Martin Hellbrügg sanft. »Er wird bestimmt kommen.«
»Du sagst es nur, Tino«, flüsterte sie, »du sagst es immer wieder, schon so lange.«
Was sollte er sonst sagen? Dass niemand wusste, wo sich Kai Candell aufhielt, ob er überhaupt noch lebte?
»Ich habe doch schon mein Baby verloren«, schluchzte Leila. »Sie können mir doch Kai nicht auch nehmen.«
Martin zog es das Herz zusammen. Leila hatte eine Frühgeburt erlitten. Das Baby war nicht zu retten gewesen, und es stand zu fürchten, dass auch sie die folgenden Tage nicht überstehen würde, wenn nicht ein Wunder geschah. Das Wunder, dass Kai kommen würde. Aber wie sollte er kommen? Er wusste ja nicht einmal, dass sich seine Frau im Hospital befand. Und wenn er sie im Hause suchte, in seinem Hause, würde er dieses leer und verwüstet finden.
Martin war mit den Candells befreundet. Kai war leitender Ingenieur in einer Diamantenmine und seit zwei Jahren mit der reizenden Farmertochter Leila verheiratet. Sie hatten sich wohlgefühlt in diesem Land, und sie hatte Martin das Heimweh vergessen helfen. Nun aber war alles anders gekommen. Nun herrschte hier das Chaos.
Dr. Martin Hellbrügg gab Leila ein Beruhigungsmittel und dachte dabei sorgenvoll, dass die Medikamente nicht mehr lange reichen würden, um die Patienten noch zu versorgen. Auch die Lebensmittel waren zusammengeschmolzen. Die Lage schien aussichtslos.
Leila war eingeschlafen. Martin ging zu seinem Kollegen Dr. Brown. Der dunkelhäutige Arzt blickte ihn aus müden Augen an. »Bei Tagesanbruch landet ein Hubschrauber, Tino«, sagte er heiser. »Pack deine Sachen.«
»Wieso?«, fragte Martin bestürzt.
»Ihr werdet geholt. Du und die sechs Weißen, die noch hier sind.«
»Und du?«
»Ich bleibe selbstverständlich.«
»Dann bleibe ich auch.«
»Nein, du musst die Patienten betreuen. Wird Leila es schaffen?«
Martin zuckte die Schultern. »Was ist mit Percy?«, erkundigte er sich.
Dr. Brown legte die schmalen Hände vor sein müdes Gesicht. »Er bleibt. Er hat nichts mehr zu verlieren. Laura ist vor einer Viertelstunde gestorben.«
Martin senkte den Kopf. Ein Zucken lief über sein Gesicht. »Ich bin weder ein Feigling, noch ein Deserteur«, sagte er leise.
»Nein, du bist beides nicht. Ich befehle dir, die Patienten zu begleiten. Ich bin hier der Boss. Es gibt keine Widerrede. Ich hoffe, dass ihr durchkommt.« Er machte eine kleine Pause. »Und ich hoffe, dass es ein Wiedersehen gibt, Tino.«
*
Maria Hellbrügg trank den Tee, den Rosmarie ihr gebracht hatte. Ihre Hand zitterte so stark, dass sie kaum die Tasse halten konnte.
»Würden Sie heute Nacht bei mir bleiben, Rosmarie«, fragte sie leise. »Ich fühle mich so entsetzlich einsam.«
»Ich bleibe gern«, erwiderte Rosmarie.
»Sie sind sehr lieb. Ich bin egoistisch, aber …«, sie geriet ins Stocken und wischte sich schnell ein paar Tränen aus den Augenwinkeln.
»Nein, Sie sind keineswegs egoistisch«, erwiderte Rosmarie. »Auf mich wartet heute niemand mehr.«
»Aber Ihre Tage sind ausgefüllt mit der Fürsorge für andere, und Sie brauchen wirklich Ihre Ruhe. Aber ich will Sie nicht beanspruchen. Ich möchte nur nicht allein sein im Haus. Ich bin so unruhig.« Sie verschlang die Hände ineinander. »Sie können in Martins Zimmer schlafen. Ich lüfte es jeden Tag. Das Bett ist frisch bezogen.«
Und sie wartet jeden Tag auf ihren Sohn, dachte Rosmarie. Unwillkürlich wanderte ihr Blick zu der großen Fotografie, die auf dem Sekretär stand. Ein junges Gesicht, ein lächelnder Mund, helle Augen, dunkles Haar, eine unverkennbare Ähnlichkeit mit der Mutter gab dieses Bild wider.
»Sie haben keine Angehörigen in der Nähe, Rosmarie?«, fragte Maria Hellbrügg verhalten.
»Nein«, kam die leise Antwort.
»Haben Sie wenigstens eine nette Wohnung bekommen?«
»Ja, ich bin zufrieden.«
»Sie könnten hier wohnen, das Haus ist so groß.«
Überrascht sah Rosmarie Frau Hellbrügg an, denn eigentlich war auch Maria bei aller Freundlichkeit immer sehr zurückhaltend. Nun lächelte sie flüchtig. »Ich glaube, wir würden uns gut verstehen«, sagte Maria.
»Ich bin den ganzen Tag unterwegs«, sagte Rosmarie. »Morgen früh um sieben Uhr muss ich bei den Gröbners sein und die Kinder versorgen. Die Mutter ist in der Klinik, der Vater muss früh zur Arbeit.«
»Wie viele Kinder sind das?«, fragte Maria.
»Drei. Die beiden Großen gehen zur Schule, die Kleine in den Kindergarten. Liebe Kerlchen.«
Es war das erste Mal, dass Rosmarie über andere Pfleglinge sprach. Maria betrachtete das junge und doch schon so gereifte Gesicht jetzt ziemlich gedankenvoll.
»Und dann geht es den ganzen Tag so weiter?«, fragte sie.
»Wo man halt gebraucht wird«, antwortete Rosmarie.
»Sie sind noch so jung«, meinte Maria sinnend.
»So jung auch nicht mehr«, lächelte Rosmarie, und Maria bemerkte einen schmerzlichen Zug in diesem Lächeln. »Sechsundzwanzig«, fuhr Rosmarie ganz rasch fort.
Ob sie eine Enttäuschung erlebt hat, fragte sich Maria, aber sie war zu taktvoll, um eine diesbezügliche Frage an Rosmarie zu richten.
»Sie brauchen jetzt Ruhe«, sagte sie, sich aufraffend.
»Hier ist es wundervoll ruhig«, stellte Rosmarie fest. »Ich hoffe, dass Sie gut schlafen.«
»Es ist ein gutes Gefühl, nicht allein zu sein. Sie werden sich vielleicht fragen, warum ich niemanden ins Haus genommen habe, aber es ist dann so schwer, jemanden wieder vor die Tür zu setzen, und ich dachte doch immer, dass Martin eine Frau mitbringen würde. Obwohl, man weiss ja nicht, ob sie dann Wert darauf legen würde, mit der Schwiegermutter unter einem Dach zu leben. Es geht einem so viel durch den Sinn, und man weiß nicht, wie man es richtig macht.« Das sagte sie mehr zu sich selbst, verhalten, stockend und gedankenverloren, und dann fügte sie leise hinzu: »Ich habe mit meinem Mann fast dreißig glückliche Ehejahre in diesem Hause verbracht. Die Erinnerungen sind lebendig.«
*
Auch bei Dr. Norden wurden Erinnerungen lebendig an jene Zeit, als Martin Hellbrügg sein Studium beendet hatte und sich entschloss, zu Dr. Brown nach Afrika zu gehen. Auch Dr. Norden hatte den afrikanischen Arzt anlässlich eines Kongresses kennengelernt und in ihm einen vornehmen, warmherzigen Menschen und großen Arzt, dem ganz andere Möglichkeiten geboten wurden, sein Wissen und Können unter Beweis zu stellen. Aber Dr. Brown hatte es vorgezogen, in der Heimat seiner Eltern zu wirken. Martin Hellbrügg hatte Dr. Brown bewundert, und von seiner Mutter wusste Dr. Norden, dass aus dieser Bewunderung eine tiefe, enge Freundschaft entstanden war. Er konnte nicht wissen, dass Dr. Browns Zuneigung zu Martin so tief wurzelte, dass er das Leben des jungen Freundes retten wollte.
»Es schaut da drunten wirklich düster aus«, sagte Daniel Norden zu seiner Frau Fee. »Hoffentlich sehen wir Martin Hellbrügg eines Tages doch wieder. Seine Mutter würde es kaum verwinden, wenn er ihr genommen würde. Sie hat sich nie ganz damit abgefunden, dass ihr einziger Sohn in das fremde Land ging.«
»Welche gute Mutter findet sich schon damit ab«, meinte Fee sinnend. »Was meinst du, wie froh ich bin, dass du nicht auf solche Gedanken gekommen bist.«
»Der Gedanke kam mir schon«, erwiderte Daniel. Fee sah ihn bestürzt an, und schnell fuhr er fort: »Aber ich hatte Angst, dass eine gewisse Fee sich dann für einen anderen Mann entscheiden könnte, und außerdem galt es ja auch noch, Vaters Vermächtnis zu erfüllen.«
Das Vermächtnis seines Vaters war das Sanatorium »Insel der Hoffnung«, das von Fees Vater Dr. Cornelius geleitet wurde, der Dr. Friedrich Nordens bester Freund gewesen war.
Dass Fee und Daniel sich in inniger Liebe gefunden hatten, war die Krönung der Erfüllung dieses Vermächtnisses. Sie waren sehr glücklich mit ihren drei Kindern Danny, Felix und Anneka.
Die Insel der Hoffnung war zu einer Oase des Friedens in einer hektischen Welt geworden, und viele hatten dort schon Genesung gefunden, die verzweifelt und ohne Hoffnung gewesen waren. Dr. Friedrich Norden hatte es nicht mehr erlebt, doch sein Geist und seine Menschlichkeit lebten weiter.
»Vielleicht wäre es besser, wenn Frau Hellbrügg ein paar Wochen auf unserer Insel verbringen würde«, meinte Fee nachdenklich.
»Sie geht jetzt nicht fort aus ihrem Haus«, sagte Daniel. »Sie wartet auf ihren Sohn. Ich bin nur froh, dass Rosmarie sich um sie kümmern kann. Sie sind wesensgleich.«
»Rosmarie hat ein erstaunliches Einfühlungsvermögen«, stellte Fee fest. »Für ihre jungen Jahre ist sie schon sehr abgeklärt. Was mag sie hierher verschlagen haben?«
»Ich weiß es nicht, mein Schatz. Als Operationsschwester hatte sie ganz sicher auch kein leichtes Leben.«
»Vielleicht hat sie sich in einen Arzt verliebt, der schon gebunden war«, meinte Fee.
Daniel lächelte nachsichtig. »Es muss ja nicht immer eine unglückliche Liebe sein, die das Leben einer hübschen jungen Frau in andere Bahnen lenkt. Es könnte ja auch ein grantiger Chef gewesen sein, oder ein Wechsel in der Leitung, der ihr nicht behagte. Wir können jedenfalls sehr froh sein, dass wir sie hierhaben. So was hat uns gefehlt.«
Rosmarie ahnte nicht, wie viel Gedanken man sich über sie machte. Sie schlief. Sie war den ganzen Tag auf den Beinen gewesen und hatte wiederum einen arbeitsreichen Tag vor sich. Aber für sie konnte es nicht genug Arbeit geben. Sie wollte ja nicht zum Nachdenken kommen. Sie wollte beansprucht werden und vergessen, was sie quälte. So gut wie in diesem fremden Bett, das Martin Hellbrügg gehörte, hatte sie schon lange nicht mehr geschlafen, nachdem sie sich überzeugt hatte, dass auch Maria Hellbrügg eingeschlafen war.
*
Im Morgengrauen war der Hubschrauber gelandet. Von fern hörte man vereinzelte Schüsse, aber sonst blieb alles ruhig. Beruhigend für die drei Ärzte, die sich Adieu sagten, war das nicht. Überall lauerte Furcht.
»Alles Gute, mein Freund«, sagte Dr. Brown mit rauer Stimme zu Martin. Dr. Percy Bolton, der vor ein paar Stunden die geliebte Frau verloren hatte, drückte Martin nur stumm die Hand. In dem herrschte eine völlige Leere. Er fühlte sich elend und brauchte nun doch so viel Kraft für die anderen, deren Leben nun vielleicht doch gerettet werden konnte. Aber wie würde es weitergehen?
Leila war bewusstlos, die anderen fünf Patienten, darunter der achtjährige Benjamin Ross, waren benommen und wie gelähmt vor Furcht. Doch nichts geschah.
»Wohin bringen sie uns, Doc?«, fragte Benjamin bebend. »Werde ich Mummy und Daddy wiedersehen?«
»Das hoffe ich doch sehr, Benny«, erwiderte Martin tröstend. Aber auch das waren nur Worte, denn das Schicksal von Bennys Eltern war ungewiss. Er selbst hatte den Jungen schwer verletzt in einem verlassenen Wagen gefunden, und es war ihm gelungen, das junge Leben zu retten.
Leila stöhnte. »Kai«, flüsterte sie, »komm doch, mein Liebster.«
Dann war da noch leises Schluchzen, und Molly Brooks betete unentwegt. Sie hatte ihren Mann verloren, die Tochter, den Schwiegersohn und die beiden Enkel. Sie war fünfzig und hatte bleiben wollen, aber Dr. Brown hatte ihr dann gesagt, dass Dr. Hellbrügg sie brauchen würde.
Die Minuten wurden zur Ewigkeit. Martin wusste nicht, wie lange der Flug dauerte. Dann landeten sie irgendwo.
Kenia, dachte Martin, es muss Kenia sein, wohin sonst sollten sie uns bringen. Südafrika war es nicht. So lange hatte der Flug nicht gedauert.
Aber sogleich und ohne viele Worte wurden sie zu einem anderen Flugzeug gebracht. Die Kranken auf ihren Tragen, Martin und Benny folgten. Martin hatte einen Arm um den schmächtigen Jungen gelegt, der noch immer humpelte. Aber kein Wort der Klage kam nun über Bennys Lippen. Er klammerte sich an Martin. »Ich möchte bei dir bleiben, Doc«, flüsterte er.
Martin nickte, seine Blicke folgten langsam Leila. Molly sprach jetzt den Mitpatienten Mut zu und betete wieder.
»Dr. Hellbrügg«, sagte da eine Männerstimme vom Flugzeug her.
»Ja, ich bin hier«, erwiderte Martin heiser. Seine Augen brannten, so sengend schien die Sonne nun schon herab. Er sah den breitschultrigen blonden Mann nur verschwommen.
»Flugkapitän Böhm«, stellte der sich vor. »Wir bringen Sie nach Zürich.«
»Nach Zürich«, wiederholte Martin staunend, »und die Patienten?«, fragte er dann rasch.
»Die natürlich auch.«
»Wie das?«, wunderte sich Martin jetzt etwas fassungslos.
Der andere zuckte die Schultern. »Wir bekamen einen Befehl, mehr kann ich nicht sagen. Wir werden sofort starten. Aufenthalt wurde uns nicht zugebilligt.«
Martin war jetzt alles gleich. Sie blieben zusammen. Leila und Benny wurden nicht von ihm getrennt, und auch die andern nicht. Molly rannen dicke Tränen über die Wangen.
»Warum nicht auch meine Lieben«, murmelte sie.
Warum nicht auch Kai und Percy, dachte Martin, aber dann wanderten seine Gedanken zu seiner Mutter. Bald konnte er ihr Nachricht geben, doch so recht wollte er es noch nicht glauben, dass sie auch tatsächlich in Zürich landen würden.
Afrika, das weite Land, lag weit unter ihnen, die hellen Wüstenflächen, verstreute Siedlungen, die endlosen Savannen Kenias, das grüne Hochland, der Nationalpark mit seinem Wildreichtum. Martin hatte zuerst dieses Land kennengelernt, bevor Dr. Brown ihn in den Urwald holte, und er hatte anfangs gemeint, es müsste überall so sein.
Er war als ein Träumer gekommen, voller Illusionen, und nun ging er, hart geworden, und all die Tragik mit sich nehmend, die Machtkämpfe über den schwarzen Kontinent brachten, während die Touristen nur das genossen, was sie sehen wollten.
Er hielt Leilas fieberheiße Hand. Benny war in seinem linken Arm eingeschlafen, und auch die andern schliefen, während Molly mit tränenvollen Augen zum Fenster hinausblickte und Abschied nahm von ihrer zweiten Heimat und den Gräbern, die zurückblieben.
*
Für Rosmarie hatte der Tag begonnen wie jeder andere, nur mit dem Unterschied, dass sie in einem anderen Bett erwacht war und dann zuerst Maria Hellbrügg versorgt hatte.
Dann fuhr Rosmarie zu den Gröbners. Sie wusste, dass Frau Gröbner an diesem Morgen operiert wurde, aber die Kinder brauchten es nicht zu wissen. Es waren aufgeweckte, aber sehr brave Kinder. Rosmarie fand keine Unordnung vor. Sie wurde freudig begrüßt. Der Frühstückstisch war schon ordentlich gedeckt.
Jutta, die Zehnjährige, wurde gelobt, aber sie bemerkte sogleich, dass Rolf auch geholfen hätte. Das Nest-häkchen Susi versicherte, dass es sich ganz allein angezogen hätte.
»Mutti soll sich nicht ärgern, wenn sie wiederkommt«, sagte Jutta ernsthaft.