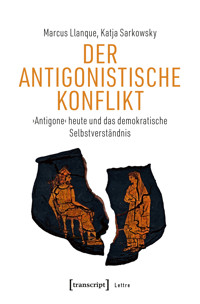7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Politische Ideen haben in der Geschichte große Wirksamkeit entfaltet. Die großen politischen Denker wie Platon und Aristoteles, Thomas von Aquin, Machiavelli,Hobbes,Montesquieu, Kant oder Marx zählen zu den Klassikern derWeltliteratur.Wer sich mit ihren Werken auseinandersetzt, wird nicht nur in den Gang der Weltgeschichte eingeführt, sondern erweitert auch seinen politischen Horizont. Marcus Llanque liefert in diesem Buch einen ebenso knappen wie informativen Gang durch die Geschichte des politischen Denkens und seiner Epochen. Dabei stehen Autorenpaare im Vordergrund, an denen sich die Grundströmungen der verschiedenen Epochen besonders gut und anschaulich verdeutlichen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Marcus Llanque
GESCHICHTE DER POLITISCHEN IDEEN
Von der Antike bis zur Gegenwart
C.H.Beck
Zum Buch
Politische Ideen haben in der Geschichte große Wirksamkeit entfaltet. Die großen politischen Denker wie Platon und Aristoteles, Thomas von Aquin, Machiavelli, Hobbes, Montesquieu, Kant oder Marx zählen zu den Klassikern der Weltliteratur. Wer sich mit ihren Werken auseinandersetzt, wird nicht nur in den Gang der Weltgeschichte eingeführt, sondern erweitert auch seinen politischen Horizont. Marcus Llanque liefert in diesem Buch einen ebenso knappen wie informativen Gang durch die Geschichte des politischen Denkens und seiner Epochen. Dabei stehen Autorenpaare im Vordergrund, an denen sich die Grundströmungen der verschiedenen Epochen besonders gut und anschaulich verdeutlichen lassen.
Über den Autor
Marcus Llanque ist Professor für politische Theorie an der Universität Augsburg.
Inhalt
Einleitung
1. Platon, Aristoteles und die antike Demokratie
2. Augustinus von Hippo und Marsilius von Padua:Glaube, Kirche und Politik im Mittelalter
3. Thomas Morus und Niccolò Machiavelli:Politik zwischen Utopie und Machterhalt
4. Thomas Hobbes, John Lockeund der neuzeitliche Kontraktualismus
5. Montesquieu und Rousseau:Politik und Gesellschaft in der Aufklärung
6. «Federalist Papers» und Immanuel Kant:Verfassungsstaat und Rechtsstaatim Zeitalter der Revolutionen
7. Hegel, Marx und die modernen Widersprüchein Gesellschaft und Politik
8. Alexis de Tocqueville und John Stuart Mill:Individuum und Demokratie in der Moderne
9. Max Weber und John Dewey:die Idee der Demokratie zwischenRealismus und Idealismus
10. Carl Schmitt und Max Horkheimer:politisches Denken in der Epoche totalitärer Regime
11. Die Gegenwart:das Zeitalter der Menschenrechte
Zitierte Literatur
Einleitung
Politische Ideengeschichte ist die Bezeichnung sowohl für eine wissenschaftliche Disziplin wie für ihren Gegenstand, der Entstehung und Vielfalt politischer Theorien seit der griechischen Antike. Diese Theorien haben Autoren vor dem Hintergrund intensiver Debatten und Diskussionen entwickelt, aus welchen sie ihre Themen und Problemstellungen bezogen und auf die sie mit ihren Texten einzuwirken versuchten. Auch die Interpretation dieser Theorien findet vor dem Hintergrund solcher Debatten statt. Das Interesse der Interpreten an mitunter jahrtausendealten Texten beruht auf dem Problembewusstsein, das sie mit dem interpretierten Text verbindet: Was ist Macht? Was bedeutet Gerechtigkeit in der Politik? Wer soll wen regieren? Die Politische Ideengeschichte besteht also aus einem Kontinuum von Theoriedebatten, in dem Texte politischer Theoretiker und ihrer Interpreten versammelt sind. Diese wiederum formieren sich in Diskursen und bewegen sich in spezifischen ideenpolitischen Konstellationen. Solche Konstellationen sind bestimmt durch politische Ereignisse (wie Krisen oder Kriege) oder durch Erwartungen und Hoffnungen (auf Frieden oder Gerechtigkeit).
Die Politische Ideengeschichte als wissenschaftliche Disziplin rekonstruiert die entsprechenden Debatten und kontextualisiert die Texte durch ihre Einbettung in die entsprechenden Diskurse. Ein solcher Diskurs kann das Gesamtwerk eines einzelnen Autors sein: Welche Fragen seiner Lehrer und Vorbilder hat er aufgenommen, welche Fragen seiner Zeit versucht er zu beantworten? Wie hat sich sein Denken entwickelt, wie ist es seinerseits rezipiert worden, von Zeitgenossen und späteren Diskursen? Die Interpretation von Texten im Lichte ihres Urhebers, des Autors oder der Autorin, ist ein sofort einsichtiger und ganz traditioneller Vorgang. Die Häufigkeit einer solchen Thematisierung macht einen Autor zu einem «Klassiker» und dies ist eines der Auswahlkriterien gewesen für die Frage, welche Texte welcher Autoren in diesem Band vorgestellt und diskutiert werden. Auch Klassiker reagieren mit ihren Texten auf politische Ereignisse und wollen bestimmte Probleme lösen. Vor allem stehen sie in Konkurrenz zu anderen Theorien.
Texte müssen also diskursiv eingebettet werden, einerseits in die Menge an Texten, auf die sie Bezug nehmen, andererseits in darüber hinaus reichende Problemstellungen, die das ideengeschichtliche Kontinuum oft bis in unsere Gegenwart hinein durchziehen. Der Vorgang der Einbettung hat zwei Seiten, die man das Archiv der Politischen Ideengeschichte und ihr Arsenal nennen kann.
Fragen der Demokratie beispielsweise beschäftigten Autoren der griechischen Antike. Nun kann man einwenden, dass die moderne Demokratie aufgrund des Wandels der Gesellschaftsstrukturen kaum mehr mit der griechischen Demokratie vergleichbar sei. Aber das hat nichts daran geändert, dass mit der Idee der Demokratie weiterhin die Forderung einer möglichst weitreichenden Partizipation verknüpft ist, deren Bedingungen der Möglichkeit von jenen antiken Autoren besonders intensiv diskutiert wurden, die sie selbst in Augenschein nehmen konnten, mit all ihren Vor- und Nachteilen. Die Archivierung der Vielfalt politischer Theoriearbeit ist insofern ein wesentlicher Beitrag der Disziplin der Politischen Ideengeschichte, da auf diese Weise theoretische und praktische Potentiale von Ideen wie «Demokratie» und Begriffen wie «Macht» in Erinnerung gerufen werden, die sonst in Vergessenheit geraten.
Die Archivierung bewahrt also die theoretischen Potentiale der Ideengeschichte ungeachtet der Frage, wie nahe, aktuell oder verwandt sie mit der Gegenwart sind. Sie stellt damit eine gewaltige Vielfalt an Theorieleistungen zur Verfügung, liefert aber bereits Schemata der Interpretation, denn sie muss diese Vielfalt gruppieren und klassifizieren. Das kann ein relativ harmloser zeitlicher Bezug zu einer bestimmten Epoche sein, es kann aber auch eine Einordnung in diachrone Diskurse sein, in die bereits Ergebnisse der inhaltlichen Interpretation einfließen können. Gehören die Texte von John Locke beispielsweise zum «Liberalismus» und was bedeutet es für die weitere Interpretation, wenn man sie von vornherein im Lichte dieses Schemas zur Kenntnis nimmt und nicht des Schemas «Republikanismus»? Welche Textstellen gelten als repräsentativ, welche können vernachlässigt werden und welche müssen intensiver interpretiert werden in der Annahme, sie gäben dem modernen Interpreten darüber Aufschluss, was Liberalismus ist?
Die Archivierung bereitet einerseits also Interpretationen vor, verhindert aber andererseits, in Kenntnis der weitverzweigten Interpretationsgeschichte, vorschnelle Interpretationen. Dadurch bildet sie ein kritisches Korrektiv, und zwar zur Arsenal-Funktion der Politischen Ideengeschichte. Der Gegenstand der Ideengeschichte gleicht einem Arsenal an Argumenten und Modellen, derer sich die Politische Theorie bedient, um ihre Gegenwarts- und Zukunftsfragen zu klären. Das zeigt sich heute etwa an der Diskussion des Kosmopolitismus, die im letzten Kapitel gestreift wird. Im Arsenal ist der Zugriff auf das ideengeschichtliche Textmaterial höchst selektiv. Wenn zum Beispiel ein erheblicher Teil der Theorie der Internationalen Beziehungen heute mit der Konstruktion der sog. «westfälischen Staatenwelt» operiert, in welcher die nationalstaatliche Souveränität im Mittelpunkt steht, so wird meist Thomas Hobbes als wichtigster Referenzautor herangezogen. Mit der Widerlegung des Souveränitätsbegriffs von Hobbes steht und fällt die Legitimation der westfälischen Staatenwelt heute. Wer erfolgreich die Legitimität des Nationalstaates in Zweifel ziehen kann, eröffnet Bahnen für die Legitimation einer inter-, post-, trans- oder suprastaatlichen politischen Ordnung. Hierbei werden aber oft andere Theorien der Souveränität vor (Jean Bodin) und nach Hobbes (Jean-Jacques Rousseau) ignoriert. Solche verkürzenden Interpretationen sind ein ganz gewöhnlicher Vorgang, den Bodin, Hobbes oder Rousseau ihrerseits vornahmen. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass hier die Ideengeschichte als Arsenal benutzt wird, um sich im gegenwärtigen Meinungsstreit mit Argumenten zu rüsten.
Das bedeutet nicht, dass jede Interpretation genauso plausibel ist und am Ende die Prüfung der Argumente völlig gleichgültig wäre. Das Archiv der Ideengeschichte kennt eine nicht enden wollende Fülle an Interpretationen, von denen sich bei weitem nur der kleinste Teil durchgesetzt hat, also durch anhaltende Rezeption einen eigenen Diskurs begründete. Die Plausibilität von Interpretationen hat etwas zu tun mit geteilten Rationalitätsmaßstäben und geteiltem Problembewusstsein, vor dessen Hintergrund Autoren die Richtigkeit oder Wahrscheinlichkeit von Argumenten einschätzen. Solche Rahmenbedingungen kann man erkennen und damit die Plausibilitätswahrscheinlichkeit ermessen.
Das führt zu dem letzten Aspekt der Arsenal-Funktion der Politischen Ideengeschichte. Das Textmaterial der Ideengeschichte stellt nicht nur ein Kontinuum dar, dieses ist selbst Gegenstand der Interpretation. Jede Argumentation, beispielsweise über die Zeitgemäßheit oder Modernität politischen Denkens, stellt nicht nur dessen spezifische Merkmale heraus, sie verschafft ihm eine besondere Legitimation und kann so andere Merkmale als unmodern oder vormodern abqualifizieren.
Politische Ideen sind also keine historischen Relikte, sie dienen dazu, dem Menschen inmitten der unüberschaubaren Fülle möglicher Auslegungen des Selbstverständnisses und der daran sinnvoll anschließenden Handlungsweisen eine gewisse Orientierung zu vermitteln. Solche vereinfachenden Gesamtinterpretationen des ideengeschichtlichen Kontinuums können viele wissenschaftliche Einwände aushalten (etwa seitens der Archiv-Funktion der Politischen Ideengeschichte) und behalten doch ihre soziale Wirksamkeit, so lange es ihnen gelingt, kollektives Verhalten zu koordinieren. Die «Geschichte» der Politischen Ideengeschichte gleicht einem anhaltenden Meinungskampf um die Legitimation von politischen Strukturen der Gegenwart und ihrem Fortbestand in der Zukunft.
Die diskursive Einbettung von Texten ist ein Ansatz in der Politischen Ideengeschichte (Llanque 2008), der verschiedene etablierte Ansätze in sich aufnimmt. Die sogenannte Cambridge School folgt der im angelsächsischen Wissenschaftsraum weit verbreiteten Sprachphilosophie Ludwig Wittgensteins, wonach Sprache eine Form des Handelns ist und ihr Inhalt sich aus ihrem konkreten Gebrauch ergibt. Daraus hat Quentin Skinner den Schluss gezogen, dass Texte der politischen Theorie vor allem als Interventionen von Theoretikern in zeitgenössische (synchrone) Diskurse zu verstehen sind. Die Leitfrage der ideengeschichtlichen Forschung ist dann, was die beherrschenden Probleme einer bestimmten Zeit sind, worauf Autoren dieser Zeit mit ihren Theorien eine Antwort zu geben trachten (Tully 1988). J.G.A. Pocock hat ein noch darüber hinaus gehendes Verständnis von Diskursen entwickelt. Für ihn ordnet sich der Sprachgebrauch zu einer ganzen politischen Sprache (Liberalismus, Republikanismus), die einen zeitübergreifenden (diachronen) Diskurs formt: Hier ermittelt sich die Semantik der Worte aus der Grammatik der Sprache, in welcher sie benutzt werden (Pocock 1971).
Die Begriffsgeschichte geht hingegen nur von diachronen Diskursen aus, die anhand einzelner Begriffe geordnet sind. Aus dem Wandel des inhaltlichen Verständnisses der Begriffe werden Rückschlüsse auf den Wandel politischer und sozialer Strukturen gezogen, die sich auf den Sprachgebrauch auswirken (Koselleck 1979). Besonderes Augenmerk wird hier auf die «Sattelzeit» gelegt, eine Periode, die um die Zeit der Französischen Revolution datiert und den Umbruch von der Neuzeit zur Moderne markiert.
Folgt die Cambridge School dem Sprachverständnis Wittgensteins, so die französische Postmoderne mit ihrem Ansatz der ideengeschichtlichen Genealogie dem Sprachverständnis Ferdinand de Saussures. Demnach ist die gesprochene Rede von der strukturierenden Funktion der Sprache zu unterscheiden. Von hier ist es kein weiter Weg zur Annahme, soziale Wirklichkeit sei durch Sprache konstituiert. Michel Foucault parallelisiert auf dieser Grundlage die Ordnung der Gesellschaft mit den Regeln des Diskurses. Die Regeln des Diskurses prägen das Sagbare und Unsagbare indem sie bestimmen, was als wirklich und normal zu gelten hat. Politische Ideengeschichte ist hier der Spiegel von Wissensformationen. Foucault hat dies auf die Genealogie der Moderne angewandt, um das Aufkommen einer grundsätzlichen Beherrschbarkeit des Menschen durch die Festlegung grundlegender Parameter des Lebens (Biopolitik) zu erhellen, die erst moderne Verwaltung und staatliche Wohlfahrtspolitik ermöglichten und so die Varianz der Lebensführung stark einschränkten. Mit Foucault erhält die ideenpolitische Funktion von Ideengeschichte ein besondere Bedeutung (Foucault 2004).
Unterschiedliche ideengeschichtliche Ansätzen nehmen das ideengeschichtliche Material unterschiedlich in den Blick und wollen damit unterschiedliche Dinge beweisen. In diesem Buch geht es zunächst darum, den Vorgang der Theoriebildung im Kontext der Entstehungszeit darzustellen und Hinweise für ihre Relevanz für die gegenwärtige Theoriebildung zu geben. Das ideengeschichtliche Material ist nach Autorenpaaren organisiert, die entweder unmittelbar aufeinander Bezug nehmen, einander kritisieren und voneinander abweichende Theorien aufstellen oder aber die Bandbreite der Theoriearbeit einer Epoche repräsentieren. Kein Autor war alleiniger Repräsentant einer Epoche, jede Theorie kannte Alternativen. Gerade aus der Einsicht fortwährender Konkurrenz von Theorien erwächst der größte Gewinn der Ideengeschichte für das politische Denken heute: Vertraute politische Begriffe können im Lichte möglicher alternativer Interpretationen ständig infrage gestellt werden, was die Urteilskraft schärft.
Zur Erleichterung des Auffindens der erwähnten Textstellen werden die Haupttexte der Politischen Ideengeschichte in der Regel nach Buch (römische Ziffer) und Kapitel (arabische Ziffer) zitiert (s.a. Abschnitt Literatur).
1. Platon, Aristoteles und die antike Demokratie
Es ist anzunehmen, dass der Mensch seit seinen frühesten Tagen lernte, politisch zu denken. Die Überlegung, dass man sich gegen Neigung und trotz Freiheitsdrang in ein Herrschaftsverhältnis fügt, um Schutz zu finden oder Güter zu erringen, derer man alleine nicht habhaft wird, gehört zur Kultivierung des Lebensraums von Anbeginn. Die ältesten Schriftzeugnisse lassen sich daraufhin befragen, welches politische Denken das Handeln der Menschen prägte. Die ägyptische Kultur oder die ältesten Textschichten der Bibel sind voll mit politischen Ereignissen und dokumentieren politische Praxis. Hier wie in der griechischen «Ilias» finden wir auch die ersten Spuren der theoretischen Reflexion politischen Denkens. Doch ein regelrechter Diskurs über das Wesen des Politischen, die Bedingungen seiner Möglichkeit, die Vielfalt individuellen Handelns und die institutionelle Verstetigung kollektiven Handelns lässt sich erst im Zusammenhang der athenischen Demokratie beobachten.
Athen besaß die größte Bevölkerung der griechischen Stadtstaaten im 5. vorchristlichen Jahrhundert. Es gebot über ausgedehnte Territorien, war die vorherrschende Seemacht und eines der kulturellen Zentren des Hellenentums. Als führendes Mitglied des attisch-delischen Seebundes, der ursprünglich zur Abwehr der persischen Bedrohung gegründet worden war, verfügte Athen nicht zuletzt durch die Tributzahlungen der übrigen Bündnismitglieder über erhebliche finanzielle Mittel, die auch für kulturelle Prestigeprojekte verwendet wurden, was wiederum zahlreiche Künstler und Wissenschaftler anlockte.
Im Zuge einer sich über Jahrhunderte erstreckenden politischen Entwicklung hatte sich Athen von einer klassischen Monarchie in eine Demokratie verwandelt, in welcher fast alle öffentlichen Fragen unter Beteiligung eines vergleichsweise sehr hohen Anteils der Bevölkerung diskutiert und entschieden wurden. Aufgrund des erfolgreichen Freiheitskampfes gegen die persischen Eroberungsversuche im 5. vorchristlichen Jahrhundert war das hellenische kollektive Gedächtnis geprägt von der Vorstellung, Griechenland und das autokratisch regierte Perserreich würden politisch-kulturell gesehen Antipoden darstellen.
Die politische Rede der athenischen Bürger war das zentrale Medium der Kommunikation. Die athenische Selbstregierung wurde vor Gericht, in den Ratsversammlungen, auf der Agora, auf dem Versammlungsplatz der Bürger ständig von Reden begleitet. Die Rede war auch das literarische Medium der theoretischen Reflexion von Politik. In der Tragödie wurden politische Argumente mittels kunstvoller Reden ausgetauscht, und zwar Reden einzelner Personen wie von Chören, welche die Bürgerschaft als Ganzes repräsentierten. In der Geschichtsschreibung wurde der Meinungskampf in Gestalt von Reden wiedergegeben (Thukydides). Die Rede war schließlich auch zentraler Bestandteil der Politischen Theorie. Platons Kritik der athenischen Demokratie war ein Angriff auf die politische Kommunikationsform der Rede, die seiner Ansicht nach nur die Überredung durch Meinungen, nicht Überzeugung durch Wissen anstrebte. Aristoteles, der Schüler Platons, widmete der Rhetorik eine eigene Abhandlung. Beide folgten in der Weise ihrer Präsentation von Argumenten und Gegenargumenten der rednerischen Praxis, sie publizierten sogar in Form von Dialogen, von denen freilich nur die Platons erhalten sind, von Aristoteles nur seine Lehrschriften. So lange überhaupt noch mündlich Argumente ausgetauscht werden, so lange nicht gewaltige Rechenzentren mittels der Auswertung von quantitativen Datenbergen kollektive Entscheidungen an Stelle politischer Beratung treten lassen, so lange wird die Politische Theorie der athenischen Demokratie Relevanz behalten.
Platon (428/427–348/347) war von adliger Abstammung und gehörte zu einer Familie, welche die Überwindung der Demokratie angestrebt hatte. Zu seinen prägenden Erlebnissen gehörte der Tod seines geliebten Lehrers Sokrates, den ein demokratisches Volksgericht verurteilt hatte. Die Frage, wie eine politische Ordnung den besten ihrer Bürger – so jedenfalls seine Einschätzung – hinrichten konnte, beantwortete Platon mit einer politischen Systemanalyse: Nicht die moralische Dekadenz der Athener oder ihr böser Wille sei schuld, sondern die Gesamtanlage der athenischen Demokratie. In der Demokratie werde nicht das Gute angestrebt, sondern die mehr oder weniger zufälligen Wünsche und Bedürfnisse der Menschen, die jedoch, auf die Natur und die Voraussetzungen dieser Bedürfnisse angesprochen, kaum in der Lage seien, vernünftig darüber Auskunft zu erteilen. Hier könne auch nur ein fundamentaler Strukturwandel Abhilfe schaffen, kein Laborieren an einzelnen Institutionen. Platons Lösung lautete: Das Philosophenkönigtum soll an die Stelle der Demokratie treten.
Platon hat in seinen Schriften seinen Lehrer Sokrates verewigt, er ist derjenige, der die Redepartner in philosophische Fragen verstrickt und in dialektischer Weise Argumentationen entfaltet, an deren Ende die Dialogpartner meist gezwungen sind, der Meinung von Sokrates zuzustimmen. Viele der platonischen Dialoge diskutieren politische Gegenstände. Einzelne für die Politik relevante Tugenden, die Rhetorik («Gorgias»), das Geschäft des Regierens und der geeignete Charakter eines Politikers («Politikos»), Institutionen und Verfahren («Nomoi») und schließlich die ideale Verfassung einer politischen Ordnung («Politeia»). Letzterer Dialog bildet den Kern von Platons politischer Philosophie, deren Hauptangriffspunkt die Demokratie war.