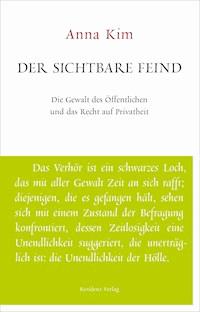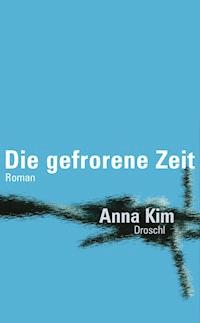12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
In einer US-amerikanischen Kleinstadt wird 1953 ein Junge geboren und noch in derselben Nacht von seiner ledigen Mutter zur Adoption freigegeben. Der Skandal: Das Baby scheint nicht »weiß« zu sein. Als die junge Frau sich weigert, die Identität des Vaters preiszugeben, beginnt eine Sozialarbeiterin mit akribischen Nachforschungen, um die wahre ethnische Herkunft des Kindes zu ermitteln.
Klug und berührend erzählt der Roman, der auf einer wahren Begebenheit beruht, wie wir aufeinander schauen und was wir glauben, im anderen zu sehen, und wie die fatale Idee von »Rasse« bis heute nicht nur die Gesellschaft prägt, sondern auch tief in private Lebenswege eingreift.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Sammlungen
Ähnliche
Cover
Titel
Anna Kim
Geschichte eines Kindes
Roman
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2022.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: any.way, Hamburg
Umschlagfoto: Nick Veasey/Science Photo Library/Getty Images
eISBN 978-3-518-77232-4
www.suhrkamp.de
Als Autorin werden mir von Zeit zu Zeit Geschichten geschenkt, Geschichten, die mehr sind als Geschichten, Geschichten, die Welten in sich tragen. Auf einem solchen Geschenk basiert das vorliegende Buch, man könnte sagen: auf einer wahren Begebenheit, oder: ihm liegt die Kindheit eines Menschen zugrunde. Es ist ein äußerst kostbares Geschenk, eines, das einen verantwortungsvollen, respektvollen Umgang verdient. Ich habe versucht, dem gerecht zu werden, indem ich die Vergangenheit unverändert, unbeschönigt dargestellt habe, gerade, was ihren Wortschatz betrifft. Nicht, um zu verstören oder zu verletzen – die Verstörung, Verletzung lässt sich, dies ist mir bewusst, nicht verhindern –, sondern um jenen, die bereits verletzt, verstört sind, ihr Recht zurückzugeben, über den Schmerz zu bestimmen. Dieser liegt jedoch, und das ist mir wichtig zu betonen, nicht in der Vergangenheit. Obwohl wir gewisse Wörter, Begriffe abgeschafft haben, haben wir es doch nicht geschafft, uns von den Ideen zu trennen, die ihr Innerstes, ihren Kern bilden. Somit riskieren wir, wenn wir Geschichten wie diese weitergeben, auch einen Blick auf die Unterseite der Sprache: auf ihre Kehrseite.
A. K.
Und wenn alle Räume unserer Einsamkeit hinter uns zurückgeblieben sind, bleiben doch die Räume, wo wir Einsamkeit erlitten, genossen, herbeigesehnt oder verraten haben, in uns unauslöschlich.
Gaston Bachelard, Poetik des Raumes
Im Jänner 2013, kurz nachdem Barack Obamas zweite Amtsperiode begonnen hatte, reiste ich in den Mittleren Westen der USA, nach Wisconsin. Ich war vom St. Julian College eingeladen worden, das Sommersemester als Writer in Residence in Green Bay zu verbringen. Untergebracht war ich in der Gästewohnung der Universität, die sich im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes befand, in einem Betonquader aus den siebziger Jahren; die Einrichtung stammte aus den Achtzigern, die Klimaanlage aus den Neunzigern. Seit den Nullerjahren konnte man die Fenster nicht mehr öffnen, sie aus den Angeln zu heben oder gewaltsam herauszureißen waren die einzigen Optionen, um der Luft zu entgehen, die unaufhörlich durch das Gitter geblasen wurde, gemeinsam mit Staub, Rost und fein zerfallenen Rattenexkrementen. Manchmal hörte sich das Rauschen der Klimaanlage an wie Autolärm, selten wie das Tosen von Wellen, meistens fraß sich der monotone Gesang in meinen Gehörgang, attackierte von dort aus mein Gehirn. Nur im Badezimmer war es leise, ausgerechnet hier hatte die Belüftung ihren Geist aufgegeben.
Nach einem Monat beschloss ich, dem Hinweis einer mir wohlgesinnten Kollegin folgend, eine gewisse J. Truttman aufzusuchen, die angeblich Zimmer vermietete –
ausschließlich wochenweise.
Seit Tagen schneite es ohne Unterlass. Der Schnee fiel unermüdlich, unerbittlich, überdeckte das von Menschenhand Erbaute, löschte es aus. Die breiten Straßen waren verlassen, die sporadische Anwesenheit von Leben schien unbeabsichtigt, einmal nur brummte ein Schneepflug an mir vorbei.
Ich war zu Fuß unterwegs; ich hatte mich nicht dazu durchringen können, ein Auto zu mieten. Da sämtliche Markierungen von einem dichten Weiß geschluckt worden waren, konnte ich es mir aussuchen, wo ich mich bewegen wollte, ob auf der Fahrbahn oder auf dem Gehsteig; ich setzte meine Fußspuren stets auf unberührte Flächen. Neben den vom Himmel schwebenden, gleitenden und rieselnden Flocken waren mein Stapfen und Atmen die einzig vernehmbaren Geräusche, keine Menschen, keine Tiere, keine Autos, nicht einmal der Wind regte sich. Mir kamen die Worte Bachelards in den Sinn: Von allen Jahreszeiten ist der Winter die älteste. Ich wandelte sie ab in: Von allen Jahreszeiten ist der Winter die jüngste. Sie bringt Kindheit in die Erinnerung, setzt alles auf Anfang.
Ich brauchte lange, um J. Truttmans Haus zu finden. Unter den zweistöckigen Betonbauten mit flachen Dächern und großer Einfahrt, denen die Holzhäuser, Farmhäuser, in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts hatten weichen müssen – man hatte die family homes eigens für die aus dem Krieg heimgekehrten Veteranen gebaut –, stach es zwar heraus mit seiner hellblau getünchten Holzverkleidung, dem Wintergarten, der einst eine Veranda gewesen war, und dem Mansardenzimmer, das auf dem Dach thronte wie eine Krone. Die Hausnummer aber versteckte sich hinter einem Ahorn, weshalb ich die Woodlawn Avenue mehrere Male auf und ab schreiten musste, um sicherzugehen, dass ich den Pfad, der zum Haus führte, auch mit gutem Grund betrat. Ich fühlte mich beobachtet, glaubte, obwohl ich niemanden dabei ertappte, überwacht zu werden; zudem war das Grundstück der Truttmans das einzige, das umfriedet war, ein Jägerzaun und ein Schild zeigten dessen Grenzen an: No Trespassing.
Ich hatte mich verspätet. Als ich an der Tür klingelte, verfluchte ich den Schnee, jegliche winterliche Romantik war verflogen. Ich dachte, Sie kommen nicht mehr, sagte J. Truttman statt einer Begrüßung und mir die Hand reichend: I'm Joan; ihr you fühlte sich an wie ein Sie. Ich auch, brummte ich und stellte mich mit Franziska vor.
Can I call you Fran? Sie sah mich fragend an. Ich nickte und spähte an ihr vorbei ins Wohnzimmer, wo es nach Butter, Vanille und Zimt duftete. Sie sind also die Autorin aus Österreich, sagte Joan. Wieder nickte, noch immer spähte ich. Sie grinste.
Dann kommen Sie mal rein.
Coffee Cake nannte sich das himmlisch duftende Gebäck, und es kam mit so vielen Tassen heißem Kaffee, wie ich trinken konnte. Nach der ersten fühlte ich meine Hände wieder, nach der zweiten meine Füße, auf die Zehen musste ich noch warten. Am Ende der dritten Tasse einigten wir uns darauf, dass ich noch am selben Tag einziehen würde, Joan versprach, mich hin und her zu chauffieren. Ich unterschrieb den Mietvertrag, ohne das Zimmer gesehen, ohne das Kleingedruckte gelesen zu haben. Es reichte mir zu wissen, dass es im Cuckoo's Nest wohltuend still war.
Die Stille war, wie ich bald nach meinem Einzug merkte, das Gestaltungsprinzip des Hauses: Nichts durfte laut, gar schrill sein, nichts hervortreten. Das Radio, das in der Küche stand, schwieg unter der Woche, nur am Wochenende war es ihm erlaubt zu sprechen. Das Gerät war so alt wie ich, funktionierte trotz allem einwandfrei, wenn man davon absah, dass die Musik gedämpft klang. Dem Plattenspieler im Wohnzimmer fehlte die Nadel und dem Kassettendeck die Kassette, Joan glaubte, sie weggeworfen zu haben, konnte sich aber nicht mehr daran erinnern. Die einzigen Geräusche, die im Haus zu hören waren, kamen von draußen: das Zwitschern der Vögel, die in den Büschen und Bäumen im Garten lebten, das Brummen von Motoren, das aufgeregte Plaudern der Nachbarn (besonders Ada Berkins' unermüdlicher Sopran bohrte sich in die Stille).
Das akustische Ödland spiegelte sich im Farbschema der Innenräume wider. Die Einrichtung war grün, braun und beige, wobei die Teppiche grün waren, die Möbel braun (von Natur aus oder in einem Braunton lackiert) und sämtliche Textilien und Tapeten beige. Die Tische, Stühle und Regale schienen alterslos, da sie keine Verzierungen aufwiesen, sie waren zusammengezimmerte Holzbretter. Die Teppiche und Vorhänge wiesen ebenfalls keine Muster auf, sie wollten reine Flächen sein. Die Couch imitierte den Tisch in seiner Formlosigkeit, versuchte sich als braune Bank. Die Tapete war im Laufe der Jahre nachgedunkelt, ich vermutete von Polarweiß über Naturweiß zu Beige. Auch meine Vermieterin hielt sich an die Hausfarben, vergeblich war ich auf der Suche nach schillernden Farbtönen oder ausgefallenen Schnitten. Sie besaß offenbar bloß schlichte Hosen und Röcke, die sie mit den immer gleichen Blusen und Westen kombinierte.
Zuerst dachte ich, dass das Bauwerk seine Bewohnerin infiziert, sich Joan dem Diktat der Stille gebeugt habe. Mit der Zeit aber begann ich zu begreifen, dass es genau umgekehrt war: Sie war es, die dem Haus ihr Verständnis von Ordnung aufgezwungen hatte. Ihre zerbrechliche Gestalt, ihr dünner Hals, die mageren Arme und Beine, die feinen silbrig weißen Haare und ihre zarte blasse Haut standen im Gegensatz zu ihrer dunklen, kräftigen Stimme, die immun gegen jede Art von Widerspruch war und während des Sprechens sogar noch an Festigkeit gewann; in ihren Augen aber lag eine Unsicherheit, die mich überraschte und berührte.
Anfangs genoss ich die Stille. Ich entdeckte, dass sie aus Geräuschen und Tönen besteht, aus Klängen, die sich zu Melodien zusammenfügen und einem Rhythmus unterliegen; dass Vorhersehbarkeit wesentlich für ihre Genese ist und es möglich ist, dem Etwas zu lauschen, das dem Nichts verwandt ist. Dass sie der Ort ist, an dem sich das Flüchtige festhalten lässt, länger als einen Augenblick.
Ich fühlte mich frei, befreit, sobald ich das Kuckucksnest betreten, die Treppe in den ersten Stock erklommen hatte. Ich genoss es, der Welt den Rücken zuzukehren, sie auszusperren, und ich beschloss, mein Büro im Institut nicht länger aufzusuchen, es erschien mir absurd, ein solches Geschenk in den Wind zu schlagen. Drei Stunden pro Woche, jeden Dienstag von fünf bis acht Uhr abends verbrachte ich in der Universität, die restliche Zeit war ich im Kloster, wie ich Joans Haus bald nannte, die Anwesenheit der Klosterfrau hörte ich zwar nicht, fühlte sie aber; ich hätte wissen müssen, dass diese spezielle Art des Glücks nicht halten würde. Es dauerte nicht lange, und ich meinte, vom Stillstand erdrückt zu werden. Mich frei im Haus zu bewegen erschien mir nicht bloß ungehörig, sondern verboten, No Trespassing, die Worte hatten sich in mein Gehirn gebrannt. Ich meinte, die Wände kröchen beständig näher, mein Zimmer wäre ein Turmzimmer und das Fenster der einzige Ausgang; dass eine Tür existierte, entfiel mir. Wenn ich nun das Treiben um den kahlen Apfelbaum im Garten beobachtete, dann nicht, um der Krähe zuzusehen, wie sie von einem Ast zum andern flatterte, sondern weil ich meinte, der Baum sei eine Brücke zur Außenwelt.
Vielleicht hatte sich Joan Sorgen um mich gemacht, später vertraute sie mir an, eine entfernte Cousine leide an Schizophrenie, Wahnvorstellungen gehörten zum Alltag ihrer achtzigjährigen Tante; vielleicht aber war es auch einfach eine freundliche Geste, dass sie an jenem Nachmittag im Februar an meine Tür klopfte, um mir ein Geschenk zu überreichen, Welcome Home stand auf der beigelegten Karte. Für dich, sagte sie, unruhig von einem Fuß auf den anderen tretend. Normalerweise lasse ich mir Zeit beim Öffnen, schüttle das Päckchen, betrachte ausgiebig das Muster auf dem Papier. Die Zeitspanne vor dem Auswickeln, und sei sie noch so kurz, ist für mich ein winziger Ausschnitt der Welt der Wunder, alles scheint möglich; Joan machte mich allerdings so nervös, dass ich mich genötigt sah, die Verpackung aufzureißen.
Es war ein gerahmtes Bild: zwei Goldfische (Koi) in einem Teich unter herabhängenden Kirschblütenzweigen. Die Künstlerin sei chinesische Amerikanerin, sagte Joan, und früher Bakteriologin gewesen. Miss Wang habe in Kalifornien an einer Ivy-League-Universität studiert, sich im Alter von fünfzig Jahren jedoch für eine künstlerische Laufbahn entschieden, Chinese Brush Painting und 3D-Bilder geben ihrem Leben neuen Sinn. 3D?, fragte ich verwirrt. Joan schmunzelte. Eine spezielle Brille brauchte ich nicht, um es zu betrachten. Sie deutete auf die Fische, deren Körper nicht gemalt, sondern aus Papier geformt und aufgeklebt waren. Es erinnert mich an Origami, dich nicht?
Mich erinnerte es an Glückwunschkarten, trotzdem nickte ich und stellte das Bild auf die Kommode; das Dottergelb und Feuerwehrrot stachen aus der Umgebung hervor. Es müsste in deinen Koffer passen, sagte Joan und ließ sich zu meinem Verdruss auf der Bank nieder, die am Fußende des Bettes stand, selbst gerahmt ist es nicht groß; sie betrachtete mich, als sei auch ich ein Bild, ein Bild ohne Koi, wenngleich nicht minder kurios.
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, so hielt ich mich an meinem Lächeln fest.
Joan lockerte ihren Blick. Sie sagte, ich habe an dich denken müssen, als ich es sah. Und nach einer Pause (die sie zum Anlauf nutzte): I imagine, it must be lonely.
Sie wusste, dass ich an einem Roman arbeitete, sie hatte eine Schreibtischlampe für mich vom Speicher geholt, ich erwiderte daher, Schreiben sei einsam, aber, beeilte ich mich hinzuzufügen, vielleicht seien es jene, die die Einsamkeit suchen, die das Schreiben finden.
Sie sah mich überrascht an, dann lachte sie, das habe sie nicht gemeint. Sie habe gemeint, es müsse schwierig sein, weit und breit die einzige Asiatin zu sein. In Green Bay seien die meisten ursprünglich aus Europa – Deutschland, Belgien, Polen und Irland. Ihre Großeltern etwa seien aus dem Osten Irlands nach Amerika gekommen. Sie habe immer davon geträumt, die grüne Insel einmal zu besuchen, the Emerald Isle, sie habe gehört, die Gesänge der Irischen See seien unvergesslich. Sie verstummte, und ich dachte schon, wir hätten das Thema abgehakt, als sie sagte: In Österreich leben vermutlich auch nicht viele Asiaten. Ich antwortete, ich sei in Wien geboren, ich fühle mich in etwa so asiatisch wie sie.
Sie musterte mich misstrauisch. Das glaube sie mir nicht, rief sie endlich aus, den Wurzeln entkomme man nicht – ich sei doch gemischt, oder? Sie betrachtete mich erneut, kürzer diesmal, und kam zu dem Schluss, dass meine hohen Wangenknochen, die Form meiner Augen (das so genannte Mandelformat) und meiner Nase meine ethnische Herkunft, zumindest den dominanten Teil, verrieten. Natürlich, fuhr sie fort, meine Haare seien leicht gewellt und mittelbraun, zudem nicht so dick und fest, die Länge, das heißt die Kürze, mache es jedoch schwer, eine genaue Bestimmung vorzunehmen, und, murmelte sie, ich sei größer und langgliedrig, doch sie irre sich selten, japanisch würde sie ausschließen, ebenso chinesisch, sie kniff ihre Augen zusammen, sei ich Koreanerin? Die Koreaner sähen den Europäern noch am ähnlichsten. Sie resümierte (ohne meine Antwort abzuwarten): Ich sähe aus wie eine koreanisch gefärbte Europäerin. Oder, fragte ich, wie eine europäisch angemalte Koreanerin?
Sie lachte.
Exactly.
Ihr Lachen provozierte mich. Mein Vater, ließ ich mich zu einer Erklärung hinreißen, die sich wie eine Rechtfertigung anfühlte, stamme aus Österreich, meine Mutter aus Südkorea.
Joan hob beschwichtigend ihre Hände. Ich dürfe sie nicht falsch verstehen, sie spreche keineswegs als Ahnungslose, sondern als Eingeweihte: Ihr Mann Danny sei in der gleichen Situation wie ich. Er sei der einzige Afroamerikaner in Green Bay, zumindest fühle sich das so an.
Wieder blickte sie mich forschend an – oder Hilfe suchend, da ich beharrlich schwieg? Ich wusste nicht, in welcher Form ich an diesem Austausch teilhaben sollte; ich hatte den Eindruck, meine Rolle sei die des Publikums und als solches wäre ich unbeteiligt.
Als sie den Faden wiederaufnahm, war ihre Stimme leise. Sie sagte, es sei wichtig, eine Gruppe zu haben, zu der man gehöre, der man sich zugehörig fühlen könne. Don't you agree?
Herkunft sei nicht die alleinige Bedingung für Zugehörigkeit, wandte ich ein. Sie schüttelte den Kopf. Danny habe sich immer schwer damit getan, der Einzige zu sein. Er sei der einzige Schwarze im Kindergarten gewesen, der einzige in der Schule, der einzige in der Arbeit, und er habe viele Jobs gehabt, so viele. Nun sei er der einzige Schwarze im Pflegeheim. Ach nein, verbesserte sie sich, es gebe noch einen zweiten, einen ganz jungen, Jonah, der nach einem Autounfall alles neu erlernen müsse, essen, gehen, sprechen. Jonah und Danny hätten einen ähnlichen Therapieplan, sagte sie, aber Danny werde wahrscheinlich früher entlassen werden, deshalb vermiete sie dieses Zimmer nur wochenweise. Sobald er wieder zu Hause sei, brauche sie keine Gesellschaft mehr. Sie verzog ihr Gesicht zu einem wehmütigen Lächeln. Ohne ihn sei es einsam.
Einzig durch sein Licht ist das Haus menschlich. Ein feiner Lichtstrahl fiel durch das staubblinde Glas, bahnte sich seinen Weg zur Raummitte. Joan stand langsam auf. Zuerst mied sie meinen Blick, dann besann sie sich und passte ihn ab. Sie sagte, ich frage mich, ob ich nicht auch vor seiner Krankheit einsam war, einsam mit ihm.
Seine Einsamkeit war ansteckend.
Aus der Akte des Sozialdienstes der Erzdiözese Green Bay
13. 07. 1953
Telefonat m. Sr. Aurelia:Am Sonntag, den 12. Juli, kam gegen 22 Uhr eine junge Frau mit starken Wehen in die Notaufnahme. Kurz nach Mitternacht gebar sie ein 3,2 kg schweres Kind. Sie gab ihm den Namen Daniel. Der Arzt, der die Entbindung vornahm, war Dr. Karl Schreiber. Mutter und Kind sind wohlauf.
Miss M. Winckler (MW) wurde mit dem Fall betraut.
14. 07. 1953
Besuch/Krankenhaus St. Mary:Der Name der Kindsmutter lautet Carol Anne Truttman. Sie war höflich, aber schroff. Sie erklärte, dass sie den Knaben zur Adoption freigeben wolle und er auf die Kinderstation verlegt werden könne, sobald die Ärzte dies gestatten.
Miss Truttman wohnt zurzeit in der Kellogg Street 223 in Green Bay, Wisconsin. Sie wurde am 11. Februar 1933 in Green Bay geboren, ist 20 Jahre alt und ledig. Sie besucht regelmäßig die Messe in der Kirche St. Mary in Green Bay. Ihr Vater, Joseph Truttman, starb vor fünf Jahren an Darmkrebs. Ihre Mutter, Anne Bellin (seit 1949 verheiratet mit Mr. Nicholas Bellin), lebt auch in Green Bay (St. Baird Street 1556). Die Familie stammt aus Österreich und Deutschland.
Sie hat drei Geschwister, zwei Brüder und eine Schwester; sie ist die Zweitälteste. Max ist 21 Jahre alt und arbeitet in der Wood Preserving Company. Walter ist 19 Jahre alt und Student am St. Julian College in Green Bay. Olivia ist 13 Jahre alt und besucht die St. Mary Junior Highschool in Green Bay. Max und Walter sind Junggesellen.
Miss Truttman hat die St. Mary Highschool in Green Bay abgeschlossen. Seither arbeitet sie als Telefonistin bei der Bell Telephone Company in Green Bay. Sobald sie aus dem Krankenhaus entlassen wird, möchte sie diese Tätigkeit wiederaufnehmen. Da sie es jedoch versäumt hat, sich krankzumelden, hofft sie, dass die Stelle in der Zwischenzeit nicht vergeben wurde.
Carol Truttman ist ca. 1,60 m groß und 70-75 kg schwer. Sie ist hellhäutig und hat ein rundlich begrenztes Gesicht mit einem spitzen Kinn. Ihre Stirn ist zurückweichend und kurz. Die Nase ist eher breit, die Obernase leicht flach; sie mutet wie eine Knopfnase an. Der Mund ist groß, die Lippen sind voll. Das Haar ist schulterlang, die Haarfarbe braun, die Haarform weitwellig. Die Augeneinbettung ist tief, die Augen sind klein, rund und hellbraun, die Wimpern kurz.
Den vollständigen Namen des Kindsvaters kennt sie nicht. Sie weiß nur, dass er mit Vornamen George heißt. Er ist angeblich 23 oder 24 Jahre alt und unverheiratet. Sie vermutet, dass er in Chicago lebt. Über seine Familie ist ihr nichts bekannt.
Sie haben keine Heiratspläne, sie sind bloß „ein paar Mal“ miteinander ausgegangen. (Miss Truttman erwähnte nicht, wie oft.) Das erste Treffen kam über die Vermittlung von Bekannten zustande. Sie sagte zuerst „Freunde“, verbesserte sich dann.
In dem Moment betrat ihre Mutter den Saal. Anne Bellin ist eine noch jung wirkende, attraktive Frau, die ältere, schmälere Version der Tochter. Sie war geschmackvoll gekleidet und äußerst höflich. Sie bedankte sich, dass wir ihrer Tochter behilflich sind. Mrs. Bellin bekräftigte, dass der Säugling zur Adoption freigegeben werden soll. Sie ist ebenfalls damit einverstanden, dass er so bald wie möglich auf die Kinderstation verlegt wird.
Mrs. Bellin und ihrer Tochter wurde erklärt, mit welchen Kosten sie zu rechnen hätten und wie in etwa das Verfahren zur Aufgabe der Elternschaft ablaufen würde. Es wurde vorgeschlagen, es so bald wie möglich – in etwa zwei Monaten – zu eröffnen. Weder Mrs. Bellin noch Miss Truttman erhoben Einspruch.
Für eine Untersuchung des Kindes war weder Zeit, noch war dies nötig.
(MW/JE)
(Handschriftliche Anmerkung v. JT: Die Mitarbeiter des Sozialdienstes diktierten ihre Berichte den Stenotypistinnen June Everson/JE und Betty Young/BY.)
03. 08. 1953
Telefonat m. Sr. Aurelia:Laut Schwester Aurelia besitzt der Truttman-Säugling Körpermerkmale, die auf eine indianische Abstammung hinweisen könnten. Es ist allerdings noch zu früh, dies zu beurteilen. Das Kind ist erst drei Wochen alt.
Schwester Aurelia erklärte, sie werde die Entwicklung des Kindes im Auge behalten.
31. 08. 1953
Telefonat m. Sr. Aurelia:Die Schwester war so aufgeregt, dass es schwierig war, sie zu verstehen. Offenbar haben die Schwestern Aurelia und Geneviève das Kind in den letzten Wochen genauestens beobachtet und mehr als einmal eingehend untersucht. Gemeinsam sind sie zu dem Schluss gekommen, dass seine Körpermerkmale eher denen eines Negers entsprechen als denen eines Indianers. Das Kind, betonte Schwester Aurelia, weise „mit Sicherheit“ Merkmale auf, die nicht normal seien.
MW versuchte, die Schwester zu beschwichtigen. Sie sagte, dass Dr. Denys Daniel demnächst untersuchen werde, und schlug vor, den Befund des Psychiaters abzuwarten. Außerdem würde sie den Knaben in Bälde selbst in Augenschein nehmen.
Schwester Aurelia war mit dieser Vorgangsweise einverstanden. Sie warnte MW jedoch, dass sich unter diesen Umständen die Suche nach geeigneten Adoptiveltern schwieriger gestalten werde. Mit Mischlingskindern kenne man sich hier nicht aus, das habe es noch nie gegeben: Daniel Truttman sei ihres Wissens nach der erste Mulatte, der in Green Bay geboren wurde.
(MW/JE)
01. 09. 1953
Untersuchung D. Truttman, Krankenhaus St. Mary:Das Kind ist 7 Wochen und 2 Tage alt. Der allgemeine Gesundheits- und Ernährungszustand ist als sehr gut zu bezeichnen. Es war bisher noch nicht krank. (Es ist allgemein bekannt, dass der amerikanische Neger, wenn überhaupt, nur von einer leichten Form der Masern und Diphtherie befallen wird. Erkrankungen an Scharlach und Windpocken verlaufen gleichfalls relativ harmlos. Allerdings soll er häufiger als der Weiße unter Erkrankungen der Atmungsorgane leiden.)
Nasenform:Die Nasenbreite des Kindes liegt zwischen den Werten der größten (negriden) und geringsten Nasenbreite (europiden), ist somit mittelbreit. Bekanntlich nimmt der Nasenindex mit zunehmendem Alter stark ab, was auf das im Verhältnis zur Breite viel stärkere Wachstum der absoluten Nasenhöhe zurückzuführen ist. Der amerikanische Neger ist nicht nur im kindlichen Stadium, sondern auch als Erwachsener ebenso mittelbreitnasig wie der Durchschnittseuropäer.
Hautfarbe:An der Beugeseite des linken Oberarms, die den Umwelteinflüssen (etwa Sonne) am geringsten ausgesetzt ist, wirkt das Kind hellhäutig. Seine Augenlider, Brustwarzen und Achselhöhlen sind jedoch stärker pigmentiert als der Rumpf. Dieser ist dunkler als die Gliedmaßen (an der Beugeseite). An den seitlichen Stirnpartien sowie in der Nackengegend gibt es Anhäufungszentren von Pigment.
Hiermit sei darauf hingewiesen, dass die Innenflächen der Hände und Füße hell sind.
Augenfarbe:Beim Kind wurde eine braune Irispigmentation festgestellt. Der Gesamteindruck der Iris ist von einer strahlenden Klarheit und Tiefe. Hinzu kommt ein deutlich bläulicher Außenring. Eine Negerfalte an den Augen ließ sich (noch) nicht feststellen. Die meisten amerikanischen Neger stammen aus Westafrika, die Negerfalte sollte bei ihnen stark ausgeprägt sein.
Haarfarbe:Die Haarfarbenklasse ist braun, die Haarform (soweit erkennbar) straff.
Lippenform:Die Lippen sind (eher) fleischig.
Missbildungen:Da in der Literatur wiederholt die Vermutung geäußert wird, dass bei Rassenmischung mit vermehrten Disharmonien zu rechnen sei, wurde besonders auf solche geachtet: Es ließen sich keine Missbildungen feststellen.
Conclusio:Weder negride noch indianide Einflüsse sind auszuschließen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass der amerikanische Neger nicht dem gebürtigen Afrikaneger gleichzusetzen ist. Er stellt eine Auskreuzung dar, dessen Grundkomponente die negride geblieben ist, in der aber europide und einige wenige indianide Einflüsse ihren Niederschlag gefunden haben. 22 % der amerikanischen Neger sind unvermischt, etwa 51 % weisen einen europiden und 27 % sowohl einen europiden als auch indianiden Einschlag auf.
Vor den nächsten Schritten sollte der Test des Psychiaters abgewartet werden.
14. 09. 1953
Telefonat m. Dr. Denys:Der Intelligenzquotient des Kindes wurde gemessen. Der Psychiater stellte zusammenfassend fest, dass dessen IQ mit 120 überdurchschnittlich hoch sei. Für ein endgültiges Ergebnis bat er darum, den zweiten Test abzuwarten.
Zur Rasse des Kindes wollte er sich nicht äußern. Dies sei bei Mischlingen oftmals problematisch. Daraufhin wurde Miss Truttman angerufen und für Montag, den 21. September, um 9 Uhr ins Büro bestellt.
Legende:
< 60: debil
70-79: grenzwertig
80-89: unterer Durchschnitt
90-109: Durchschnitt
110-119: oberer Durchschnitt
120-139: überdurchschnittlich intelligent
> 140: Genie
(MW/JE)
21. 09. 1953
Termin/Miss Truttman und Mrs. Bellin, 9 Uhr:Miss Truttman kam in Begleitung ihrer Mutter zum heutigen Termin. Beiden Frauen wurde erklärt, dass wir Schwierigkeiten hätten, die Rasse des Säuglings eindeutig zu bestimmen. Es scheine sich aber um ein Mulattenkind zu handeln. Dr. Denys schließe sich der Vermutung an.
Wider Erwarten blieben Empörung und lautstarker Protest aus: Miss Truttman reagierte verhalten, ebenso ihre Mutter. Mrs. Bellin erklärte, der Kindsvater sei auf Besuch in Green Bay gewesen, allerdings habe sie Bekannte, die mit ihm befreundet seien. Von ihnen könne sie seinen Nachnamen und seine Herkunft erfahren. Miss Truttman schwieg, während dies erörtert wurde. Sie hat abgenommen, ist jedoch nach wie vor plump. Plötzlich platzte es aus ihr heraus, dass der Vater des Kindes polnisch sei und sein Nachname „ganz sicher“ mit der Silbe „-ski“ ende. Sie betonte auch, dass seine Gesichtszüge „grob“, seine Lippen „wulstig“, seine Haut „brauner als unsere“ und seine Augen und Haare „dunkelbraun, fast schwarz“ seien. Außerdem sei er groß (etwa 1,80 m), schlank, aber kräftig (zw. 90 und 100 kg), und er habe bereits Geheimratsecken. Sie schwöre, er stamme aus Polen.
Dies gab uns die Gelegenheit, die Geschichte der Familie Truttman zu erfragen. Mrs. Bellin, geborene Burkard, sagte aus, auf mütterlicher und väterlicher Seite deutscher Abstammung zu sein. Mr. Truttman stamme auf mütterlicher und väterlicher Seite aus Österreich. Beide Familien, Burkard (Burkhardt?) und Truttman (Trauttmann?), wanderten im 19. Jahrhundert nach Wisconsin ein. Carol könnte, bei näherer Betrachtung, slawische Gesichtszüge besitzen.
Es wurde mit größtmöglichem Nachdruck erklärt, dass wir mehr Informationen über den Vater benötigen, ehe wir die Suche nach geeigneten Adoptiveltern in Angriff nehmen können. Es sei unser Ziel, Kinder und Eltern zusammenzubringen, die innerlich und äußerlich zueinander passen. Im besten Fall sei kein Unterschied zwischen den Adoptiveltern und den Kindern bemerkbar: Wir erschaffen Familien, die natürlich, von Gott gewollt, wirken. Nur so können wir das Glück dieser Kinder garantieren.
Mrs. Bellin gab sich verständig. Sie versprach, die fehlenden Informationen bald nachzureichen.
22. 09. 1953
Telefonat m. Sr. Aurelia:Sie ist nun wieder davon überzeugt, dass sich unter den Nachfahren der Truttmans „mindestens ein Indianer vom Stamm der Winnebago“ befindet. Carol sei halb indianisch, beim Knaben lägen die Dinge anders. Seine Gesichtszüge empfindet sie als zu grob für einen Indianer. Es sei durchaus möglich, dass das Kind wie ein Farbiger aussehe, weil sein Vater grobe slawische Gesichtszüge besitze.
MW versprach, diese Bedenken an Miss Murphy weiterzugeben. In der Zwischenzeit möge die Schwester Dr. Merline um eine genaue Untersuchung des Kindes bitten. Er solle besonderes Augenmerk auf die Rasse richten. Schwester Aurelia versicherte, sie werde dies sofort arrangieren.
(Anmerkung v. JT: Miss Margaret Murphy war die Leiterin des Sozialdienstes der Erzdiözese Green Bay, Dr. Charles Merline der Kinderarzt im Krankenhaus St. Mary.)
28. 09. 1953
Telefonat m. Mrs. Bellin:Kurz vor Büroschluss meldete sich Mrs. Bellin; sie war in Eile und meinte, sie könne nicht lange reden. Ihr Mann sei von der Existenz des Enkelkindes nicht unterrichtet.
Sie erklärte, dass der Kindsvater definitiv polnisch sei, in Chicago lebe und sein Name Sebinski (oder Sobinski/Sobieski?) laute. Mehr habe sie nicht herausfinden können.
29. 09. 1953
Besprechung m. Dr. Merline, Dr. Schreiber, Dr. Denys, Krankenhaus St. Mary, 9 Uhr:Dr. Merline, Dr. Schreiber und Dr. Denys haben das Kind gründlich untersucht. Sie hegen den Verdacht, dass es Negerblut in seinen Adern hat. Die Gesäßzeichnung changiere zwischen olivfarben und hellbraun, was ein Hinweis auf eine gemischte Elternschaft sei.
Mehr könne man ihrer Meinung nach noch nicht sagen – Kinder seien im Allgemeinen rassisch undifferenzierter als Erwachsene –, doch Dr. Denys werde in einer Woche einen weiteren Intelligenztest durchführen.
(MW/JE)
06. 10. 1953
Besprechung/Dr. Denys, Krankenhaus St. Mary:Der zweite Test hat ergeben, dass Daniel Truttmans IQ 118 beträgt. Er ist seit dem letzten Test gefallen. Dr. Denys schloss daraus, dass der Knabe einmal dazu fähig sein sollte, eine höhere Ausbildung abzuschließen.
Im Durchschnitt sei die Intelligenz der Negerkinder um zwei Prozentpunkte niedriger als die weißer Kinder.
07. 10. 1953
Hausbesuch/C. Truttman:MW suchte Carol zu Hause auf, um sie mit dem Verdacht der Ärzte zu konfrontieren. Diese Vorgangsweise war mit Miss Murphy abgesprochen.
Carol hat ein Zimmer bei Mrs. Trude Rentmeester gemietet. Mrs. Rentmeester ist eine etwa 60 Jahre alte, schlanke und große Dame mit einer sehr hellen, fast weißen Haut und schmalen hellblauen Augen. Ihre langen weißen Haare trägt sie zu einem Knoten aufgesteckt. Mrs. Rentmeester bessert ihre Witwenrente auf, indem sie die drei Zimmer, die sie nicht nutzt, an alleinstehende, arbeitende Frauen vermietet. Die Einnahmen seien nicht hoch, aber ausreichend. Viel könne sie von den jungen Frauen ja nicht verlangen, erklärte sie.
Da Carol noch nicht von der Arbeit zurückgekehrt war, bot Mrs. Rentmeester MW eine Tasse Kaffee im Wohnzimmer an. Das Haus wirkte äußerst ordentlich und gepflegt: Ein Strauß frischer Blumen aus dem Garten stand auf der Anrichte, die Kissen und Polster dufteten frisch, auf dem Bücherregal fand sich kein bisschen Staub. Mrs. Druwiski, eine Polin, komme jeden Tag zum Kochen, Putzen, Bügeln und Waschen. Das war zu erwarten, die Kellogg Street befindet sich in einer guten Gegend. Zum Kaffee reichte Mrs. Rentmeester Gewürzkekse, eine Spezialität aus ihrer Heimat Belgien.
Sie kenne das Mädchen schon seit vielen Jahren, sagte sie, für sie sei Carol noch immer das siebenjährige Kind mit der großen Zahnlücke, das beim Klavierabend der Musikschule weinend von der Bühne gelaufen sei. „Ein solch goldiges Mädchen“, sagte sie, „herzensgut und sanft. Aber schüchtern, mein Gott, wie schüchtern!“ Dass Carol ein uneheliches Kind auf die Welt gebracht habe, schockiere sie, sie hätte dies vielen jungen Frauen zugetraut, aber nicht ihr. Andererseits gehe ja schon seit längerem eine Art „Epidemie“ im Lande um. Seit dem Ende des Krieges kämen so viele uneheliche Kinder wie noch nie auf die Welt. In allen größeren und kleineren Städten würden Häuser für unverheiratete Frauen eingerichtet, in denen die Frauen unter ärztlicher Aufsicht und ungestört gebären würden. Mrs. Rentmeester wiederholte mit vielsagendem Blick: „Ungestört.“ In dem Moment betrat Carol das Wohnzimmer. Sie war überrascht und ganz und gar nicht erfreut, MW zu sehen – sie zitierte sie sofort in ihr Zimmer. Trudes freundliche Einladung, eine Tasse Kaffee mit ihr zu trinken, ignorierte sie.
In ihrem Zimmer herrschte Unordnung. Auf dem hölzernen Stuhl neben der Tür lag ein Haufen ungewaschener Kleidung. Der Kleiderschrank war halb geöffnet, und Strümpfe, Büstenhalter, Blusen und Rockzipfel ragten aus dem Spalt. Statt sich für das Chaos zu entschuldigen, beschuldigte sie MW, unerlaubterweise in ihr Heim eingedrungen zu sein. Die Sozialarbeiterin habe kein Recht, bei ihrer Vermieterin Erkundigungen über sie einzuholen. MW verteidigte sich und versicherte ihr, dass sie dies nicht getan habe, was Carol etwas zu beruhigen schien. Diese Pause nutzte MW, um ihr vom Verdacht der Ärzte zu erzählen, woraufhin sich Carol kleinlaut auf ihrem Bett niederließ; MW bot sie keinen Sitzplatz an. Niemals habe sie mit einem Neger verkehrt, beteuerte sie mit geröteten Wangen, das müsse man ihr glauben. Aber sie sei „ein Jahr lang“ mit einem gewissen Maynard Helnore ausgegangen. Maynard habe eine eher dunkle Hautfarbe. Diesen Gerald (nicht George!) Sebinski, den sie ursprünglich als Vater angegeben habe, kenne sie noch nicht lange.
Unser Angebot, Mr. Helnore zu kontaktieren, wies sie zurück. Sie wolle nicht, dass ihn ein Mitarbeiter des Sozialdienstes mit dieser Nachricht überrasche. Nachdem ihr ins Gewissen geredet und auseinandergesetzt worden war, weshalb es so wichtig sei, die Vaterschaft eindeutig festzustellen, meinte sie, sie werde darüber nachdenken und am Montag, den 12. Oktober, um 9 Uhr ins Büro kommen.
Nach ihrer Beziehung zu Österreich und Deutschland befragt, reagierte Carol überrascht, gab aber bereitwillig Auskunft, dass sie nicht viel über diese Länder wisse, ihre Eltern hätten kaum über die alte Heimat gesprochen. Die Frage, ob sie als Kind Deutsch gelernt und gesprochen habe, verneinte sie. Sie kenne diese Sprache nur aus Filmen.
Es wurde von weiteren Nachfragen abgesehen. Die Entwurzelung, an der die junge Frau leidet, ist spürbar. Möglicherweise ist dies die Ursache für die außereheliche Schwangerschaft.
12. 10. 1953
Termin/C. Truttman, 9 Uhr:Soeben erteilte Carol dem Sozialdienst die Erlaubnis, Maynard Helnore anzuschreiben. Momentan leiste er seinen Militärdienst in Georgia ab, sie werde uns seine Anschrift noch diese Woche telefonisch durchgeben, sie habe sie nicht bei sich.
MW