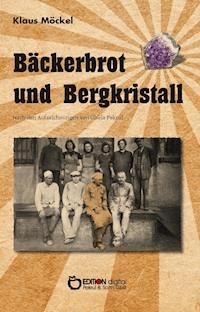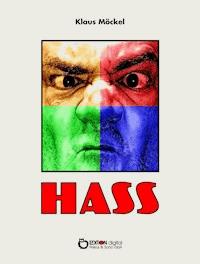Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Dieser dritte Fall Kreys führt ins Künstlermilieu. Eine Malerin wird vermisst, und der Detektiv soll Nachforschungen anstellen. Doch seine Fragen passen manchen Leuten nicht in den Kram, so dass er begreifen muss, dass er sich wieder mal auf ein gefahrvolles Spiel eingelassen hat. Ein Toter taucht auf, Fälscher und Hehler versuchen das große Geld zu machen. Zusammen mit seiner Freundin Jeanette, die ihm helfen will, gerät er in höchste Lebensgefahr, doch er wäre nicht Krey, wenn er deshalb aufstecken würde. LESEPROBE: „Oh, da irren Sie sich. Der Name bedeutet eine ganze Menge, zumindest hat er mich auf die Spur eines spektakulären Raubs gebracht mit dem auf irgendeine Weise das Verschwinden von Beate Hallenbeck zusammenhängt. Aber ich vermute, das wissen Sie längst. So schwer es Ihnen im Augenblick fallen mag, Frau Rothenfels, Sie sollten dieses traurige Ereignis nutzen und mir jetzt endlich die Wahrheit sagen." Unvermutet wurden wir unterbrochen. Hinter mir flog die Tür auf, und ich sah, wie sich die Augen der Frau erschrocken weiteten. Trotzdem brauchte ich einen Moment zu lange, um zu begreifen, was vorfiel. Ich warf mich zu spät zur Seite. Ein Schuss knallte, ein scharfer Schmerz durchzuckte mich und riss mich zu Boden. Zum Glück stürzte ich hinter einem Sessel nieder, so dass die zweite Kugel nur das Sitzpolster traf. Dass geschossen worden war, kriegte ich allerdings erst hinterher so richtig mit. Ich stieß einen Schrei aus, versuchte nach dem Arm zu greifen, den es erwischt hatte, und sah im Fallen eine Gestalt mit einer Bärenmaske im Türrahmen. Nicht sehr groß, bullig. Dann schlug ich blödsinnigerweise mit dem Schädel gegen ein Tischbein, und mir wurde schwarz vor Augen. Ich kam nicht dazu, mich lange der Dunkelheit und der angenehmen Fühllosigkeit hinzugeben, in die ich geglitten war. Jemand ohrfeigte mich und zerrte an mir herum. Der Arm tat höllisch weh, auch der Kopf schmerzte. Ich stöhnte und sah einen jungen Mann über mich gebeugt, der befriedigt erklärte: „Jetzt kommt er endlich zu sich." Ein anderer Mann, etwas älter, schaute ihm mit rotem Gesicht zu. „Er blutet, er braucht einen Arzt", erklärte eine weibliche Stimme. Sie gehörte der Frau, die vorhin das Kinderkleid mit den Glöckchen in Arbeit gehabt hatte. „Was war denn los?", fragte ich dümmlich. „Jemand scheint auf Sie geschossen zu haben. Das müssten Sie doch am besten wissen", sagte die Frau, und der ältere Mann fügte hinzu: „Was machen Sie überhaupt hier?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Klaus Möckel
Gespensterschach
Kriminalroman
ISBN 978-3-86394-725-5 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1995 in der DIE-Reihe (Delikte, Indizien, Ermittlungen) bei: Eulenspiegel Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH.
Die kriminellen Sprüche wurden dem Buch "Wer zu Mörders essen geht..." von Klaus Möckel, erschienen 1993 bei Frieling & Partner GmbH Berlin, entnommen.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Das Gemälde beeindruckte mich. Ein türkisfarbenes Meer, lila Segelboote, ein rötlich-gelber Strand, auf dem ein paar Leute herumliefen. Nach hinten zu Häuser und seitlich, als Farbkleckse, Bäume, Häuser. Eine gelungene Komposition. „Ihre Schwester hat wirklich Talent", sagte ich und vermied die Vergangenheitsform. „Das hier würde ich ihr auf der Stelle abkaufen." Dann fügte ich hinzu: „Vorausgesetzt, mein Geldbeutel könnte es verkraften."
„Das ist Max Pechstein", erwiderte der Mann mit einem flüchtigen Lächeln. „Ein Expressionist. Meine Schwester hat ihn nur kopiert. Gut kopiert, das stimmt, ich kenne mich ein bisschen aus. Aber eben nichts Echtes, für sie war es eher eine Fingerübung."
„Eine Fingerübung, aha."
„Naja, ich sage das so. Sie ist ja Malerin und hat gern kopiert, schon als Studentin, meist die neueren Meister. Ihre Brötchen hat sie sich aber mit Illustrationen verdient. Für Kinderbücher, Märchen und ähnliches. Solange das noch ging. Hier, sehn Sie", und er reichte mir ein paar Blätter mit Skizzen herüber.
Er war Buchdrucker, besaß einen kleinen Betrieb und beschäftigte sich nebenbei gleichfalls ein wenig mit Kunst, als Hobby, wie er mir erzählt hatte. Lebte mit seiner Familie in einem Haus in Röntgental am Rande von Berlin. Ein langer, hagerer Kerl, der in seinen Turnschuhen, seinen schwarzweiß bedruckten Bermudas storchenhaft auf mich wirkte. Und bekümmert, selbst wenn er, wie soeben, leicht lächelte.
Er hatte mich zunächst angerufen und zu einem Besuch in sein Einfamilienhaus eingeladen. „Hallenbeck, ich wende mich wegen meiner Schwester an Sie. Beate ist seit einem halben Jahr verschwunden, hat seither kein Lebenszeichen von sich gegeben. Wir befürchten mittlerweile das Schlimmste, hoffen aber noch. Es darf einfach nicht sein, dass sie... dass ihr..." und er ergänzte: „Vielleicht können Sie etwas herausfinden."
„Hat denn die Polizei nichts ermittelt?", fragte ich, in diesem Augenblick noch unentschlossen.
„Die Nachforschungen haben bisher nichts gebracht, nach meiner Meinung ist nicht gründlich genug recherchiert worden. Deshalb dachten wir ja an einen Detektiv. Wir möchten zumindest Gewissheit haben."
„Das verstehe ich. Aber wenn die Polizei nichts erreicht hat, kann die Sache einigermaßen aufwendig werden. Ich meine, auch finanziell."
„Meine Frau und ich, wir haben uns das gut überlegt", erwiderte er. „Nicht dass Sie glauben, wir hätten's ungeheuer dicke - wir schlagen uns gerade mal so durch -, doch wenn es um Beate geht, wollen wir nicht knausern. Übernehmen Sie den Fall nun oder nicht?"
„Na gut. Wenn Sie so entschlossen sind, will ich mein Bestes tun." Und ich dachte daran, dass mein Kontostand eine Anhebung durchaus vertragen konnte.
Dieses Gespräch hatte am Vortag stattgefunden, heute war ich nun nach Röntgental gefahren, unterhielt mich ausführlicher mit meinem neuen Auftraggeber. Ich schaute mir auch diejenigen Sachen der Malerin an, die er in sein Haus mitgenommen hatte. „Ihre Wohnung in Berlin haben wir nicht etwa aufgegeben, dort ist nur vorübergehend eine Studentin eingezogen, die dringend eine Unterkunft brauchte", sagte er entschuldigend. „Die Möbel und ein Teil von Beates Bildern befinden sich noch dort."
Es war reichlich warm draußen, achtundzwanzig Grad im Schatten, kein Jahrhundertsommer, aber man kam ins Schwitzen. Der Hausherr schilderte mir die Situation seiner Schwester vor ihrem Verschwinden und wischte sich von Zeit zu Zeit mit einem großen Taschentuch über die Stirn. Die Fenster des Zimmers, in dem wir uns befanden und wo er ihre wichtigsten Gegenstände aufbewahrt hatte, standen weit offen. Von der Straße drang Verkehrslärm herein und das Geratter eines Bohrhammers.
„In den letzten zwei Jahren hatte sie echt Schwierigkeiten, sich über Wasser zu halten, wissen Sie. Kaum noch Aufträge und die steigenden Mietkosten, gerade die Künstler hat's ja erwischt. Sie war manchmal ganz schön verzweifelt. Dass wir ihr Geld zusteckten und aushalfen, wo es nur ging, konnte keine Lösung auf Dauer sein. Außerdem hatte sie ihren Stolz, wollte nichts geschenkt haben."
„Vermuten Sie, dass sich Ihre Schwester etwas angetan hat?", fragte ich.
Der Mann schüttelte den Kopf. „Eigentlich nicht. Sie hatte trotz allem die Hoffnung, dass es wieder aufwärts gehen würde, und dann gab es da noch eine Besonderheit. Wenige Tage vor ihrem Verschwinden telefonierten wir nämlich, und sie erzählte mir was von einem günstigen Geschäft. Mehr auf mein Drängen hin, weil ich mich wieder mal nach ihrer wirtschaftlichen Situation erkundigte. Sie meinte aber, sie könnte vielleicht bald all ihre Schulden bezahlen."
„Ja und? Was war das für ein Geschäft?"
„Das ist es ja. Sie tat geheimnisvoll, wollte nichts verraten. Die Polizei hat später alle Bekannten befragt, niemand wusste etwas. Auch aus ihren Briefen geht nichts hervor. Trotzdem war das bestimmt kein Hirngespinst."
„Dann muss ich mich wohl nochmals ihrer Korrespondenz annehmen", sagte ich. „Und der Bekannten. Können Sie mir eine kleine Aufstellung machen?"
Er öffnete eine Schublade, zog eine Mappe und ein Fotoalbum heraus. „Ich dachte mir das schon, hab alles vorbereitet. Hier sind Briefe und eine Liste mit Adressen. Fotos brauchen Sie doch auch?"
„In der Tat", erwiderte ich philosophisch. „Fotos sind für unsereinen so etwas wie eine Wünschelrute, mit der man sich an das Verborgene herantastet."
Ich hatte es witzig gemeint, doch er verzog keine Miene. Vielmehr schlug er das Album auf. „Das ist meine Schwester."
Eine vollschlanke junge Frau mit kurzen Haaren und großen Augen. Burschikos gekleidet. Sie hatte keinerlei Ähnlichkeit mit ihrem Bruder, der auch um einiges älter war.
Er sah meinen vergleichenden Blick. „Das scheint Sie zu überraschen. Nun ja, ich bin nach meinem Vater geraten, sie nach der Mutter."
Die meisten der Aufnahmen lagen Jahre zurück. Beate Hallenbeck als Schulmädchen, als Backfisch, allein oder im Kreis der Familie. Einmal, ich schätzte sie auf dem Foto Anfang bis Mitte Zwanzig, erkannte man sie inmitten einer Gruppe von jungen Leuten, denen man die künftigen Künstler ansah. Sie trugen Schals, auffälligen Modeschmuck, verrückte breitrandige Hüte.
„Das war ihre Gruppe an der Kunsthochschule", erklärte der Bruder. „Irgendeine Feier."
„Und diese Aufnahme? Wie sieht's überhaupt mit Männerbekanntschaften aus? Bisher weiß ich nur, dass sie sich nicht fest gebunden hatte." Ich tippte auf ein Foto, das aus neuerer Zeit stammen musste. Sie lehnte neben einem kräftigen Glatzkopf mit Brille an einem Geländer.
„Das ist ein Kunsthändler, der ein paar Bilder von ihr verkauft hat. Eine tiefere Beziehung scheint es zwischen ihnen nicht gegeben zu haben. Einen Freund hatte sie ab und zu, erzählte aber nie viel darüber. Sie war da zurückhaltend."
„Lebte sie in der letzten Zeit mit jemandem zusammen?"
„Nein. Ich wüsste auch niemanden zu nennen, mit dem sie etwas gehabt hätte. Mit fünfundzwanzig war sie mal unsterblich in einen ihrer Dozenten verliebt. Da hieß es dauernd: 'Doktor Kasimir sagt das, Doktor Kasimir macht jenes, Doktor Kasimir würde das ganz anders sehen.' Aber in der letzten Zeit - nichts!"
„Sie war keine fünfundzwanzig mehr", wandte ich ein, „und Sie erwähnten ja selbst, dass Ihre Schwester kaum darüber sprach."
„Trotzdem, wir hätten es erfahren!"
„Ich hatte meine Zweifel daran, ließ den Punkt aber fallen. In diese Richtung würde ich ohnehin Nachforschungen anstellen müssen. „Wer stand Ihrer Schwester am nächsten? Zu wem hatte sie den engsten Kontakt?", fragte ich. „Außer zu Ihnen natürlich."
„Zu ihrer Freundin Franziska Rothenfels", erwiderte der Buchdrucker sofort. „Die beiden kennen sich schon lange, wollten mal gemeinsam einen Modeshop aufmachen. Aber es fehlte an Startkapital. Sie hat früher in einer Theaterwerkstatt gearbeitet und jetzt eine ABM-Stelle in einem Kulturverein. Ihre Adresse steht auf der Liste."
2. Kapitel
Meine künstlerische Bildung ist bescheiden - leider! Vater, der aus einfachen Verhältnissen stammte, als junger Mann in der Emigration gewesen war und sich nach dem Kriegsende unter schwierigen Bedingungen zum Bauingenieur qualifiziert hatte, interessierte sich zwar etwas für Architektur, mehr jedoch für Politik und die Freiwillige Feuerwehr, in der er jahrelang mit großem Einsatz wirkte. Für das Musische war Mutter zuständig, die „bloß" im Büro arbeitete, aber gern las, vor allem klassische Werke. Auch Musik mochte sie, ärgerte sich immer, dass sie kein Instrument spielen konnte. In der Malerei liebte sie das Romantische: Ein Druck von Caspar David Friedrich hing bei uns im Wohnzimmer, eine mondscheinüberflutete Landschaft mit rauen Felsen und dicken, knorrigen Bäumen. Das war's dann allerdings auch. Ich selbst hatte während der Oberschulzeit eine Phase, in der ich mich für den Impressionismus begeisterte, oder genauer: Eine Freundin schwärmte dafür, und ich rannte mit ihr in jede Gemäldeausstellung, die sich bot. Später beschäftigte ich mich auch eine Weile mit Kunstfälschung, ich werde noch darauf zurückkommen. Während meiner Zeit bei der Kripo traten dann aber andere Dinge in den Vordergrund, vor allem der Sport. Über den Handball kam ich mit Ingrid zusammen, und an den Handball hab ich sie wieder verloren. Genauer gesagt, an ihren Handballtrainer. In stillen Stunden regt es mich noch immer auf, dass sie gerade ihn erwählen musste.
Doch zurück zum Thema. Wäre ich vor allem in der modernen Kunstszene besser bewandert gewesen, ich hätte manchen Namen, der in Beate Hallenbecks Korrespondenz und in der Adressenliste auftauchte, schneller zuordnen können. So dagegen fiel es mir - als ich wieder zu Hause an meinem Schreibtisch saß - schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen und die Dinge, die für mich wichtig sein konnten, herauszuklauben. Da gab es Briefe an den Kultursenator, an private und öffentliche Stiftungen, an berühmte Kollegen, bei denen die Malerin um eine Unterstützung nachgesucht hatte. Bescheidene Aufträge von einem graphischen Betrieb und einem Zeitungsverlag waren darunter, ein paar bezahlte und ein paar offene Rechnungen, wobei es sich bei den bezahlten um zwei-, bei den unbezahlten meist um dreistellige Beträge handelte.
Auf der Rückseite eines der Briefe stand, anscheinend von ihr selbst hingekritzelt und mit Ausrufezeichen versehen, das Wort Derndorf'. Irgendein Nest, wie ich annahm, denn darunter fand ich den Vermerk: „17.11., an Ort und Stelle überprüfen!" „An Ort und Stelle überprüfen", was sollte das heißen? Und was hatte dieser 17.11. zu bedeuten? Zwischen der Notiz und dem Brief gab es offensichtlich keinen Zusammenhang. Er war an die Wohnungsverwaltung gerichtet und älteren Datums. Ich überlegte eine Weile und nahm mir dann vor, den Bruder zu fragen, was es mit dieser Notiz auf sich haben könnte.
Ich war auf dem besten Wege, mich in die Probleme einer nicht gerade vom Ruhm verwöhnten Malerin zu versetzen, ein bisschen ihre Welt kennen zu lernen, als ich jäh abgelenkt wurde. Meine Freundin Jeanette traf ein und mit ihr ein brillenbewehrter, eifriger Mensch, der sich als Computerfachmann vorstellte. Ein Kollege aus dem Warenhaus, in dem sie Koffer und sonstige Ledersachen verkaufte. Wie ich erfuhr, hatte er sie überredet, einen PC nebst Zubehör bei mir zu installieren, selbstverständlich alles zu Vorzugspreisen. Etliche Kartons wurden auf meinem Schreibtisch und dem Fußboden meines Büros abgeladen, unförmige Geräte herausgeschält. „Es wird Zeit, dass wir uns modernisieren, Dirk weist dich ein", erklärte Jeanette.
Meine Begeisterung hielt sich in Grenzen. Obwohl ich zugebe, dass sie mich schon lange zu dieser Anschaffung gedrängt hatte und ich die Sache theoretisch auch einsah, fürchtete ich die praktischen Konsequenzen. Möbel mussten umgestellt oder beseitigt werden, ich war gezwungen, vorübergehend die eigentliche Arbeit zu vernachlässigen, um mich mit der ungeliebten neuen Technik zu beschäftigen.
„Was soll erst ein Fünfzigjähriger sagen, wenn schon du dich so sträubst", entgegnete Jeanette auf diese Einwände und fügte hinzu: „Man ist heutzutage eben auf so was angewiesen."
„Ich nicht. Mit meiner Schreibmaschine, meiner Kundenkartei und meinem bescheidenen Archiv komme ich bestens zurecht."
„Mit dem Computer kannst du die Informationen ganz anders speichern und verarbeiten, zum Beispiel viel schneller die Varianten durchspielen, die für deine Fälle wichtig sind."
„Vielleicht nimmt er mir auch noch das Fotografieren ab", spottete ich.
„Ach, mit dir kann man nicht ernsthaft reden. Wenn du dich so sperrst, muss ich die Sache eben selber in die Hand nehmen."
Genau das aber hatte sie nun getan, sie überfiel mich mit ihrem Fachmann, und Beate Hallenbeck war für den Nachmittag völlig aus meinem Hirn verdrängt. Stattdessen schwirrte mir nach zwei Stunden Erklärungen der Kopf von Begriffen wie Festplatte, optimale Auflösung, Controller für Harddisk, MB-Arbeitsspeicher, MS-DOS, Windows und Tintenstrahldrucker. Ich hatte schon Angst, dass demnächst mein Programm abstürzen könnte, und blätterte gehetzt in zwei dicken Handbüchern, in denen angeblich alles genauestens erläutert wurde. Als der Computermensch verschwunden war, versuchte ich die Geräte so auf dem Schreibtisch zurechtzurücken, dass mir wenigstens noch ein Eckchen Platz für handschriftliche Notizen blieb.
„Darauf kannst du getrost verzichten, das wirst du in Zukunft nicht mehr nötig haben", sagte Jeanette.
„Bist du verrückt? Der Notizblock ist mein wichtigstes Arbeitsinstrument. Außerdem muss ich irgendwo meine Mappen ablegen."
„Na gut, dann nehmen wir eben den Rollschrank am Fenster und das Bücherbord weg. Dafür kaufen wir einen preiswerten Computertisch."
„Und wo soll der Rollschrank hin?"
„Den schmeißt du einfach weg. Brauchst ihn ja nicht mehr."
Ich stellte mich mit ausgebreiteten Armen vor den alten, geliebten Schrank, als stünde seine Beseitigung unmittelbar bevor: „Kommt nicht in Frage."
„Manchmal bist du wirklich ein Opa, Krey, führst dich auf wie deine Mutter", sagte Jeanette, die unseren Altersunterschied - sie war ein paar Jährchen jünger - nur dann ins Spiel brachte, wenn sie sich absolut genervt fühlte.
Nach diesen Worten verließ sie mich, denn sie hatte vor kurzem eine eigene kleine Wohnung in der Saarbrücker Straße bezogen und war weder auf die elterliche Behausung noch auf mein Bett angewiesen. Ich dachte über das Sporadische unserer Beziehung nach und kam zu dem Ergebnis, es sei am besten, nichts Grundsätzliches daran zu ändern. Auch wenn Jeanette nicht täglich bei mir weilte, brachte sie schon genug durcheinander.
In meine Überlegungen hinein klingelte das Telefon, und darauf eingestellt, dass meine Freundin ihren letzten Bemerkungen noch etwas hinzuzufügen hätte, hob ich ab.
„Hier Rothenfels", meldete sich eine verhaltene Frauenstimme, „bin ich mit der Detektei Krey verbunden?"
„Ja, Sie sind richtig."
„Spreche ich mit Herrn Krey persönlich?"
In mir klickte es. Rothenfels, das war der Name von Beates Freundin. Der Buchdrucker war der Meinung, die beiden seien gut miteinander bekannt.
Sie erklärte ihren Anruf sofort: „Herr Hallenbeck hat mir erzählt, dass Sie nochmals nach Beate suchen sollen und sich unter anderem an mich wenden würden. Da dachte ich, es wäre am einfachsten, wenn ich mich selbst mal melde."
Ich sagte: „Das kommt mir durchaus entgegen, Frau Rothenfels. Ich habe den Eindruck, wir müssen bei Null anfangen, und Sie kennen die Malerin offenbar sehr gut."
„Das kann man wohl sagen", seufzte sie.
„Ich würde mich gern direkt mit Ihnen unterhalten. Wann können wir uns sehen?"
„Sie dürfen sich keine übertriebenen Hoffnungen machen", erwiderte sie sanft. „Über ihr Verschwinden weiß ich leider gar nichts."
„Übertriebene Hoffnungen hege ich in diesem Fall bestimmt nicht."
„Wissen Sie was?" Ihr Ton klang verschwörerisch. „So sonderbar es sich bei dem, was jetzt dauernd passiert, anhören mag, aber ich glaube, sie hat sich nur für einige Zeit... na ja... zurückgezogen. Bestimmt! Sie ist irgendwohin ins Ausland gegangen, nach Italien oder Spanien, wollte alles hinter sich lassen. Davon hat sie zuletzt oft geschwärmt."
„Aber dann würde sie doch ihrem Bruder oder Ihnen ein Lebenszeichen zukommen lassen."
„Nicht so bald. Erst muss sie sich dort zurechtfinden."
Ich wusste nicht, was ich auf dieses Argument entgegnen sollte, und sagte zögernd: „Alles ist möglich, Frau Rothenfels. Um das herauszubekommen, bin ich ja engagiert worden. Würde es Ihnen morgen passen?"
„Leider nein. Das ist auch ein Grund, weshalb ich mich so schnell gemeldet habe. Ich muss wegfahren, bin erst am Wochenende zurück." In ihrer Stimme lag Bedauern.
„Ah, das ist schade."
„Die Reise ist unaufschiebbar, ich kann es nicht ändern", erwiderte sie.
„Und wann sind Sie wieder da?"
„Wahrscheinlich am Sonnabend. Ich rufe dann noch mal an. Einverstanden?"
„Natürlich", sagte ich, „außerdem bleibt mir nichts anderes übrig. Vergessen Sie es aber bitte nicht."
„Auf keinen Fall."
Mir fiel noch etwas ein: „Eine Frage könnten Sie vielleicht doch gleich beantworten, Frau Rothenfels. Beates Bruder sprach von einem Geschäft, das Ihre Freundin möglicherweise in Aussicht hatte. Es muss für sie eine günstige Sache gewesen sein. Wissen Sie etwas darüber?"
„Nein. Ich habe es ihm bereits damals gesagt. Sie hat mir nichts davon erzählt."
„Nicht einmal in Andeutungen?"
„Nicht einmal das", erwiderte die Frau. „Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie einen Käufer für eins ihrer Bilder gefunden hat, ich meine, einen, der eine größere Summe ausgeben wollte. Eher denke ich an einen Verehrer. Jemand, der Geld hat und mit ihr auf und davon ist. So was soll's ja geben."
„Ein Millionär? Ein Märchenprinz?"
„Spotten Sie nur. Ein wenig träumen wir Frauen doch alle davon."
„Aber Sie haben keine Ahnung, wer in ihrem Fall als Märchenprinz in Frage käme?"
„Wirklich nicht. Jedenfalls hat sie mir niemanden dieser Art vorgestellt. Die Typen, die sich für uns interessierten, besaßen keine Millionen." Und mit einem Anflug von Ironie fügte sie hinzu: „Vielleicht hatte sie aber bloß Angst, dass ich ihn ihr abspenstig mache."
3. Kapitel
In den folgenden Tagen führte ich eine Menge Telefongespräche und suchte die verschiedensten Leute auf. Als erstes erkundigte ich mich bei Brinke, einem ehemaligen Kollegen der Kripo, nach dem Stand im Fall Beate Hallenbeck. Nicht dass er selber damit zu tun gehabt hätte - er war nur näher dran und konnte sich besser informieren.
Brinke, seit kurzem mit dem Rang eines Kommissars versehen, war ein paar Jahre älter als ich, sehr penibel, um nicht zu sagen pingelig, und im Gegensatz zu mir Familienvater mit Frau, Tochter und Sohn. Im November 89 hatte ich im Zuge der politischen Wirren alles hingeschmissen, nach heftigen Auseinandersetzungen mit meinem Chef, dem die Fähigkeit zum kritischen Denken völlig abhanden gekommen war, meinen eigenen Weg gesucht. Nicht gerade einen attraktiven, wie ich zugebe, aber das steht auf einem anderen Blatt. Mein Kollege dagegen war geblieben und später sogar als einer von wenigen übernommen worden. Wir beide hatten uns nicht sehr nahe gestanden, was auch an mir liegen mochte, doch ein paar Erinnerungen an gemeinsame Einsätze gab es schon. An die wochenlange Jagd nach einem Sexualtäter, an die Kleinarbeit beim Entlarven eines Schieberrings, auch an den einen oder anderen Mordfall. In meinem derzeitigen Beruf jedenfalls war die Verbindung zu ihm sehr wertvoll für mich. Selbst wenn er mir nicht immer helfen konnte oder wollte, durch ihn erfuhr ich bestimmte Details, bekam Kenntnis von Fakten, die mir sonst verborgen geblieben wären.
Diesmal kriegte ich Brinke erst nach mehreren Versuchen an die Strippe, und als ich ihn endlich erreicht hatte, reagierte er äußerst brummig: „Arbeit bis über die Ohren, bei allem, was in dieser verrückten Zeit so anfällt, und jetzt kommst du auch noch mit einer Künstlerin." Er sprach dieses Wort ein bisschen abfällig aus. „Du weißt, dass wir nicht genügend Personal haben. Ich hab weder die Hände noch den Kopf frei für zusätzlichen Kram."
Ich ließ ihn erst mal reden, stimmte ihm, auch aus taktischen Gründen, im Wesentlichen zu: „Okay, ich kann mir vorstellen, was ihr alles am Hals habt, ich beneide dich nicht. Aber wenn du diesen Fall Kram nennst, muss ich dir in aller Bescheidenheit widersprechen. Immerhin ist die Frau seit einem halben Jahr spurlos verschwunden, hat keinem ein Lebenszeichen zukommen lassen. Und eben weil die Kripo auf der Stelle tritt, hat sich der Bruder an mich gewandt."
Das letzte jubelte ich ihm unter, so sanft ich es vermochte, und obwohl er mir noch versicherte, dass in der Sache Hallenbeck bestimmt das Menschenmögliche getan worden sei, weshalb weiteres Nachforschen zwecklos wäre, bequemte er sich am Ende, mir seine Unterstützung zuzusagen: „Also meinetwegen, weil du es bist. Aber dränge mich nicht, ich melde mich in der nächsten Zeit selber bei dir."
Gut, ich würde die „nächste Zeit" abwarten, zuverlässig war Brinke ja. Inzwischen würde ich mit Nachbarn der Malerin sprechen, mit Bekannten und Geschäftspartnern, soweit es sie gab. Ich würde mich auf Kunstmärkten und Galerien herumdrücken, in Archiven wühlen.
Ich traf mich mit verschiedenen Künstlern. So mit einem Bildhauer, einem sonderbaren Heiligen, der in seinem Atelier gekreuzigte Tierleiber modellierte: „Symbole der grausamen Herrschaft des Menschen über die Natur".
Kim Hengbord war ein interessanter, wie mir allerdings schien, ziemlich starrköpfiger Mann. Er sei nicht zu Kompromissen mit einer Welt bereit, erklärte er, die das Geldscheffeln zum obersten Prinzip erhebe, und habe sich aus dem offiziellen Kunstbetrieb zurückgezogen.
Ich erwiderte: „Ihr Standpunkt mag ehrenhaft sein, dennoch müssen Sie ja von irgendwas leben. Sie müssen Ihre Werke verkaufen."
„Ich muss gar nichts. Das hier ist ohnehin unbezahlbar. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich komme schon durch."
Da es wirklich nicht meine Aufgabe war, mir Sorgen um ihn zu machen, versuchte ich ihn über Beate Hallenbeck auszufragen. Ich erfuhr, dass er sie früher mal verehrt hatte. „Sie schien anders zu sein als all diese Aufsteigertypen, doch letzten Endes hat auch sie sich angepasst. Ihr Verschwinden bewegt mich natürlich. Aber schon morgen kann mir oder Ihnen das gleiche passieren."
Er sah mich mit einem eigenartig wilden Gesichtsausdruck an, so dass ich für einen Augenblick an seinem Verstand zweifelte. Doch sofort verschloss er sich wieder und wandte sich seiner Arbeit zu.
Dennoch versuchte ich ihm ein paar Fotos zu zeigen. „Glauben Sie, dass mir dieser Mann weiterhelfen könnte?" Ich wies auf den Glatzkopf, von dem der Buchdrucker gesagt hatte, er sei Kunsthändler.
„Holstenau? Weiß ich nicht. Er hat manchmal etwas von ihr verkauft, das stimmt..."
Der Tonfall, in dem er antwortete, war so abweisend, dass ich auf weitere Fragen verzichtete. Aber immerhin hatte mich der Mann beeindruckt. Ich setzte hinter den Namen Hengbord auf meiner Liste ein dickes Ausrufezeichen.
Ich suchte zwei Maler auf, die auf dem Foto aus der Studienzeit der Vermissten zu sehen waren. Einer von ihnen, Rico Pascal, ein großer, quirliger Kerl, der weder beim Arbeiten noch beim Kaffeetrinken seinen blauen Jeanshut absetzte, war gesprächig. Er wusste eine Menge über „Beatchen" zu erzählen. Dass sie früher recht schlank gewesen sei und erst nach der blöden Affäre mit Professor Probst „zu fressen" angefangen hätte. „Später hat sie sich's dann wieder abzuhungern versucht", erklärte er, „es ist ihr nur zum Teil gelungen."
„Heißt dieser Professor Probst mit Vornamen Kasimir?", wollte ich wissen.
„Ja, Kasimir Probst, ein guter Pädagoge, der auch künstlerisch etwas drauf hatte. Wir Studenten nannten ihn nur Doktor Kasimir. Für unser romantisches Beatchen war er aber viel zu steif."
„Und was meinen Sie mit blöder Affäre?"
„Na, dass die Sache einfach mit einer Enttäuschung für sie enden musste", erwiderte der „Jeanshut". „Erst hat sie ihm Modell gestanden, dann auf seiner Couch gelegen und sich am Ende die Seele aus dem Leib geheult. Als er nämlich Schluss machte und höchst prosaisch zu seiner Frau zurückkehrte."
„Aber das Ganze ist doch schon eine Weile her", sagte ich.
„Fünf, sechs Jahre. Schließlich hat sie sich mit Männern getröstet, die ihr der Zufall bescherte. Mai mit diesem, mal mit jenem."
„Sie hatten auch in den Jahren nach der Kunsthochschule Kontakt zu ihr?", fragte ich.
Der Maler schüttelte abwehrend den Kopf. „Nein, nein. Ich hab nicht in Berlin gelebt, bin erst vor kurzem zurückgekommen. Ich gebe nur das wieder, was man so gehört hat." Er schaute mich mit zusammengekniffenen Augen an.
Rico Pascal hatte sich auf kleine abstrakte Ölgemälde spezialisiert, sie hingen überall an den Wänden. Im Gegensatz zu dem Bildhauer und einigen anderen Kollegen, die über mangelnde Aufträge klagten, schien es ihm nicht schlecht zu gehen. Er hatte ein schönes großes Atelier in guter Lage gemietet, litt offenbar nicht unter Kundenmangel. Der Jeanshut, die gebrauchten, ja abgerissenen Jeansklamotten waren Arbeitskleidung und Zeichen einer nicht gerade taufrischen Boheme.
Der andere Maler vom Gruppenfoto prägte sich mir wegen seiner zurückhaltenden Art ein und weil ich ziemlich viel Mühe darauf verwenden musste, ihn in Friedrichshagen ausfindig zu machen. Er malte große, lichtvolle Bilder mit viel Weiß, Gelb und einer Art Frostblau: Landschaften, Porträts, Akte. Er nannte sich Malstrate, hatte einen struppigen kleinen Hund und einen versonnenen Blick, der zu seiner Kunst passte. Er behauptete, Beate Hallenbeck sei schon immer dickköpfig gewesen. Es dauerte allerdings eine Weile, bis ich ihm diese Bemerkung entlocken konnte. „Was sie wollte, versuchte sie auch durchzusetzen", erklärte er etwas lebhafter. „Und so was geht nicht immer gut."
„Bisher habe ich eher gehört, dass sie romantisch veranlagt sei. Jemand sagte mir auch, sie habe sich zuletzt angepasst", wandte ich ein.
„Der Mensch hat verschiedene Eigenschaften. Eine schließt die andere nicht aus."
„In Ordnung. Aber was meinten Sie mit Ihrer Bemerkung, dass es nicht immer gut ausgehe, wenn man dickköpfig ist?"
„Ach, nichts Besonderes, vergessen Sie's", wehrte er ab.
„Haben Sie irgendeine Vermutung, dass ihr wegen dieser Dickköpfigkeit etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte?", beharrte ich.
„Nein, nein, Sie haben mich falsch verstanden", murmelte Malstrate und streichelte seinen Hund, der mich misstrauisch beäugte.
Es war, als wäre ihm etwas herausgerutscht, was er nicht hatte sagen wollen, aber ich konnte mich auch täuschen. Jedenfalls merkte ich, dass es keinen Zweck hatte, tiefer in ihn zu dringen. Nicht im Augenblick. Für alle Fälle kündigte ich ihm an, ich würde vielleicht noch einmal wiederkommen. Mir schien, dass ihn diese Worte keineswegs erfreuten.
Wie auch immer, all die Gespräche und Telefonate brachten mich nicht wesentlich voran. Zwar meldete Brinke sich zwei Tage später wie versprochen und erklärte, dass nichts Neues über die Malerin bekannt sei; unter den nicht identifizierten Leichen befinde sich keine, deren Merkmale mit ihren übereinstimmten; aber mehr kam nicht heraus. Immerhin, es war erfreulich, wenigstens das zu hören. Franziska Rothenfels würde es bestimmt als Beweis für ihre hoffnungsvolle Hypothese betrachten, ihre Freundin mache sich in Italien oder sonst wo ein schönes Leben.